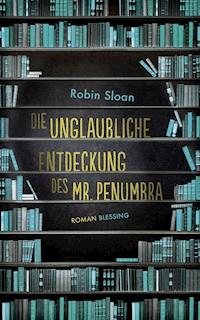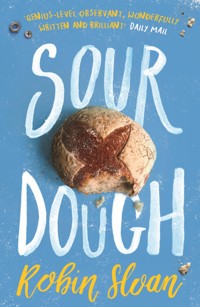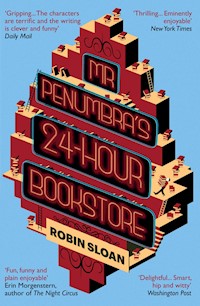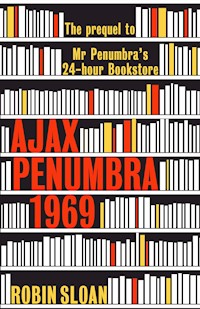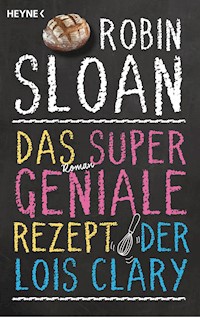
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein neuer Ansatz für Lois Clary
Als die beiden Brüder, bei denen Lois Clary jeden Abend ihr Essen bestellt, ihr Take-away aufgeben müssen, hinterlassen sie Lois einen Sauerteigansatz. Lois' Leben verändert sich fundamental: Sie kündigt ihren Job als Software-Ingenieurin, backt ihr eigenes Brot und eröffnet einen Stand auf einem geheimnisvollen Markt, wo es in allen Farben leuchtenden Käse und Kekse aus Heuschreckenmehl gibt. Als der Sauerteigansatz das Interesse einer Biochemikerin weckt, regt sich in Lois der Verdacht, dass diese Frau für die Lebensmittelindustrie arbeitet, und sie will wissen, wer eigentlich den Markt finanziert ...
Im Hardcover erschien dieser Roman unter dem Titel »Der zauberhafte Sauerteig der Lois Clary«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 287
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Das Buch
Als die beiden Brüder, bei denen Lois Clary jeden Abend ihr Essen bestellt, ihr Take-away aufgeben müssen, hinterlassen sie Lois einen Sauerteigansatz. Lois’ Leben verändert sich fundamental: Sie kündigt ihren Job als Software-Ingenieurin, backt ihr eigenes Brot und eröffnet einen Stand auf einem geheimnisvollen Markt, wo es in allen Farben leuchtenden Käse und Kekse aus Heuschreckenmehl gibt. Als der Sauerteigansatz das Interesse einer Biochemikerin weckt, regt sich in Lois der Verdacht, dass diese Frau für die Lebensmittelindustrie arbeitet, und sie will wissen, wer eigentlich den Markt finanziert …
Der Autor
Robin Sloan wurde 1979 in der Nähe von Detroit geboren, hat an der Michigan State University Wirtschaftswissenschaften studiert und anschließend für Twitter und verschiedene andere Onlineplattformen gearbeitet. Sein Debüt »Die sonderbare Buchhandlung des Mr. Penumbra« erschien 2015 bei Heyne. Robin Sloan lebt in San Francisco.
ROBIN SLOAN
DAS SUPERGENIALE REZEPT
DER LOIS CLARY
ROMAN
Aus dem Amerikanischen
von Dietlind Falk
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Die Originalausgabe SOURDOUGH
erschien bei Farrar, Straus and Giroux, New York
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Vollständige deutsche Taschenbuchausgabe 12/2019
Copyright © 2017 Robin Sloan
Copyright © 2018 der deutschen Ausgabe unter dem Titel
Der zauberhafte Sauerteig der Lois Clary
by Karl Blessing Verlag
Copyright © 2019 dieser Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Bauer+Möhring, Berlin,
Umschlagmotive: iStockphoto (Josef Hanus, bob_bosewell),
Illustration: Bauer+Möhring, Berlin
Satz: Leingärtner, Nabburg
Alle Rechte vorbehalten
e-ISBN: 978-3-641-25458-2V001
www.heyne.de
DIE BESTE ESSERIN
Ich hätte Nährstoffgel zu Abend gegessen, wie immer, hätte ich nicht an meiner Wohnungstür die Speisekarte eines Restaurants aus der Nachbarschaft entdeckt, das mit seinem neuen Lieferservice warb.
Ich kam gerade von der Arbeit nach Hause, mein Gesicht vom Stress ganz spröde – was häufig vorkam –, und normalerweise hätte ich keinerlei Interesse an etwas gehabt, was ich nicht kannte. Meine allabendliche Portion Slurry wartete drinnen auf mich.
Doch die Speisekarte machte mich neugierig. Die Worte waren in einer dunklen, selbstbewussten Schriftart gedruckt – besser gesagt in zwei Schriftarten: Die Gerichte wurden zuerst in dem Alphabet beschrieben, das mir geläufig war, und dann in einem anderen, das ich nicht kannte und das in etwa wie Kyrillisch aussah, mit jeder Menge Punkte und verbindenden Schnörkeln. Das Menü war jedenfalls recht kompakt: Es gab Spicy Soup oder ein Spicy Sandwich oder eine Kombi (Double Spicy), alle Speisen waren, wie die Karte erklärte, vegetarisch.
Oben stand in riesigen, ausladenden Buchstaben der Name des Restaurants: CLEMENT STREET SUPPE UND SAUERTEIG. Darunter die Telefonnummer und das Versprechen, schnell zu liefern. Die Clement Street war ganz in der Nähe. Ich fand die Speisekarte charmant, und daraus ergab sich, dass mein Abend, und mein Leben an sich, einen anderen Verlauf nahmen als geplant.
Ich wählte die Nummer, und mein Anruf wurde sofort entgegengenommen. Eine Männerstimme antwortete leicht außer Atem. »Clement Street Suppe und Sauerteig! Einen Moment, bitte!«
Ich wartete und hörte Musik dudeln – ein Lied in irgendeiner fremden Sprache. Die Clement Street war eine vielsprachige Arterie, durch die Kantonesisch, Burmesisch, Russisch und Thailändisch pulsierten, manchmal sogar Fetzen von Gälisch. Doch dies war eine andere Sprache.
Die Stimme war wieder dran. »Okay! Hallo! Was kann ich für Sie tun?«
Ich bestellte die Double-Spicy-Kombi.
Ich war von Michigan, wo ich aufgewachsen und zur Schule gegangen war, und wo meine Körperfunktionen größtenteils friedlich und vorhersehbar gearbeitet hatten, nach San Francisco gezogen.
Mein Vater war Datenbankprogrammierer bei General Motors und hatte es sich zur Aufgabe gemacht, mich von Kindesbeinen an mit Computern zu umgeben. Ein Plan, der aufging, denn nie zog ich etwas anderes in Betracht, als in seine Fußstapfen zu treten, besonders in einer Zeit, in der dem Programmieren eine schimmernde Dynamik anhaftete und Informatiklehrstühle aggressiv junge Frauen umwarben. Es ist schön, umworben zu werden.
Dass ich gut darin war, half natürlich. Mir gefiel der Rhythmus aus Herausforderung und Lösung, Programmierprobleme zu enträtseln war sehr befriedigend. Während meiner Zeit am College war ich zwei Sommer lang Praktikantin bei Crowley Control Systems gewesen, einer Firma in Southfield, die Software für die Motorensteuerung eines Elektroautos von Chevrolet herstellte, und als ich meinen Abschluss in der Tasche hatte, wartete dort ein Job auf mich.
Die Arbeit war minutiös vorgegeben und wurde sorgsam überprüft, und manchmal kam es mir vor, als wäre ich eine Maurerin: Man musste die Ziegel mit Bedacht ablegen, denn eine zweite Chance hatte man nicht. Der Computer auf meinem Schreibtisch war alt und vor mir von mindestens zwei anderen Programmierern benutzt worden, aber die Codebasis aktuell und interessant. Neben meinen Monitor stellte ich ein Bild von meinen Eltern und einen winzigen Kaktus, den ich Kubrick getauft hatte. Ich kaufte ein Haus zwei Städte weiter, in Ferndale.
Dann wurde ich gescoutet. Eine Frau kontaktierte mich über mein klägliches LinkedIn-Profil – ihr eigenes identifizierte sie als Talent Associate einer Firma namens General Dexterity mit Sitz in San Francisco –, bat mich um einen Anruf, um mir auf den Zahn zu fühlen, und ich willigte ein. Ihr strahlendes Lächeln drang durch den Lautsprecher. General Dexterity, so sagte sie, sei führender Designer von Roboterarmen für Labore und Fabriken. Die Firma brauche Programmierer mit Erfahrung im Bereich der Bewegungskontrolle, und die seien in San Francisco spärlich gesät. Sie erklärte mir, eine Filtersoftware habe mein Profil als vielversprechend angezeigt, und dass ihre Meinung mit der Auswertung des Computers übereinstimme.
Folgendes glaube ich über Menschen meines Alters: Wir sind die Kinder aus Hogwarts, und mehr als alles andere wollen wir wissen, wo wir hingehören.
Ich saß in meinem Auto auf dem kleinen Parkplatz hinter Crowley Control Systems an der West 10 Mile Road in Southfield, und meine Welt öffnete sich einen winzigen Spalt. Es war nur ein Haarriss, gerade eben groß genug, um hindurchzuspähen.
Am anderen Ende der Leitung orakelte die Recruiterin von schwierigen Problemen, die nur die hellsten Köpfe zu lösen vermochten. Sie erwähnte großzügige Lohnvorteile und Mahlzeiten umsonst, und oh, war ich Vegetarierin? Nicht mehr, nein. Aber vielleicht würde ich es noch einmal versuchen, in Kalifornien. Sie schwärmte von der Sonne. Der Himmel über dem Crowley-Parkplatz war grau, und es tröpfelte, wie vom Unterbau eines Autos.
Dann – ganz ohne Orakeln – machte mir die Frau ein Angebot. Sie bot mir ein Gehalt, das mehr Geld umfasste als das, was meine beiden Eltern derzeit zusammen verdienten. Ich war gerade ein Jahr mit dem College fertig. Wieder wurde ich umworben.
Nach zehn Monaten mit einer Michigan’schen Hypothek verkaufte ich mein Haus in Ferndale mit kleinem Verlust. Ich hatte kein einziges Bild an die Wand gehängt. Als ich mich von meinen Eltern verabschiedete, weinte ich. Das College war weniger als eine Stunde entfernt gewesen, insofern war dies ein wirklicher Abschied. Mit meinem Hab und Gut im Wagen und meinem Kaktus angeschnallt auf dem Beifahrersitz, fuhr ich quer durchs Land.
Ich fuhr über einen schmalen Pass durch die Rockies gen Westen, durch das staubige Nichts von Nevada, kollidierte mit dem sattgrünen, vertikalen Kalifornien und hatte einen Schock. Ich kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Das südöstliche Michigan ist plattes Land, beinahe konkav – hier hatte die Welt eine Z-Achse.
In San Francisco wartete eine Übergangswohnung auf mich, ebenso wie die Recruiterin, die mich auf dem Gehweg vor dem geklinkerten Hauptgebäude von General Dexterity empfing. Sie war winzig, vielleicht eins fünfzig groß, doch ihr Händedruck war schraubstockartig. »Lois Clary! Willkommen! Sie werden es hier lieben!«
Die erste Woche war atemberaubend. Zusammen mit einem Dutzend anderer Dexters (wie man uns nahelegte, uns zu nennen) füllte ich Krankenversicherungsformulare aus, nahm etliche schauderhaft aussichtsreiche Aktienoptionen entgegen und hörte mir Vorträge über die kurze Firmengeschichte an. Ich sah den originalen Roboterarm-Prototypen, den der Firmengründer gebaut hatte, eine stattliche, mit drei Gelenken ausgestattete Extremität, beinahe so groß wie ich, die mitten in der Cafeteria in einem kleinen Schrein aufbewahrt wurde. Man konnte rufen: »Arm, neuer Befehl, sag hallo!«, und dann winkte er eifrig zur Begrüßung.
Ich lernte die Anatomie der Software kennen, mit der ich arbeiten würde, genannt ArmOS. Ich lernte meinen Chef kennen, Peter, der meine Hand noch fester drückte als die Recruiterin. Ein hauseigener Makler besorgte mir eine Wohnung auf der Cabrillo Street im Richmond District von San Francisco, für die ich eine Miete zahlte, die viermal höher war als meine Hypothekenrate in Michigan. Der Makler ließ den Schlüssel in meine Hand fallen und sagte: »Ist nicht sehr groß, aber Sie werden so oder so nicht viel Zeit hier verbringen!«
Der Gründer von General Dexterity, ein unfassbar junger Mann namens Andrei, führte unsere Gruppe über die Townsend Street zum Task Acquisition Center, einem niedrigen Gebäude, das einmal eine Tiefgarage gewesen war. Der Zementboden war noch mit Ölflecken überzogen. Statt langer Autoreihen standen hier nun dreißig Roboterarme hintereinander. Ihre Plastikverkleidung war im Firmenblau gehalten, die Konturen gefällig und leistungsfähig, mit einem Hauch von Bizeps – eine sanfte Beule, darauf das General-Dexterity-Logo, ein schmucker Blitz.
Alle Arme arbeiteten gleichzeitig, sie fegten und griffen und stießen und hoben. Man wollte uns beeindrucken: Es funktionierte.
All das waren sich wiederholende Gesten, erklärte Andrei, derzeit wurden sie von menschlichen Muskeln und menschlichen Hirnen ausgeführt. Wiederholung sei der Feind der Kreativität, sagte er. Wiederholung war etwas für Roboter.
Wir hatten eine Mission: das Ende körperlicher Arbeit.
Was dafür nötig wäre? Ein Arsch voll Arbeit.
Meine Orientierungswoche endete am Freitagabend mit ein paar feierlichen Bieren und einem Tischtennisturnier gegen einen der Roboterarme, der natürlich gewann. Dann fing mein Job an. Nicht am folgenden Montag. Am nächsten Morgen. Samstag.
Ich hatte das Gefühl – flupps –, von einem Schlauch eingesogen zu werden.
Die Programmierer bei General Dexterity unterschieden sich völlig von meinen Crowley-Kollegen, die mittleren Alters und entspannt gewesen waren, und die nichts lieber taten, als geduldig zu erklären. Die Dexters waren alles andere als geduldig. Viele von ihnen hatten die Uni abgebrochen, sie hatten es eilig gehabt hierherzukommen, fertig zu sein, und reich. Sie waren fast ausnahmslos männlich, jung, knochig und kaltäugig, Gespenster in japanischen Jeans und Limited-Edition-Turnschuhen. Sie fingen spät am Morgen an und arbeiteten bis nach Mitternacht. Sie schliefen im Büro.
Mir war der Gedanke zwar zuwider, doch auch ich ergab mich gelegentlich den weichen, im Firmenblau bezogenen Sofas. In manchen Nächten lag ich da, starrte an die Decke – die freigelegten Rohre, die regenbogenfarbenen Kabel, die Daten durchs Büro beförderten –, und spürte einen Knoten in meinem Magen, der sich nicht lösen wollte. Ich dachte dann, ich müsse mein Geschäft verrichten, hockte mich auf eine Toilette, und nichts passierte. Der Bewegungsmelder ging aus und ließ mich in der Dunkelheit zurück. Manchmal hockte ich eine Weile dort. Dann kam ich irgendwann auf eine Zeile Code, humpelte zu meinem Schreibtisch und tippte sie ein.
Bei Crowley Control Systems in Southfield war die Botschaft, die uns Clark Crowley auf seinem monatlichen Rundgang durch die Büros zurief: Leistet weiterhin so gute Arbeit, Leute! Bei General Dexterity in San Francisco war die Botschaft, die uns Andrei jeden Dienstag und Donnerstag in einem quantitativen Geschäfts-Update zukommen ließ: Wir sind auf dem Weg, die menschlichen Arbeitsbedingungen zu revolutionieren, also strengt euch noch mehr an, das gilt für alle.
Ich fing an, mich zu fragen, ob ich überhaupt wusste, wie man sich noch mehr anstrengte. In Michigan hatten all meine Kollegen Familien und extrem ernst zu nehmende Hobbys gehabt. Davon war bei ihren unterkühlten Wiedergängern hier nichts übrig geblieben: RK- und Code-Produktionsmaschinen in Menschengestalt. Ich versuchte, sie zu imitieren, doch etwas in mir blockierte. Meine Turbine wollte einfach nicht anlaufen.
In den folgenden Monaten bekam ich mehr und mehr das Gefühl, dass irgendeine lebensnotwendige Quelle in mir versiegte, und ich versuchte es zu ignorieren. Meine Kollegen rackerten sich seit drei Jahren ununterbrochen bei gleichbleibender Geschwindigkeit ab, und ich schwächelte bereits nach einem Sommer in San Francisco? Ich sollte das strahlende Frischfleisch sein, eine von den Fitten.
Ich war nicht fit.
Mein Haar war strähnig und dünn geworden.
Mir tat der Magen weh.
In meiner Wohnung auf der Cabrillo Street existierte ich hauptsächlich in einem Zustand katatonischer Regeneration, das Hirn schlaff, die Zellen japsend. Meine Eltern waren weit weg, eingeschlossen in das Fenster des Video-Chats. Ich hatte keine Freunde in San Francisco, abgesehen von ein paar Dexters, und die waren alle ebenso traumatisiert wie ich. Meine Wohnung war klein und dunkel, ich zahlte zu viel dafür, und das Internet war langsam.
Zwölf Minuten nach meinem Anruf kam meine Bestellung von Clement Street Suppe und Sauerteig, ein junger Mann mit freundlichem Gesicht, das halb verdeckt war von einem ketchupfarbenen Motorradhelm, brachte sie mir an die Tür. Ein sanftes, rhythmisches Uuunz-uuunz entstieg seinem Helm, und er nickte zum Beat.
Seine Begrüßung dröhnte mit einem schweren, kaum identifizierbaren Akzent aus ihm heraus:
»Guten Abend, meine Liebe.«
Groß sind die unter uns, die »meine Liebe« auf eine Art zu völlig fremden Menschen sagen können, die nicht oberflächlich rüberkommt, sondern irgendwie echt und voller emotionaler Tiefe; denen du, binnen Sekunden nach dem ersten Aufeinandertreffen, Glauben schenkst.
Ich wühlte in meiner Tasche, und während ich ihn bezahlte, dachte ich glücklicherweise daran, ihn zu fragen: »Was für Essen ist das?«
Sein Gesicht leuchtete auf wie Neonreklame. »Das Essen der Mazg! Ich hoffe, es schmeckt Ihnen. Wenn nicht, rufen Sie an. Beim nächsten Mal macht mein Bruder es besser.« Er spurtete zu seinem Motorrad, drehte sich jedoch auf halbem Weg um und sagte: »Aber es wird Ihnen bestimmt schmecken!«
In meiner Wohnung, auf der Anrichte meiner Küche – die völlig nackt war, frei von jeglichem Anzeichen von Nahrungszubereitung oder menschlichem Leben überhaupt – wickelte ich das Sandwich aus, öffnete die Suppenverpackung und aß die erste Kombi (Double Spicy) meines Lebens.
Wenn traditionelle Hühnersuppe im Vergleich mit vietnamesischer Ph und ihren physischen wie psychischen Heilkräften wie Abwaschwasser schmeckt – was der Fall ist –, dann verwässerte diese pikante Suppe wiederum Ph. Sie war ein Elixier. Das Sandwich war noch schärfer, dünn geschnittenes Gemüse, großzügig mit einer roten Sauce überzogen, das Brennen wurde von dicken, kunstvoll getoasteten Brotscheiben abgemildert.
Erst entspannte sich mein Magen, dann mein Gehirn. Mir entfuhr ein langer Seufzer, der sich in einen gekräuselten Rülpser wandelte, sodass ich laut lachen musste, allein, in meiner Küche.
Ich nahm den einsamen Magneten von meiner Kühlschranktür, wobei ein paar glänzende Pizza-Coupons zu Boden fielen, und befestigte stattdessen ehrfürchtig die neue Speisekarte.
Am nächsten Abend rief ich wieder bei Clement Street Suppe und Sauerteig an, und am Abend danach auch. Dann setzte ich aus Scham einen Abend aus, doch am darauffolgenden Abend bestellte ich wieder. Trotz aller Schärfe war das Essen perfekt für meinen traumatisierten Magen.
Im folgenden Monat erfuhr ich nach und nach:
• Das Restaurant wurde von zwei Brüdern geführt.
• Beoreg, mit der lieben Stimme und dem perfekten Englisch, ging ans Telefon und kochte das Essen.
• Chaiman, mit dem freundlichen Gesicht und den Ohrstöpseln, aus denen nie keine Dance-Musik tönte, fuhr das Motorrad und lieferte das Essen aus.
• Auf bohrende Nachfragen zum »Essen der Mazg« lachte Chaiman nur und sagte: »Es ist berühmt!«
• Beoreg und Chaiman brachten erst seit etwas mehr als einem Jahr pikante Suppen und/oder Sandwiches in San Francisco unters Volk.
• Einen Laden hatten sie nicht: Sie kochten in ihrer Wohnung, deren genaue Adresse sie ungern preisgaben.
• Chaiman sagte: »Ist okay. Nur nicht legal. Aber definitiv okay.«
• Zum Double Spicy gab es ein Extrastück Sauerteigbrot, immer, um es in die Suppe zu tunken.
• Das Brot war das Geheimnis der gesamten Operation. Beoreg backte es jeden Tag selbst.
• Dieses Brot war Leben.
An den meisten Abenden rief ich frühzeitig an und blieb in der Leitung (wobei sie mich mittlerweile kannten, und ich von Bruder Beoreg nicht mehr mit »Einen Moment bitte!« begrüßt wurde, sondern mit »Lois! Hi! Du musst kurz in der Leitung bleiben. Nur eine Sekunde, versprochen«), während die fremdsprachige Musik ertönte, die ich mittlerweile zu schätzen gelernt hatte – sie war traurig, aber auf eine schöne Art –, bis ich erlöst wurde wie aus dem Fegefeuer und meine Bestellung aufgenommen wurde (jedes Mal dieselbe), und wenn Bruder Chaiman sie auf seinem Motorrad vorbeibrachte, grüßte ich ihn herzlich und gab ihm reichlich Trinkgeld, trug anschließend mein Double Spicy in die Wohnung und aß es im Stehen, wobei meine Augen vor Schärfe und Glückseligkeit tränten.
An einem Freitag nach einem besonders niederschmetternden Tag im Büro, an dem all meine Code-Reviews voller roter Markierungen und herablassender Kommentare zurückgekommen waren, und sich der Manager, Peter, sachte nach der Geschwindigkeit meiner Refaktorierungen erkundigt hatte (»Vielleicht ein bisschen mehr Gas geben?«), kam ich in einer Angstspirale gefangen nach Hause, und Gereiztheit und Selbstvorwürfe rangen einmal wieder darum, wer von ihnen mir heute den Abend versauen dürfte. Am Telefon mit Beoreg bestellte ich unter einem rasselnden Seufzer, und als sein Bruder vor der Tür stand, hatte er etwas Neues dabei: einen etwas kompakteren Container, der eine feurig rote Brühe enthielt und zwei Brote zum Eintunken statt nur einem. »Geheimes Spicy«, flüsterte Chaiman. Die Suppe war so scharf, dass sie die aufgestaute Frustration in mir wegbrannte, und beim Zubettgehen fühlte ich mich wie ein frischer Teller, kochend heiß abgewaschen und leer gekratzt.
Wäre es übertrieben zu sagen, Clement Street Suppe und Sauerteig rettete mich? Abends ging ich nicht mehr mit schwankendem, aufgewühltem Magen verärgert die Fehler des Tages durch, sondern … schlief ein. Ich kam wieder auf Kurs. Ich hatte wieder an Ballast gewonnen, in Form von pikanter Brühe und aromatischem Brot – und zwei neue Freunde oder So-was-wie-Freunde oder so.
Dann gingen sie weg.
An einem Mittwoch im September wählte ich die Nummer und hörte Beoreg »Einen Moment bitte« sagen, als würde er mich nicht kennen, dann überließ er mich lange der bittersüßen Musik, sogar so lange, dass ich dachte, er habe mich vergessen. Als er wieder ranging, nahm er pflichtbewusst meine Bestellung entgegen und sagte mir, sein Bruder würde sie schnellstmöglich bringen. »Auf Wiedersehen«, murmelte er, bevor er auflegte. Das hatte er zuvor noch nie gesagt.
Als Chaiman an meine Tür klopfte, war sein freundliches Gesicht voller Verdruss. Musik hörte er auch nicht. Plötzlich schien die Nacht bedrückend still.
»Hallo, meine Liebe«, sagte er leise. Die Tüte, die mein Double Spicy enthielt, hing schlaff von seinen Fingern.
Ich nahm sie entgegen und drückte sie an mich, fühlte die Wärme der Suppe an meiner Brust. »Was ist los?«
»Wir gehen«, sagte er. »Die Visa, weißt du?«
Ich traute meinen Ohren nicht.
»Wir können nicht bleiben. Ich würde es ja versuchen, aber Beoreg sagt … Er will sich nicht für immer verstecken. Er will ein richtiges Restaurant. Mit Tischen.« Chaiman machte große Augen, als sei der Wunsch, in einem physisch vorhandenen Etablissement echte Kunden zu bedienen, auf einem Level mit der Extravaganz von Versailles.
»Wir werden dich vermissen«, sagte er. »Ich und Beoreg auch.«
Die Tüte knisterte in meinem Arm, genau wie die Haut um meine Augen herum. Ich wollte schluchzen, Lasst mich nicht allein! Was soll ich denn essen? Wen soll ich anrufen? Doch alles, was ich herausbrachte, war: »Es tut mir so leid, das zu hören.«
Er nickte. Ich nickte auch. Es war frisch draußen. Er sagte: »Weißt du … Beoreg und ich machen immer einen Witz. Er gibt mir die Tüte«, hier bohrte er den Finger in das verpackte Essen in meinen Armen, »und sagt: ›Für Lois auf der Cabrillo Street‹, und dann sagen wir zusammen: ›Die beste Esserin!‹«
Ich wusste nicht, was das bedeutete, nur dass mich niemand je zuvor so genannt hatte.
»Ist nett gemeint. Weil wir dich mögen. Verstehst du?«
Ich verstand.
Als er auf seinem Motorrad saß, hob Chaiman noch einmal die Hand und schüttelte energisch den Zeigefinger. Er ließ den Motor aufheulen und rief noch einmal: »Die beste Esserin!«
DER SLURRY-TISCH
Meine Arbeit verlief folgendermaßen: Ich saß zwölf Stunden lang an meinem Schreibtisch im Keller einer ehemaligen Makkaronifabrik in der Nähe des Parks, wo die Giants spielen. Mein Firmenlaptop war wuchtig und laut, die dröhnende Lüftung notwendig, um das superschnelle GPU darin zu kühlen. An meinem Schreibtisch schloss ich ihn an zwei Monitore, eine Tastatur und ein Stylus-Tablet an. Keine Maus. Den Tablet-Trick hatte ich von einem der geduldigen Programmierer bei Crowley gelernt, der es empfahl, um einen Mausarm zu vermeiden. Hier bei General Dexterity beäugten mich die Wiedergänger deswegen skeptisch. Sie konnten sich noch nicht vorstellen, irgendwann von ihren Körpern im Stich gelassen zu werden.
ArmOS bestand aus zwei Flügeln.
Zunächst einmal Control, der Code, der den Armen sagte, wie sie sich zu bewegen hatten. Er las ihre superpräzisen Sensoren, spannte ihre motorischen Muskeln an. Der Code war sehr kompakt und extrem optimiert, denn jede Verbesserung von Control – schneller lesbare Sensoren, ein festerer Griff – beeinflusste alles, was die Arme taten.
Dann war da noch Task, der Code, der den Armen sagte, warum sie sich bewegen sollten. Task war ein aufregendes Gemenge aus Heuristik und Hacks.
Bei Control ging es um eine einzige Sache – Bewegungen im Raum –, während es bei Task um tausend Dinge ging. Das Stapelnmodul versorgte die Arme mit der Theorie zu Erdanziehung, Balance und Schichten, und direkt daneben lag das Modul Glaswaren, ein fest programmiertes Cheat-sheet, das bis auf den Millimeter genau die Dimensionen der zehntausend gängigsten wissenschaftlichen Kolben und Phiolen auf der ganzen Welt enthielt.
(Zusätzlich zu Task und Control gab es auch noch Interface, den Code, der den Usern ermöglichte, ihre Arme zu kontrollieren und durchgängig ArmOS-Upgrades anzuwenden, alles mit einer simplen Web-App, doch die anderen Teams sahen auf Interface herab, da die Arbeit daran so einfach war.)
Mein Boss, Peter, war kürzlich befördert worden und nun komplett für Control verantwortlich. Ich arbeitete an dem Untermodul, das für die Propriozeption verantwortlich war, ein schönes Wort – Pro – prio – zep – tion! –, das den Prozess, durch den Organismen die Position ihrer Körperteile im Raum bewerten, beschreibt. Es handelte sich um einen entscheidenden Sinn, definitiv wichtiger als ein paar der großen fünf. Wenn man läuft, sieht man geradeaus, nicht auf die eigenen Füße, da man weiß, sie sind dort, wo man sie erwartet, und sie gehorchen den eigenen Befehlen. Das ist ein ziemlich cooles Feature.
Als unerwartete Konsequenz meiner Arbeit an der Propriozeption von Robotern saß ich häufig am Schreibtisch und bewegte meine Arme schlangenartig durch die Luft, wobei ich versuchte, ganz genau wahrzunehmen, was dabei passierte. Ich schloss meine Augen, streckte die Hand aus, hob sie langsam an und drehte sie dabei. Wie fühlte sich das an? Das Gewicht meines eigenen Armes, sicher, aber auch … eine Ranke aus merkwürdigen Informationen. Nicht wirklich eine Berührung. Etwas anderes. Propriozeption!
Ich tat das ziemlich häufig, sowohl aus technischen als auch therapeutischen Gründen, und einmal stand Peter plötzlich vor mir, als ich die Augen öffnete. Er hatte mich stillschweigend dabei beobachtet, wie ich propriozeptionierte. Ich schrie auf.
Meine ständigen Bauchschmerzen waren bei einem Besuch in General Dexteritys hauseigener Praxis (sie befand sich neben dem Zahnarzt und der Masseurin) als Stresssymptom diagnostiziert worden. Die Arzthelferin fischte eine Broschüre aus einem dicken Stapel; der Titel, dexterblau gedruckt, lautete: Auf sich achtgeben, während man die Welt verändert.
Peter war es auch, der mir empfahl, zu den Flüssigmahlzeiten zu greifen, die er und viele andere Programmierer bevorzugten, und die unter den gegebenen Umständen – extrem und unerbittlich – leichter zu verdauen schienen.
»Slurry«, sagte er. »Fabelhaftes Zeug.«
Slurry war ein Nährstoffgel, das von einer gleichnamigen Firma produziert wurde, die noch jünger war als General Dexterity. Serviert wurde es in mattgrünen Tetrapaks, und der Inhalt hatte die Konsistenz eines dickflüssigen Milchshakes. Es enthielt alle wichtigen Nährstoffe und war reich an Probiotika. Es war die reine Dystopie.
Mithilfe eines Coupons, den ich von Peter bekommen hatte, schloss ich für einen Monat ein Probeabo ab und bekam das Gel direkt ins Büro geliefert. Ich war nicht die Einzige. Als ich das Päckchen im Postzimmer entgegennahm, wartete dort eine riesige Zikkurat aus grünen Tetrapaks auf einer Palette. Es schmeckte nach verbrannten Mandeln und tat meinem Magen tatsächlich wohler als das reguläre Essen in der Cafeteria; darüber hinaus ersparte es mir das endlose Hin und Her zwischen Salatbar und Paella-Station.
Es hatte noch einen weiteren Vorteil sozialer Natur. In der Mittagspause saß ich in der Slurry-Ecke der Cafeteria, zusammen mit einem nicht unerheblichen Teil der Dexters, die sich dort versammelten, um verstohlen das Gel einzusaugen. Die Gruppe am Tisch wurde zu meinem ersten wackligen Gerüst aus Bürofreundschaften. Peter war unser Anführer, er wurde sogar von Slurry gesponsert und bekam sein Deluxe-Abo umsonst, solange er bei Sportevents (10K-Rennen, Triathlons, Baumstammwerfen) unter den Top fünf seiner Altersgruppe landete und dabei sein strahlend grünes Slurry-Stretchoutfit trug. Sein Abo war eine Bleeding-Edge-Version mit teils unschönen Nebeneffekten – er aß Slurry dreimal am Tag, sieben Tage die Woche.
Wir anderen aßen Slurry nur zwei- bis dreimal pro Woche. An den anderen Tagen schleppten wir uns zur Lunchwarteschlange, um unter den traurigen Blicken von Küchenchefin Kate die gebratenen Hühnchenteile auszusuchen, die wir bevorzugten.
Neben Peter gab es noch Garrett, einen blassen und etwas unheimlichen Programmierer aus dem Internationalisierungsteam; Benjamin, einen Sicherheitsspezialisten, der daran arbeitete, dass man die Roboterarme nicht hacken konnte; Anton, einen Sales Associate, den man unglücklicherweise mit einem äußerst unattraktiven Bluetooth-Kopfhörer ausgestattet hatte; und Arjun, einen aufgeweckten Interface-Designer, der ebenfalls aus Michigan stammte, der erste Dexter, den ich mich traute, meinen Freund zu nennen. Zusätzlich zu unseren Interaktionen am Slurry-Tisch migrierten Arjun und ich, wenn wir abends das Büro verließen, manchmal in eine Bar, die etwas weiter die Townsend Street runter lag, für ein Zehn-Uhr-Bier und Käsefritten. Peter hielt nichts davon.
Während einer unangenehmen Gesprächsflaute am Tisch – von denen gab es viele, wir waren unbeholfen – erzählte ich meinen schlürfenden Kameraden die traurigen Neuigkeiten über Clement Street Suppe und Sauerteig.
»Ich esse kein Brot«, sagte Peter prophylaktisch.
»Hast du davon kein Bauchweh bekommen?«, fragte Garrett.
Hatte ich nicht. »Die Suppe war richtig scharf, aber ausgleichend, irgendwie. Und ich mochte die Jungs sehr, die sie zubereitet haben.« Meine Wangen spannten, und ich wusste, dass Gefühle aus mir herauspulsierten, die für diese Runde zu viel waren, also sagte ich: »Also zurück zum Slurry-Dinner!«, und saugte lang und gurgelnd an meinem Tetrapak.
An dem Tag ertrug ich weder Propriozeption noch ArmOS oder irgendetwas anderes, also lief ich über die Townsend Street zum Task Acquisition Center.
Sämtliche Arme waren auf eigens dafür gebauten, rollbaren Arbeitsflächen festmontiert und mit verschiedenen Szenarios konfrontiert: Auf einer war eine Reihe Reagenzgläser aufgebaut, wie in einem Labor; auf einer anderen lag ein auseinandergenommenes Handy, wie in einer Fabrik; auf der nächsten ein offener Pappkarton, wie in einem Lager, und so weiter und so fort. Arme mit Staubsaugern, Arme mit Bohrern, Arme mit nichts weiter als ihren bloßen sechsfingerigen Händen. Der Trainingsbereich klickte und surrte und heulte und klatschte. Den Lärm durchdrang der eine oder andere menschliche Fluch.
An jeder Arbeitsfläche stand ein Lehrer, der den Arm durch die Bewegungssequenz führte und zeigte, wie sich die Prozedur gestaltete: Das Reagenzglas anheben und schütteln; das Handy zusammensetzen; den Karton vollpacken und zukleben, ein Job für zwei Arme, unterbrochen nur vom Rrrrtsch des Klebebandes.
Die Trainer waren Auftragsnehmer, sehr gut bezahlt – aber nur für eine gewisse Zeit. Jeder Laborassistent oder Fabrikarbeiter oder Logistikspezialist brachte einem der Roboterarme bei, eine bestimmte Aufgabe einwandfrei auszuführen, unter vielen verschiedenen Bedingungen, mit steigendem Schwierigkeitsgrad. Wenn er die Aufgabe beherrschte, wurde alles in ArmOS eingespeist, und in dem Moment wurde jeder einzelne General-Dexterity-Arm auf dem Planeten so viel leistungsfähiger.
Auch außerhalb dieses Gebäudes gab es Trainer. Zusätzlich zu den eingebauten ArmOS-Standardfähigkeiten gab es einen Marktplatz für Fähigkeitserweiterungen – Nischentätigkeiten, die unsere Vorstellungskraft überstiegen. Wie man eine Petrischale schwenkte, die einen bestimmten Strang Bakterien enthielt. Wie man einen Brennstab sicher in einen nuklearen Reaktor einführte. Wie man einen Football zusammennähte. Ganze Firmen waren um diese Aufgaben herum entstanden. Die Brennstableute hatten nur drei Auftraggeber, trotzdem waren sie steinreich.
Ich hielt einen Moment inne, um die Arme bei ihrer Arbeit zu beobachten, und in ihren subtilsten Bewegungen sah ich meinen eigenen Beitrag. Wenn sie sich zweidimensional bewegten, war die Bewegung flüssiger als noch vor ein paar Monaten. Ich hatte sehr lange über dem PKD 2891 Schrittmotordatenblatt gebrütet, um so weit zu kommen.
Einer der Arme, der unter Aufsicht eines breitschultrigen, bärtigen Trainers arbeitete, war mit der Attrappe einer Küchenarbeitsfläche konfrontiert, auf der nichts stand außer einer Schüssel und einer Packung Eier. O nein. Der Arm tat mir leid.
Er griff nach einem der Eier, hob es über die Schüssel, klopfte damit gegen den Rand (zu sanft); noch einmal etwas fester (noch immer zu sanft); und ein drittes Mal zu fest (viel zu fest), die Schale explodierte am Rand der Schüssel, das Eigelb lief in orangefarbenen Striemen durch seine Finger und rann an beiden Seiten der Schüssel hinunter, bis sich eine Pfütze auf der Anrichte bildete.
Ich war froh, nicht am Force Feedback zu arbeiten. Selbst nach jahrelanger Arbeit bereitete die sanfteste Berührung ArmOS Probleme. Wir würden alles andere lösen, bevor wir das Eiproblem lösten.
An jenem Tag verließ ich General Dexterity früher denn je, die Sonne schien noch draußen auf den Gehsteig. Ich hatte mich der üblichen Bürospielchen bedient: Eine Liste lag auf meinem Schreibtisch, aufgeschlagen auf der dritten Seite, als wäre ich mitten in der Arbeit, und meine Jacke hatte ich kunstvoll über den Stuhl drapiert, als hätte ich das Büro gar nicht verlassen – Gott bewahre! –, als befände ich mich gerade in einem Meeting oder heulend auf dem Klo. Das Übliche eben.
Tatsächlich aber sprang ich in die Muni-Bahn nach Downtown. Während ich durch die Stadt fuhr, spürte ich ein drückendes Gefühl in der Brust, das ich kurzzeitig für ein Herzproblem hielt, doch als mich der 5er-Bus im Richmond District absetzte, verstand ich, dass es sich einfach nur um Trauer handelte.
DER CLEMENT-STREET-ANSATZ
Ich hatte um meinen Verlust getrauert und mein Slurry geschlürft und war dabei, mit meiner langsamen Internetverbindung ein düsteres Seriendrama zu streamen, als ich ein Klopfen an der Tür hörte, sanft und selbstbewusst. Ich kannte dieses Klopfen.
Es war Chaiman, zum ersten Mal ohne seinen Motorradhelm. Seine Haare waren hellbraun wie Sand.
»Beste Esserin!«, rief er.
Hinter ihm stand noch jemand, ein paar Stufen die Treppe hinunter. Dieser Mann hatte dasselbe freundliche Gesicht und dasselbe sandbraune Haar, doch seine Haut war etwas dunkler und seine Körpermitte etwas fülliger.
Chaiman drehte sich zu ihm. »Beoreg, sei nicht so schüchtern. Komm schon.«
Die Stimme am Telefon! Beoreg. Koch und Bäcker, Meister des Double Spicy, Quelle meines Wohlbefindens. Ich hatte das Gefühl, mich verneigen zu müssen.
»Wir sind jetzt weg«, sagte Chaiman. Ein braunes Taxi wartete im Leerlauf an der Straße hinter ihnen. »Aber Beo hatte die Idee, dir etwas zu schenken.«
»Lieb von euch«, sagte ich.
Beoreg lächelte, doch sein Blick war auf etwas in Höhe meiner Schienbeine fixiert. Er hielt mir ein Objekt hin, das in ein kratziges Küchentuch gewickelt war. Es war ein Keramiktopf, etwa so groß wie ein XXL-Erdnussbutterglas, dunkelgrün mit passendem Deckel, die Lasur schimmerte vielfarbig.
»Was ist das?« Es sah aus wie ein Behältnis, in dem die Asche eines Vorfahren aufbewahrt wurde, und so etwas wollte ich definitiv nicht haben.
»Das ist unsere Kultur«, sagte Beoreg leise.
Nee, so was wollte ich definitiv nicht.
»Ich meine unser Ansatz«, korrigierte Beoreg sich selbst. »Für das Sauerteigbrot, weißt du? Ich habe ihn mitgebracht, damit du dein eigenes backen kannst.«
Ich hatte keine Ahnung, was ich mit diesem Ansatz anfangen sollte.
Chaiman bemerkte meine Unsicherheit. »Beo zeigt es dir«, sagte er. Er reckte den Hals, um in mein Apartment zu schielen. »Falls du eine Küche hast?«
Ich hatte eine Küche. Ich führte sie in die Wohnung.
»Sehr sauber«, sagte Beoreg. Sein Englisch war makellos, er sprach ein klein wenig abgehackt, wie jemand aus einer BBC-Show – einer aktuellen, nicht aus so einem Historiendrama.
»Ich koche nie«, gab ich zu.
»Weil du unsere beste Esserin bist!«, johlte Chaiman.
Überglücklich deutete er auf ihre Speisekarte, die an der Kühlschranktür hing.
»Hast du Mehl?«, fragte Beoreg leise.
Fast hätte ich gelacht. »Kein Mehl«, sagte ich. »Ernsthaft. Ich koche nie.«
Er nickte entschlossen. »Kein Problem. Ich gebe dir alles, was du brauchst.« Er joggte zur Tür.
Chaiman hatte ungefragt den Kühlschrank geöffnet und wühlte darin herum. Er zog den stumpfen Tetrapak-Slurry heraus und hielt ihn an zwei Fingern hoch, als handle es sich um eine tote Maus.
Einen Moment später kam Beoreg mit einem riesigen Holzkoffer im Schlepptau zurück, der zerkratzt und mit Stickern übersät war, aus einer anderen Ära des Reisens. Er öffnete die Verschlüsse und hob schwungvoll den Deckel an. In seinem Innern befand sich, kreuz und quer durcheinandergeworfen, eine komplette Küchenausstattung.
Da waren kleine Messlöffel mit langen Stielen und breite flache Pfannen. Ich sah ein dickes Bündel Kochlöffel aus Holz, die Ränder fleckig und angebrannt, und ein ganzes Sammelsurium an Schüsseln, sorgfältig ineinandergestapelt, mit einer Schicht Zeitungspapier dazwischen. Trübe Glasbehältnisse enthielten Baby-Xenomorphen (ich nehme an, es handelte sich um Cornichons), und einige strahlend bunte Schachteln waren in Arabisch und Hebräisch und anderen Alphabeten, die ich nicht kannte, bedruckt. Winzige unbeschriftete Gläschen enthielten rote und gelbe Gewürze – sicherlich alles Zutaten fürs »geheime Spicy«. Am Rücken des Koffers lehnte ein Schneidebrett, dessen Oberfläche befleckt und von Ritzen durchzogen war, und einige tiefe Kerben zeugten vom Gebrauch eines Hackebeils.
Während er darin herumwühlte, fragte Beoreg: »Also, weißt du, wie man Brot macht?«
»Klar«, sagte ich. »So ungefähr.« Ich wusste, dass Mehl mit im Spiel war. »Nicht wirklich.« Ich war Esserin, keine Bäckerin.
»Man braucht etwas Lebendiges, eine Kultur. Man sagt auch Ansatz dazu. Du mixt den Ansatz mit dem Mehl und mit Wasser und Salz, so bildet sich ein Gas, sodass der Teig aufgeht. Es verleiht ihm auch einen gewissen Geschmack.« Beoreg stand auf, mit einer Auswahl an Kochutensilien in der Hand. »Hattest du mal ein Haustier?«
Schuldbewusst schüttelte ich den Kopf. Das einzige Lebewesen, für das ich je gesorgt hatte, war ich selbst, und das auch nur mit mäßigem Erfolg, außer …
»Vielleicht eine Pflanze?«
»Ja!«, sagte ich. »Ich habe einen Kaktus auf dem Schreibtisch.«
»Okay! Diese Kultur, oder dieser Ansatz, ist genauso. Er lebt.« Er hob den Deckel des Keramiktopfes. »Siehst du?«
Der graue Schleim darin sah alles andere als lebendig aus. Er sah aus wie der Feind alles Lebendigen. Wie etwas, das Lebewesen dazu brachte, die Straßenseite zu wechseln.
»Riech mal«, befahl er mir und hielt mir den Topf hin, indem er ihn ein wenig nach vorne neigte. »Riechst du es?«
Sehr vorsichtig roch ich und ließ dabei höchstens zwei bis drei Moleküle aus dem gärenden Behältnis in meine Nase wandern. »Wie soll es denn riechen?«, fragte ich alibimäßig.