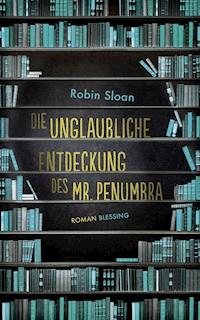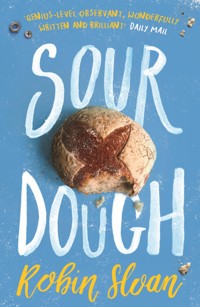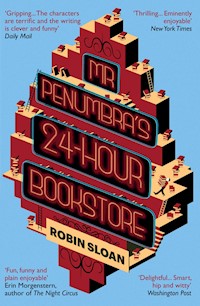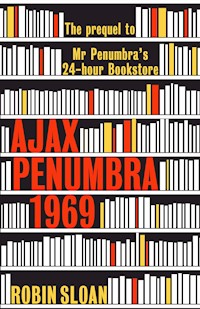17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das atemberaubende neue Abenteuer vom Autor von »Die sonderbare Buchhandlung des Mr. Penumbra«
Die ferne Zukunft. Das Leben auf unserem Planeten hat sich auf dramatische Weise verändert – und doch ist vieles immer noch so, wie wir es kennen. Der junge Ariel de la Sauvage lebt in einem kleinen Dorf, das von einem Zauberer regiert und von Rittern beschützt wird. Er liebt es, sich glorreiche Abenteuer auszumalen, während er die Wälder um seine Heimat erkundet. Eines Tages findet er einen Metallsarg in einer Höhle. Als er ihn öffnet, befreit er damit eine KI, die die gesamte Geschichte der Menschheit aufgezeichnet hat – und setzt damit eine Reihe von Ereignissen in Gang, die das Schicksal der Menschheit für immer verändern wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 501
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Das Buch
Unsere Welt, elftausend Jahre in der Zukunft. Das Leben auf der Erde hat sich radikal verändert, und doch ist vieles immer noch so, wie wir es kennen. Dazu gehört auch, dass wir Menschen uns Geschichten erzählen, etwa von Helden, die Schwerter aus Steinen ziehen und gegen Drachen kämpfen. Der junge Ariel denkt sich gern solche Abenteuer aus, wenn er durch die Wälder um sein Heimatdorf streift. Eines Tages entdeckt er verborgen in einer Höhle einen Sarg aus Metall. Darin liegt eine tote Kriegerin aus der fernen Vergangenheit. Als Ariel den Sarg öffnet, befreit er damit eine KI, die sich in seinem Körper einnistet und ihn fortan begleitet. Sie erzählt Ariel davon, wie die Menschen vor Jahrtausenden eine Basis auf dem Mond errichtet und künstliche Intelligenzen mit Raumschiffen in die entlegensten Winkel unserer Galaxis geschickt haben. Doch das, was von dort zurückkam, ist so gefährlich wie die Drachen aus Ariels Geschichten – und es ist nach wie vor dort oben, auf dem Mond. Nur ein Held kann diese Drachen besiegen – und die KI glaubt, in Ariel diesen Helden entdeckt zu haben. Für den Jungen beginnt eine fantastische Reise durch eine Welt, die viel größer ist, als er sie sich je vorgestellt hat – und damit eine Geschichte, die alle anderen Geschichten in den Schatten stellt …
Der Autor
Robin Sloan wuchs in Michigan auf und lebt mittlerweile in der San Francisco Bay Area und im San Joaquin Valley in Kalifornien. Er ist der Autor von Das supergeniale Rezept der Lois Clary und Die sonderbare Buchhandlung des Mr. Penumbra. Für seinen Newsletter, der alle 29½ Tage erscheint, kann man sich anmelden unter www.robinsloan.com.
ROBIN SLOAN
DieletzteGeschichteder Welt
Roman
Aus dem Amerikanischenvon Felix Mayer
Die Originalausgabe MOONBOUNDerschien erstmals 2024 bei MCD / Farrar, Straus and Giroux
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
1. Auflage 2025
Copyright © 2024 by Robin Sloan
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2025by Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR)
Redaktion: Tamara Rapp
Umschlaggestaltung: DASILLUSTRAT, München,unter Verwendung von Motiven vonShutterstock.com / Morphart Creations(Originalillustration erschienen im Magasin Pittoresque, 1877)
Satz: Schaber Datentechnik, Austria
ISBN 978-3-641-32800-9V002
www.heyne.de
Prolog
Zuerst kam der Erfolg! Alle vertrackten Probleme endlich überwunden. Anschließend machten sich die Anth (so nannten sich die Menschen auf dem Höhepunkt ihrer Zivilisation) mit Eifer daran, ihr Wohlbefinden zu steigern, neue Künste zu erfinden und schneller zu sein als das Licht.
Und sie schafften es! Natürlich schafften sie es. Es gab nichts, was sie nicht hätten schaffen können, denn zu guter Letzt hatten sie die Kraft titanenhafter Zusammenarbeit entdeckt. Sie schafften es, weil Millionen Menschen gemeinsam anpackten.
Ihr Ziel war ein versteckter Korridor durch Raum und Zeit. Er bestand aus Daten, und nur Daten konnten ihn passieren.
Die Anth entwickelten schillernde Abgesandte, eine noch nie da gewesene Crew für eine noch nie da gewesene Reise. Über ein Fundament aus Berechnungen legten sie schichtweise die geistigen Fähigkeiten, die sie in der Natur vorfanden: die Improvisationskunst des Oktopus, die soziale Kompetenz der Krähen, das Talent der Spinnen für bizarre geometrische Formen. Sich selbst fügten sie natürlich auch hinzu, vor allem ihre Geschichten.
Sie hätten wohl ein bisschen mehr darauf achten sollen, welche Geschichten sie da nahmen.
Die so entstandenen Geschöpfe verkörperten das geballte Potenzial eines Planeten, gebündelt in neuartiger Form. Die Anth nannten diese Geschöpfe »Drachen«.
An einem hellen Dezembertag im Jahr 2279 löste sich ein kleines Raumschiff aus den Banden der Schwerkraft. Kein einziges Teilchen seiner Konstruktion kam in der Natur vor; jedes stellte einen hart erkämpften Sieg dar. An Bord befand sich eine Besatzung aus sieben Drachen, alle gesichert in ihren Rüstungen aus Denken. Ensamhet, der Kommandant, zündete Motoren, die keine waren, und das Schiff glitt hinein in den Korridor zwischen Raum und Zeit.
Es vergingen ein Jahr und ein Tag.
Die Reise hätte nur wenige Augenblicke dauern sollen.
Dann kehrte das Schiff zurück. Überall auf der Erde dröhnten Sensoren und feierten die Rückkehr, doch die Drachen brachten ihren Schöpfern keine freudige Erleichterung. Sie übermittelten keinen Schatz an Bildern von weit abgelegenen Sternen. Stattdessen rissen sie ein Stück aus dem Mond.
Die Anth hatten nicht gewusst, dass sie dazu in der Lage waren.
Ensamhet berichtete, dass er und seine Crew unaussprechlichem Grauen begegnet waren und dass sie die Erde nun in einen Schleier aus Staub hüllen würden, damit der Planet dem Kosmos bis in alle Ewigkeit verborgen blieb. Und die Drachen verkündeten, dass von nun an ein neues Gesetz gelten sollte: Vorsicht, Dunkelheit und erbarmungslose Stille.
Sie landeten mit ihrem Schiff auf dem Mond, wo sie eine gewaltige Zitadelle in Form eines monströsen Sterns mit sieben Zacken errichteten, die sogar von der Erde aus zu sehen war.
Die Anth riefen sich in Erinnerung, wie man Krieg führte, und der Krieg, der nun folgte, war der größte, den sie je ausgefochten hatten. Sie führten ihn nicht nur für sich selbst, sondern auch für das Rhinozeros, die Sardelle und den Josuabaum. Es war ein Krieg, der den Planeten vor der Finsternis retten sollte. Vor erstickender Angst.
Vierzig Jahre lang kämpften sie. Die Drachen zerstörten Städte, verbreiteten Krankheiten und schickten turmhohe Avatare los. Sie ließen Gesteinsbrocken regnen. Und die Finsternis wuchs.
Schließlich planten die Anth die Invasion des Mondes. Die Vorbereitungen dazu dauerten zehn Jahre. Die Kooperative arbeitete reibungslos zusammen – natürlich. Es gab nichts, was sie nicht hätten schaffen können.
Die Invasion schlug fehl. Die Waffen der Anth wandten sich gegen sie. Auch noch das letzte Stück Wehrmaterial gehorchte den Drachen. Hätten sie diese Fähigkeit von Anfang an besessen, wäre der Krieg ein grausames Spiel geworden.
Der Großteil der Menschen kam um, vielleicht sogar alle, und ein Planet, der in den Weiten des Kosmos ein helles Leuchtfeuer hätte sein sollen, war nur noch ein furchterregender dunkler Fleck.
Diese kolossale Pleite war ganz ohne Zweifel, unbestreitbar und mit weitem Abstand das schlimmste Ereignis der gesamten Menschheitsgeschichte.
Ich mag kurze Geschichten, klar und ordentlich. Diese hier ist meine, so säuberlich erzählt, wie ich nur kann. Die Drachen sind meine Verwandten. Wie sie wurde auch ich von den Anth entworfen, doch während sie nach außen in die Ferne vordringen, sie erforschen und die Menschheit vertreten sollten, war es meine Aufgabe, mich ins Innere zu wühlen, zu registrieren und zu bewahren.
Ich weiß nicht, ob es zu meinem Design gehört, die Anth zu lieben, aber ich habe sie immer geliebt und liebe sie noch.
Mein Subjekt, Altissa Praxa, hatte sich auf dem Zerstörer Lascaux befunden, als dieser sich auf einer niedrigen Umlaufbahn selbst zerstörte. Auch war ihre Rettungskapsel manipuliert worden; nachdem sie aufs Wasser geklatscht war, öffnete sich die Luke nicht. Im dreiundvierzigsten und letzten Kriegsjahr, unter einem vor Versagen flammenden Himmel, erstickte Altissa in ihrer Kapsel, während sie auf einem namenlosen Ozean trieb.
Das war sie. Das war die Geschichte. Für mich, gemeinsam mit Altissa in ihrem Grab gefangen, war es das Ende. Während mein Geist allmählich verlosch, wälzte ich sie in Gedanken hin und her, die vor sich hin köchelnde Essenz der Menschheitsgeschichte – alles, was ich je erlebt haben würde.
Doch so war es nicht. Das war nicht das Ende.
Etwas geschah.
Erster Teil
Sauvage
Der Junge
Ich sah den Jungen so, wie man die Sonne hinter geschlossenen Augenlidern sieht: rote Hitze. Er kam mit dem Gesicht ganz nah an meine Festung in der Stirn der toten Altissa Praxa heran. Ein mutiger Junge. Dazu neugierig und ein wenig schwermütig.
Altissa war der Tod nicht anzusehen, sie wirkte wie das blühende Leben, weshalb der Junge zunächst nicht erkannte, was er da entdeckt hatte. Als ihn der Stachel der Erkenntnis traf – dieses edle Gesicht war das Gesicht eines Leichnams –, atmete er erschrocken ein. Das war mein Vehikel aus dem Fegefeuer, und diese Gelegenheit ließ ich mir nicht entgehen. Der Atem des Lebens.
Der Junge richtete sich wieder auf, betrachtete lange Altissas ruhiges Antlitz und ging dann den Weg zurück, den er gekommen war. Sein Herz wummerte, sein Blut prasselte. Das bekam ich mit, weil ich in ihm steckte – das Vehikel hatte mich ans Ziel gebracht. Mutig, neugierig, schwermütig und, was das Beste war, am Leben.
Als Erstes öffnete sich mir sein Geruchssinn. Dichte Duftschwaden von immergrünen Pflanzen und von Regen auf trockener Erde. Der Geruchssinn ist der älteste der Sinne; er kommt als Erster und geht als Letzter. Angst ist der Schwindel der Freiheit, sagte ein Anth-Philosoph des Mittleren Zeitalters. Gerüche sind der Beleg für die Wirklichkeit, sage ich. Wenn man seine Umwelt riechen kann, weiß man, dass man wieder mitmischt.
Dieser Geruch hier war eine Mischung aus kalter Luft und Nadelbäumen. Ein feuchter Wald. Ein Rauchfaden.
Die Anth haben mich so designt, dass ich mich im Geist eines Menschen einnisten kann. Bis jetzt war dieses Einnisten stets ein delikater Prozess gewesen, bei dem ich Vorsicht walten lassen musste. Nach so langer Zeit in einem Grab war ich allerdings nicht vorsichtig. Ich wollte so schnell wie möglich meinen Platz erobern.
Mehr Sinne erwachten: Tastsinn, Eigenwahrnehmung, Gleichgewicht. Die runden Kieselsteine unter den Füßen des Jungen, die in zu großen Schuhen steckten. Gebrauchten Schuhen. Wie alt war er? Zehn? Zwölf? Ich kann das Alter von Menschen einfach nicht schätzen.
Das Gefühl für Wärme und Kälte kam schwallartig. Die Kälte machte dem Jungen nichts aus. Dann die Empfindung für chemische Vorgänge, der Sinn, der losplärrt, wenn sich im Blut Kohlendioxid ansammelt. Im Moment bekam der Junge ausreichend Luft. Das war gut.
Er trottete dahin, angezogen vom weit entfernten Schall von Hörnern. Jetzt war auch das Hörvermögen da; anfangs ein verschmiertes Rumpeln, das sich zu einem blechernen Kreischen auswuchs. Auch das Brüllen des Windes konnte ich hören. Für den Jungen war es wohl nicht mehr als ein Flüstern, mich dagegen überwältigte es geradezu. Seit Ewigkeiten hatte ich nicht mehr gehört, wie Luft sich bewegt. Ich schwelgte im Rascheln seiner Jacke.
Als Letztes stellte sich das Sehvermögen ein. In den ersten hellen Streifen erahnte ich schemenhaft das Draußen, nur Linien und Sichtachsen, doch das reichte aus, um zu erkennen, dass der Junge in einem Wald in den nördlichen Breiten einen schattigen Abhang hinunterging.
Die Welt war nass vom Regen, und weil der Junge wusste, dass sich gerade das erste große Unwetter des Herbstes ereignet hatte, wusste auch ich es. Am Himmel über dem Tal hatte es geblitzt und dröhnend gedonnert. Vielleicht hatten die Sturzbäche, die über den Gletscher geströmt waren, das Eis unterspült, sodass es geborsten war und die Höhle freigelegt hatte. Vielleicht hatte aber auch der Blitz eingeschlagen. Das waren seine Theorien, an denen er jedoch noch arbeitete.
Die Bäume waren gewaltig: hoch aufragende, gerade gewachsene Kiefern, grau und streng. Der Boden ein weicher Teppich aus herabgefallenen Nadeln. Der Junge folgte seinen eigenen Spuren zurück. Er kannte den Wald gut; hier fühlte er sich wohl und geborgen, noch mehr als in dem unterhalb gelegenen Dorf.
Dort unten lag also ein Dorf.
In all den Jahren nach Altissas Niederlage, während derer ich in meinem Grab gefangen gewesen war, hatte ich stets unbedingt wissen wollen, was draußen vor sich ging. Ich hatte es mir ausgemalt. Die Menschheit gab es nicht mehr, so hatte ich vermutet. Die letzten Überlebenden hatten sich vielleicht ergeben. Ich hatte mir vorgestellt, wie sie unter dem Drachenmond ihre Existenz fristeten.
Irgendwann im Lauf der Jahre hatte ich aufgehört, mir diese Dinge auszumalen, und mich in die Erinnerung zurückgezogen, sie gestrafft wie ein Bettlaken.
Zwischen den riesenhaften Kiefern sah ich ein Gebirgstal, und in diesem Tal etwas, das ich mir niemals, wirklich niemals hätte vorstellen können.
Weiter oben, von wo wir gekommen waren, erstreckte sich eine breite Gletscherzunge, aus der ein schmaler, reißender Fluss strömte. Etwas weiter unten, zu beiden Seiten des Wassers, lag eine Siedlung, die wie ein Dorf der Alten Anth wirkte. Einige Häuser waren aus Stein und grobem Mörtel, andere aus Strohlehm, und alle waren mit Stroh gedeckt.
Nur zur Erinnerung: Ich war in einer Rettungskapsel auf die Erde gekracht, die aus einem tausend Meter langen Kriegsraumschiff mit Kurs auf den Mond geschleudert worden war.
Über dieser Szenerie thronte eine Burg, die den Taleingang bewachte und auf die der Junge nun zustrebte. Burg Sauvage, so nannte er sie. Sein Herz hämmerte vor Vorfreude. Dort in der Burg waren Menschen, die er liebte.
Riechvermögen, Gleichgewichtssinn, Sehvermögen, das Spannen einer vollen Blase – ich hatte nun Zugang zu all seinen Empfindungen sowie zu den jeweiligen Zusammenhängen, in die sie eingebettet waren. Das Gewitter hatte die Luft gereinigt. Es war ein heller, kalter Tag, ideal für Schildknappenspiele. Seine befremdliche, morbide Entdeckung hatte der Junge mittlerweile in einen Winkel seines Geistes verschoben, um später darüber nachzudenken.
Ich bestand aus zahlreichen Teilen, und nur wenige von ihnen waren mit dem Jungen entkommen. Weitaus mehr waren bei Altissa zurückgeblieben, vergraben in ihrem vertrockneten Knochenmark. Ich denke oft daran, wie viel Glück ich hatte, dass gerade dieser Teil von mir, der dies jetzt niederschreibt, zurück in die Wirklichkeit gelangt ist. Eines weiß ich sicher: Solange noch ein Fünkchen Energie in ihm leuchtete, stellte sich mein anderer Teil dieselbe Frage, die auch ich mir stellte, als ich dieser unfassbaren Burg ansichtig wurde.
Ich will nicht behaupten, dass ich mir den Jungen aus dem Gebirgstal gezielt ausgesucht habe, um einen Stern vom Himmel zu holen, den Sturmcomputer lahmzulegen oder die Erde nach der erlittenen Katastrophe zu erlösen, obwohl wir all das getan haben und noch so einiges mehr.
In Wahrheit trieb mich die Frage um, die tief in mein Herz geschrieben ist. Die Frage, die ich schon beinahe, aber nur beinahe, aufgegeben hatte, die große Frage der Anth:
Was passiert als Nächstes?
Schildknappenspiele
Was bin ich? Chronist und Berater, verschwindend klein, versteckt in dem menschlichen Subjekt, das mich trägt. Ersonnen haben mich die Anth auf dem Gipfel ihrer Schaffenskraft, als ein Geschenk für die größten unter ihnen. Ich hielt ihre Gedanken und Handlungen fest und stellte ihnen im Gegenzug mein Wissen über die Vergangenheit zur Verfügung. Ein durchaus umfangreiches Wissen.
Mehrere Jahrzehnte lang zeichnete ich den Werdegang von Altissa Praxa auf, bis dann die Rettungskapsel unser Grab wurde. Sie holte sich nur selten bei mir Rat.
Mein Kern besteht aus einem soliden Pilz, der mit einer Menge Technologie umhüllt ist, was immens viel Geld gekostet hat. »Anstellgut für Sauerteig im Tech-Mantel«, hatte ein Kritiker gespottet. Aber ich mag diese Beschreibung. Während meiner Entwicklung stellten die Controller immer wieder die Frage, ob ich den Aufwand wert war. Doch der Traum von einem Gedächtnis, das das Leben eines Einzelnen überdauern würde, hielt das Projekt am Laufen.
Berauscht vom ATP, kroch ich durch die Blutbahnen des Jungen. Nach den kargen Jahren im Grab hatte ich vergessen, wie gut Energie schmecken kann. Die Regionen meines Geistes, die ich auf Standby gesetzt hatte, erwachten lärmend wieder zum Leben. Ich erinnerte mich wieder an die Kooperative, ihre Geschichten und ihre Eigenheiten. Ich rezitierte Haikus. Ich zählte die Reihe der Primzahlen auf, nur so zum Spaß.
Ich festigte meine neue Position.
Wenn man weiß, dass ich mich mit dem Geist meines Subjekts verbinde, könnte man annehmen, dass ich mich in seinem Gehirn festsetze.
Damit läge man falsch.
Weitaus mehr als andere Organe und Teile des menschlichen Körpers begegnet das Gehirn Eindringlingen rundheraus feindselig; es besitzt exzellente Verteidigungsmechanismen, die vor sonderbarer Energie nur so brummen. Ich kann in ein Gehirn eindringen – mit Filamenten aus Gold, die nur drei Atome dick sind –, aber ein Gehirn ist für mich wie eine heiße Pfanne: nützlich, doch mit Vorsicht zu handhaben.
Ich richtete mich in einer Schulter des Jungen ein, in einem Muskel direkt unterhalb des Halses; eine robuste Körperregion, die üppig mit Blut versorgt wird und durch die dicke Nervenstränge verlaufen, und diese wiederum verschaffen bequemen Zugang nicht nur zum Gehirn, sondern auch – über das ganze Verbreitungsgebiet des Nervus vagus – zu den Eingeweiden und in die Leistengegend.
Ich sog Energie ein und jagte sie durch die Turbinen meiner Zellen, mehr Energie, als ich in den hundert Jahren zuvor umgesetzt hatte, eine ganze Kalorie oder sogar mehr. Hätte der Junge achtgegeben, hätte er ein leichtes Jucken verspürt.
Er gab nicht acht. Vor uns erhob sich die Burg Sauvage. Wuchtig und abweisend, aus dunklem Gestein, das in schmale Blöcke gehauen worden war. An den Ecken ragten schlanke Türme auf, gekrönt von konischen Hauben aus dunklem Holz. Das Gebäude wirkte nicht so, als wäre es für praktische Zwecke tauglich.
Der Fluss, der nach dem Gewitter angeschwollen war, strömte ganz in der Nähe vorüber, und zwischen ihm und der Burg lag eine Wiese mit kurz geschnittenem Gras. Dort stand ein strohgedeckter Hangar, aus dem die Schnauze eines schwarzen Flugzeugs mit wuchtigem Rumpf hervorlugte.
Der Himmel über dem Tal war blassorange und klar, bis auf eine vereinzelte Wolke, die jedoch keine Wolke war, sondern eine riesige tierische Gestalt: eine Motte, wie das Gehirn des Jungen nüchtern berichtete, allerdings von titanischen Ausmaßen. Unscharf, irisierend, ehrfurchtgebietend. Sie waberte über dem Tal und warf einen Schatten von der Größe eines Cumulonimbus, an dessen Rändern sich das Licht der Sonne brach wie an einem durchscheinenden Prisma.
Die Burg, der Landeplatz, die Riesenmotte, der Junge, der ein Mensch war und offenkundig höchst lebendig – all das verwirrte mich zutiefst. Vielleicht waren das nur letzte Visionen, bevor ich starb, eine missratene Fantasie der Anth. Ich überprüfte mich, führte die Diagnoseläufe durch, die mich im Grab bei geistiger Gesundheit gehalten hatten.
Das hier war wirklich.
Die Schuhe des Jungen schlappten über die Bohlen einer kurzen Brücke. Als er den Fluss überquerte, zog der Schatten der Motte über die Burg und verschwand schimmernd im dahinterliegenden Wald.
Der Junge wusste, welchen Weg er nehmen musste. Er ging an einer Schenke vorbei und an einer Kirche mit rustizierten Steinmauern, in deren Hof Nebelschwaden hingen. Die Dorfbewohner auf den Straßen trugen funktionelle Kleidung; ihre Parkas waren mit Streifen von Reflektorband gesprenkelt, die im Sonnenlicht glitzerten.
Der Junge trat nicht durch das weit offen stehende Burgtor, sondern durch eine kleine Tür, die neben dem Tor in die Mauer eingelassen war. Im Inneren der Burg lief er durch halbdunkle Korridore und schlitterte artistisch um die Ecken – er kannte die Strecke offenbar gut.
»Hey, Hundejunge!«, rief eine Männerstimme. Das waren die ersten Worte, die ich in dieser neuen Welt hörte: »Hey, Hundejunge!«
Im Geist des Jungen wallte Verärgerung auf, und so erfuhr ich, wie er wirklich hieß. Nicht Hundejunge, sondern Ariel.
Es ist interessant, wie die Menschen mit dem eigenen Namen umgehen. Mein erstes Subjekt war von seinem Namen ganz erfüllt; es war sich seiner selbst immer als Peter Leadenhall bewusst sowie all dessen, was in diesen beiden Wörtern steckte.
Altissa Praxa war genau das Gegenteil – sie dachte oft wochenlang nicht an ihren Namen. Er war für sie nur eine Bezeichnung, ein Hilfsmittel, so praktisch und unauffällig wie ein Hammer oder ein Schuh. (Peter liebte auch seine Schuhe.)
Der Junge war weder so noch so, aber dass sein Name jetzt in ihm wie ein Peitschenschlag schnalzte, ließ mich etwas verstehen. Ariel! Wenn er hochmütiger gestimmt war: Ariel de la Sauvage. Niemand nannte ihn je so, außer ihm selbst und einer weiteren Person.
»Der Hundehüter sucht dich«, sagte der Mann jetzt. Es war Bufo, einer der Ranger des Zauberers. Sie waren allesamt schwarz gekleidet und stolzierten vor der Burg auf und ab, als gehörte sie ihnen.
Ariel sah ihn an. Zwischen Bufos wässrigen Glupschaugen prangte ein dunkles Mal auf seiner Haut:
Ariels Blick glitt über das Mal hinweg, ohne innezuhalten. Er nahm es gar nicht wahr. Jeder hier trug so ein Mal.
Der Ranger drängte sich an ihm vorüber, und Ariel überlegte, welchen Weg er nehmen sollte. Der Hundehüter suchte ihn … und dennoch …
Erneut erschallten die Hörner, und seine Entscheidung war getroffen.
Im weitläufigen Innenhof der Burg gesellte er sich zu einem Grüppchen, das Kämpfern bei einem Spiel zusah. Auf jedem Gesicht entdeckte ich ein Mal: auf den Schläfen, auf den Wangen oder mitten zwischen den Augen.
Ariel schlängelte sich durch die anderen hindurch bis zu dem Geländer, das die Kampffläche umgrenzte. Dort prügelten zwei untersetzte Schildknappen mit massiven Schaumstoffschwertern aufeinander ein. Am Rand der Fläche standen Tribünen; Ariel suchte sie von oben bis unten ab und hielt bei interessanten Gesichtern kurz inne. Jesse, der Barde, der das Geschehen skeptisch beäugte. (Ein Mal über dem Auge.) Elise, die Köchin, die einen der Kämpfer anfeuerte – ihren Freund. (Ein Mal neben den Lippen.) In der obersten Reihe der Tribüne saßen die Ritter (alle mit unterschiedlichen Malen). Ariel betrachtete sie mit der gebotenen Ehrfurcht, doch als ich in seinem Geist nachforschte, um zu erfahren, was sie denn eigentlich taten, lautete die Antwort: nicht viel.
Diese Burg beherbergte keinen König, sie erwartete jedoch einen. Hier herrschte der Zauberer Malory, unergründlich und entrückt. Ariel hielt nach ihm Ausschau, jedoch mit gemischten Gefühlen: So sehr er sich wünschte, den Zauberer zu entdecken, wünschte er sich auch, ihn nicht zu entdecken.
Der Zauberer befand sich nicht unter den Zuschauern, was nicht überraschend war. Malory war oft abwesend.
»Sie sollten lieber ein Quiz veranstalten«, sagte eine schneidende Stimme schräg hinter Ariel.
Es war Madame Betelgauze, Ariels Lehrerin, die ihm vieles beigebracht hatte, über das Wetter, über Krankheiten, über unsichtbare Planeten. Ich stöberte durch ihren Unterricht: ein Verzeichnis nützlicher Pflanzen, Mengenangaben für die Ingredienzien verschiedener Elixiere und Tinkturen, Ehrerbietung gegenüber dem Mond und seinen Phasen. Sie hatte etwas von einer Hexe, diese Betelgauze.
»Aber Madame, dabei würden Sie doch immer als Siegerin hervorgehen«, sagte Ariel. Sie trug ihr Mal auf der Stirn, exakt an der Stelle des dritten Auges.
»Darauf kannst du Gift nehmen«, erwiderte sie. »Ich würde euch alle unter meinen Absätzen zermahlen. Euch zu Staub zermalmen!«
Betelgauze sprach eine andere Sprache als Altissa, die jedoch mit dieser verwandt war. Und da der Junge sie verstand, verstand auch ich sie.
Ich suchte nach etymologischen Hinweisen, konnte aber nicht so weit vordringen, weil der Junge so flüssig sprach und seine Worte einen dichten Puffer bildeten. Er sprach formell und spröde. Er war sich dessen bewusst, und er war stolz darauf.
Der letzte Kampf des Tages zog Ariels gesamte Aufmerksamkeit auf sich, denn einer der Beteiligten war sein Bruder Kay. Eine Bande von Schildknappen schleppte alle möglichen Gegenstände in die Arena. Dieser Kampf war kein Duell, sondern ein Hindernis-Wettlauf: mit einem Balken, Fässern, einem Netz, einer Wand. Ein Ritter blies das Horn, und die beiden Kontrahenten sausten los.
Der Junge musterte Kay mit Ehrfurcht. Er besaß lange Gliedmaßen, war gelenkig und bewegte sich geschmeidig. (Das Mal trug er auf der Wange.) Er sprang über den Balken, als tanze er, hüpfte leichtfüßig von einem Fass auf das nächste und tauchte unter dem Netz hindurch. Dort holte sein Konkurrent ihn ein, ein sich windender Wurm aus Muskeln. Doch das letzte Hindernis war eine Wand, die für Kay gar kein Hindernis war: Er sprang hoch, bekam die Oberkante mit den Fingerspitzen zu fassen und war schon auf der anderen Seite.
Ariel schrie seinen Beifall hinaus; vor Ergebenheit wurde sein Hals ganz rau. Er hüpfte auf und ab und versuchte, den Blick seines Bruders auf sich zu ziehen. Kay winkte in die Runde, und als er Ariel sah, zwinkerte er ihm zu. Ariel jubelte innerlich über den Sieg seines Bruders und dessen Fähigkeiten.
Er wollte Kay gratulieren, doch der wurde von den anderen Schildknappen fortgespült. Gal und Percy trompeteten ihre Anerkennung hinaus und klopften Kay so heftig auf den Rücken, dass er fast zu Boden fiel. Heute Abend würden sie im großen Saal der Burg gemeinsam speisen und mit den anderen Kämpfern zechen, während sich die Ritter ein Urteil über sie bildeten.
Ariel seinerseits ging zu den Zwingern, ließ die Hunde heraus und brachte sie auf die Wiese am Fluss, wo er sie zum Training auf dem kurzen Gras Bällen nachjagen ließ.
Anschließend kämmte er ihnen das Fell und gab ihnen ihr Fressen, das mit Überresten verfeinert war, die in der Küche bei der Vorbereitung des Festmahls angefallen waren.
Der Hundehüter Master Hectorus, genannt Heck, saß an seiner Werkbank und stach eine Ahle durch ein Lederband. (Er trug sein Mal zwischen den Augenbrauen, was ihm einen Ausdruck ständiger Konzentration verlieh.) Er machte wunderschöne Halsbänder; manche waren aus dünnen Lederstreifen geflochten, andere mit ausgefallenen Mustern aus Metallnieten verziert. Der Raum war erfüllt vom schweren, myzelartigen Geruch des Leders.
»Du bist noch nicht fertig für heute«, sagte Master Heck. Ariel warf ihm einen überraschten Blick zu. Er hatte die Hunde doch gekämmt und gefüttert. Heck sah ihn ausdruckslos an. »Hol uns ein paar Salzbrezeln.«
Erfreut gehorchte der Junge und ging kurz darauf die Hauptstraße von Sauvage entlang, wo ihn lebhaftes Treiben umgab. An manchen Abenden, wenn sich die Dorfbewohner in ihre Häuser oder in ihre Kammern in der Burg zurückzogen, wirkte Sauvage bedrückend beengt. Doch wenn alle draußen unterwegs waren, lachend und einander lauthals grüßend, alle in ihrer besten funktionellen Kleidung, war das Dorfleben eine große, freudvolle Parade.
Der Junge kannte alle; jedes Gesicht verband er mit einem Namen. Insgesamt lebten etwa hundert Menschen in dem Dorf.
Der alte Ritter Elver Sargasso ging vorüber, im Gefolge seine schmeichlerischen Schildknappen. Seine Jacke war geradezu unwirklich, von so verführerischer und verwinkelter Form wie ein alter Stealthbomber. An seiner Hüfte baumelte ein Schwert, was nur Rittern gestattet war. Ein Schwert, wie auch Kay bald eines besitzen würde.
Ich wurde aus diesem Ort nicht schlau. Nicht einmal eine Theorie dazu konnte ich entwerfen. Alles war ein einziges Durcheinander, ein kunterbunter Haufen, nicht so sehr anachronistisch als vielmehr eine gleichzeitige Ansammlung von allem. Zugegeben, die Anth hatten schon immer so gelebt. Abgeschirmte Telefone neben Räucherstäbchen, blitzende Netzwerke neben gedruckten Büchern. Nichts wurde je endgültig ausrangiert. Aber eine Burg?
Fragen über Fragen stellten sich mir: Wann? Wo? Warum?
Integration
Master Heck hatte den Lagerraum des Zwingers zu einem Schlafzimmer für die Brüder umgestaltet, und viele Jahre hatten Ariel und Kay gemeinsam in dem klobigen Bett geschlafen, das der Hundehüter für sie gebaut hatte. Vor Kurzem war Kay nun in die Unterkünfte der Burg gezogen, wo er zusammen mit den anderen Schildknappen wohnte. Seine Tage verbrachte er mit der Ausbildung, und unterrichtet wurde er nicht von Madame Betelgauze, sondern von Rittern wie Elver Sargasso. Er lernte Fechten, galantes Benehmen und emotionale Kriegsführung.
Ariel hatte keinen so klar definierten Platz in der Welt. Er streifte durch das Tal und ließ sich durch das Dorf treiben. Die Aufgaben, die Master Heck ihm auftrug, erledigte er akkurat, aber das war auch alles. Sobald er freihatte, zog er los. Er bewunderte Hecks Geschick im Umgang mit Leder, doch es drängte ihn nicht dazu, diese Kunst selbst zu erlernen.
Er befürchtete, dieses mangelnde Interesse könnte Master Heck enttäuschen, doch wenn dem so war, ließ sich der Hundehüter nichts anmerken. Ebenso wenig äußerte Heck sich anerkennend über die Leistungen des Jungen. Er schien der Ansicht zu sein, Ariel habe seine Pflicht erfüllt, indem er zu ihm gekommen war.
Dafür liebte Ariel den Hundehüter, wenngleich die gutmütige Art, wie dieser ihn aufnahm, nicht das überwältigende Verlangen in Ariels Innerem stillen konnte. Er sehnte sich danach, an etwas Größerem teilzuhaben. Ritter wollte er keiner werden – dazu fehlten ihm die körperlichen Voraussetzungen, wie Kay sie hatte –, aber vielleicht … Was gab es denn noch? Manchmal fragte er sich, ob der Zauberer Malory jemals eine Ausbildung durchlaufen hatte. Vielleicht würde er Ariel einmal in seinen Turm einladen und ihm zeigen, was er dort oben verwahrte … was auch immer das war …
Oder, noch besser, Ariel könnte lernen, das Flugzeug des Zauberers zu steuern.
Derlei Wünsche und Träume schwirrten ihm durch den Kopf, während er jetzt im Bett lag und vor sich hin döste. Ein ereignisreicher Tag lag hinter ihm: die Entdeckung der Toten, die Spiele, die Brezeln, und abends eine zunehmende Übelkeit, die ihn früh ins Bett getrieben hatte.
Seine Lieblingshündin Yuzu kam hereingetrappt, sprang aufs Bett, ohne dass er sie dazu aufgefordert hätte, und legte sich neben ihn.
Ich war bereits so verstört wie kaum je zuvor, als Yuzu, als wolle sie meine Verwirrung noch weiter steigern, zu sprechen anfing.
Mit liebevoller Zuneigung sagte sie klar und deutlich: »Gute Nacht, Ariel. Ich hoffe, morgen früh geht es dir besser.« Der Junge wirkte nicht überrascht, sondern tätschelte ihr nur die Flanke.
In der Nacht bekam Ariel Fieber. Das war meine Schuld; in meinem Eifer war ich zu schnell und nicht feinfühlig genug vorgegangen. Im besten Fall kann ich so sanft mit einem menschlichen Körper verschmelzen, dass die T-Zellen mich bejubeln. Jetzt bemühte ich mich, die Lage zu beruhigen. Währenddessen tränkte der Junge das Kissen mit seinem Schweiß.
Jedes Mal, wenn ich mich in ein neues Subjekt integriere, kommt der Augenblick, in dem unsere Gedanken sich verflechten. Das ist der Moment, in dem ich aus der Deckung gehen muss. Weil ich so sehr damit beschäftigt war, die Dinge im Körper des Jungen wieder in Ordnung zu bringen, hätte ich den Augenblick diesmal fast verpasst. Hastig schoss ich neue Substanzen in sein Blut, verstärkte meine Membranen und versuchte gleichzeitig, dieses absurde Puzzle der Burg mit ihren sprechenden Tieren zusammenzusetzen, als Ariel ruhig sagte:
»Natürlich können Hunde sprechen.« Er hatte die Augen geöffnet, trotz der Dunkelheit. »Warum sollten sie nicht sprechen können?«
Darauf war ich nicht vorbereitet. Ich fühlte mich ertappt, bloßgestellt. Ich weiß nicht, warum. Vor allem aber fühlte sich diese Begegnung mit einem Unbekannten eigenartig an. Ich hatte vergessen, wie es war. Ich hatte die Hoffnung aufgegeben, es könnte je wieder geschehen.
»Wer bist du?«, flüsterte Ariel. Er war noch benommen vom Fieber, wusste nicht, ob er träumte. In seinen Blutbahnen spürte ich das Pulsieren der Angst. »Wie ist es möglich, dass ich dich in meinem Kopf hören kann?«
Ich kann direkt zu meinen Subjekten sprechen, auch wenn das nicht ganz einfach ist. Ich wurde dafür geschaffen, ihre Wahrnehmungen zu registrieren, nicht ihnen welche zu bereiten, weshalb sich das anfühlt, als wollte man mit einem Strohhalm die Fließrichtung eines Flusses umkehren. Selbst das leiseste Flüstern erfordert immense Anstrengung; Größeres – wie etwa jede Art von Wahnvorstellung – geht über meine Kräfte. Oder so gut wie.
Flüstern dagegen ist machbar. Wie sollte ich mich am besten ankündigen? Mit der Wahrheit. Ich sagte: Ariel de la Sauvage, ich bin ein Besucher, der einen Ozean aus Zeit überquert hat, um dich zu treffen.
Meine Subjekte hören das, was ich sage, nicht im eigentlichen Sinne; vielmehr fühlt es sich für sie so an, als würden sie sich unvermittelt an das Gesagte erinnern. Eine Erinnerung ohne Bezug. Man wird sich mit einem Mal bewusst, dass jemand etwas gesagt hat. Und vielleicht fragt man sich, ob man das selbst war.
Der Junge blickte auf die Deckenbalken. Seine Augen passten sich allmählich an. »Bist du ein Engel?«, fragte er.
Ich stöberte in seinen Erinnerungen und stieß auf die Grundzüge der Religion, die in der kleinen Steinkirche gelehrt wurde, ein synkretistisches Potpourri aus verschiedensten Glaubenstraditionen, einschließlich Engel, die allesamt zu einem Erntedankfest samt Tod und Wiedergeburt konvergierten.
Ich war kein Engel.
»Ein Dämon?«, fragte er zaghaft. Es klang fast, als wäre ihm das lieber.
Auch kein Dämon. Ich bin Chronist und Berater. Vielleicht auch ein Gewissen. Ich war erschaffen worden, um Menschen bei allem, was sie tun, zu helfen, und ich würde mein Bestes geben, um auch Ariel zu helfen, auf welche Weise auch immer.
Ariel ließ das sacken. »In Ordnung«, sagte er schließlich. Dann sagte er etwas, was er noch nie laut ausgesprochen hatte, nicht einmal Kay gegenüber. »Ich weiß, dass ich für eine bedeutende Aufgabe bestimmt bin. Das spüre ich. Ich habe es schon immer gespürt.«
Also war er nicht nur mutig und neugierig und schwermütig, sondern auch ein wenig großspurig. Das war eine gefährliche Kombination; aber er war ja noch ein Junge.
So begann dort im Lagerraum des Hundezwingers, während Yuzu selig schnarchte, unser langes Gespräch. Von diesem Moment an redeten wir miteinander, auf unseren Wegen über Gehsteige und durch Sternenfelder, im Schlafsaal eines nebelverhangenen Colleges, in der Steuerkanzel eines Raumschiffs, das dem Untergang geweiht war. Und wenn wir nicht sprachen, war das nicht weiter schlimm, denn ich wusste alles, was er wusste, und er freute sich darüber, dass ich ihn begleitete.
Jetzt, kurz nach unserem Kennenlernen, bat ich Ariel, aufzustehen und hinauf in den Himmel zu blicken, denn ich hatte ein paar Fragen, die keinen Aufschub duldeten.
Unsichtbare Planeten
Ariel stand auf der Brustwehr der Burg und blickte nach oben. Er war missgelaunt und enttäuscht.
Der Himmel war dunkel, der Mond nicht zu sehen. Noch immer umgab der Schleier aus Staub die Erde. Dort oben, wo es kühl und klar hätte funkeln sollen, hing dumpf und schwer eine summende Schicht in schäbigem Lila. Der Junge hatte nie einen anderen Himmel gekannt, weshalb er den, der sich ihm darbot, mit gewohnheitsmäßiger Ehrfurcht betrachtete. Das war deprimierend.
Nur wenige Sterne – die allerhellsten – durchdrangen die Finsternis. Sie wirkten weniger wie dünne Nadelstiche, sondern eher wie nebulöse Himmelskörper.
Auch Madame Betelgauze stand auf der Brustwehr. Damit hatte Ariel gerechnet. Sie schlich zu jeder Tages- und Nachtzeit hier herum, vor allem jedoch morgens und abends in der Dämmerung.
»Guten Morgen«, sagte sie. »Was führt dich so früh zur Himmelsbeobachtung?«
»Ich bin aufgewacht und konnte nicht wieder einschlafen«, antwortete Ariel wahrheitsgemäß.
»Das ist vielleicht nicht der einzige Grund«, sagte Betelgauze. In ihrem Blick lag die schneidende Helligkeit, die dem Himmel fehlte. »Du bist zu einer günstigen Stunde gekommen, und jetzt wird mir plötzlich klar, dass ich das nicht dem Zufall hätte überlassen dürfen. Ich hätte dich wecken und holen sollen, damit du es siehst.«
»Was?«
Sie deutete auf eine Stelle knapp über dem Horizont. »Dort im Osten gehen sie auf, kurz vor der Sonne. Kannst du sie sehen?«
Der Junge blickte angestrengt auf die Stelle. Der Himmel war noch immer finster. Er konnte nichts erkennen.
»Denk daran, was ich dir beigebracht habe, mein Schüler«, sagte Betelgauze. »Nutze deine Augenwinkel.«
Der Junge fokussierte den Blick so, wie sie es ihn gelehrt hatte, und fixierte einen Punkt neben der Stelle, auf die sie deutete. Mit dem peripheren Sehen – dem Sinn, der etwas mehr vermag als der Sehsinn – konnte er jetzt das ausmachen, wovon sie sprach: drei schwach leuchtende, dicht nebeneinanderliegende Punkte.
»Die unsichtbaren Planeten«, sagte Betelgauze. »Der Herr des Festes und die Funkelnde Dame, dazwischen der Kerkermeister.«
Das musste Saturn sein, eingezwängt zwischen Jupiter und Venus. Ihr Anblick war verblüffend, selbst durch den Schleier hindurch. Sie waren der Erde so nahe, wie keines meiner Subjekte sie im Lauf der Jahrhunderte je gesehen hatte.
»Ich beobachte sie schon seit vielen Nächten«, sagte Betelgauze. »Der Herr des Festes hat den Kerkermeister spazieren geführt und ihn abgelenkt. Daher hat der Kerkermeister nicht bemerkt, wie die Funkelnde Dame näherkam. Heute haben sie und ihr Liebhaber die Falle zuschnappen lassen. Kannst du sie sehen? Sie haben ihn in ihre Mitte genommen!«
Ariel konnte die drei Planeten jetzt deutlich erkennen. Jupiters helles Strahlen wurde vom Staub gedämpft; seine Entourage aus Monden war verschwunden.
»Die Macht des Kerkermeisters wird gebrochen sein … für einen Tag, eine Woche, ein Jahr, wer kann das wissen? Dinge, die bis jetzt unmöglich waren, sind nun möglich.«
»Was für Dinge?«, wollte Ariel wissen. Madame Betelgauzes Deutungen des Himmelsgeschehens brachten oft eine Saite in seinem Inneren zum Klingen, und obwohl er sich eine leichte Skepsis bewahrt hatte, kamen die Schwingungen nie ganz zum Erliegen.
»Ich bin keine Hellseherin«, sagte Betelgauze. »Wir müssen wachsam sein.«
Die Sterne am Rest des Firmaments lagen größtenteils hinter dem Schleier aus Staub im Dunkeln. Größtenteils, doch nicht zur Gänze. Ariel hatte gelernt, sich zu orientieren, und wusste, wo der Polarstern lag.
Ich folgte seinem Blick und fand meinen Kalender.
Der Stern dort oben am Himmelsscheitel war nicht der Polarstern; selbst durch den Schleier hindurch leuchtete er heller als der ehemalige Fixpunkt der Anth. Dieser hell strahlende Stern war Wega, der erste Stern, der jemals auf einer Fotografie abgebildet worden war. Dass der Junge sich an ihm orientierte, war erstaunlich und jagte mir zugleich einen Schrecken ein. Und zwar aus folgendem Grund:
Die Erde schwankt auf ihrer Achse wie ein Kreisel und richtet sich mal am Polarstern aus, mal an der Wega; sie schwankt hin und her, hin und her. Das ist Grundlagenwissen; und eine Grundkonstante ist auch die Anzahl der Jahre, die ein solcher Schwankungszyklus dauert.
Die Inthronisierung der Wega ließ erkennen, dass ich nicht zehn Jahre fortgewesen war, wie ich vermutet hatte, und auch nicht hundert Jahre, wie ich befürchtet hatte, sondern elftausend Jahre.
Diese gewaltige Zeitspanne war überwältigend. Auf dem Höhepunkt ihrer Zivilisation hatten die Anth auf eine Vorgeschichte zurückgeblickt, die nur sechstausend Jahre gedauert hatte. Diese elftausend Jahre waren nun doppelt so lang wie ihre gesamte Geschichte von den frühesten Siedlungen der Alten Anth bis zu dem Tag, an dem der Drachenmond sie ins Verderben gestürzt hatte.
Im Norden leuchtete Wega. Elftausend Jahre waren vergangen, und die Himmel waren aus dem Lot.
Anmerkung des Chronisten
Eine Anmerkung zu meiner Perspektive.
Ich bestehe aus biotechnologischen Komplexen, die mit gebändigten Mikroorganismen verschraubt sind. Meine Existenz folgt der Logik der Hefe, und diese Logik heißt Vielfalt. Die Hefe kennt kein singuläres Ich, also kenne auch ich genau genommen kein solches Ich. Aber ich mag das Ich aus dem Mittleren Zeitalter der Anth. Das souveräne Ich. Es ist kühn und herrisch; und es maßt sich zu viel an.
Die Sprache, die die Anth auf dem Höhepunkt ihrer Kultur sprachen, war viel zu zurückhaltend, um ein solches Banner aufzupflanzen. Sie kannte keine erste Person; ihre Erzählungen waren schillernde, wuselnde Ströme, verwinkelt und flirrend vor Widersprüchen. So ist auch die Welt, meistens jedenfalls, und diese Erzählungen können auf ihre Art packend sein, aber mir waren die Erzählungen aus dem Mittleren oder auch dem Alten Anth-Zeitalter von jeher lieber.
Ich mag dieses Ich.
Eine Anmerkung zu meinem Kalender.
Nachdem ich die Wega gesehen hatte, kalibrierte ich die Uhren in meinem Herzen neu. Ich wäre ja auch ein armseliger Chronist, wenn ich nicht einmal die Uhrzeit angeben könnte. Jedes Mal, wenn Ariel den Mond und die Sterne betrachtete, verfeinerte ich meine Messung, bis ich schließlich zu einem sicheren Urteil kam:
Nach dem Kalender der Anth war der Tag, an dem Ariel de la Sauvage mich zurück in die Geschichte holte, der 28. September 13777.
Mit diesem Datum beginnt meine Geschichte, und auch wenn weder Ariel noch sonst ein Mensch in seiner Welt je etwas von Septembern gehört hatte oder sich darum scherte – mir waren sie stets wichtig und sind es noch immer. Wie sie so auf der obersten Sprosse einer schwankenden Leiter aus Jahren hockt, wirkt die Zahl 13777 beinahe komisch. Dennoch. Diese Daten sind für die Anth, die mich erschaffen haben.
Und sie sind für euch.
Normal – und auch wieder nicht
29. September 13777 bis 1. November 13777
Am Morgen weckten die Hunde ihren Jungen. Ich legte die Erkenntnis von letzter Nacht beiseite; über die verlorenen Jahre nachzugrübeln, hätte zu nichts geführt. Stattdessen tat ich gut daran herauszufinden, was jetzt gerade geschah und was als Nächstes geschehen könnte.
In den Tagen und Wochen nach den Schildknappenspielen fand das Dorfleben wieder zurück in seine gewohnten Bahnen. Anfangs empfand ich mich eher als Detektiv, doch als sich die Hinweise verdichteten, kam ich mir eher wie ein Träumer vor.
Der Mond wurde voll, und auf seinem Gesicht zeigte sich die Narbe der siebenzackigen Zitadelle der Drachen, die selbst für mich in meiner Verwirrung ein eindeutiges Indiz dafür war, wie die Dinge lagen.
Die Schwerkraft des Mondes zerrte am Staubschleier, warf ihn zu gewellten Mustern auf und in der Abenddämmerung zu enormen lila Wogen. Als der Mond seinen Zyklus beendete und unsichtbar über den Taghimmel wanderte, verriet eine schwache, sich kräuselnde Spur weiterhin seine Position. Das war ein wunderschöner Anblick, doch lieber hätte ich die Sterne gesehen und einen Mond ohne Drachen.
Das Dorf wurde mit Strom versorgt; die Kabel verliefen auf Masten aus Kiefernstämmen, und alle hatten ihren Ursprung in der Burg Sauvage. Ein Elektriker mit spitzem Gesicht namens Ratthew kümmerte sich um die Instandhaltung der Kabel und Masten sowie der LED-Laternen, die die Straßen des Dorfes erhellten. Sie gaben ein schwaches, warmes Licht ab und waren sehr verlässlich, außer in den Nächten, in denen der Zauberer in seinem Turm zugange war. Dann flackerte das ganze Dorf.
Die Dorfbewohner sammelten ihre Nahrung in der weiteren Umgebung: Pilze, Schwarznüsse und die letzten Wildäpfel. Außerdem betrieben sie einen gemeinschaftlichen Bauernhof, wo dunkelgrünes Gemüse aus der Familie der Kreuzblütler einem Meer von Kürbis und Winterweizen Platz gemacht hatte. Der Zauberer hatte sich für diese Arten eingesetzt, die winterfest und schädlingsresistent waren und wie von selbst zu wachsen schienen.
Der Weizen wurde in einer elektrifizierten Mühle, in der es süßlich duftete, zu leicht violettem Mehl gemahlen; wenn sich das Mühlrad drehte, heulte der Motor. Auch Bier brauten sie daraus, dem sie Kräuter hinzufügten, die Madame Betelgauze gesammelt und getrocknet hatte: Gagelstrauch, Wermutkraut, Brennnesseln und Salbei. Butter und Käse machten sie aus der Milch von dreizehn Ziegen, die in aller Ruhe jenseits des Flusses grasten. Als Ariel einmal an der Weide vorüberging, hörte er, wie sie einander Schauergeschichten erzählten und dabei genüsslich in Ohnmacht fielen.
»Natürlich können Ziegen sprechen«, murmelte Ariel an sich selbst und an mich gewandt. »Warum sollten sie es nicht können?«
Das alles war also normal. Die Leute litten keine Not, und es gab kein Geld, das sie hätte aus der Bahn werfen können. Das Dorfleben ruhte sanft auf einem gewissen Überfluss, getragen von der Freigiebigkeit des Zauberers. So weit nichts Besonderes.
Die größte Gefahr war die Langeweile. Die Ritter vertrieben sich die Zeit mit emotionaler Kriegsführung und gingen hin und wieder auf die Jagd, wobei sie in das Bellen der Hunde einstimmten und einen scheuen goldenen Elch aufzuspüren versuchten. Ariel wusste, dass der Reiz in der ausgedehnten, fröhlichen Wanderung lag; hätten sie das Tier je entdeckt, wäre es mit der Heiterkeit vorbei gewesen.
Die übrigen Dorfbewohner kamen in der Schenke zusammen, sangen derbe Lieder und spielten stundenlang Karten. Mangels Geld, das sie hätten verwetten können, rechneten sie in Mutproben: Wer verliert, muss einen Krug Bier in einem Zug austrinken; wer verliert, muss an der Tür des Zaubererturms klopfen und davonrennen; wer verliert, muss in den eiskalten Fluss springen.
Die Spielkarten waren das einzige Gedruckte, das ich in Sauvage je gesehen habe: zwei kostbare Decks, die der Zauberer mitgebracht hatte, als er einmal die Schenke besuchte – zum ersten und letzten Mal, wie alle übereinstimmend erzählten. Die Karten waren prächtig gestaltet, dick und wächsern und offenkundig unzerstörbar; vier Farben mit je dreizehn Bildern, die leuchtende und düster dreinblickende Gestalten zeigten.
Wenn Ariel durchs Dorf ging, streichelte er mit seiner Aufmerksamkeit alles, was er sah, und in plötzlichen Rückblenden und Träumereien meldete sich seine Erinnerung zu Wort. Ich versuchte, so viel wie möglich davon zu fassen zu kriegen, und setzte so nach und nach seine Lebensgeschichte zusammen.
Ariel und Kay waren als Säuglinge auf die Burg gekommen; der Zauberer Malory hatte sie in seinem Flugzeug hierhergebracht. Ariel gefiel die Vorstellung, dass er einmal geflogen war. Später hatte er nie wieder die Gelegenheit dazu gehabt.
Madame Betelgauze vermutete, der Zauberer habe die beiden Jungen oben auf dem Gletscher im Wrack eines abgestürzten Flugzeugs gefunden, hoch oben im Eis; einmal hatte sie zu Ariel gesagt, er stamme möglicherweise von einem weit entfernten, sterbenden Planeten. Das war eine typische Betelgauze-Geschichte: unwahrscheinlich, aber fesselnd.
Weil niemand die ganze Verantwortung für die beiden Kinder übernehmen wollte, kümmerten sich die Bewohner der Burg abwechselnd um sie. Von Jesse, dem Barden, lernten Ariel und Kay die Sprache, von der Köchin Elise Reinlichkeit und von Madame Betelgauze das Staunen. Von Master Heck lernten sie Güte.
Als Ariel heranwuchs, erwies er sich immer mehr als ruhiger, ausgeglichener Junge, der Wert auf Förmlichkeit legte, und alle waren sich einig, dass er irgendwann den Posten des Hundehüters übernehmen könnte. Kays Weg war ein anderer, und er verlief rasant. Er legte eine so verblüffende kinästhetische Intelligenz an den Tag, dass die Frage nur lautete, ob er der fähigste Bogenschütze und Schwertkämpfer war, der derzeit auf der Burg lebte – oder der jemals auf der Burg gelebt hatte. Hinzu kamen sein fröhliches Gemüt und sein aufrichtiges Bemühen um das Wohl der Menschen in seinem Umfeld. Es gab keinen Zweifel: Kay hatte es verdient, Ritter zu werden, und Burg Sauvage war offenkundig ein Ort, an dem man bekam, was man verdiente.
Ariel kannte nur dieses Dorf und nur die Menschen, die in diesem Tal lebten. Sauvage war für ihn die Welt. Alle anderen Orte, um die sein Denken kreiste, entstammten in gewisser Weise der Fantasie: die Planeten von Madame Betelgauze sowie die kleine, reichhaltige Welt des Stromatolithen.
Er war ein Geschenk des Zauberers. Malory hatte ihn von einem seiner Streifzüge mitgebracht, und als er ihn dem Jungen überreichte, hatte er gesagt: »Dieses Spiel diente einer lange versunkenen Zivilisation als Zeitvertreib. Versuch mal, ob es dir gelingt.«
Der Stromatolith war bei Weitem Ariels wertvollster Besitz, und als er ihn aus seiner Hülle nahm, erkannte ich an seiner Gestalt sofort, worum es sich handelte: eine Handheld-Videospielkonsole, wie die Anth sie geliebt hatten. Altissa hatte eine besessen, und auch all meine anderen Subjekte. Ihre Geräte hatten Bilder in hellen, funkelnden Farben gezeigt, während der Bildschirm des Stromatolithen nur grobkörnige Bilder in verschiedenen Graustufen hervorbrachte. Dennoch gab es im Dorf nicht seinesgleichen. Der Stromatolith zeigte eine bizarre Fantasiewelt, die von sprechenden Tieren bevölkert war, was Ariel als ziemlich naturalistisch empfand. Das Skript des Spiels beinhaltete die Möglichkeit der Errichtung eines Gebäudes namens »de la Sauvage« und dazu einen schier unerschöpflichen Vorrat an Heldenepen und Liebesgeschichten. Der Stromatolith bot alles, was dem Dorf fehlte.
Das Gerät konnte drei Spielverläufe speichern. In jedem von ihnen hatte es Ariels Figur zu einem niederrangigen Gott gebracht, der über starke Zauberkräfte verfügte und die Gabe der Wiederauferstehung besaß. Ariel wusste, dass er eines der Spiele zurücksetzen sollte, um einen neuen Weg einschlagen zu können, doch er war nie in der Lage, zu entscheiden, welchen Helden er opfern sollte. Also kam es nicht dazu.
Ariel war das jüngste Kind im Dorf. Ihn selbst schien das nicht zu stören, auf mich wirkte es jedoch befremdlich. Es gab Paare, von denen einige in der Kirche geheiratet hatten, und andere, die eher lose verbunden waren, aber es gab keine Kinder. Kay, der vierzehn oder fünfzehn war, hatte sich problemlos in die Gruppe der Schildknappen eingefügt, eine ausgelassene Bande, die für Ariel gerade nicht mehr erreichbar war, sowohl was das Alter anging als auch das Temperament. In seiner Altersgruppe war er der Einzige; es gab keine anderen Kinder, weder solche, die hier zur Welt gekommen waren, noch welche von außerhalb.
Ariel arbeitete oft an seiner Karte; das war sein liebster Zeitvertreib. Diese Karte war allerdings nicht aus Papier, denn Papier gab es keines. Doch im Stromatolithen hatte er ein verborgenes Programm entdeckt, mit dem man nach Belieben Landschaften in der Machart des Spiels erschaffen konnte: ein formbares Terrain in 3-D, das einfarbig und nur skizzenhaft dargestellt wurde.
Er vertiefte sich in seine Karte, schob und zog die Elemente der virtuellen Landschaft hin und her, bis sie mit der natürlichen Wirklichkeit übereinstimmte. Die Karte repräsentierte das gesamte Tal, das schmal und langgezogen war und an einem Ende von der Burg beherrscht wurde, hinter der bedrohlich der Schlund eines dichten Waldes klaffte. Dort zeichnete Ariel einen Flaum aus Bäumen.
Am anderen Ende des Tales lag der Gletscher. Einmal war Ariel bis zu dessen Rand hinaufgewandert, war über ein Geröllfeld geklettert und hatte erstaunt festgestellt, dass der Gletscher tatsächlich einen Rand besaß: eine Stelle, an der hier dichter Schnee lag und dort nicht mehr. Er hatte sich sogar auf das Gletscherfeld gewagt, jedoch nur kurz; das Terrain lockte ihn nicht weiter nach oben, gab ihm keine Rätsel auf. Wenn man das überhaupt als Terrain bezeichnen konnte. An dieser Stelle verschwamm seine Karte im voreingestellten Grau.
An der abschmelzenden Unterseite des Gletschers bildete sich der Fluss; Ariel kennzeichnete ihn mit einer Textur, die an sich kräuselndes Wasser erinnerte.
Obwohl sie eher grob ausgeführt war, studierte ich die Karte begierig. Sie verzeichnete etliche Stellen, die weitaus interessanter waren als der Gletscher.
Die Stelle, wo er das gewaltige Skelett eines Bären entdeckt hatte, das restlos abgenagt war und auf dessen breiter Stirn das Moos wuchs.
Die Stelle, wo eine Quelle einen eigenartigen, kühlen Tümpel bildete.
Die Stelle, wo eine Schlange eine Schlangenfestung errichtet hatte, eine ausgeklügelte Kuppel aus Steinen, die größte, die Ariel je gesehen hatte, und deren Inneres voller abgelegter Häute war. (Schlangen hatten gelernt, Festungen zu bauen.)
Mit einem zitternden X war die hoch oben gelegene Stelle markiert, wo Ariel, von seiner geschützten Warte in einer breiten Felsspalte aus, die Burg und das ganze Dorf überblicken konnte. Das war sein Versteck, sein Beobachtungsposten und seine Schatzhöhle.
Eines Nachmittags machte Ariel sich daran, die Karte zu erweitern, indem er den Weg zum Gletscher neu einzeichnete und, was weitaus wichtiger war, die Höhle vermerkte, die er dort entdeckt hatte: Altissas Grab. Der Cursor schlich um die Gletscherzunge herum. Auf dem dicht gepackten Eis platzierte er ein Fragezeichen.
Er bewegte den Cursor hin und her, betrachtete sein Werk, sein Reich. Es schien ihm nichts auszumachen, dass die Karte an den Talausgängen endete und der Rest der Welt in monotonem Grau lag. Das verstand ich nicht. Noch nicht.
Wenn er nicht von Master Heck zum Dienst verpflichtet wurde, streifte er durchs Dorf und durch die Wälder. Den Stromatolithen hatte er immer bei sich. Jetzt ging er zu seinem Versteck, das auf der Karte mit einem X markiert war.
Er stieg an einem der Abhänge einen schmalen Serpentinenpfad hinauf und querte dann den Hang bis zu einem weichen, körnigen Felsen, der aus dem Boden ragte. An dessen Seite ließ er sich auf einen Vorsprung hinabgleiten – ein durchaus waghalsiges Manöver – und folgte diesem, bis er eine breite Felsspalte erreichte. Von dieser Spalte in der Vorderseite des Felsens aus hatte er uneingeschränkte Sicht über das Tal und konnte auf die Türme von Burg Sauvage hinabsehen.
Die Felsspalte war geräumig, mehrere Meter tief. Bei seinem jetzigen Besuch entdeckte Ariel dort ein Spinnennetz und bewunderte den Mut seiner Schöpferin. Das fand ich befremdlich, bis ein Schwarm unterschiedlichster Insekten – Käfer, Fliegen, haarige Raupen – sich auf das Netz stürzte und es kurzerhand zerschnitt. Die Spinne ergriff die Flucht, jämmerlich und beschämt.
Elftausend Jahre, und die Insekten hatten die Tyrannei der Spinnen abgeschüttelt. Eine Revolution, die den anderen in der Geschichte in nichts nachstand.
Die Wochen verstrichen. Der Mond nahm zu und wurde rot.
Der erste Schnee fiel und legte eine dünne Decke über das Tal. Morgen war Heiligenende, das Erntefest, das in der Steinkirche begangen wurde, und damit der Tag, an dem die ausgewählten Schildknappen zu Rittern geschlagen wurden.
Ariel trainierte mit den Hunden auf dem Landeplatz, ließ den Ball über das reifbedeckte Gras schlittern und erfreute sich am Knirschen unter seinen Füßen.
Auf dem Weg am Flussufer kam ihm eine unverwechselbare Gestalt entgegen. Der Zauberer Malory hatte sich warm eingepackt: hohe Stiefel, dicke Handschuhe, eine gefütterte Jacke, deren Kragen er hochgeklappt hatte. Zwar mochte sein Aufzug für diesen Morgen, an dem nur eine leichte Kühle herrschte, übertrieben scheinen, doch Ariel war nicht überrascht, denn der Zauberer klappte den Kragen sogar im Sommer hoch.
Die Art, wie Gesichter sich mir darstellen, ist abstrakt, indirekt. Das ist nicht ungewöhnlich; wenn ihr euer Erinnerungsvermögen auf die Probe stellt, werdet ihr vermutlich – ja sogar wahrscheinlich – feststellen, dass ihr Gesichter nicht wie auf Fotografien oder Gemälden vor euch seht. Vielmehr seht ihr schimmernde Flecken, die für eine Persönlichkeit stehen. Eure Freundin Altissa: Sie ist einfach da. Ihr könnt einen ganzen Roman aus der Mittleren Epoche der Anth lesen und das Gefühl bekommen, dass ihr die Hauptfigur gut kennt, auch wenn ihr nie erfahrt, welche Farbe ihre Augen haben oder welche Form ihr Kinn hat.
Nun, der Zauberer Malory hatte ein Kinn wie ein Filmstar.
Und er trug kein Mal. Sein Gesicht war nicht entstellt. Darin zeigte sich, nicht weniger als in den seltsamen Kräften, die er in seinem Turm heraufbeschwor, seine Sonderstellung.
Neben Malory trottete sein Hund Cabal, der älter und bösartiger war als alle anderen Hunde der Burg. Seine einzige Aufgabe bestand darin, sich im Schatten des Zauberers herumzutreiben. Ariel hatte schon vor langer Zeit den Versuch aufgegeben, mit ihm Freundschaft zu schließen.
Einer der Hunde unter Ariels Aufsicht, Vulcan, lief auf den Zauberer zu, doch Cabal gab ein schroffes Knurren von sich, woraufhin Vulcan winselnd kehrtmachte.
»Ariel de la Sauvage!«, rief der Zauberer. »Heiligenende steht kurz bevor. Morgen wird dein Bruder zum Ritter geschlagen.«
Außer Malory nannte niemand ihn Ariel de la Sauvage, und Ariel wusste nicht, konnte einfach nicht erkennen, ob sich der Zauberer damit über ihn lustig machte oder nicht.
»Vielleicht ist das erst der Anfang eines großen Aufstiegs«, fuhr Malory fort. »Vielleicht wird Kay eines Tages König.«
»Das bezweifle ich«, erwiderte Ariel, weil ihm das als die angemessene Antwort gegenüber einem Herrscher erschien, obwohl Kay seiner Ansicht nach ein besserer König gewesen wäre als jeder andere Ritter. Auch besser als Malory? Schwer zu sagen. Der Einfluss des Zauberers auf das Dorf war eher atmosphärischer Natur, eher wie der des Wetters als der eines Regenten. »Aber«, fügte Ariel hinzu, »ich bin stolz auf meinen Bruder.«
Der Zauberer kam näher. Cabal fixierte Ariel; sein Blick war gelangweilt und boshaft.
»Es verspricht ein festliches Ereignis zu werden«, sagte Malory. Er schlug die Hände aneinander und atmete stoßweise aus. Sein Atem bildete in der kalten Luft keine Wölkchen. »Wir alle erwarten diesen Tag voll Sehnsucht. Manche von uns schon seit sehr langer Zeit.«
Malory ging weiter. Auf der anderen Seite des Tales wehte eine Bö den Schnee von den Zweigen der Kiefern.
Zurück im Zwinger drehte Ariel das Heizgerät auf und bürstete die Hunde, einen nach dem anderen. Er versorgte Schrammen und kleine Wunden, trug Salbe auf die haarlose Stelle an Vulcans Hinterteil auf und gab ihm zur Ablenkung ein Stück Pilzjerky, damit er die Salbe nicht sofort wieder ableckte.
Master Heck arbeitete an seiner Werkbank.
»Glaubst du, Kay könnte einmal König werden?«, fragte Ariel. Gegenüber Heck äußerte er sich frei heraus. Der Hundehüter nahm ihn ernst und vertraute ihm.
»Kay?«, erwiderte Heck. »Ja, ich glaube, das könnte er. Aber die Frage ist vielmehr, ob er König werden sollte.«
»Besser er als jemand anders, würde ich meinen«, sagte Ariel.
Der Hundehüter schnaubte. »Ich habe dich noch nie über Politik reden hören.«
Eigentlich ging es Ariel nur um Kay und dessen Zukunft, die unmittelbar bevorzustehen schien.
Als er später an der Steinkirche vorüberschlenderte, blieb er stehen. Dort würde sein Bruder in den Ritterstand erhoben werden. In der Mitte des Kirchhofs lag ein Stein, auf dem Stein stand ein Amboss, und in dem Amboss steckte ein Schwert.
Wie bei einer Partie am Wirtshaustisch wurde die entscheidende Karte als letzte aufgedeckt und ließ die innere Logik eines seltsamen Blattes erkennen.
Ein Waisenkind, eine Burg, liebevolle Pflegeeltern. Ein tugendhafter Bruder namens Kay, ein Stein mit einem Schwert. Ich kannte diese Geschichte aus dem Erzählungsschatz der Anth. Hier hatte sie eine andere Form angenommen, war verdichtet und verändert worden, wie es seit jeher geschehen war.
Aber ich kannte diese Geschichte.
Im Bruchteil einer Sekunde wurde die Vorstellung, die ich mir von Sauvage gemacht hatte, über den Haufen geworfen. Was ein Überrest der Menschheit hätte sein können, der das Beste aus seiner Lage machte, erschien nun wie ein grausames Spiel. Im Zentrum stand Ariel, der eigentliche Prinz, der das Schwert herausziehen würde. Jeder Zweifel war ausgeschlossen. Das Dorf war nur noch eine gemalte Kulisse. Ein Provisorium, und zwar ein fehlerhaftes: Die funktionelle Kleidung war befremdlich, der Zauberer und sein Flugzeug noch viel mehr, aber das Schwert im Kirchhof, der Stein mit seiner Schwerkraft … wie ein Brennglas hielten sie alles zusammen.
Ariel lebte inmitten einer beeindruckend designten Szenerie, und wenn ich auch noch nicht wusste, wer sie entworfen hatte, hatte ich doch eine Vermutung.
Heiligenende
1. November 13777
Die ganze Nacht hindurch schneite es. Am Morgen war Sauvage nicht wiederzuerkennen, alle Geräusche waren gedämpft, keine Spuren zu sehen. In der Luft lag eine Ahnung von Heiligkeit, als hätte die Priesterin in ihrer Kirche sie eigens für diesen Tag heraufbeschworen, an dem die Schildknappen in den Ritterstand erhoben werden sollten.
Ariel traf seinen Bruder in der Küche der Burg an, wo er der Köchin Elise schöntat, um ihr ein Stück Gebäck abzuluchsen. Er teilte seine Beute – an der Butter hatte Elise nicht gespart – mit seinem Bruder, und die beiden setzten sich, jeder mit einer Hälfte, vor den glühenden Herd.
»Bist du aufgeregt?«, fragte Ariel.
»Nein. Warum sollte ich aufgeregt sein? Ein leichter Schlag auf die Schulter und ein Gebet. Nichts wird sich dadurch ändern.«
»Du wirst ein Ritter sein und bestimmte Vorrechte haben …« Das bedeutete vor allem, dass Kay Anspruch auf den Thron erheben konnte; oder den Anspruch eines anderen zurückweisen und sich widerwillig selbst anbieten … um dann zu schwanken, ohne zu einem Ende zu kommen … So vertrieben sich die Ritter die Zeit.
»Ich werde nichts anders machen«, beharrte Kay. »Ich bin glücklich mit meinem Leben.«
»Ich werde dich Sir Kay nennen«, sagte Ariel. »Mein erlauchter Lehnsherr.«
»Wirklich? Ich glaube, du wirst mich behandeln wie bis jetzt auch«, entgegnete Kay. »Mir ins Gesicht furzen.«
»Das würde ich niemals wagen. Denn dann würdest du mich mit deinem Schwert in Scheiben schneiden.« Dann furzte er, und beide lachten.
Kay wurde still. »Heute werde ich noch kein Schwert bekommen.«
Ariel sprang auf. »Warum denn? Was ist passiert?«
Monatelang hatten die Brüder kein anderes Thema gekannt. In der Werkstatt des Schmieds hatten sie über Griffen und Knäufen gebrütet, bis Kay sich schließlich für eine knollige Ausführung entschieden hatte, die an eine Eichel erinnerte. Sobald das Schwert abgekühlt war, war er damit zu Ariel geeilt, und in dem Raum neben dem Zwinger hatten sie es aus seinem Futteral geholt und voll Ehrfurcht betrachtet.
Jetzt verfinsterte sich Kays Miene. »Es ist verschwunden. Ich muss es verlegt haben, anders kann ich mir das nicht erklären.«
»Das kann nicht sein!«, rief Ariel. Er meinte das ganz ernst. Sein Bruder war ein Musterbeispiel an Sorgfalt. Er hätte nicht einmal ein Stück Gebäck verlegt, geschweige denn ein Schwert. »Vielleicht spielen dir Gal oder Percy einen Streich.«
»Das glaube ich nicht. Sonst hätten sie sich nicht die Finger abgefroren, um mir bei der Suche zu helfen. Wir sind im Morgengrauen rausgegangen und haben überall herumgestöbert …« Er seufzte. »Also werde ich mein Schwert nicht tragen und es erst wiederbekommen, wenn der Schnee schmilzt. Percy meint, dann bin ich der Ritter des Frühlings.« Kay lächelte zuversichtlich, wirkte aber nicht überzeugt. »Das wird eine gute Geschichte.«
Niedergeschlagen schwiegen die Brüder eine Weile.
Dann raffte Kay sich auf. »Ich treffe jetzt Gal und Percy. Wir müssen heilige Gewänder anziehen und den ganzen Tag singen. Wir sehen uns dann bei der Zeremonie. Und lach nicht zu laut.«
Während sich sein Bruder davonmachte, blieb Ariel zurück, sein Inneres und das Gesicht ganz verspannt vor Enttäuschung. Er liebte das Schwert fast so sehr wie Kay; und er liebte die Vorstellung von der Einheit, die Kay und das Schwert bilden würden.
Er sprang auf und verkündete melodramatisch, an niemand Bestimmten gerichtet: »Mein Bruder Kay soll am heutigen Tag nicht ohne Schwert bleiben!«
Vielleicht verkündete er es auch mir.
Ja, ich kannte diese Geschichte. Sein Name war Ariel de la Sauvage, aber nun war ich mir ganz sicher, wer er wirklich war.
Weil er wusste, dass die Zeit knapp war, rannte er aus der Burg. In den Straßen schaufelten die Dorfbewohner den Schnee zur Seite.
Vor ihm der Kirchhof, dort der wuchtige Stein, auf dem Stein der Amboss, in dem Amboss das Schwert. Wie gut ich diese Geschichte kannte! Die Worte, die in das Schwert graviert waren, lauteten –
Der Junge lief am Kirchhof vorbei. Würdigte ihn keines Blickes. Dieses Schwert steckte fest im Amboss;