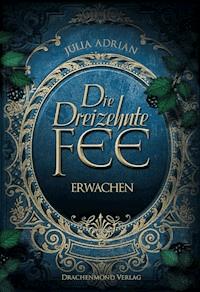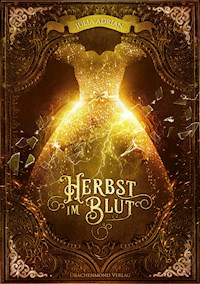Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Drachenmond Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Ich denke darüber nach, meine Schwester zu töten. Ein gespanntes Nylonseil an der Treppe. Eine gelockerte Schindel. Es gibt so viele Arten, den Halt zu verlieren und gleichsam das Leben. Jenna und Scarlett sind Schwestern – und Feinde bis aufs Blut. Zwischen ihnen entbrennt ein Kampf um Macht und die Wahrheit. Was geschah wirklich, damals vor zehn Jahren, als ihre Mutter am helllichten Tag und ohne eine Spur verschwand? Jenna kämpft gegen das Vergessen und das Schweigen in ihrem eigenen Haus. Doch wenn sie sich selbst schon nicht trauen kann, wem dann?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 315
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Tagebuch der Jenna Blue
Julia Adrian
Copyright © 2021 by
Lektorat: Stephan Bellem
Korrektorat: Michaela Retetzki
Layout: Stephan Bellem
Charakterillustrationen, Schmetterling, Pusteblume und Briefe: Julia Adrian
Pflanzenillustrationen: Katharina V. Haderer
Umschlagdesign: Alexander Kopainski
Bildmaterial: Shutterstock
ISBN 978-3-95991-306-5
Alle Rechte vorbehalten
Für meine Herzdrachen
Kintsugi*
Dank euch weiß ich:
Jeder Bruch ist eine Chance auf einen Neubeginn.
Dieses Tagebuch gehört:
Scarlett
Jenna
Vergissmeinnicht
Jenna,
Bevor du dieses Buch beiseitelegst, ohne es eines Blickes zu würdigen – denn ich weiß, das ist dein erster Impuls –, gib mir die Chance, dir zu erklären, inwiefern es dir helfen kann. Ich selbst habe nie Tagebuch geführt; ich lese, und das mit großer Freude, doch meine Gedanken in Worte zu fassen erschien mir stets zu heikel, obendrein fehlt es mir an Talent. Dir jedoch, da bin ich sicher, wird es leichtfallen. Du bist wie deine Mama. Auch sie schwieg bis zu ihrem Verschwinden; allein Briefen vertraute sie sich an. Briefe, die keiner von uns je zu Gesicht bekam. Ich weiß nicht, wem oder worüber sie schrieb. Sie verbrannte einen jeden, nachdem sie ihn sorgsam versiegelt hatte. Sie sagte, der Wind würde die Worte zur rechten Person tragen.
Du bist wie sie.
Du leidest still.
Du trägst deinen Kummer und deine Worte unausgesprochen mit dir. Du musst sie nicht mit der Welt teilen, doch sie niederzuschreiben kann ihre Last verringern. Versuche es. Lass deine Hände für dich sprechen und deine Gedanken in dieses Buch fließen. Es wird sie für dich verwahren, egal wie düster sie auch sein mögen. Vielleicht werden dadurch die Nächte – und ihr Verlust – ein bisschen erträglicher.
In Liebe, deine Schwester Anna
Ich hasse dich!
Ist es das, was du hören willst? Soll ich darüber schreiben, wie sehr ich euch verachte? Euch beneide? Euch anschreien möchte und es doch nicht tue? Du sagst, in mir seien Worte – du hast ja keine Ahnung!
In mir ist vor allem Leere.
Ich bin leer, Anna.
Ich bin so leer, dass es wehtut.
Der Ball hat sein Ziel getroffen. Das Blut rinnt mir aus der Nase in den Mund, ich spucke es aus.
Kopf in den Nacken? Oder nach vorn?
Ich weiß nicht mehr, was richtig ist, stehe bloß da, während das Blut in Spiralen gen Abfluss rinnt. Blut, das genauso gut ihres sein könnte. Es gibt niemanden auf der Welt, der mir so sehr gleicht, wie sie es tut. Von der DNS bis zum Spiegelbild. Ist Blut dicker als Wasser?
»Brauchst du Hilfe?« Maria zwängt sich durch den Türspalt der Mädchentoilette, ein Koloss in zu engen Leggins und zertanzten Schuhen. Wäre das hier ein Märchen, käme ihr die Rolle des Rotkäppchens zu, das dem Wolf freimütig in die dunkelsten Gefilde folgt – selbst ins Schulklo.
»Ist Blut dicker als Wasser?«, frage ich sie.
»Ich versteh kein Wort. Ist die Nase gebrochen?«
Hoffentlich nicht.
»Kopf nach vorn«, sagt sie und reißt einen Batzen Papiertücher aus dem Spender. »Dein Glück, dass die Schule zu geizig für eine Handtuchrolle ist.« Sie dreht den Hahn auf, tränkt das Papier und klatscht den nassen Klumpen in meinen Nacken. »Das sollte helfen.«
Es geht nicht um mich.
Wenn sie so lächelt, könnte ich das fast vergessen. Sie sieht bloß Scarletts ältere Schwester in mir. Selbst ich tue das. Alle tun das. Obwohl der Spiegel gesprungen ist – oder gerade deswegen? –, blickt sie mir überdeutlich entgegen. Das spitze Kinn, die scharf geschnittenen Lippen, zuletzt die Verachtung im Blick. Als hätte Mutter unsere Züge mit dem Meißel geschlagen. Scarlett und ich sind Schwestern, wir entspringen demselben Schoß, doch das heißt nicht, dass wir einander lieben.
Maria kippt das Fenster. Flirrendes Licht fällt hinein, schillert auf den Pfützen und benetzt die stahlgrauen Fliesen, auf denen Generationen von Schülern Hass- und Liebesbotschaften notierten. Scarlett, Scarlett, Scarlett. Sie inspiziert die leeren Kabinen, die Nase gerümpft in Erwartung von Ungeziefer, Ratten oder Monstern. Stattdessen bin da nur ich, das triefende Gesicht übers Waschbecken gebeugt, die Haare klitschnass. Der Hahn tropft. Warum ich sie noch an meiner Seite dulde, weiß ich selbst nicht genau. Sie erwartet keine Zuneigung, keine Antworten. Nur Infos über Scarlett.
»Fertig?«, fragt sie.
Ein letzter Blick gen Spiegel – es ist, als würde Scarlett zwinkern. Doch das bin nur ich, totenbleich und ohnmächtig vor Zorn.
Es heißt, ältere Geschwister würden Schatten werfen, denen die jüngeren nicht entkommen können. Bei uns ist es andersherum. Es ist Scarletts Existenz, die der meinen ihre Farben raubt. Es ist ihr Licht, das alles andere überstrahlt. Seit es sie gibt, verblasse ich neben ihr – wie die Schlieren im Becken.
Ist Blut dicker als Wasser? Ich sage Nein.
Ich habe gefragt, worüber ich schreiben soll, und du hast gesagt, es sei vollkommen egal; ich könne alles schreiben, eine Geschichte, ein Märchen. Irgendetwas.
Aber wo fange ich an?
Bei uns? Bei Mutter?
Oder damit, dass sie ging?
Ich könnte erzählen, dass ich an guten Tagen in die Stadt fahre, das Rad am Bahnhof abstelle und ziellos durch die Straßen streife, in der stillen Hoffnung, auf sie zu treffen. In einem der Läden. Beim Bäcker, im Café oder dem Buchladen. Manchmal stehe ich minutenlang vor einem Schaufenster und warte, dass sich eine bestimmte Person umdreht, wünschend und fürchtend zugleich, dass sie es ist. Ich wüsste nicht, was ich täte, stünde sie plötzlich vor mir. Was sagt man zu jemandem, der einen verlassen hat? Sagt man Hallo? Oder schlägt man zu?
»Was schreibst du?«
Maria linst über meine Schulter. Das Buch schnappt vor ihrer Nase zu. Beleidigt richtet sie ihre Aufmerksamkeit auf Scarlett. Die sitzt in der ersten Reihe; ihr Stuhl kippt, als sie sich zu ihrem Freund neigt. Wagt sie sich bewusst weit hinüber? Genießt sie den Kitzel des möglichen Sturzes? Spürt sie, dass nicht nur Marias Blick, sondern der aller auf ihrem Rücken ruht und von dort zu den Beinen des Stuhls und ihren wandert? Ich behaupte, dass es so ist. Dass jede ihrer Bewegungen auf eine Wirkung abzielt. Dieses Klassenzimmer ist ihre Bühne und wir sind ihr Publikum.
Zu gern würde ich aufstehen, nach vorn gehen und ihr den Stuhl wegtreten. Zack, läge sie da. Auf dem Rücken. Die Augen weit, das Haar scharlachrot. Zu gern täte ich es.
Doch ich bleibe, wo ich bin.
Scarletts Stuhl kippt zurück. Sie erhebt sich. Selbst das ist inszeniert, der Hüftschwung zu ausladend, die Dehnung des Oberkörpers zu gewollt. Jeder kann ihre Brüste sehen. Rund und fest zeichnen sie sich unter dem dünnen Baumwollstoff ab. Sie trägt keinen BH, sie behauptet, er enge sie ein. Sie nennt es feministisch, dabei bin ich mir sicher, dass sie es einzig und allein deswegen tut, weil es ihr Gegenüber irritiert. Sie hat gern die Kontrolle – und jemand, der ständig auf ihren Busen schielt, ist ihr per se unterlegen.
»Aufgepasst«, ruft sie, dabei ist ihr jegliche Aufmerksamkeit gewiss. »Die Party beginnt um acht. Ihr seid alle willkommen! Bringt mit, was ihr tragen könnt.«
Natürlich meint sie Alkohol – und natürlich lädt sie weder mich noch zu uns nach Hause ein. Die Party findet wie üblich im Bootshaus statt, nur dass diesmal alle willkommen sind. Wirklich alle? Ich erwarte Protest. Von irgendjemandem. Doch was folgt, ist tosender Applaus. Maria hat es längst vom Stuhl gerissen.
»Hast du gehört, Jenna? Eine Party im Bootshaus! Wie abgefahren ist das denn?«
»Abgefahren«, echoe ich dumpf – da trifft mich Scarletts Blick. Instinktiv sehe ich über die Schulter, doch da ist niemand. Ihr Lächeln wirkt anders, als ich zurückblicke, irgendwie fragil; ein Wort, das so gar nicht zu ihr passen will.
Man könnte meinen, wir wären uns ähnlich, immerhin wurden wir beide verlassen. Doch obwohl in uns dieselbe Wunde schwärt, gehen wir unterschiedlich damit um. Wir sind Schwestern, die tief fielen, doch während eine auf Gold stieß, fand die andere nur Pech.
Scarlett ist erblüht, ich bin verstummt.
Als es klingelt, kennt Marias Euphorie keine Grenzen mehr. Sie schwebt auf Wolke sieben den Flur entlang, mit mir als drohendem Gewitter im Schlepptau.
»Ich brauche das Kleid, Jenna! Es passt perfekt zu den Chucks, für die ich so lange gespart habe.«
Seltsamerweise überlagert sich die Erinnerung an das Kleid mit der an die Reißzwecke, in die ich heute Morgen getreten bin. Es ist ein dumpfes, irgendwie drückendes Gefühl.
»Das wird die beste Party aller Zeiten!«, schwärmt Maria.
»Auf der letzten Party ist jemand ertrunken«, werfe ich ein. »Wird schwer zu toppen.«
»Fast ertrunken«, korrigiert sie fröhlich. »Die Neue wäre nicht gestürzt, hätte sie besser aufgepasst. Ich meine, wir wohnen am Meer! Da sollte man schon wissen, wo es beginnt, zumal das Bootshaus naturgemäß am Kai steht. Wenn du mich fragst, war es ihre eigene Schuld. Lässt sich herausfischen und beschwert sich dabei auch noch, jemand habe sie geschubst! Also bitte!«
»Danach«, sage ich.
Das bringt Maria aus dem Takt. »Wonach?«
»Nach der Reanimation. Sie hat sich danach beschwert.«
Nicht dass einer von uns beiden dabei gewesen wäre, als die Neue ins nachtschwarze Hafenbecken stürzte und – sollte man den Gerüchten glauben – nur knapp dem Tod entronnen ist. Nein, die Partys sind einzig einer bestimmten Klientel vorenthalten und besitzen wahren Kultstatus, wie Maria nicht müde wird zu betonen. Die Vorstellung, dass auf dieser ihr so heiligen Veranstaltung ein Mensch beinahe sein Leben verlor, ist für sie so absurd, dass sie es kurzerhand beiseitewischt. »Wie auch immer … Hast du gefragt?«
»Habe ich was?«
Beleidigt hebt sie die Brauen. »Das Kleid, Jenna!«
Ah, das. »Nein.«
»Aber du wolltest sie fragen!«
Wollte ich nicht. Aber das hat Maria schlicht überhört.
Ich zeige zu den Fahrradständern. »Da ist sie. Frag selbst.«
Tatsächlich sehe ich sie gar nicht, dafür ist zu viel los. Doch wenn sich der Fluss staut, ist Scarlett für gewöhnlich der Damm, der alles zum Erliegen bringt. Ihr Name ziert zahllose Tische, die Wände der Toiletten und ist in scharlachroten, beinahe verzweifelt um Aufmerksamkeit heischenden Lettern an die Turnhalle gesprüht.
SCARLETT. Eine Offenbarung.
»Spinnst du?« Maria lacht eine Spur zu hoch. »Sie weiß nicht einmal, dass ich existiere, geschweige denn, dass ich deine Freundin bin.«
»Tja.«
»Tja?«, wiederholt sie gekränkt.
Innerlich stöhnend unterdrücke ich den Wunsch, Maria einfach stehen zu lassen. Im Gegensatz zu meiner Schwester besitze ich bloß diese eine Freundin, auch wenn ihr Interesse einzig und allein Scarlett, Scarlett, Scarlett gilt.
»Kannst du sie nicht fragen?«, fleht Maria und das Stöhnen, das ich so wunderbar unter Kontrolle hatte, droht mich zu überwältigen. Ich bezwinge es mit einem Lächeln; es fühlt sich an, als würde ich die Zähne fletschen, und offensichtlich sieht es auch so aus, denn Maria rudert zurück. »Du könntest mich auch mit zu dir nehmen –«
»Nein«, sage ich.
»Wieso nicht?«, jammert sie.
Diesmal lasse ich sie stehen. Sie ruft mir etwas hinterher, doch ich ignoriere es. Sie kennt die Antwort. Ich nehme sie nicht mit zu mir. Selbst Scarlett bringt keine Freunde heim. Unser Hof ist tabu. Scarlett schämt sich zu sehr, mir hingegen ist er heilig.
»Hallo, Schwesterherz.«
Wenn man vom Teufel spricht.
Scarlett lächelt.
Ist das wirklich sie? Oder mein Spiegelbild?
Wir sprechen für gewöhnlich nicht miteinander. Weder in der Schule noch auf dem Weg dorthin, und erst recht nicht vor ihren Freunden, von denen einer ihr Rad hält.
»Hast du es eilig?«, fragt sie und legt doch tatsächlich eine Hand auf meinen Lenker. »Das trifft sich gut, ich will auch los.« Als wäre es das Normalste der Welt, sich mit mir zu unterhalten oder gar gemeinsam heimzuradeln. Dabei kommt das der Entdeckung einer außerirdischen Spezies gleich. Es ist absolut unglaublich. Oder eher: unwahrscheinlich.
Ich wittere einen Hinterhalt.
»Was willst du?«, fahre ich sie an, kaum dass wir außer Hörweite sind. »Und hör auf, so dämlich zu grinsen.«
»Deine Laune stinkt ja zum Himmel!«
»Lass das Geplänkel.«
Sie zieht die Brauen zusammen. »Ich weiß, dass unsere Beziehung recht unterkühlt ist« – die Untertreibung des Jahrhunderts – »doch ich bezweifle wirklich, dass ich so tiefe Abneigung verdient habe.«
Hass trifft es eher, denke ich; oder sage ich es laut?
»Komm zum Punkt«, verlange ich.
»Wie du willst.« Die Weichheit fällt von ihr wie das Laub von den Bäumen. Das ist Scarlett, die echte Scarlett. Kühl und überlegen. »Ich möchte, dass du zur Party gehst.«
Ich blinzele irritiert. »Heute Abend?«
Sie wirft mir einen Seitenblick zu. »Bist du zu anderen eingeladen, von denen ich nichts weiß?«
»Ach was, die Einladung galt auch mir?«
Scarletts Lächeln bekommt etwas Wölfisches. »Natürlich.«
Ich frage mich, wann ich den Pelz verlor und das Cape überstreifte. Jetzt trägt Scarlett die Wolfshaut und ich bin ihr unterlegen – wie Maria vorhin mir. Meine Hände sind schweißkalt, der Lenker droht mir zu entgleiten.
»Also, begleitest du mich?«
»Begleiten?«, echoe ich ungläubig.
»Nun, wir haben den gleichen Weg.«
Sie lässt den Satz verklingen. Vielleicht ist ihr selbst aufgegangen, dass wir tagtäglich den gleichen Weg nutzen, doch niemals zusammen radeln. Alles an ihrer Bitte ist falsch. Ich soll sie begleiten? Dass ich nicht lache!
»Wie geht es deiner Nase?«, fragt Scarlett da und betrachtet mich von der Seite. Ich zwinge den Blick nach vorn. Keine Schwäche zeigen, nicht einen Zentimeter breit. »Das war wirklich ein unglückseliger Wurf. Mitten ins Gesicht. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt so viel Blut gesehen habe.«
Ich hasse sie.
Ich hasse sie.
Ich hasse …
»Derek hätte besser aufpassen müssen. Keine Sorge, das wird ihm so schnell nicht wieder passieren.«
»Ach nein?«, zwinge ich hervor.
»Nein.« Sie klingt fast bedauernd. »Wir sind Schwestern und ich sorge für dich. Auf meine Weise.«
Ich schnaube. Sie seufzt.
»Weißt du, Jenna, wir müssen nicht so sein. Zueinander, meine ich. Wir könnten –«
»Was? So tun, als wäre nichts geschehen?«
»Warum nicht?« Diesmal sehe ich sie an. Ihr Blick wirkt erneut fragil. Ist es nun das Laub oder der Wolfspelz, den sie trägt? Ich traue ihr nicht. Geschweige denn mir selbst.
»Komm zur Party. Begleite mich. Wie früher.«
Früher. Bevor unsere Familie entzweibrach. In ein Davor und ein Danach. Als Mutter noch da war und dann nicht mehr.
Mit ihr verloren wir uns selbst.
»Es gibt kein Zurück.« Ich bleibe stur.
»Nein«, sagt sie und lächelt sanft. »Aber ein Weiter.«
Wenn ich über uns nachdenke, frage ich mich oft, ob wir selbst es sind oder das Dorf, das an ein Märchen denken lässt. Wie in den alten Geschichten kennt es weder eine bestimmte Zeit noch eine bestimmte Lage. Zu klein, zu weit ab von den Wegen, zu einsam gelegen am Rande der Nordsee. Es könnte auch jedes andere Meer oder gar ein See sein, an dessen Ufern diese Geschichte ihren Anfang nahm. Bootshaus und Schule sind lediglich Nebenschauplätze, die so oder auch anders sein könnten. Einzig der Resthof, die Spukvilla und der toxische Garten dazwischen sind elementar.
Ist es nun der Ort, der über uns bestimmt?
Oder führen wir selbst Regie?
Du würdest sagen, das Übel sprießt aus dem Boden.
Ich sage, wir tragen es in uns.
Doch ich greife voraus.
Noch sind wir nicht so weit.
Noch nicht.
Die Straße wird schlechter, schweigend weichen wir den kraterartigen Schlaglöchern aus, die seit Jahren nicht ausgebessert wurden. Ich kenne ein jedes auswendig, seine Form und Tiefe und das Gefühl derer, durch die ich trotzig zu fahren pflege, in der stillen Hoffnung, es möge mich niederreißen, und triumphierend, sobald ich sie bezwungen habe. Scarlett beobachtet mich mit einer Mischung aus Mitleid und Überlegenheit. Sie meidet die Risse im Beton, während ich so viele zu passieren versuche wie möglich. Ist es Spieltrieb, der mich dazu anhält? Oder ein masochistischer, selbstzerstörerischer Drang?
»Du solltest mehr lachen«, stellt Scarlett fest. »Was nützt das tiefste Loch, solang es keine Freude bringt?«
»Was verstehst du schon davon.«
»Ich weiß beispielsweise, wieso du glaubst, mich hassen zu müssen.« Sie spricht mit einer Ruhe, für die allein ich sie vom Rad stoßen könnte. »Ich komme damit klar und du nicht. Ich verfüge über Resilienz und lebe weiter, während du dich aufgibst. Mir das zum Vorwurf zu machen halte ich für fragwürdig, wenn nicht gar für unfair. Ich vermisse sie genauso, allerdings –«
Da unterbreche ich sie: »Halt die Klappe!«
»Jenna, ich …«
»Lass es!«
»Findest du nicht, wir sollten …«
Ich trete in die Pedale, Scarlett bleibt zurück.
Ich drossele das Tempo erst, als sich das Mauermassiv am Straßenrand erhebt. Scarlett ist überzeugt, dass unser Dorf schon vor Mutters Verschwinden verflucht war. Es ist auf keiner Karte vermerkt, nicht einmal bei Google Maps, als sei es schlicht vergessen worden, gestrichen aus dem Gedächtnis der Welt. Ein Ort des Nirgendwo, dessen einzige Besonderheit das Spukhaus ist.
Vermooster Klinker, ein Tor aus rostigem Eisen und dahinter der geschwungene Kiesweg. Er ist gesäumt von dichten Spindelsträuchern und uraltem Silberregen, durch den der Wind träge streicht. Mehr ist von der Straße nicht zu erkennen. Innerhalb der Sphäre unseres Dorfes spinnen sich unzählige Legenden um das Spukhaus und seinen Besitzer.
Dass jeder, der das Grundstück betritt, dem Tode geweiht ist, hält sich hartnäckig als Gerücht. Ich kann es weder bestätigen noch Lüge strafen, obwohl ich direkt daneben wohne und manch wagemutigem Dorfkind beim Erklimmen der Mauer zusah. Die meisten scheiterten bereits beim Aufstieg, ob aus Furcht oder aufgrund der Höhe, ist ungewiss. Einige schafften es auf die Krone, doch von denen sah ich niemals einen auf der anderen Seite verschwinden. Es galt bereits als höchster Beweis des eigenen Mutes, dort oben zu sitzen und die Beine über dem Ginster baumeln zu lassen.
Scarlett behauptet, einst durch einen Spalt in den Nachbarsgarten geschlüpft zu sein, sie verbot mir jedoch, darüber zu sprechen, und ich, damals noch ihre engste Vertraute, habe bis heute geschwiegen.
Nun, Scarlett lebt noch. Bedauerlicherweise.
»Wartest du auf mich?«, fragt sie und hält neben mir an.
»Warst du im Garten der Spukvilla?«
Sie hebt eine Braue. »Das interessiert dich? Nun, ich verrate es dir, wenn du mich begleitest.«
»Mich interessiert einzig, ob du bald stirbst.«
Sie gluckst. Dabei meine ich es todernst.
»Hör zu«, Scarletts Augen blitzen vergnügt, »ich verrate dir alles, was du über den geheimen Garten wissen willst. Ich zeige dir sogar den Spalt – falls es ihn gibt –, solang du mich begleitest.«
Verschwörerisch zwinkert sie, als wäre das alles ein Heidenspaß. Gott, ich hasse sie wirklich dafür, dass es ihr leichtfällt. Dass sie lacht und tanzt und lebt, als läge unsere Welt nicht in Trümmern.
»Abgemacht?«, fragt sie und streckt mir die Hand entgegen. Ich kann aus Prinzip nicht annehmen. Scarlett bekommt immer, was sie will – nur bin das aus irgendeinem unverständlichen Grund diesmal ich.
»Warum?«, frage ich.
»Das war kein Nein«, stellt sie zufrieden fest, kreuzt die Arme über dem Lenker und stützt den Kopf darauf. So sieht sie mich an, schräg von unten, die Augen zu wach für die scheinbare Gelassenheit. »Du glaubst doch an Zeichen, nicht wahr? Betrachte es als eines. Wir sollen gemeinsam zu dieser Party gehen. Du und ich. Wie …«
Das Früher verschluckt sie gerade noch rechtzeitig, als würde sie ahnen, dass ich es kein zweites Mal ertrage, daran zu denken. An früher. An uns und wie wir einst waren.
»Nein«, sage ich schwerfällig. »Ich komme nicht mit.«
Sie zuckt mit den Achseln, schwingt das Bein übers Rad, schiebt es die letzten Meter bis zum Hof und wirft es achtlos ins Gras. Ihr Pferdeschwanz wippt, als sie die brüchigen Stufen zu unserer Haustür erklimmt und die fehlende überspringt. Die Türklinke fällt scheppernd zu Boden. Ich höre Scarlett fluchen und das Metall knirschen, als sie den Stift zurück an seinen Platz schiebt.
Es sind Momente wie diese, in denen ich ihre Scham teile. Unser Resthof gleicht einer Ruine. Die Farbe blättert von den Wänden wie die Rinde von jungen Birken, dem Dach fehlen Schindeln, eine Außenwand sackt gefährlich gen Erde. Sie wird einzig durch zwei Balken gehalten, die ich letzten Herbst anbrachte. Der Zerfall ist nicht aufzuhalten. Ich kann ihn verzögern, hier und dort eine Wunde versorgen, die über kurz oder lang aufbrechen wird. Wie die Wand.
Ob Vater aus seiner Starre erwachen und etwas tun würde, sollte sie einstürzen? Manchmal bin ich versucht, es herauszufinden, indem ich einen Balken entferne – und lasse es dann doch, zu groß ist die Angst, dass er es nicht täte.
Ich schiebe den Schmerz beiseite und die Räder in den Stall. Scarlett ist es gewohnt, dass andere ihr vorauseilen oder hinterherräumen, und da es abgesehen von mir niemanden gibt, der sich daran stört, ignoriere ich es. Wähle deine Kämpfe. Das Motto, nach dem ich lebe. Ein Streit mit Scarlett zählt zu den Dingen, die ich meide wie der Teufel das Weihwasser.
Du hast mich gefragt, ob mir das Schreiben gefällt. Ich konnte nicht zugeben, dass es so ist. Scarlett saß neben dir. Es war die Art, wie sie mein Tagebuch ansah.
Als witterte sie eine Schwäche.
Ich hasse sie dafür.
Ich hasse auch dich, weil du es nicht bemerkst.
Sie fragte, ob sie eines haben könne, und du hast versprochen, ein zweites zu kaufen. ›Fein‹, hat sie gesagt und gelacht und mich mit diesem Blick bedacht, der so vieles verspricht. So viel böses Blut zwischen uns.
Ich traue ihr nicht.
Wieso tust du es?
Papa sitzt in seinem Arbeitszimmer, neben ihm auf dem Tisch stapeln sich die Zeitungen der letzten Wochen, darauf Dutzende schwarze Ringe: Zeugen seiner Kaffeesucht. Er blättert in einem Buch und blickt erst auf, als ich meinen Rucksack in einem Anfall von Trotz in die Ecke zwischen die Zeitschriftenstapel schmetterte. Die Dielen ächzen, als sich Papa aus dem Sessel hievt, in dem er vermutlich den ganzen Morgen saß. Manchmal fürchte ich, er kommt nur uns zuliebe aus ihm heraus. Für einen kurzen Moment, einen Kuss, eine Umarmung. Weil er die Scham nicht erträgt, die in unseren Blicken wächst. Was aus ihm werden soll, wenn wir erst fort sind, wage ich mir kaum auszumalen.
Unbeholfen drückt er Scarlett einen Kuss auf den Scheitel. Sie verzieht den Mund und taucht unter seinem Arm hinweg in die Küche. Anna steht am Herd und lächelt, als Scarlett von hinten die Arme um sie schlingt.
»Was gibt es?« Sie ignoriert unseren Vater.
Er nimmt es kommentarlos hin und zwinkert mir zu, ehe er zurück in sein Zimmer schlurft und im verblichenen Blümchenpolster seines Sessels versinkt. Ich beobachte von der Tür aus, wie er den Umschlag des Buches anstarrt, das er vorgab zu lesen. Früher einmal verbrachte er jeden Nachmittag mit mir in der Werkstatt. Wir flickten Möbel, schliffen und strichen Zäune, planten ein Baumhaus. Heute liegt so dicker Staub auf der Werkbank, als wäre sie seit einem Jahrzehnt ungenutzt – was sie ist.
Zehn Jahre sind vergangen, seit Mutter uns verließ.
Zehn Jahre, die Vater zu einem Wrack haben verkommen lassen. Einem Schatten seiner selbst.
»Jenna?«, fragt er heiser und blickt zu mir auf. Der Wunsch nach Ruhe steht ihm ins Gesicht geschrieben. Er hofft, dass ich gehe, dass ich nicht erneut versuche, ihn aus dem Zimmer und seiner Lethargie zu befreien. Er will nicht. Er will einfach nicht.
»Ich hab dich lieb«, sage ich deshalb.
Er lächelt und kurz glänzen seine Augen wie früher, dann greift er nach einem Buch – einem anderen als zuvor – und klappt es ziellos auf. Fahrig gleitet sein Blick über die Zeilen, von denen ich bezweifle, dass auch nur eine einzige seinen Verstand erreicht. So sitzt er da, zwischen abgegriffenen Büchern und überfüllten Regalen, die sich unter der Last eines Jahrzehnts gefährlich biegen, ein einsamer alternder Mann, der dem Leben abgeschworen hat.
Sorgsam schließe ich die Tür und lehne die Stirn ans Holz. Aus der Küche dringt Scarletts Lachen und Annas Stimme. Sie sprechen über die Party, das Essen, die Ferien. Unverfängliche Themen. Über Papa reden sie nie. Vielleicht fehlen ihnen die Worte. Vielleicht glauben sie, es sei besser, so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Wer lange genug eine Lüge lebt, hält sie irgendwann für die Wahrheit.
Ich fahre mit der Hand über die Blümchentapete unseres Flurs. An den Ecken blättert sie bereits ab, offenbart den grauen Putz darunter. Mutter hat sie ausgesucht. Alles hier trägt ihre Spuren: das Muster von Papas Sessel, die bunten Gemälde, die gestrichenen Stühle des Esszimmers, der Teich in der Badewanne. Ich erinnere mich nur flüchtig und unfreiwillig an sie; hier ein Bild, dort ein Fetzen. Wie sie den ersten Fisch in die Wanne setzte, wo er noch heute zwischen Sumpfgräsern und Lotusblumen golden hervorschimmert. Scarlett auf der Schaukel im Wohnzimmer, Mutter hinter ihr in einem bunten Kleid. Anna im Garten, auf der Wange einen leuchtenden Handabdruck und zu ihren Füßen ein zertretener Wildkräuterstrauß. Ich erinnere mich an Mutters Schreie, nicht jedoch an den Grund des Streits.
Nie wieder! Tu das nie wieder!
Ich umfasse das gedrechselte Treppengeländer. Meine Finger finden eine jede Kerbe blind. Dieses Haus liegt mir im Blut, mit all seinen schimmeligen Ecken und knarrenden Dielen. Es konserviert unsere Erinnerungen wie in Formaldehyd. Das Leben, das wir einst hatten, spiegelt sich in jedem Zentimeter. Die Striche an der Wand im oberen Stockwerk, mit denen wir unsere Größe festhielten.
Anna. Jenna.Scarlett.
Daneben der Elefant, den ich unbeholfen an die Wand malte, als niemand hinsah. Er erinnert mehr an einen Hasen mit zu langer Nase. Ich zeichne die blassen Linien nach, frage mich, ob sie verschwänden, sollte ich sie oft genug nachfahren, und fürchte zugleich, dass es geschieht.
Der Gedanke ist unerträglich.
Genauso der an die Zukunft. Ich bilde mir ein, die Jahre verfliegen zu sehen; mich selbst mit Koffern nach unserem Abschluss, kurz darauf Papa in einem Sarg; ihm folgt Anna, treu bis zum Schluss. Das Haus steht eine Weile leer, der Winter kommt, der Winter geht, ehe Maler all unsere Spuren von den Wänden tilgen, den Elefanten unter weißer Farbe begraben und mit ihm unsere Kindheit.
»Jenna?« Anna steht am Fuß der Treppe. »Kommst du essen?«
»Gleich.« Verstohlen wische ich die Tränen fort. Sie soll nicht sehen, dass ich weine. Sie würde es falsch verstehen, sich womöglich die Schuld geben. Und das will ich nicht.
Wenn es etwas Beständiges in unserem Leben gibt, dann Anna. Die gute Seele des Hauses, die Mutters Aufgaben übernahm, als sie verschwand, und Papas mit dazu, als er sich und uns aufgab. Sie ist meine Halbschwester, ihre Mutter starb, bevor meine in ihr Leben trat. Wir sprechen selten darüber, zu schmerzhaft sind die Erinnerungen, zu sehr unterscheiden sie sich voneinander. Nicht zu Unrecht handeln Märchen von bösen Stiefmüttern.
»Alles in Ordnung?« Erneut Anna, diesmal näher. Sie ist die Treppe hinaufgekommen. Ihre Hand legt sie auf meine Schulter. »Scarlett sagt, du begleitest sie zur Party?«
»Blödsinn.« Meine Stimme klingt schrecklich erstickt.
Anna bemerkt es nicht. »Du solltest mitgehen. Freunde treffen, ein bisschen feiern, Spaß haben.« Uns trennen nur acht Jahre, doch manchmal kommt es mir wie eine ganze Generation vor. Sie streicht mir die Haare aus der Stirn; hat sie die Tränen doch gesehen? »Sie reicht dir eine Hand, Jenna.«
»Es ist bloß eine Party«, protestiere ich.
»Richtig, bloß ein Abend. Was macht das schon?«
Ja, was macht das eigentlich? Ein Abend. Eine Party.
»Vielleicht«, gebe ich nach. Ich tue es allein für Anna.
Veilchenblau
Ich weiß nicht, wann ich Scarlett das erste Mal des Nachts die Stufen hinunter folgte; die Wände sind hellhörig, mein Schlaf ist leicht und im Gegensatz zu mir hat sie nie gelernt, sich lautlos zu bewegen, eins zu werden mit dem Haus und seinen Schatten. Ich hörte sie in der Küche hantieren und später im Wohnzimmer. Die Dielen verrieten ihren Weg; und wie ich so dastand und mit der Dunkelheit verschmolz – beim ersten und bei allen folgenden Malen –, vernahm ich nichts als das Wispern des Windes, der zärtlich ums Gemäuer strich und sich mit Scarletts Atem vereinte. Ihr Seufzen lockte mich wie das Licht die Motte. Das Wohnzimmer, bestehend aus zwei Teilen, betrat ich durch den hinteren Zugang im Flur. Scarlett befand sich im angrenzenden Teil nahe der Küche; ich konnte sie hören – und schließlich auch sehen. Sie saß auf dem Sofa, die Beine angewinkelt, das Nachthemd gelöst. Erst starrte ich nur auf die Rundung ihrer milchweißen Brüste, die im Gegensatz zu meinen so prall waren, dass ich mich unwillkürlich fragte, weshalb wir uns ausgerechnet in diesem Detail unterschieden. Dass sie sich vor das Fenster mitten in das Viereck aus Mondlicht setzte, vermag ich mir nur so zu erklären, als dass auch sie sich gern zusieht und um ihre Schönheit weiß.
Sie zu beobachten, wie sie sich selbst berührt, sie für ihre Unbeschwertheit zu hassen und zugleich um ihre scheinbar grenzenlose Freiheit zu beneiden, lässt mich ihr so nah sein wie nur irgend möglich. Wir teilen ein Geheimnis. Das verleiht mir gewisse Macht über sie. Es macht den Alltag in ihrem Schatten erträglicher. Ich weiß, was sie zur dunkelsten Stunde tut. Ich weiß, wer sie dann ist.
»Ich wusste, dass es dir steht!«
Scarletts Mund lächelt, doch ihre Augen sind so ausdruckslos wie mein Gesicht. Nebeneinander stehen wir vor dem Spiegel, der jede Ballerina vor Neid erblassen ließe. Wie Scarlett es aushält, sich durchgehend selbst zu betrachten – am Schreibtisch, beim Umziehen, im Bett –, ist mir schleierhaft. Ich würde mich beobachtet fühlen.
Vielleicht ist es gerade das, was ihr gefällt.
Vielleicht kann sie nicht mehr ohne.
»Was sagst du dazu?« Sie zupft den Träger auf meiner Schulter mit spitzen Fingern zurecht. Ich weiß nicht, wann wir uns das letzte Mal so nah waren. Ich erinnere mich nicht einmal daran, wie sie sich anfühlt. Der Gedanke, ihre Hand zu halten, sie gar in den Arm zu nehmen, ist so surreal, dass ich unweigerlich einen Schritt zur Seite trete. Scarlett quittiert es mit einer gehobenen Braue.
»Gefällt es dir nicht?«
Nein. »Doch.« Ich betrachte mich im Spiegel.
Ich trage niemals Rot. Es ist Scarletts Farbe. Ihre Schuhe, ihr Haarreifen, ihr Mantel. Ihre Farbe. Selbst in der Schule wagt niemand darauf zurückzugreifen. Es ist ein ungeschriebenes Gesetz. Rot liegt ihr im Blut. Oder besser noch: im Namen. Mich in diesem Kleid zu sehen, fühlt sich an, als würde ich ihre Haut tragen.
»Vertrau mir«, sagt sie und streift sich das Top über den Kopf. »Es ist perfekt.«
»Was ziehst du an?«
»Ich gehe nackt«, scherzt sie und stellt sich neben mich, als sei es ihr tatsächlich ernst. Das Gefühl, im falschen Körper zu stecken, wird durch den Kontrast der Farben verstärkt: sie lilienbleich, ich blutrot. Als wären wir durch den Spiegel in ein verdrehtes Wunderland gefallen, fragt sich nur, wer den Kopf verliert.
Ich? Oder sie?
Zu meinem Entsetzen greift sie auch noch zu dem alten Stoffhasen, den sie von Geburt an besitzt. Das Fell, ehemals flauschig weiß, ähnelt mehr dem eines Kadavers, dem Gesicht fehlt ein Auge und Wolle quillt wie Gedärm aus einem Riss, den sie stets verbot zu flicken.
»Wie spät ist es?«, frage ich.
»Zu früh«, sagt sie und winkt ihrem Spiegelbild mit der Hasenpfote zu. Wahrscheinlich existiert in jedem Haushalt ein solches Kuscheltier, dessen Ablaufdatum längst überschritten ist, das dennoch nicht entsorgt werden kann; zu viele Erinnerungen sind daran geknüpft, zu viele Tränen hat es aufgesogen, zu viele Nachtmahre in die Flucht geschlagen – falls Scarlett je Albträume hatte.
Was ich bezweifle. Nicht Scarlett.
Ich selbst besitze kein solches Tier. Kein Kissen. Keine Decke. Nichts. Anna sagt, ich hätte nie etwas gebraucht, ich hätte gar alles, was sie mir als Kind ins Bett legten, wieder hinausgeworfen. Vielleicht hat sich bereits darin mein Hang zur Einsamkeit angedeutet, so wie in Scarletts Hasen die Eigenheit, ihren Freunden alles abzuverlangen. Zerliebt nennt sie den Zustand, in dem er ist.
Zerstörerische, vernichtende Liebe.
Entspannt greift sie nach einem ultrakurzen Paillettenkleid, das ich noch nie an ihr gesehen habe – und auch nicht in ihrem Schrank, dabei kenne ich jedes Kleidungsstück. Beinahe zwanghaft suche ich ihr Zimmer auf, sobald sie das Haus verlässt. Ich weiß, in welcher Schublade sie ihre Unterwäsche aufbewahrt und was sie zwischen den Seidenstoffen versteckt. Ich kenne den Inhalt ihres Schreibtisches so gut wie den ihres Mülleimers oder den der Briefe, die sie regelmäßig an Mutter schreibt. Sie sind kurz und knapp, mehr eine distanzierte Zusammenfassung der Erlebnisse, denn der Versuch echter Teilhabe. Ich weiß nicht, wozu sie die Briefe schreibt; genauso wenig wie ich weiß, woher das Kleid stammt.
Scarletts Mund verzieht sich spöttisch. »Ein Geschenk.«
Als wüsste sie, dass ich stöbere. Dass ich sie dafür verachte, wie leichtfertig sie Geld ausgibt. Papas Staatshilfe reicht kaum für die Nebenkosten. Anna führt Buch über alle Ausgaben und einigen Dorfbewohnern den Haushalt, um das Nötigste dazuzuverdienen. Ich trage meinen Teil bei, indem ich den örtlichen Friedhof pflege, das Gras stutze und die Grabsteine säubere.
Nur Scarlett … ist eben Scarlett.
»Schau nicht so.« Sie wedelt meinen Vorwurf davon, ehe ich ihn in Worte fassen kann. »Heute Abend haben wir Spaß, du wirst schon sehen.«
In mir wächst ein kleiner drückender Knoten, den ich verzweifelt zu ignorieren versuche. Sie ist all das, was ich nicht bin. Unbekümmert. Frei. Sorglos. Beliebt. Sie fühlt sich wohl in ihrer Haut, besitzt Freunde, die ihr etwas schenken, und einen Freund, der ihr verfallen ist. Alle sind das, einfach weil sie sie ist. Und ich bin ich.
Und manchmal ist das einfach scheiße.
Sie reicht mir einen Lippenstift. »Sie werden dir zu Füßen liegen.«
Ich widerstehe dem Drang, ihn aus dem geöffneten Fenster zu schmeißen und den Abend zu streichen. Anna zuliebe.
Während des Abendbrots verlor sie kein Wort darüber, doch ihr Blick sprach Bände. Geh mit. Ob sie wirklich glaubt, dass ein Abend etwas ändert, wage ich zu bezweifeln. Anna ist pragmatischer Natur, nicht umsonst hat sie uns die letzten Jahre getrennt.
Scarlett, in dein Zimmer, Jenna, ab in den Garten.
Scarlett, komm mit mir, Jenna, bleib bei Papa.
Scarlett hier, Jenna da.
Wir teilen nichts. Kein Hobby, keine Freunde, ja, nicht einmal das Badezimmer. Scarlett nutzt das, welches Papa kurz vor Mamas Verschwinden renovierte, ich das mit der Wanne und dem Fisch. Einzig die gemeinsamen Abendessen fallen aus dem Muster, auf die besteht Anna aus unerfindlichen Gründen und wir nehmen klaglos teil: Anna zuliebe. Auch das hat System. Der Grund, warum wir uns bisher am Leben ließen und die Existenz der anderen stillschweigend dulden: Anna zuliebe.
Sie hält uns zusammen.
Deshalb stehe ich hier und trage das Kleid, nach dem es Maria verlangt. Die Vorstellung ihrer Enttäuschung, sollte sie mich darin sehen, verschafft mir auf unerklärliche Weise Genugtuung. Der Schlafmangel ist schuld. Er bringt die schlechtesten Seiten in mir zum Vorschein, die ich am liebsten Scarlett zuschreiben würde.
»Der Stift trägt sich nicht von allein auf«, neckt sie und der Knoten in meinem Magen wiegt schwerer, weil ich ihr selbst jetzt, da wir uns gemeinsam vorbereiten, nur die niedersten Motive unterstelle. Ich suche geradezu nach dem Haken, der Falle, dem Grund, warum sie nett zu mir ist.
Rasch trage ich den Lippenstift auf. Was ich im Spiegel erblicke, gefällt mir. Meine Züge sind zwar nicht so fein wie Scarletts, doch meine Augenfarbe ist schöner und mein Mund überraschend sinnlich. Wahrhaftig. Das Rot ist magisch.
»Du siehst aus wie Mama.« Die Gesichtszüge entgleisen mir. Scarlett lacht. »Kein Grund zur Panik. Das ist gut. Mama ist wunderschön.«
»War«, korrigiere ich automatisch.
»Ist«, hält Scarlett dagegen. Sie hasst, dass ich unsere Mutter als verstorben betrachte. Mir hingegen ist die Vorstellung unerträglich, dass sie irgendwo in der Welt herumspaziert, wohl wissend, dass es uns gibt, es ihr aber schnurzpiepegal ist. »Ich habe noch eine passende Tasche«, wechselt Scarlett in unverfängliche Gefilde.
»Kein Bedarf.«
Skeptisch hebt sie die Brauen. »Und deine Sachen?«
»Welche Sachen?«
»Lippenstift, Deo, Tampons, Taschentücher, Kondome.«
»Kein Bedarf.«
»Zumindest dein Smartphone solltest du mitnehmen!«
»Ich besitze keins.«
Ihr fallen fast die Augen aus dem Kopf. »Ernsthaft?«
Ich schweige dazu. Was könnte ich auch sagen? Dass es an nur drei Orten unseres Dorfes Empfang gibt? Das würde sie nicht überzeugen, immerhin gelten dieselben Bedingungen für sie. Es ist viel erbärmlicher. Abgesehen davon, dass ich es mir nicht leisten könnte (und keine Ahnung habe, wie ihr die Finanzierung gelang), wüsste ich nicht, mit wem ich Kontakt halten sollte. Mit Maria? Nein danke.
Scarlett starrt mich ein paar Herzschläge lang an, dann gibt sie nach. Punkt für mich. Welch denkwürdiger Tag.
»Können wir los?«, frage ich, was ihr ein selbstzufriedenes Lachen entlockt.
»Wir werden abgeholt. Von Derek.«
Derek, der Junge mit dem Ball, hat mir gerade noch gefehlt. »Weiß er, wo wir wohnen?«
»Natürlich nicht. Er holt uns beim Spukhaus ab.«
Diesmal schießen meine Brauen in die Höhe.
»Nicht so herablassend«, tadelt sie und kommt mir dabei selbst schrecklich überheblich vor. »Er weiß selbstverständlich, dass wir nicht dort wohnen. Es ist lediglich der Treffpunkt. Es ist schwer genug für ihn, überhaupt hierherzufinden.«
Ob das an der Unsichtbarkeit unseres Dorfes oder dem Verstand ihres Freundes liegt, wage ich nicht zu fragen. Scarlett mag Derek. Derek mag Scarlett. Heute fährt er uns zur Party. Uns – wie seltsam das klingt.
»Dann lass uns gehen«, versuche ich es erneut, »zum Spukhaus, meine ich.«
»Er kommt in einer Stunde«, klärt sie mich auf. »Wir haben Zeit.« Sie schnappt sich ihre winzige Handtasche (in die unmöglich passt, was sie vorhin aufgezählt hat) und tritt zum Fenster, unter dem das Stalldach liegt. »Folge mir.«
Wie sie es in dem extrakurzen Paillettenkleid auf den Fenstersims und hinaus schafft, ist mir ein Rätsel. Ich brauche drei Anläufe und fürchte bis zuletzt, dass ich dabei mein Tagebuch verliere. Ich lasse es niemals aus den Augen, selbst dann nicht, wenn Scarlett in meiner Nähe ist und ich es in Sicherheit weiß. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Als ich den Giebel erreiche, sitzt sie bereits da, in der einen Hand ihr Smartphone, in der anderen eine glühende Zigarette.
»Auch eine?«, fragt sie und bläst den Rauch in den dunkelnden Himmel.
»Weiß Anna davon?«
»Himmel, nein! Und du wirst nichts sagen, verstanden?«
»Zu Befehl«, erwidere ich zynisch und sinke neben ihr nieder. Unter uns liegt der Hof, eine verwilderte Betonfläche, die im Schatten des Stalls versinkt. Gras sprießt aus sämtlichen Ritzen, Löwenzahn und Vergissmeinnicht erobern trotzig den unwirtlichen Grund. Dass etwas so Unscheinbares wie ein Samenkorn Betonplatten zu sprengen vermag, gibt mir den Mut, nicht aufzugeben.