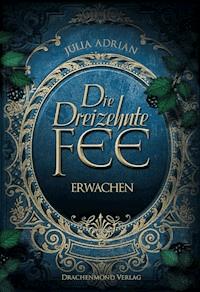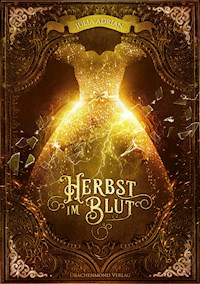Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Drachenmond Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Eine märchenhafte Anthologie
- Sprache: Deutsch
"In Feenquellen und Zauberschlössern" ist die siebte Märchenanthologie des Drachenmond Verlages und das Grundmotiv sind dieses Mal Zahlen. Alle Anthologien können unabhängig voneinander gelesen werden. Drei Prüfungen. Sieben Wassernymphen. Zwölf Prinzessinnen. Zahlen besitzen in Märchen oft eine ganz eigene Magie. Doch nicht immer entfaltet sich ihr Zauber auf die gleiche Weise. Möchtest du wissen, welche Schicksalsfäden sich verweben, wenn das Glückskind auszieht, um drei goldene Haare zu stehlen, oder eine junge Frau von einem Schneeflöckchen aus Glas träumt? Folgst du mit uns der Spur einer verliebten Meerjungfrau und hast ein Herz für ein kämpferisches Rotkäppchen und einen Meisterdieb, in dem weit mehr steckt, als es scheint? Dann lass dich verzaubern von siebzehn Geschichten, scheinbar so alt wie die Zeit und doch überraschend und neu.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 457
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
In Feenquellen und Zauberschlössern
EINE MÄRCHENHAFTE ANTHOLOGIE
HRSG. CHRISTIAN HANDEL
Copyright © 2023 by
Lektorat: Julia Adrian
Korrektorat: Michaela Retetzki
Layout Ebook: Stephan R. Bellem
Umschlagdesign: Alexander Kopainski
alexanderkopainski.de
Umschlagbildmaterial: Shutterstock
Illustrationen Print: Soufiane El Amouri
ISBN 978-3-95991-708-7
Alle Rechte vorbehalten
Inhalt
Vorwort
Lisa Rosenbecker
Die siebte Geschichte
Olga A. Krouk
Der zweite Sohn
Noah Stoffers
Die drei Aufgaben des Meisterdiebs
Ria Winter
Die Zauberfürstin und der listige Recke
Nina Bellem
Von gebrochenen Herzen
Anabelle Stehl
Chervona
Carina Schnell
Die Macht der Wünsche
Justine Pust
Die drei Sirenen
Anne Danck
Meerhäschen
Julia Adrian
Das Böse
Kathrin Wandres
Drei Tage, die über Leben oder Tod entscheiden
Christian Handel
Twelve
Eleanor Bardilac
(K)Ein Liebeslied für Gefallene
Ellen Birkhahn
Der Holunder
Caroline Brinkmann
Ein einziger Wunsch
Gesa Schwartz
Der Geist des Winters
Stella Tack
Der letzte Schnee
Drachenpost
Vorwort
Die Sieben ist im Märchen eine magische Zahl. Sieben Raben, sieben Zwerge, sieben Geißlein, Siebenmeilenstiefel und Sieben auf einen Streich – und sieben Märchenanthologien im Drachenmond Verlag. Das hat schon auch etwas sehr Magisches für mich. Und deshalb wird dieses Vorwort auch persönlicher als die bisherigen.
Als Astrid und ich uns im Frühjahr 2016 an die Arbeit machten, Hinter Dornenhecken und Zauberspiegeln zusammenzustellen, wussten wir nicht, ob sich überhaupt jemand für eine Anthologie mit märchenhaften Kurzgeschichten begeistern würde.
Drei Jahre später erschien Von Fuchsgeistern und Wunderlampen, unsere dritte Märchenanthologie. Und direkt am offiziellen Erscheinungstag schlug Astrid mir vor, mit der Reihe weiterzumachen. Es war ein turbulenter Samstag während der Frankfurter Buchmesse 2018, und wir gönnten uns eine Minipause an einem der Essensstände. »Du weißt schon«, sagte ich damals mit einem Augenzwinkern zu ihr, »wenn wir jetzt nach der Drei weitermachen, müssen es mindestens sieben Anthologien werden.«
Damals habe ich halb gescherzt, halb gehofft. Und nun haltet ihr mit In Feenquellen und Zauberschlössern einen Traum in den Händen, der wahr geworden ist.
Ein Traum, den ich nicht allein geträumt habe und der auch nicht von einem einzigen Menschen in die Wirklichkeit geholt wurde. So möchte ich an dieser Stelle all jenen Menschen danken, die diesen Traum mit mir träumen: Astrid für ihre Leidenschaft, ihre Unermüdlichkeit, ihre harte Arbeit und ihr großes Herz sowie den Buchsatz; Soufiane für traumhafte Illustrationen, Julia, Alexandra, Stephan und Nina für die Lektorate, Larissa, Sarah, Nina und Kathrin für die Übersetzungen, Kathi für einen wundervollen Rahmen bei der Antho Nr. 6, Michaela für das Korrektorat, Alexander für die atemberaubenden Cover, euch allen dafür, dass ihr diese Bücher ins Herz geschlossen habt und die Werbetrommel für sie rührt.
Und natürlich all den Autorinnen und Autoren, die uns über die Jahre hinweg ihre Geschichten anvertraut haben. Auch diesmal habe ich die große Ehre und Freude, euch die wunderbaren Erzählungen ebenso wunderbarer Kolleginnen und Kollegen präsentieren zu dürfen. Danke für euer Vertrauen. Bereits ein Blick auf das Cover verrät: Es sind auch diesmal mehr als sieben geworden.
Überhaupt ist die Sieben nicht die einzige Zahl, der im Märchen eine besondere Bedeutung zukommt: die eine wahre Liebe, die zwei Brüder, die drei Sirenen, die zwölfte Prinzessin – märchenhafte Zahlen sind das unsichtbare Band, das die Geschichten dieser Anthologie miteinander verknüpft. Wie auch in der Vergangenheit, haben wir uns erlaubt, darüber hinaus Geschichten aufzunehmen, die von diesem Thema abweichen, wenn sie uns besonders gut gefallen haben. Wir glauben, dadurch wird diese Sammlung stärker.
Danke, dass ihr zur neuen Märchenanthologie gegriffen habt. Vielleicht ja schon zum siebten Mal? Aber egal, ob ihr uns wiederholt besucht oder unserer Einladung zum ersten Mal folgt: Wir wünschen euch ganz viel Freude beim Eintauchen in Feenquellen und dem Erkunden neuer Zauberschlösser!
Christian Handel, Frühjahr 2023
Lisa Rosenbecker
Lisa Rosenbecker liebt Tee, gute Bücher und das Schreiben. Ihr erster Roman erschien 2015, und seither hat sie nicht mehr aufgehört, selbst fantastische Welten zu erschaffen. Manchmal sind es fantastische Königreiche (wie in Arya & Finn: Im Sonnenlicht), manchmal Urban-Fantasy-Welten (wie etwa für ihre Romantasy-Dilogie Magie aus Gift und Silber und Magie aus Tod und Kupfer). Und ab und an stößt sie auch die Tore zu einem ganzen Universum auf, wie etwa in ihrer Litersum-Reihe, in der man in Buch-Welten eintauchen kann.
Wer sie bereits im realen Leben getroffen hat – auf einer Lesung, zum Beispiel, auf einer Buchmesse oder gar im plüschigen Drachenkostüm auf der ersten Drachennacht –, wird bestätigen, dass sie ein überaus herzlicher und hilfsbereiter Mensch ist.
Lisa zählt zu den ersten Drachenmond-Autor*innen, die ich persönlich kennenlernen durfte, und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass sie mir nach Die Jägerin in Von Flusshexen und Meerjungfrauen für diese Anthologie bereits zum zweiten Mal eine Geschichte anvertraut.
In ihrem Märchen geht es um die Macht und die Bedeutung von Geschichten. Gäbe es eine bessere Möglichkeit, eine Anthologie zu eröffnen?
www.lisarosenbecker.de
Die siebte Geschichte
LISA ROSENBECKER
Geschichten waren wertvoller als Gold.
Lumea wusste, dass sich in den schier endlosen Regalen der königlichen Bibliothek mehr Kostbarkeiten verbargen als in den Schatzkammern des Schlosses. Die ledernen Einbände, das vergilbte Papier und die blank polierten Mahagonibretter glänzten nicht wie Edelmetall, aber wer genau hinsah, wusste den Reichtum vor sich zu schätzen.
Als Bibliothekarin war sich Lumea ihrer Verantwortung bewusst. Diese Schätze zu bewachen, war Ehre und Bürde zugleich. Sie musste sie mit dem Herzen eines Drachen hüten und mit der Seele eines Schmetterlings pflegen. Tagein, tagaus kam sie dieser Aufgabe nach und war stolz auf ihre stetig wachsende Sammlung. Sogar die Königin war immer wieder aufs Neue beeindruckt und führte die Bibliothek ihren Gästen vor, die sich staunend umsahen, doch nie zum Lesen blieben. Lumea störte sich nicht an ihrem Leben in Abgeschiedenheit. Es war besser für sie, und für die Bücher. Zu viele Hände verursachten zu viele Schäden. Und Lumea war sich sicher, dass niemand die Geschichten so sehr schätzte wie sie.
Ihre Tage verbrachte sie mit Lesen. Seite um Seite, Tag um Tag flogen an ihr vorbei, während sie in ihrem Lieblingssessel saß und mit den Buchstaben tanzte. Sie steckte ihre Nase in alle Geschichten, historischen Abschriften und Monografien, die in den rotbraunen Regalen auf sie warteten. Auch die Bildbände studierte sie, die Karten und Prophezeiungen, die keinen Sinn ergaben. Sie trank die Worte, genoss die Bilder und atmete den Duft von Papier und Tinte.
Ihr Drang zu lesen wuchs ins Bodenlose. Immer mehr und immer mehr Bücher verleibte sie sich ein, bis sie nur noch in ihnen lebte. Vor den Fenstern der Bibliothek wechselten sich von ihr unbeobachtet die Jahreszeiten ab, es war ihr einerlei. Ob Sommer oder Winter, Lumea konnte sich das Wetter, den Ort oder die Zeit in ihren Büchern aussuchen. Sie war glücklich in ihrer eigenen Welt, die sie sich nach ihrem eigenen Willen gestaltete.
Eines Tages stieß sie auf das Notizbuch eines Geschichtenerzählers. Darin berichtete der Mann von seinen Reisen und von sieben Menschen, die sich geweigert hatten, ihm ihre Geschichten zu erzählen. Leere Seiten am Ende warteten darauf, mit Tinte und Leben gefüllt zu werden. Sie waren geduldig. Lumea nicht.
In ihrem Herzen wurde es still, der Drache schlief ein. Das Pulsieren ihrer Schmetterlingsseele schwächelte. Ohne diese ungeschriebenen Geschichten würde sie eingehen.
Lumea rief den Hauptmann der königlichen Garde zu sich, den alle den Wolf nannten. Er trug das Wappen mit dem Tier, dessen Namen er angenommen hatte, stolz auf der Brust.
»Ich brauche Eure Hilfe«, sagte Lumea mit rauer Stimme. Sie hielt das Notizbuch hoch. »Es fehlen sieben Geschichten. Ihr müsst sie finden.«
Der Wolf sah sich um. »Hier gibt es mehr Bücher, als ein Mensch in einem Leben lesen kann. Reicht Euch das nicht?«
»Die Bibliothek der Königin muss vollständig sein«, erwiderte Lumea nachdrücklich. Sie musste die Geschichten in ihren Besitz bringen. Um jeden Preis.
»Ich werde nicht selbst gehen«, erwiderte der Wolf ergeben, »aber ich werde Euch sieben meiner Männer zur Verfügung stellen. Sagt ihnen, wo sie die Geschichten finden, und wir bringen sie Euch.«
Lumeas Herz sang vor Freude. Sie schöpfte Hoffnung, dass die Leere in ihrem Inneren aufgefüllt werden würde.
Am nächsten Morgen stand ein Mann der Garde vor der Bibliothek und bot seine Dienste an. Lumea hatte in der Nacht zuvor alles für den ersten Auftrag zusammengetragen. Ihre Augen schmerzten von der Arbeit bei Kerzenlicht.
Sie gab dem Mann den Zettel mit den Anweisungen. »Die erste Geschichte gehört zu einem Schreiner aus den nördlichen Wäldern. Sagt ihm, dass Ihr einen besonderen Tisch für die Königin kaufen wollt. Dann wird er sich Euch vielleicht anvertrauen.«
Der Mann bedankte sich und zog los, um den Auftrag auszuführen.
Am nächsten Morgen kam der zweite Mann aus der Garde des Wolfs. Auch ihm gab Lumea Anweisungen. Sie hatte die ganze Nacht über einem Buch gekniet, um ihm eine Karte zu zeichnen, und ihr Rücken brannte von der Anstrengung. Doch die Hoffnung trieb sie weiter an.
»Die zweite Geschichte gehört zu einer Traumweberin aus den Inselregionen. Sagt ihr, dass sie einen Traum der Königin deuten soll. Dann wird sie sich Euch vielleicht anvertrauen.« Sie reichte ihm die Karte. Nach einem kurzen Dank machte sich der Mann auf den Weg.
Und so schickte sie über die Tage hinweg alle sieben Männer los, damit sie ihr die fehlenden Geschichten brachten. Neben dem Tischler und der Traumweberin gab es noch eine Köchin, einen Heizer, einen Schneider, eine Wäscherin und eine Uhrmacherin, zu denen die Männer aufbrachen. Immer unter dem Vorwand, im Auftrag der Königin zu handeln. Lumea wusste nicht, was sie sonst hätte tun sollen. Laut den Notizen aus dem alten Buch war es bisher niemandem gelungen, jenen Menschen ihre Geschichten zu entlocken. Und wenn das Wort der Königin nicht zählte, dann gab es keinen anderen Weg.
Nach der anstrengenden Woche, in der sie jeden Tag und jede Nacht gearbeitet hatte, schmerzte ihr ganzer Körper und ihr Herz war leer. Sie versuchte sich mit anderen Büchern abzulenken, doch keines vermochte ihre Gedanken auszufüllen. Rastlos streifte sie umher. Was sollte sie bis zur Rückkehr der Männer mit sich anfangen?
Sie geisterte durch die Regale, befreite sie vom Staub und strich über die Buchrücken. Dann fing sie von vorn an, auch wenn sie jeden Tag gebückter ging. Nur der Gedanke an die neuen Geschichten hielt sie aufrecht.
Eine Woche verstrich, in der sie in ihrer Monotonie gefangen war. Sie aß nicht, trank kaum und nachts warf sie sich von der einen Seite auf die andere. Ihr schlichtes Kleid riss an mehreren Stellen, aber sie war zu schwach, sich umzuziehen. All ihre Kraft hob sie für jenen Moment auf, in dem sie die Männer der Garde empfangen würde.
Und endlich kam der Tag, an dem der erste zurückkehrte. Er reichte ihr einen Stapel Papier, jede Seite dicht mit Tinte beschrieben. »Dies ist die Geschichte des Schreiners. Er erschuf einst einen magischen Tisch, der sich von selbst decken konnte und Essen für die ganze Familie zauberte.«
Lumea nahm das Papier mit zitternden Fingern entgegen. Sie würde sich sogleich auf die Geschichte stürzen und sie ordentlich in das Notizbuch übertragen. Der Mann verbeugte sich zum Abschied, und erst da fiel ihr die frische Narbe an der Hand des Mannes auf.
»Was ist mit Eurer Hand geschehen?«, fragte sie ihn.
»Der Tischler hat mir gezeigt, wie ich eine Wiege für mein Kind bauen kann.« Der Gardemann, der bei seinen Worten gelächelt hatte, drehte sich um und ließ sie allein zurück.
Lumea las die aufregende Geschichte und vergaß für eine Nacht alles um sich herum. Am nächsten Morgen stand der zweite Mann vor der Tür der Bibliothek und brachte ihr die Geschichte der Traumweberin.
»Sie hat aus den Träumen einer jungen Frau ein Wesen geschaffen, das Albträume fressen kann. Seitdem sind alle in ihrem Dorf glücklicher«, erzählte er und händigte ihr einen kleinen Papierstapel mit der niedergeschriebenen Geschichte aus.
Auch er sah anders aus als vor seiner Abreise. Eine seiner Iriden war nicht mehr braun, sondern grün.
»Was ist mit Eurem Auge geschehen?«, fragte Lumea.
»Die Traumweberin hat mich verzaubert. Sie hat mir hundert Nächte guten Schlaf geschenkt.« Der Mann verabschiedete sich fröhlich und ging.
Lumea rieb sich über die trockenen Wangen und zog sich in die Bibliothek zurück. Sie las die Geschichte über die Traumweberin gern und bannte sie mit Tinte auf Papier. Das Notizbuch füllte sich, ihr Herz jedoch nicht.
Ihre Gedanken schweiften immer wieder zu den beiden Männern der Garde ab. Etwas an ihren Erzählungen störte sie. Etwas, das ihren Magen schwer machte und sie wie Steine herunterzog. Sie hatte sich von den neuen Geschichten vergeblich Zufriedenheit erhofft. Vielleicht, dachte sie, vielleicht wirkte es erst, wenn sie alle sieben beisammenhatte.
Nach den ersten beiden kehrten noch vier der restlichen Männer der Garde mit den Geschichten zurück. Bald füllten die Worte über die Köchin, den Heizer, den Schneider und die Wäscherin die Seiten des Notizbuchs. Sie las sie in einem Rutsch durch und empfand so etwas wie Freude. Doch sie währte immer nur bis zum nächsten Morgen. Dann kehrte die Leere zurück, ihr wölfischer Hunger war nicht gestillt.
Es war ein Spiel zwischen ihr und ihren Gefühlen, mit den Geschichten als Spielsteinen. Am Ende würde es nur eine Gewinnerin geben. Die letzte Partie, die siebte und letzte Geschichte, würde über Sieg und Niederlage entscheiden.
Doch sie kam nicht. Lumea wartete und wartete. Unruhig streifte sie durch die Bibliothek, vom Fenster zur Tür und wieder zurück. Sie hielt Ausschau nach dem siebten Mann und der Geschichte der Uhrmacherin, die ihr endlich Frieden bringen sollte.
Weitere sechs Nächte und sieben Tage vergingen, ehe der Mann zurückkehrte. Er erschrak, als Lumea ihm die Tür öffnete. Sie war nur noch ein Schatten, der sich selbst nicht mehr im Spiegel erkannte. Ihre Haut war aschfahl und gräulich wie ein Bogen Papier, die Haare glänzend wie ein abgegriffener Ledereinband und die Lippen blau wie Tinte. Als Lumea die leeren Hände des Mannes sah, fiel sie auf die Knie.
»Wo ist die Geschichte der Uhrmacherin?«, fragte sie flehend.
Der Mann schüttelte den Kopf. »Ich habe sie nicht. Aber die Uhrmacherin ist selbst gekommen.« Er trat einen Schritt zur Seite.
Hinter ihm tauchte eine junge Frau in einem graubraunen Kleid auf, die an einem breiten Ledergürtel allerhand Werkzeug mit sich trug. Sie hatte ihre hellen Haare zu einem Knoten zusammengefasst und Lumea erhaschte einen Blick auf ihre Augen. Sie wirkten älter als die junge Frau. Weiser.
Die Uhrmacherin half Lumea auf und führte sie zu ihrem Sessel.
»Was ist mit Euch?«, fragte sie. »Seid Ihr verflucht?«
Lumea schüttelte den Kopf, was ihre ganze Kraft kostete. »Eure Geschichte«, bat sie. »Erzählt sie mir.«
»Nur wenn Ihr mir vorher Eure erzählt«, antwortete die Uhrmacherin. »Ich gebe nichts umsonst.«
»Und wenn ich Euch Geld gebe?«
»Nein. Eure Geschichte ist wertvoller als alles, was Ihr oder die Königin mir geben könntet.«
Geschichten waren wertvoller als Gold.
Wie hatte sie das vergessen können?
Lumea sah zu der jungen Frau auf und öffnete den Mund. Doch kein Ton kam heraus. In ihrem Kopf ballten sich die Worte, all jene, die sie gierig in sich aufgenommen hatte. Sie hätte ihr von dem Tischler erzählen können oder von der Traumweberin oder von einer der unzähligen anderen Geschichten, die sie verschlungen hatte. Aber von ihrer eigenen?
»Ich heiße Lumea. Und ich bin Bibliothekarin«, sagte sie schließlich.
»Und weiter?«
Lumeas Erinnerung war so leer wie ihr Herz. Ihr fehlten die Worte, obwohl ihr ganzes Sein damit gefüllt war. Aber es waren nicht ihre. Ihr Magen fühlte sich an, als wäre er mit Wackersteinen gefüllt, und zugleich war ihre Seele hohl.
Die Uhrmacherin legte ihr die Hände an die Wangen. »Mein Name ist Hoda. Meine Leibspeise sind süße Brötchen mit Himbeeren. Und Eure? Und wann habt Ihr das letzte Mal etwas gegessen?«
Lumea erinnerte sich nicht. Dabei waren es so einfache Fragen. Es konnte nicht lange her sein, dass sie etwas gegessen hatte. Aber was? Und was aß sie gern? Je länger sie darüber nachdachte, umso dunkler wurde es ihr vor Augen. Um nicht in Ohnmacht zu fallen, sagte sie, was ihr als Erstes in den Sinn kam. »Braten. Brei. Brot mit Marmelade.« Ihre Stimme war rau und kaum noch zu hören.
Die Uhrmacherin schüttelte den Kopf. »Ihr habt Euch zwischen all diesen Geschichten verloren, Lumea.«
Verloren. Sie hatte das Spiel verloren.
»Muss ich jetzt sterben?«, fragte Lumea angsterfüllt und rollte sich zusammen.
Hoda zog eine goldene Taschenuhr hervor und hielt sie Lumea hin. »Ich habe jeden Tag mit Menschen und der Zeit zu tun und habe eines dadurch gelernt. Es ist nie zu spät, um sich wiederzufinden.«
»Aber meine Geschichte ist fort«, flüsterte Lumea, und Tränen liefen ihr über die Wangen.
»Sie ist nicht fort. Sie ist nur nicht hier. Folgt mir.«
Sie half Lumea auf die Beine, und gemeinsam verließen sie die Bibliothek. Es war das erste Mal seit … Lumea wusste es nicht. Eine Dienstmagd vor der Bibliothek entdeckte die beiden jungen Frauen und hob die Hand zum Gruß.
»Lumea, Euch habe ich seit drei Monden nicht mehr auf dem Flur gesehen. Was ist geschehen?«
Drei Monde also. So lange hatte sich Lumea in die Bibliothek zurückgezogen. Die Uhrmacherin wechselte ein paar Worte mit der Magd und zog Lumea weiter. Sie kamen zur Küche, wo der Koch seine Mütze zog, als er die beiden Frauen sah.
»Euch habe ich seit zwei Monden nicht mehr gesehen. Was habt Ihr seitdem gegessen?«
Damit war auch diese Frage beantwortet. Hoda bat den Koch um einen Tee für Lumea, die diesen widerwillig trank. Die Wärme kehrte in ihre Glieder zurück, ihre Lippen wurden rosig.
»Was isst Lumea am liebsten?«, fragte die Uhrmacherin den Koch.
»Brot mit Ziegenkäse und Feigen«, antwortete er und bereitete es sogleich zu. Lumea probierte ein Stück von dem belegten Brot, und einer der Wackersteine in ihrem Magen löste sich in Vertrautheit auf. Sie hatte ein Stück von sich wiedergefunden.
So zogen Lumea und Hoda von Raum zu Raum und setzten Stück für Stück Lumeas Geschichte zusammen. Die Waschfrauen säuberten Lumea und gaben ihr ein frisches schwarzes Kleid, in dem sie sich wie eine Prinzessin fühlte. Ihr Haar duftete nach Geißblatt, was laut einer der Frauen ihr Lieblingsduft war.
Der Gärtner führte die beiden zu den rosa Rosen, die Lumeas Lieblingsblumen waren. Der Stallmeister zeigte ihr eine zutrauliche Stute, mit der Lumea früher gern ausgeritten war. Und als sie in das Dorf gingen, erkannten viele Menschen Lumea und erzählten der Uhrmacherin von ihr. Für Lumea war es, als würde sie wie Hoda ihre eigene Geschichte zum ersten Mal hören. Doch der Drache und der Schmetterling in ihr erwachten zu neuem Leben, als sie die vertrauten Stimmen und Worte vernahmen, die Lumeas Leben erzählten.
Am Ende des Tages fühlte sich Lumea wieder wie sie selbst. Sie und Hoda waren auf den Hügel gestiegen, von dem aus sie das gesamte Dorf überblicken konnten. Die Abendsonne wärmte ihnen die Rücken, als sie sich auf einem Felsen niederließen und in das Tal hinabsahen.
Hoda schenkte ihr die Taschenuhr, die sie ihr zuvor gezeigt hatte. »Du solltest mehr Zeit in deiner Geschichte verbringen als in denen anderer.«
Lumea dachte an das Gefühl, das beim Anblick der zurückgekehrten Männer in ihr erwacht war. Jetzt, da sich ihr Blick geklärt hatte, erkannte sie darin Neid. Sie hatte sie um ihre Geschichten beneidet, die sie auf der Reise erlebt hatten, während Lumea nur dagesessen und gewartet hatte.
Lumea liebte Bücher und Geschichten nach wie vor. Aber sie würde nie wieder vergessen, dass das echte Leben, ihr echtes Leben, die besten und erfüllendsten Geschichten schrieb.
Olga A. Krouk
Als Olga und ich uns das erste Mal trafen, trug sie ein rosafarbenes Tutu über der Jeans. Das war auf der Fantasy Leseinsel während einer Leipziger Buchmesse, und ich durfte eine Veranstaltung moderieren, in der sie ihren humorvollen Märchen-Fantasyroman Ewiglich … Dornröschen?: Kiss my ass! vorstellte.
Dass Olga eine tolle Schriftstellerin und ein megasympathischer Mensch ist, wusste ich da aber schon länger. Denn kennengelernt haben wir uns bereits Jahre zuvor, weil wir beide Artikel für das Print-Magazin Nautilus– Abenteuer & Phantastik schrieben – manchmal sogar zusammen.
Olga schreibt auf Deutsch, obwohl das eigentlich nicht ihre Muttersprache ist. Sie wurde in Moskau geboren. Ihre Kindheit verbrachte sie in der Ukraine, ehe sie mit ihrer Familie nach Sankt Petersburg zog, wo sie mit dem Schreiben begann. 2001 kam sie dann nach Berlin – mit einem Kopf voller Romanideen, wie sie selbst gern sagt. Ihr Debüt Schattenseelen ist eine Urban-Fantasy-Trilogie, die in Hamburg spielt, danach folgten unter anderem zwei Romantic-Thrill-Romane. Mit Die Schattenflüsterin – Zwischen Herz und Dämon erschien ein Romantasy-Roman bei uns im Drachenmond Verlag.
Heute lebt Olga mit ihrem Mann und vier Söhnen in einer kleinen Stadt in Schleswig-Holstein. Als Clara Langenbach schreibt sie historische Romane (Die Senfblütensaga). Auf meine Einladung hin ist sie aber erfreulicherweise wieder zur Märchen-Fantasy zurückgekehrt. Viel Spaß mit ihrer Geschichte, in der sie mehrere Märchenmotive verknüpft – allen voran das des zweiten Sohnes.
www.olgakrouk.de
Der zweite Sohn
OLGA A. KROUK
Nirgends war die Welt so tot wie im verwunschenen Schloss. Die alten Bücher behaupteten, in diesem Gemäuer lauere der Wahnsinn selbst, der ahnungslose Reisende dazu bringe, aus den Fenstern zu stürzen und geradewegs in die Arme des Todes zu laufen. Doch die Bücher irrten sich. Es war nicht der Wahnsinn. Es waren die Spiegel, die den Boden, die Wände und sogar die hohe Kuppeldecke pflasterten.
Vorsichtig schob er seinen rechten Fuß vor. Bis zur Mitte des Saals war nichts passiert, doch jetzt zog sich ein hässlicher Riss durch die Spiegel unter ihm. Winzige Splitter schwebten in der Luft. Nur ein falscher Schritt, ein unvorsichtiges Wort – und die Scherben würden ihn vernichten. Das spürte er, so wie er die kalten Blicke spürte, die ihm seine eigenen Spiegelungen von überallher zuwarfen. Als würden sie nur auf einen Fehler warten.
Doch dieses Mal würde er keinen machen. Die Zukunft seines Königreiches stand auf dem Spiel. Alles hing davon ab, ob er es schaffte, den einzig wahren Zauberspiegel zu finden.
Doch welcher war der richtige?
Langsam drehte er den Kopf.
Im verfluchten Land ist nichts, wie es scheint. Dieser Satz hatte sich ihm eingebrannt, als er sich auf der Suche nach dem Zauberspiegel durch unzählige Schriften gegraben hatte. Flieh, flieh, solange du noch kannst!, flehte die Stimme in ihm, doch er ließ sie verstummen und fixierte die Spiegel genauer. Auf der Suche nach dem einen, der anders war. Da! Ein dünner Rahmen wie aus Schneereif geformt, in dem sich nichts, absolut nichts spiegelte. Schwärzer als die Nacht lockte die unendliche Leere den Betrachter herbei und labte sich an seiner Seele.
Ohne den Blick abzuwenden, trat er näher. Es knirschte unter seinen Sohlen. Noch mehr Splitter erhoben sich in die Luft. Wie über eine dünne Eisdecke schob er sich dennoch immer weiter voran, bis er direkt davorstand.
»Spieglein, Spieglein an der Wand«, begann er mit heftig klopfendem Herz und stockte kurz. »Bist du es wirklich?« Seine Stimme klang verzerrt in seinen Ohren, während die anderen Spiegel knirschten und knackten und die Splitter nur darauf warteten, ihn mit ihren scharfen Kanten in Stücke zu schneiden. »Ich verlier den Verstand«, murmelte er, leckte sich über die trockenen Lippen und versuchte seine Spiegelbilder auszublenden, die ihn hämisch angrinsten.
»Sieben.«
Das Wort durchdrang seine Sinne, rauschte durch seine Adern und pochte ihm in den Schläfen. Schneewehen wirbelten durch die Tiefen des Spiegels und bildeten eine weibliche Silhouette, die sich sofort wieder auflöste wie ein Atemhauch an einem eiskalten Wintertag. »Ja. Ich bin es«, erklang die Antwort in ihm. »Und deinen Verstand hast du längst verloren. Vermutlich in dem Moment, in dem du beschlossen hast, hierherzukommen.«
»Aha?« Unwillkürlich wich er einen Schritt zurück. »Was … was redest du da?«
»Sechs.«
Ein Spiegel direkt neben ihm zerbarst. Eine der Scherben schnitt ihm über das Gesicht, direkt unter seinem Auge. »Sechs Fragen darfst du mir stellen. Wähle sie weise, denn ich kann dir nichts sagen, was du nicht fragst. Doch solange es sich halbwegs reimt, werde ich alles beantworten, was du von mir verlangst. Wie die Sorgen um deinen Verstand.«
Er öffnete den Mund, schloss ihn aber sofort wieder. So wie es gerade aussah, würde er keine weitere Frage überleben, ohne von den Spiegelscherben zerfetzt zu werden. Das Blut, das ihm über die Wange strömte, war die letzte Warnung gewesen. Das spürte er.
So vorsichtig wie möglich spähte er zum großen Bogenfenster rechts. Fünf Schritte. Höchstens. Fünfzig bis zum Ausgang hinter ihm. Er wog seine Möglichkeiten ab: Ein Sturz auf den Schlosshof oder der Tod im Scherbenregen.
Blitzschnell riss er den Spiegel von der Wand. Fünf Schritte! Die Fensterbank. Ein Sprung zur Seite.
Einer Explosion gleich schossen die Splitter aus dem Fenster, während er an einer Hand am Gesims baumelte, den Spiegel unter den anderen Arm geklemmt. Zum Glück konnte er perfekt klettern, wo andere längst abgestürzt wären. Eine Gabe, die er perfektioniert hatte, um mit seinen Brüdern mitzuhalten. Nun zeigte sich, was wirklich in ihm steckte.
Er klemmte sich den Spiegel zwischen die Beine und hangelte sich mit geübten Griffen hinunter, selbst beeindruckt von der eigenen Kraft und Geschicklichkeit. Geschafft! Er war den todbringenden Splittern entkommen. Mit einer beiläufigen Geste wischte er sich das Blut von der Wange.
War es das wert, streifte der Gedanke wie ein Windhauch durch seinen Kopf, sein Leben für ein paar Fragen zu riskieren?
Trotzig biss er die Zähne zusammen, packte den Spiegel mit beiden Händen und sah auf die dunkle Oberfläche. »Spieglein, Spieglein an der Wand …«
»Bin ich denn an der Wand?« Jeder Laut, der in ihm erklang, zupfte an seinen Sehnen wie an den Saiten einer Geige und brachte sein Inneres zum Vibrieren. »Nein, da bin ich nicht. Denn du hast mich gewaltsam fortgerissen.«
Er stockte. Hatte der Zauberspiegel etwa Gefühle? Seine Stimme zitterte, als er erneut ansetzte: »Spieglein, Spieglein in der Hand. Wo ist die Schönste im ganzen Land?« Sobald die letzte Silbe seine Lippen verließ, hielt er inne.
»Fünf.«
Ohne zu blinzeln, starrte er auf die wirbelnde Gestalt, die aus unzähligen Schneeflocken bestand.
»In den Bergen«, erklang die unterkühlte Antwort in ihm. »Bei den sieben Zwergen.«
Frostblumen breiteten sich über die Oberfläche aus, die Wälder, Berge und eine einsame Holzhütte in einem Tal formten.
Fest umfasste er den Spiegelrahmen, ungeachtet des eisigen Schmerzes, der sich in seine Handflächen biss. Wenn er sich beeilte, konnte er schon bald bei der schönsten Frau sein, die es weit und breit gab!
Willst du das wirklich? Kehr um, es ist nicht zu spät …
»Natürlich will ich das, sonst wäre ich nicht hier!«, brüllte er in die Einsamkeit des Hofes hinein. Hatten die alten Bücher doch recht? Streifte der pure Wahnsinn durch dieses Gemäuer?
Mit bebenden Händen zog er seinen Reisemantel aus, klopfte die Scherben ab, die sich darin verfangen hatten, und wickelte den Stoff um den Spiegel. Schnellen Schrittes durchquerte er den Innenhof und sprang die Stufen hinunter zum Gang, der nach draußen führte. Zu schwer wog der Gedanke, er würde dem Druck nicht standhalten und womöglich … umkehren. Vielleicht war er einfach nicht zum Herrschen geboren … Nein, nicht daran denken! Dieses Mal würde er siegreich heimkehren, die Gunst seines Vaters gewinnen und den Neid seiner Brüder genießen. Er biss die Zähne zusammen. Die beiden hatten es von Anfang an leichter gehabt! Aber ihm, dem Zweitgeborenen, blieb nur das Los der Unsichtbarkeit. Wenigstens hatte sein Vater in der Frage um die Thronfolge allen drei Söhnen die gleichen Chancen eingeräumt. Und diese Chance würde er jetzt nutzen!
Mit langen Schritten eilte er zum Pferd, befestigte den Spiegel am Sattel und stieg auf. Noch vor wenigen Tagen hatte sich der Ritt wie eine grenzenlose Freiheit angefühlt. Doch jetzt schwelte eine seltsame Unruhe in seiner Brust, je weiter er sich vom Schloss entfernte.
Die Worte des Königs kreisten in seinem Kopf. Wer mit der schönsten Frau an seiner Seite zurückkehrt, dem werde ich das Königreich übergeben – und wir feiern nicht nur eine prächtige Hochzeit, sondern auch eine glorreiche Krönung. Nun geht – und erfüllt mein Herz mit Stolz!
Was war nur mit ihm los? Woher kamen die Zweifel? Er war doch auf dem besten Weg, seinen Vater stolz zu machen.
Aber warum soll ausgerechnet eine schöne Schwiegertochter einen alten Mann mit Stolz auf seine Söhne erfüllen? Wie eine kalte, schuppige Schlange kroch die Frage sein Rückgrat empor.
»Woher soll ich das denn wissen?«, knurrte er und zuckte bei der Bissigkeit seiner eigenen Worte zusammen. Unwillkürlich sah er zurück zum Schloss, das in der Ferne wie ein schwarzer Dorn den Himmel teilte.
Viel zu langsam zog die Landschaft aus Tälern, Hügeln und Wiesen vorbei, durch die sein Pferd ihn trug. Bis er einen Wald vor sich erblickte. Bereits von Weitem spürte er die unheimliche Aura, die ihre Fühler nach ihm ausstreckte. Er zügelte sein Pferd und spähte zwischen die Baumstämme.
Die verschlungenen Äste knarzten im Wind. Aus den Tiefen tönte ein leises Grollen.
Hast du Angst? Geh nach Hause, Prinz. Geh nach Hause.
War es der Wald selbst, der ihn warnte? Er schauderte. Doch statt umzukehren, packte er den Spiegel und blickte in die Finsternis, die ihm mit kalter Verachtung entgegenstarrte.
»Spieglein, Spieglein, sag’s doch bald. Wie gefährlich ist dieser Wald?«
»Vier.«
Bloß eine Zahl und nichts weiter. Offensichtlich wollte der Spiegel die Spanne »bald« ein wenig auskosten. Erst nach einer gefühlten Ewigkeit kam die ersehnte Antwort: »Es ist der Wald der verschlungenen Pfade. Komm nicht vom Weg ab und nimm dich in Acht vor dem großen bösen Wolf.«
»Ein Wolf also«, murmelte er und tastete nach dem Knauf seines Schwertes. »Mit einem Wolf werde ich schon fertig.«
Sein Pferd schnaufte, als er es unter die Bäume trieb. Wie ein Boot durch stürmisches Meer brach das Tier durch das Dickicht, bis es endlich auf einen Pfad stieß. Überrascht stellte er fest, wie schnell die Dämmerung heraneilte. Noch ein Wimpernschlag – und schon umhüllte tiefste Nacht die Baumkronen, als hätte jemand die Sonne wie eine einsame Kerze ausgepustet. In der Finsternis klang jedes Geräusch fremd und bedrohlich. Hier ein Knacken. Dort ein Rascheln.
War da etwas? Angestrengt spähte er in die Dunkelheit. Da! Er fuhr so hektisch herum, dass er fast das Gleichgewicht verlor und aus dem Sattel fiel. Sein Ross schnaubte alarmiert.
»Alles gut«, formte er lautlos mit den Lippen und stieg vom Pferd.
Jetzt sah er es deutlich: ein bläuliches Schimmern in der Ferne. Wie Elmsfeuer zuckte es zwischen den Ästen, begleitet von einer zarten Windspielmelodie.
Was war das?
Er zog sein Schwert und schlich zwischen den Bäumen auf das Licht zu. Stück für Stück, darauf bedacht, keine unnötigen Geräusche zu verursachen. Bis er am Rand einer Lichtung stand.
Wie ein schwarzer, undurchdringlicher Schleier lag die Nacht über der Wiese. Nur das Gras schimmerte bläulich und wogte im Wind hin und her. Dem Boden empor entstieg jene zarte Melodie, als würden Feenwesen an Grashalmen wie an den Saiten einer verwunschenen Harfe spielen.
Die süßen Klänge lockten ihn immer weiter. Am liebsten würde er sich diesem Zauber vollkommen hingeben. Bis er mitten im Schritt verharrte.
Nanu!
Er war nicht mehr allein.
Er kniff die Lider zusammen und beäugte eine Frauengestalt im roten Umhang genauer. Sie kauerte auf der Lichtung und pflückte die bläulich schimmernden Blumen, die entfernt an gläserne Glöckchen erinnerten. Jedes Mal, wenn sie an einem Stiel riss, stob ein funkelndes Pollenwölkchen auf und erhellte die Konturen ihres Gesichts unter der Kapuze.
Sein Herz flatterte, während er die geschmeidigen Bewegungen ihrer schlanken Hände beobachtete, betört von ihrem lieblichen Antlitz und der Grazie ihres Körpers.
Wie von selbst trugen die Beine ihn zu ihr. Klirrend bogen sich die Blumen beiseite, um ihm den Weg zur mysteriösen Unbekannten frei zu machen.
»Guten Tag.« Seine Stimme war belegt. Ihm selbst fremd.
Die junge Frau fuhr hoch, die Blüten schützend an sich gepresst.
Rasch steckte er sein Schwert ein, das er vergessen in der Hand hielt, und hob beruhigend die Arme. »Bitte entschuldigt. Ich wollte Euch nicht erschrecken.«
»Seid Ihr ein Jäger?« Sie wich einen Schritt zurück. Die Kapuze rutschte ihr vom Kopf und enthüllte das Gesicht, das im Schein des Blütenmeeres feenhaft wirkte. Dafür klang ihre Stimme tiefer als zuerst gedacht. Der samtige Ton mit den rollenden R-Lauten ließ ein Kribbeln in seiner Magengegend aufsteigen.
»Nein«, murmelte er, den Kopf wie leer gefegt. »Ich bin kein Jäger. Ich bin nur ein Prinz.«
»Bleibt, wo Ihr seid, Prinz!«, wisperte sie, als er einen weiteren Schritt auf sie zutrat.
»Habt keine Angst. Ich tu Euch nichts.« Behutsam streckte er eine Hand aus, um sie zu berühren. Er musste einfach wissen, ob sie echt war. Oder nur das Produkt seiner Fantasie.
»Behaltet Eure Hände bei Euch!«, rief sie und zuckte zurück. Er wollte sie am Umhang packen, sie daran hindern, wegzulaufen. Stattdessen streiften seine Finger über die Blüten.
Funken durchzuckten die Luft wie kleine Blitze. Der moderige Geruch eines frisch ausgehobenen Grabes erfüllte die Lichtung, während die Blüten im Strauß eine nach der anderen zu Asche zerfielen. Der Staub rieselte auf das Blütenmeer.
»Nein!« Die Kapuze rutschte ihr tief ins Gesicht. Verzweifelt drehte sich die Frau im Kreis inmitten der sterbenden Blütenpracht. »Was habt Ihr getan? Was habt Ihr nur getan?«
»Ich … ich weiß es nicht. Was ist denn passiert?« Er spürte einen Kloß im Hals, den niederzuringen ihm nicht gelang.
»Die Totenglocken dürfen nur in der Abenddämmerung und nur von einer Frauenhand gesammelt werden! Jetzt habt Ihr jede einzelne vernichtet, und ich muss einen ganzen Mondzyklus warten, ehe sie wieder blühen.«
»Totenglocken«, wiederholte er den seltsamen Namen und glaubte, Asche auf seiner Zunge zu schmecken.
»Hängt man einen Strauß über dem Sterbebett auf, verdrängt ihr Läuten die Schatten des Todes. Doch jetzt sind sie alle fort! Und Ihr habt damit meine Großmutter zum Tode verurteilt!«
»Wie meint Ihr das?« Noch nie hatte er sich hilfloser gefühlt. »Was fehlt Eurer Großmutter?«
Eine Weile herrschte Grabesstille, in der sein Herz beinahe ohrenbetäubend laut schlug.
»Ihr hat überhaupt nichts gefehlt, bis zwei ungezogene Gören aufgetaucht sind, um an ihrem Häuschen zu knabbern! Meine Großmutter bat sie herein, fütterte und umsorgte sie, doch einmal nicht aufgepasst – und schon haben die Gören das Feuer entdeckt!« Ein klagender Ton entstieg ihrer Kehle wie der eines verwundeten Tieres. »Seit dem Unfall mit dem Ofen ist meine Großmutter bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Diese Blumen waren ihre letzte Hoffnung!«
Er schluckte, obwohl sein Mund keinerlei Spucke hergab. »Jetzt beruhigt Euch. Vielleicht …«
Obwohl es stockdunkel war, konnte er sehen, wie ihre Augen wütend aufblitzten. »Ihr habt gerade meine Großmutter zum Tode verurteilt und sagt mir, ich solle mich beruhigen?«, zischte sie.
»Ich werde eine Lösung finden! Ich verspreche Euch, dass ich nicht aufhören werde, ehe ich eine Möglichkeit gefunden habe, Eure Großmutter zu retten!« Er wollte sie packen, sie an sich drücken, sie umarmen, um ihr Trost zu spenden. Doch sie wich zurück, bis ihre Silhouette fast mit der Dunkelheit verschmolz.
»Ach, Ihr denkt, ich habe nicht bereits alle Möglichkeiten ausgeschöpft? Ich hätte nicht alle weisen Frauen im Land befragt? Sondern hier tatenlos gewartet, dass ein Prinz vorbeikommt und mich und meine Großmutter errettet?«
»Es wird alles gut. Da bin ich sicher. Es wird alles gut!« Er wusste selbst, wie kläglich seine Worte klangen.
»Nichts wird gut, mein lieber Prinz«, knurrte sie.
Der Vollmond tauchte hinter den Wolken hervor und ergoss sein fahles Licht über die Wiese.
»Warum …« Alles in ihm erstarrte vor Grauen. »Warum habt Ihr …«
»Na los, sagt es«, zischte die Silhouette unter dem roten Umhang und bewegte sich geschmeidig auf ihn zu. »Warum habt Ihr so große Augen? Oder: Ei, warum habt Ihr so große Ohren? Vielleicht auch: Warum habt Ihr ein so entsetzlich großes Maul?« Sie ruckte den Kopf zum Mond, und die Kapuze rutschte hinab. Kein Menschengesicht – eine Wolfsschnauze lechzte ihm entgegen. »Die Antwort verrate ich gern: Damit ich Euch besser fressen kann, mein Prinz!«
Zähne blitzten im Mondschein auf. Das Wesen machte einen Satz nach vorn.
Verflucht! Was zum …
Er spürte, wie riesige Pranken in seine Brust schlugen. Zum Glück reagierte sein Körper instinktiv. Noch im Fall wandte er sich unter dem Biest zur Seite und zog sein Schwert. Zähne schnappten nur wenige Zentimeter entfernt von seinem Gesicht zu, kräftig genug, um seinen Kopf wie eine Nuss zu knacken. Mit ganzer Kraft hämmerte er den Knauf gegen den Schädel der Wölfin. Das genügte, um mehr Bewegungsfreiheit zu erlangen und mit der Klinge auf das Ungeheuer einzuschlagen. Er wusste nicht, wo er das Biest erwischt hatte. Groß wie ein Kalb und kräftig wie ein Bär – neben diesem Untier wirkte sein Schwert wie ein Zahnstocher. Fieberhaft überlegte er, was er tun sollte. Noch einmal zuschlagen? Gut zureden? Um Gnade winseln?
Eine Klaue holte bereits zum Schlag aus. Plötzlich schob sich eine Wolke vor den Mond, und aus der pelzigen Pranke wurde eine zierliche Hand, die auf ihn herabsauste. Der Schlag traf seine Schläfe, Fingernägel ritzten seine Haut auf.
»Du schlägst wie ein Mädchen«, zischte er in dem kläglichen Versuch, sie aus der Fassung zu bringen und sich dadurch einen Vorteil zu verschaffen.
»Danke. Legt Euch nie mit einem an.« Unbeirrt packte sie sein Handgelenk und verdrehte ihm den Arm. Ein ziehender Schmerz schoss ihm bis in die Schulter. Das Schwert glitt aus seinen tauben Fingern. Verdammt! Ob Wölfin oder Frauengestalt – wenn das so weiterging, war er erledigt!
Die Wolke entblößte einen Teil des Mondes. Die junge Frau hob ihr Gesicht dem Himmel entgegen. Ihre zierliche Nase wurde länger, Fell spross aus der Haut, das Gebiss verwandelte sich in eine Reihe todbringender Fangzähne … Obwohl pures Grauen sein ganzes Wesen ergriff, nutzte er die Verschnaufpause und stieß die Bestie von sich. Blitzschnell sprang er auf die Füße und rannte um sein Leben. Sein Atem rasselte. Die Gedanken sprangen hin und her.
Lauf, spottete die Stimme in seinem Verstand. Lauf nur, am besten direkt zu Papi nach Hause.
Weg, bloß weg hier! Die Bestie war ihm dicht auf den Fersen, blies ihm ihren feuchten Atem in den Nacken. Oder war das nur der Wind, der seinen Schweiß kühlte? Das Pferd! Wo war sein Pferd? Gerade als er die Hoffnung fast verloren hatte, erblickte er sein Ross am Wegesrand. Ein Glück! Er schwang sich in den Sattel und schlug dem Tier die Stiefel in die Flanken. Im wilden Galopp jagte er sein Pferd durch den Wald, während der Mondschein schwach den schmalen Pfad erhellte.
Schneller, schneller! Hätte der blöde Spiegel vorher nur von einer Wölfin gesprochen! Dann wäre er von Anfang an auf der Hut gewesen und nicht in dieses Schlamassel geraten …
Er wusste nicht, wie viel Zeit vergangen war, als sein treues Ross aus dem Wald in das blendende Tageslicht schoss.
Weiter, immer weiter. Noch immer glaubte er das Hecheln der Bestie im Nacken zu spüren. Erst nach einer Weile zügelte er sein Pferd und wischte sich erschöpft über die verschwitzte Stirn. Noch weigerte sich sein Verstand, zu begreifen, was da passiert war. Der Wald, die Wiese mit den schimmernden Blumen und dann die wunderschöne Frau, die sich im Mondlicht in ein Ungeheuer verwandelte … alles wirkte so diffus in seinem Kopf.
»In diesem verfluchten Land ist wirklich nichts, wie es scheint!«, rief er den ganzen Frust aus seiner Brust heraus. Unschlüssig darüber, auf wen er so wütend war: auf sich selbst oder auf dieses Weib, das ihn in eine Falle locken wollte.
Aber er war ihr entkommen. Und nun wieder auf dem rechten Weg, der ihn geradewegs zum Ziel führen sollte. Vor ihm erstreckte sich ein Tal, und an dessen Grund zeichneten sich die Umrisse einer einsamen Hütte ab. Das Häuschen sah genauso aus, wie es der Zauberspiegel gezeigt hatte. Endlich!
Mit letzter Kraft erreichte er die Hütte, die schief und verlassen in einem üppigen Garten stand. Schwere Früchte neigten die Zweige der Obstbäume gen Boden, Kräuter säumten die Grünfläche. Um die bunten Wildblumen herum summten Bienen, während fröhliches Tschilpen und Pfeifen die Luft erfüllte, als würden die Vögel in ihren Gesangskünsten einander zu übertreffen trachten. So viel Leben auf einem Fleck! Wer auch immer hier wohnte, besaß einen grünen Daumen und ein Händchen für die heimische Fauna.
Schwerfällig rutschte er aus dem Sattel. Sein ganzer Körper schmerzte, jeder Atemzug tat weh. Die von Wolfsklauen zerfetzte Kleidung klebte blutverkrustet an seinem Körper. Doch er wäre des Throns nicht würdig, würde er sich von so etwas aufhalten lassen. Mit erhobenem Haupt ging er auf die Hütte zu.
Da quietschte die Eingangstür und ein Mann kam heraus. Groß und kräftig gebaut, das einfache Leinenhemd umspannte seine muskulöse Brust. »Seid gegrüßt, Fremder! Wohin des Weges?«
»Und das soll ein Zwerg sein?«, entfuhr es ihm statt einer höflichen Erwiderung.
Der Mann hob die geschwungenen Augenbrauen. »Wie bitte?«
»Ähm. Ich war unterwegs zu den sieben Zwergen«, beeilte er sich zu erklären. »Bin ich hier richtig?«
Der Hüne musterte ihn mit einem absolut undurchdringlichen Blick seiner blauen Augen, deren Farbe wohl mit der von Kornblumen zu konkurrieren gedachte. »Kommt«, befahl er schließlich und hinkte hinter das Haus.
Besonders auskunftsfreudig schien dieser seltsame Kauz nicht zu sein. Mit einem genervten Seufzen stolperte er dem Mann hinterher, darauf bedacht, seine Schmerzen so gut es ging zu kaschieren. Der Riese blieb neben einem Apfelbaum stehen, die Hände hinter dem Rücken zusammengelegt und den Kopf in einer stillen Andacht zur Brust geneigt. Zu seinen Füßen waren sieben Figuren aufgereiht, kaum größer als Maulwurfshügel. Die Gesichter entsetzlich verzerrt, hielt der Stein die kleinen Körper gefangen. Erschreckend, wie lebendig sie immer noch wirkten.
»Das sind die … Zwerge?« Was hatte das zu bedeuten?
»Früher Menschen, jetzt nur noch Gartenschmuck, ja«, lautete die Antwort.
»Ich fürchte, ich verstehe nicht ganz. Was ist mit ihnen passiert?«
Der Riese zeigte zu den Bergen, die das kleine Tal umschlossen. »Das Gebirge der steinernen Herzen. Dieser Ort lässt jeden wachsen, der reiner Seele ist. Ist die Zeit reif, wird er zu einem dieser Berge, um über das Tal zu wachen. Doch hegt jemand niedere Absichten, wird er immer kleiner, bis er am lebendigen Leib versteinert.«
»Und die sieben hatten niedere Absichten?« Ein Schauer lief ihm über den Rücken.
Der Mann wiegte den Kopf. »Ich weiß nichts Genaueres. So viel habe ich allerdings rekonstruiert: Als eines Tages eine wunderschöne Maid an ihrer Tür geklopft hat …«
»Diese Maid!« Voller Ungeduld packte er den Kerl am Arm, obwohl sich in seinem Kopf von der ruckartigen Bewegung alles drehte. »Wo ist sie? Ich muss sie finden!«
»Tatsächlich?« Der Blick der kornblumenblauen Augen wirkte mitleidig. »Jedenfalls: Als meine Vettern diese junge Frau in ihr Haus gelassen haben, ihr Essen und einen Platz zum Schlafen gaben, so haben sie es nicht aus Herzensgüte getan, sondern …«
Für dieses Geschwafel hatte er definitiv keine Zeit! »Was auch immer Euren Vettern zugestoßen ist, tut mir ausgesprochen leid, aber ich will nur wissen, wo diese Frau ist! Meine Zukunft hängt davon ab!«
Der Hüne entzog sich seinem Griff. »Ich kann Euren Eifer durchaus nachvollziehen. Aber was hier geschehen ist …«
»Was hier geschehen ist! Was hier geschehen ist, interessiert mich nicht. Denn jetzt bin ich da, um die schöne Maid mitzunehmen und sie zu meiner Königin zu machen. Bringt mich zu ihr. Das ist alles, was ich will.«
Der Riese fuhr sich nachdenklich durch den Bart. Schien das Gehörte sorgfältig abzuwägen. »Ihr habt einen langen Weg hinter Euch. Wie wäre es, wenn Ihr Euch frisch macht? Und wenn Ihr dann immer noch wollt, dass ich …«
»Nichts wird mich davon abbringen können! Ich weiß nicht, wer Ihr seid, aber …«
»Ach, eigentlich finde ich es gar nicht so schlecht, dass niemand weiß, wer ich bin und wie ich heiß’.«
»Behaltet das ruhig für Euch! Und zeigt mir endlich den Weg zur schönen Maid!«
Der Mann deutete zur Seite. »Da. Den Pfad entlang in die Berge, er bringt Euch geradewegs zu einer Höhle. Dort …«
»Dort finde ich sie?« Er kniff die Augen zusammen und spähte in die Richtung. »Oder wollt Ihr mich in die Irre führen?«
»Ich gebe Euch mein Wort.« Der Hüne seufzte. »Aber bitte hört auf mich. Wascht Euch, ruht Euch aus, denkt ein wenig nach, ob es wirklich das ist, was Ihr wollt.«
»Natürlich ist es das, was ich will!« Andererseits: Seine Kleidung stank nach Schweiß, Pferd, Wolf und Blut. Er selbst hielt sich kaum noch auf den Beinen. In so einer Verfassung würde er keinen guten ersten Eindruck auf seine künftige Braut machen, Prinzentitel hin oder her. Sich zu erfrischen täte ihm bestimmt gut. Dennoch verärgerte ihn die Verzögerung, und so stapfte er missmutig ins Haus.
Das Innere lockte mit angenehmer Kühle. Idyllisch mutete die einfache Ausstattung an. In der Waschecke entdeckte er einen Bottich mit frischem Wasser und tauchte sofort sein Gesicht hinein. Eiskalt. Und unglaublich erfrischend.
Erstaunt bemerkte er, dass die Schürfwunden auf seinem Gesicht durch die Berührung mit dem Wasser sofort heilten. Das Ziehen und Brennen ebbte ab. Stirnrunzelnd sah er seine Spiegelung im Bottich an – kein Kratzer verschandelte sein königliches Antlitz.
Nanu!
Rasch säuberte er seinen Körper und stellte zufrieden fest, dass auch die schlimmsten Verletzungen, die er von den Wolfspranken davongetragen hatte, wie durch einen Zauber verschwanden. Er fühlte sich nicht nur erfrischt, sondern wie neugeboren!
Gut gelaunt wusch er seine Kleidung und hängte den Stoff am Zaun vor der Tür zum Trocknen auf. Im prallen Sonnenschein sollte es nicht allzu lange dauern. Bis dahin konnte er sich tatsächlich etwas ausruhen und vielleicht sogar das eine oder andere über seine holde Maid in Erfahrung bringen. Er holte den Spiegel und streckte sich auf einem der sieben Betten aus.
Doch sobald er einen Blick hineinwarf, zuckte er zusammen. Nicht die gewohnte Dunkelheit begrüßte ihn, sondern sein eigenes Gesicht. Es wirkte eingefallen und aschgrau wie ein Skelettschädel, der mit dünner Haut überzogen worden war. Im rechten Auge steckte ein Splitter aus Glas … oder vielleicht aus Eis? Ein zweiter Splitter ragte mitten aus seinem Herzen hervor.
Entsetzt starrte er in den Spiegel. Das konnte nicht sein, das Wasser hatte ihn doch vollständig geheilt!
Armer, armer Prinz. So blind. So hässlich. So tot.
Geh nach Hause. Rette dich.
Mit zittrigen Fingern fuhr er über die glatte Oberfläche. »Spieglein, Spieglein auf dem Kissen. Was muss ich über dieses Bild hier wissen?«
»Drei.«
Wilde Schneewirbel verschluckten seine Gestalt. Die Antwort fuhr wie ein Messerstich durch sein Innerstes: »Endlich stellst du eine gute Frage. Es ist eine Warnung. Dein Herz fühlt schon lange nichts mehr. Du bist blind, weil du – seit du denken kannst – nur dich selbst siehst. Und innerlich tot, weil der Neid auf deine Brüder dich schon immer zerfressen hat.«
»Das stimmt nicht!«, protestierte er, drehte sich um und legte den Spiegel an die Bettseite. »Spieglein, Spieglein an der Kant’, werde ich König in meinem Land?«
»Zwei.«
Erneut wirbelten die Schneeflocken umher, und es kam ihm vor, als würde der Spiegel ein enttäuschtes Seufzen ausstoßen. »Eine weniger gute Frage. Aber immerhin gibt es darauf eine eindeutige Antwort. Nein.«
Nun hatte er wirklich das Gefühl, ein scharfer Splitter würde sich tief in sein Herz bohren. Wie konnte die Antwort »Nein« lauten? Unmöglich, absolut unmöglich!
Die nächste Frage lag ihm bereits auf der Zunge, als er die polternden Schritte des Hünen hörte. Hastig zog er das Laken über den Spiegel, gerade rechtzeitig, da der Hüne die Hütte betrat.
»Brennt Ihr immer noch darauf, der Schönen in den Bergen zu begegnen?«, fragte der Riese, den Kopf eingezogen, um sich nicht an der Decke zu stoßen.
»Nichts wird mich davon abbringen!« Was führte dieser Kerl im Schilde? Hatte er vor, die Schöne für sich zu beanspruchen? Wollte er ihn davon abhalten, König zu werden? War es das, was der Spiegel ihm sagen wollte?
Der Riese trat näher. Zaghaft, als wäre ihm nicht wohl dabei, strich er sich über die muskulösen Arme. »Nicht alles, was schön zu sein scheint, bringt Euch ein gutes Ende. Lasst mich Euch dazu bitte eine Geschichte erzählen.« Er machte eine Pause, als müsste er sich sammeln, bevor er weitersprechen konnte.
»Vor langer Zeit wohnte ich in einem kleinen Dorf. Der dortige Müller hatte eine wunderschöne Tochter, und seit ich sie das erste Mal gesehen hatte, war ich ihr verfallen. Aber wer war ich schon? Ein humpelnder Taugenichts, mehr nicht. Da verirrte sich ein König zu uns. Der Müller begann ihm sofort seine Tochter anzupreisen. Zuerst weigerte sich die Schöne, das Spiel ihres Vaters mitzuspielen. Dann musste sie sich wohl oder übel fügen. Doch das Einzige, was den König interessierte, war, genug Steuern einzutreiben, um seine Goldtruhen zu füllen. Also erzählte ihm der Müller, seine Tochter könne Stroh zu Gold spinnen. Noch am selben Tag wurde die schöne Müllerstochter von den Königssoldaten ins Schloss gebracht. Ich … ich habe mir Sorgen gemacht. Wollte wissen, ob es ihr gut geht.« Er schluckte hart.
»Wie erschüttert ich war, als ich erfahren musste, dass der König sie in eine Kammer in seinem Verlies gesperrt hatte, damit sie ihm Stroh zu Gold spann! Ich tat alles, um ihr zu helfen. Es gelang mir sogar, den König zu überlisten, um Zeit zu gewinnen … So glaubte er dank mir, sie könne wirklich Stroh zu Gold spinnen, und hielt um ihre Hand an. Doch anstatt mit mir zu fliehen, wollte sie bleiben und den König heiraten!« Er schnaubte.
»Wie von Sinnen beschwor sie mich, bei ihrem Plan mitzumachen, den König zu stürzen und dem Gesinde zu ermöglichen, seine Regierungsvertreter selbst zu wählen.«
»Verrücktes Weib!«, entfuhr es ihm. Beinahe hatte er sich an der eigenen Empörung verschluckt.
Der Hüne schnalzte mit der Zunge. »So oft frage ich mich, was wohl passiert wäre, wenn ich an ihrer Seite geblieben wäre. Aber ich weigerte mich, bei ihrem Vorhaben mitzumachen. Und damit ich nichts ausplauderte, behauptete sie fortan, ich würde nach dem Leben ihres Erstgeborenen trachten. Nur mit knapper Not gelang es mir zu entkommen.«
»Hat sie es geschafft?«
»Was?«
»Den König zu stürzen?«
»Nein. Ich habe gehört, man habe sie und all ihre Unterstützer mit einem Fluch belegt, sie in ein verwunschenes Schloss gesperrt und zur Warnung eine undurchdringliche Dornenhecke drum herum gepflanzt. Andererseits habe ich auch gehört, es wäre ihr gelungen, den König in einen Frosch zu verwandeln. So oder so. Ich werde sie wohl nie wiedersehen.«
»Ich verstehe. Eine tragische Geschichte. Tut mir leid, dass Ihr an so ein hysterisches Frauenzimmer gelangt seid. Aber mit mir hat das nichts zu tun! Und nun entschuldigt mich, denn ich muss los und mein Schicksal erfüllen.« Er packte den eingewickelten Spiegel.
»Wartet, was, wenn Eure schöne Maid …«
»Ich bin ein Prinz. Ein zukünftiger König und kein …« Er verzog den Mund. »Kein einfältiger Bauerntrampel.« Rasch verließ er die Hütte.
Genug geplaudert! Wer wusste schon, warum der Riese ihn mit seinen Herzschmerzgeschichten aufzuhalten versuchte?
Er sollte sich sputen. Dieser Ort war ihm nicht wohlgesinnt, das spürte er mit jedem Atemzug, den er tat. Wenn er zu den Bergen blickte, wirkten sie noch größer und bedrohlicher als zuvor. Während er sich selbst ganz klein und unbedeutend vorkam.
Hektisch riss er seine Kleidung vom Zaun. Der Stoff war noch feucht, doch das hielt ihn nicht davon ab, sich die Sachen überzustreifen. Kurz stockte alles in ihm: Die Ärmel und die Hosenbeine waren tatsächlich zu lang. Erschrocken tastete er sich ab. Was, wenn ihm das Gleiche widerfuhr wie den sieben, die hinter der Hütte als lächerliche Gartenfiguren ihre Wache schoben?
Er musste sich beeilen. Die Sonne streifte bereits die Gipfel, und ihm grauste davor, auch nur eine Nacht hier zu verbringen. Nichts würde ihn davon abhalten, die Schöne zu seiner Braut zu machen, schwor er sich und spürte bereits die Last der Krone auf seinem Haupt.
Doch schon bald gestaltete sich das Vorankommen immer schwieriger, je enger der Pfad wurde, der sich zwischen den Klippen entlangschlängelte. Bei jedem Hufschlag holperten winzige Steine die steilen Bergwände auf ihn herab. Schon bald wurde der Weg so eng, dass er absteigen musste.
Den Spiegel unter die Achsel geklemmt, schob er sich immer weiter voran, den Hang hinauf. Jeder Schritt glich dem Balanceakt eines Seiltänzers. Die Zeit verlor an Bedeutung. Kam er überhaupt voran? Gerade als er dachte, niemals das Ende des Pfades zu erreichen, tat sich vor ihm eine Höhle auf. Als hätten die Berge aufgehört, ihn daran hindern zu wollen, sein Schicksal zu erfahren.
Unsicher trat er hinein, überrascht, dass es nicht stockdunkel war. Der raue Stein ringsherum wirkte, als hätten Menschenhände ihn gemeißelt, um den Wänden die Illusion eines festlichen Saals zu verleihen. Stalaktiten und Stalagmiten erschufen beeindruckende Säulengebilde. Und etwas weiter, auf einem Steinpodest, der einem prächtigen Altar ähnelte, thronte ein gläserner Sarg, um den unzählige grüne Lichter wie Glühwürmchen wirbelten.
Mit angehaltenem Atem betrachtete er die Gestalt, die darin ruhte. Die Haut so weiß wie Schnee. Das lange Haar so schwarz wie Ebenholz.
Endlich war er bei ihr: der schönsten Frau weit und breit. Keiner seiner Brüder, davon war er überzeugt, würde eine Braut finden, die es mit dieser hier aufnehmen konnte. Das Verlangen nach ihr machte ihn beinahe besinnungslos, so sehr drängte es ihn, sie endlich zu küssen.
»Keine Sorge.« Seine Stimme kippte. »Was auch immer dieser Sarg zu bedeuten hat, ich werde dich befreien und in mein Königreich bringen.«
Er stellte den Spiegel ab und drückte gegen den Deckel, doch dieser bewegte sich keinen Millimeter. Er drückte und stieß – ohne Erfolg. Nichts brachte ihn der Schönen in ihrem gläsernen Gefängnis näher. Voller Verzweiflung griff er nach einem Stein und rammte ihn mit voller Kraft auf den Sarg. Der Schlag hallte dumpf durch die Tiefen der Höhle.
Doch auf der Oberfläche zeigte sich nicht einmal der winzigste Kratzer.
Wieder und wieder ließ er den Stein auf den Deckel krachen, bis die Kraft ihn verließ und er neben dem Altar zu Boden sank. Die Nacht musste weit fortgeschritten sein, doch der Sarg blieb trotz all seiner Anstrengungen unversehrt.
Mit einem Ärmel wischte er sich über die verschwitzte Stirn. Konnte es sein, dass es in der Höhle dunkler geworden war? Er sah hoch. Die wirbelnden Lichter … ja, jetzt fiel es ihm auf. Sie erloschen eins nach dem anderen!
Rasch holte er den Spiegel und legte ihn vor sich auf den Boden.
»Spieglein, Spieglein auf dem Stein. Wie zerstöre ich den gläsernen Schrein?«
»Eins.«
Nur noch wenige Lichter wirbelten durch die Höhle, sodass er die Schneewehen unter der Oberfläche kaum sehen konnte. Eiskalt stach jede Silbe in sein Inneres. »Deine letzte Frage, meine letzte Antwort. Du musst nichts tun. Dreizehn Minuten bleiben bis Mitternacht, dann wird deine Schöne dich in den Armen halten. Dreizehn Minuten. In denen du noch umkehren kannst. Geh nach Hause, Prinz. Verschwinde von diesem Ort!«
Er zuckte zusammen. Dieser Hohn! Warum hatte er es nicht gleich erkannt? Die ganze Zeit zweifelte er an seinem Verstand, dabei war es der Spiegel. Dieser elende Spiegel!
»Du!«, brüllte er. »Du bist es, der mich davon abhalten wollte, hierherzukommen!«
Regungslos verharrte die Schneegestalt darin, eine Hand wie zum Abschied von innen gegen die Scheibe gepresst, während sich verschlungene Frostblumen darauf ausbreiteten.
»Du!«, schrie er wieder, holte aus und schmetterte den Spiegel auf den Boden. Tausende Eiskristalle splitterten in alle Richtungen. Dann spürte er einen Sog. Etwas zog die Scherben zusammen, sie bewegten sich in Spiralen zu einem Punkt vor seinen Füßen – und verschwanden, als hätte eine Zauberhand sie durch ein Nadelöhr gezogen.