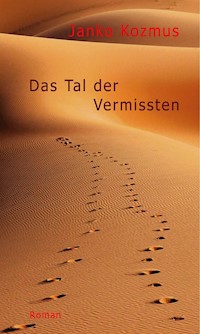
9,80 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Das Tal der Vermissten" ist ein durch eine unsichtbare Barriere geschützter Ort, an dem aus verschiedenen Epochen und Regionen Menschen aufeinander treffen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Eines ist allen gemein: Sie gelten als vermisst. Die meisten von ihnen gehörten im früheren Leben der Anonymität an, während andere – wie François Villon, Amelia Earhart oder Ambrose Bierce – als Prominente herausragten. Mit dem Eintritt in "Das Tal der Vermissten" verlässt das Subjekt seine vertraute Welt, eine Zäsur, deren Tragweite sich der Eintretende nicht bewusst ist. Jeder Einzelne muss seinen eigenen Weg finden, mit Ausnahme der „Massenheimsuchung“, bei der eine große Menge von Personen förmlich in das Tal hineingeworfen wird. Dabei wird die Struktur dieser Welt erschüttert, und einzelne Talbewohner beginnen sich zu fragen, ob und inwieweit ein Zusammenhang besteht zwischen diesem Ereignis und den Erinnerungsstörungen, von denen sie bisweilen befallen werden. Auch Laura, die neben Douglas zu den Protagonisten des Romans gehört, bleibt davon nicht verschont. Gleichzeitig registriert sie Dinge, die anderen verborgen bleiben; nur der Kundschafter Brody scheint Ähnliches wahrzunehmen. Begierig, die Grenzen des Tales zu erweitern, macht er eine Entdeckung, die – ohne dass er etwas davon ahnen würde – im weiteren Verlauf die Stabilität sowie den Fortbestand des Tals gefährdet. Parallel zum Geschehen im Tal richtet ein alter Mann seine Anschuldigungen und Klagen an den gehassten Widersacher, einer Personifizierung all dessen, was ihm im Laufe des Lebens an Unglück und vermeintlichen Ungerechtigkeiten widerfahren ist. Am Ende sieht er sich vor eine bedeutsame Entscheidung gestellt: Soll er freiwillig in den Tod gehen oder aber Zuflucht im Tal der Vermissten suchen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Das Tal der Vermissten
Roman
Janko Kozmus
978-3-8495-9925-6 (Hardcover)
978-3-8495-9940-9 (e-Book)
© Janko Kozmus
Umschlaggestaltung J.K. unter Verwendung
einer Fotografie von Lukas Kozmus
Schreiend rennt ein weiß gekleideter Mann ins Freie. Eine Gruppe von Saalgästen folgt ihm. Den Vorplatz überquerend läuft der Rufende in westlicher Richtung weiter, ohne auf seinen Schal zu achten, der hinter ihm her flattert, als besäße er ein Eigenleben. In den Gesichtern der Schaulustigen drückt sich Ratlosigkeit ob der Bedeutung des immergleichen Rufes aus. Gleichzeitig greift eine Lähmung um sich, der erst die entschiedene Frage einer Frau entgegenwirkt:
»Was meint Norec damit, der Platz reiche nicht aus?« Alle Blicke heften sich auf die Person, von der eine Antwort erwartet wird.
»Ich weiß es auch nicht, ihr wisst doch, Norec kann man nicht immer ernst nehmen!«
»Sollte man ihm nicht hinterherlaufen und ihn beruhigen?«, hakt die Frau nach.
»Der beruhigt sich wieder. Lassen wir ihn laufen. Wenn er am Bermuda-Dreieck angelangt ist, trinkt er ein Bier und kriegt sich wieder ein! Es ist ja nicht das erste Mal, dass er derart außer Rand und Band gerät.«
»Aber er muss doch etwas Bestimmtes mit seinen Rufen sagen wollen. Das klingt fast wie eine Warnung. Wofür soll der Platz nicht ausreichen?«
»Ich kann mir keinen Reim darauf machen. Kannst du es? Sieh dich doch mal um …« Der Sprecher beschreibt einen weiten Bogen mit dem rechten Arm. »Sieht das für dich nach Platzmangel aus?« Geste und Aussage scheinen die Fragende zu überzeugen, immerhin verstummt sie. Es scheint keinen Grund mehr zu geben, weiterhin draußen auszuharren, und alle begeben sich nach und nach in das Gebäude zurück. Zuletzt verlassen die Fragestellerin und der Antwortende den Ort. Letzterer zuckt mit den Schultern, als er dem leeren Platz, über dem ein aufkommender Wind Staub durcheinander wirbelt, den Rücken kehrt.
Ich weiß nicht, wie du das geschafft hast, aber überall hast du deine Finger im Spiel. Schon seit Langem habe ich so eine Ahnung. Jetzt, da ich mir sicher bin, muss ich dir diesen Brief schreiben, um dir ins Gesicht zu sagen, was ich von dir halte. Wie du aussiehst, weiß ich nicht, aber ich weiß, sollte ich dir begegnen, werde ich dich erkennen, und ich werde deine Physiognomie abstoßend finden. Beweise dafür, dass du hinter allem steckst, habe ich nicht, dennoch weiß ich einfach, dass du das bist, es definitiv sein musst. Wie könnte es sonst sein?! Bis zu einem bestimmten Zeitpunkt läuft über Jahre, was sage ich, über Jahrzehnte hinweg, alles reibungslos, und plötzlich geht alles schief. Nein, vielleicht nicht alles, aber doch so ziemlich alles. Wie machst du das?
Ich weiß, du musst damals an der Straße gestanden haben, um diesen Autofahrer zu blenden. Damit fing alles an. Oder fing es nicht eigentlich genau zwei Monate vorher schon an? Habe es bloß nicht gleich erkannt, heute weiß ich es besser. Du hast dich in die Firma eingeschlichen und dafür gesorgt, dass ich meinen Job loswurde. Wir alle haben damals unsere Arbeit verloren, die ganze verdammte Abteilung, dreiundzwanzig Leute, Männer und Frauen, die ich, obwohl sie teilweise nicht mehr die Jüngsten waren, immer als Jungs und Mädels betrachtet habe. In meiner Abteilung, ich meine natürlich die Abteilung, in der ich arbeitete, war ich mit meinen fünfunddreißig Jahren einer der ältesten und einer von nur zwei Kollegen mit Familie, mit Kindern. Der andere war Ossi und kam aus Adlershof. Er war der erste, der aus dem Osten der Stadt zu uns stieß. Ihm folgte eine Kollegin aus Köpenick. Sie erinnerte mich immer an den Hauptmann aus besagtem Ort. Dabei hielt sie nicht viel von Literatur und hatte nichts gemein mit jenen literaturinteressierten Leuten, mit denen ich normalerweise umzugehen pflegte. Aber sie war ein sexy Wesen, und ich bedauerte es, dass Frauen nicht zur Nachtschicht zugelassen waren. Vielleicht hätte ihre Anwesenheit die endlos-öden Stunden etwas aufzulockern vermocht. So schob ich meistens Dienst mit einem meiner vielen schwulen Kollegen, was mir anfangs etwas komisch vorkam. Bald aber wurde aus der Ahnung, diese unterschieden sich nur in einer Hinsicht von mir, Gewissheit. Inzwischen sind zwei dieser Kollegen an Erkrankungen infolge von AIDS gestorben. Jedenfalls war ich einer der älteren Kollegen mit Nachwuchs und mein Chef meinte immer, ich bräuchte mich nicht zu sorgen. Erstens stünden selbst bei spärlicher Auftragslage keine Kündigungen an und zweitens sei ich der Letzte, der zu gehen haben würde. »Du arbeitest gut, und du hast Kinder, auf so was nehmen die Bosse hier Rücksicht«. Er sagte nicht »Bosse«, er sagte: »die von der Firmenleitung«. Außerdem gibt es da ja noch den Betriebsrat. Und was hat er mir geholfen, der Betriebsrat? Niente, rein gar nichts. Die haben es Tatsache durchgezogen, die ganze Mannschaft haben sie »betriebsbedingt« gekündigt. Mir kam das wie eine Fingerübung in … wie heißt das gleich wieder … habe damals – als in solchen Dingen Unbedarfter – extra mal in den Wirtschaftsteil der Zeitung gesehen … genau, es handelte sich um eine Fingerübung in Sachen »lean production«. Das war eins dieser Schlagwörter, die zu jener Zeit aufkamen. Die haben ohne wirkliche wirtschaftliche Not schon mal die Mannschaft verjüngt, jawohl, »Gürtel enger schnallen«.
Gib zu, ohne deine Einmischung wäre das nicht passiert! Und ich, in meiner abgrundtiefen Dummheit, war im Grunde noch froh, gekündigt zu werden, erleichtert, mir eine Auszeit nehmen zu können. Wozu brauchte ich eine Auszeit? Hatte ich doch sowieso schon eine verkürzte Arbeitswoche. Ich machte mich nicht tot, treu meiner Devise: Bedürfnisse reduzieren, weniger malochen!
»Maloche«, wie ich sie größtenteils zu verrichten hatte, war und ist für mich der Gegenbegriff zu sinnvoller, nicht entfremdeter Arbeit. Außerdem kommt »Maloche« so schön proletarisch daher, und manchmal gefällt es mir, in die Rolle des Proleten zu schlüpfen. Nicht, dass ich glauben würde, etwas Besseres zu sein, wobei ich schon stolz darauf bin, mir ein wenig Bildung angeeignet zu haben. Schließlich ist sie mir nicht einfach so zugefallen.
Jedenfalls habe ich mich, was das Weniger-Arbeiten angeht, darauf gefreut, noch mal – diesmal ohne Stress – auf den Marathon trainieren zu können. Warum macht der Mensch sich dermaßen fertig, wozu das alles? Da hatte ich also meine Auszeit! Ich bin nicht wieder zurückgegangen, im Gegensatz zu den meisten meiner Exkollegen. Die haben das Angebot angenommen, die Abfindung zurückzugeben und mit etwa zwei Dritteln des Ursprungslohns wieder einzusteigen. Ich nicht, ich hab die zwanzig Mille behalten und mich mittelmäßig reich gefühlt, ich armer Tor!
Gib zu, das war schon eine deiner bitterbösen Machenschaften. Sehr geschickt, mir vorzugaukeln, mir was Gutes zu tun und dabei im Hintergrund zu bleiben. Was sage ich, Hintergrund, für mich warst du überhaupt nicht vorhanden, du warst buchstäblich unsichtbar, nicht wahrzunehmen. Ich hatte keinen Schimmer von deiner Existenz. Obwohl … eigentlich … Wenn ich’s mir genau überlege, diesem Moment hinterherfühle, habe ich es schon irgendwie geahnt. Irgendetwas war da. Nein, nein, irgendjemand war da. Und wer außer dir kann das gewesen sein? Du warst das, unbedingt, du musst das gewesen sein! Vorerst nur ein Nebel, eine Ahnung, Lichtjahre davon entfernt, greifbar zu sein, weniger noch als das berühmte Ungeheuer von Loch Ness, ach, was sage ich. Du verfügtest über weniger Substanz als ein frühherbstlicher Nebelschleier über diesem schottischen See. Übrigens ein schönes Stückchen Erde, in die das Wasser eingebettet ist, besonders, wenn sich der Sommer seinem Ende zuneigt, alles golden in der Abendsonne erstrahlt, die Blätter ihr grünes Kleid bunt einfärben. Einer der letzten Flecken, die ich in Europa besucht hatte. Danach war ich fast nur noch auf dem Schwarzen Kontinent, wie ich ihn nenne, unterwegs. Jetzt wäre ich schon froh, käme ich weiter, als meine Muskelkraft das Zweirad unter mir bewegen kann.
Sei still! Ich höre dich lachen, der Spreewald ist doch schön, hi hi! Ja, er ist schön, doch das wollte ich mir aufsparen für die Zeit, wenn ich wirklich alt bin, wenn ich nicht mehr die Kraft habe, entlegene exotische Länder mit extremen klimatischen Bedingungen zu besuchen. Das ist das Schlimmste, was du mir angetan hast, kaum noch reisen zu können. Das habe ich von der Einheit, die einen haben nun Reisefreizügigkeit und meine ist aufgehoben, ins Nirwana gehievt, die Werktätigen von drüben haben die Arbeitnehmer von hier verdrängt, zumindest teilweise, in Berlin auf jeden Fall. Ja, ich weiß schon … eine derartige Aussage spielt dir in die Karten. Ich weiß nicht, warum ich das so ausdrücke, wo es mir gleichzeitig wehtut.
Da ist sie schon wieder, ich fühle sie kommen, ja ja, jetzt höre ich sie tatsächlich, gleich wird sie klopfen, ich muss aufhören, ich schreibe später weiter, nein, besser morgen. Morgen, morgen werde ich dir ins Gesicht schreien, wie sehr ich dich verabscheue! Da klopft sie schon, schnell das Geschreibsel weggepackt. Sie muss es ja nicht unbedingt sehen, geht sie ja wirklich nichts an.
Selten hat sie so tief und traumlos geschlafen wie letzte Nacht. Morgentoilette und Frühstücksvorbereitung vollziehen sich mit traumwandlerischer Sicherheit wie von selbst. Während der ganzen Zeit denkt sie an nichts Bestimmtes. Ein vages Gefühl von noch zarter und zerbrechlicher Vertrautheit mit ihrer Umgebung und mit sich selbst umhüllt sie. Ohne es in ihr Bewusstsein dringen zu lassen, weiß ihr Innerstes, dass diese Empfindung ihr die Welt nicht öffnet, sondern verschließt und ihr ganzes Sein einengt. Zweifellos ist dies einer jener Augenblicke, in denen sie glaubt, einen Vorhang aufreißen zu müssen. Alltägliche Verrichtungen, wie das Abwaschen jetzt, helfen ihr beim Nachdenken. Doch kein Gedanke findet seinen Weg an die Oberfläche des Bewusstseins ohne einen Impuls. Ohne einen Auslöser treibt alles in einem Brei von Unbewusstheit, die allerdings, dieses naive Dümpeln auf der Oberfläche eines Sees von Motivationen, von Hemmungen, von unerfüllten Sehnsüchten und Trieben, nicht selten ein Wohlgefühl mit sich bringt. Ihre Stimmung, als es klopft, ist eher heiter zu nennen.
Laura schwebt federleicht zur Tür, sie öffnet neugierig. Und es erscheint ihr selbstverständlich, drei fremde Männer im Türrahmen stehen zu sehen. Fremd? Nein, einen zumindest erkennt sie. Er war am Vorabend bei ihrer Ankunft dabei. Bevor einer der Männer zu einer Äußerung ansetzen kann, sagt Laura:
»Ich kenne Sie, Sie waren doch gestern Abend draußen … Kommen Sie herein … Ich habe noch etwas Kaffee, wollen sie vielleicht welchen? Bringen Sie ihre Freunde mit herein!«
»Guten Morgen, Laura! Gesehen haben wir uns tatsächlich schon, trotzdem möchte ich mich – ohne förmlich werden zu wollen – korrekt vorstellen: Mein Name ist Jojo, dies sind Jacques und Dhondu. Wir würden gern kurz zu dir reinkommen. Und vielen Dank, ich möchte keinen Kaffee, vielleicht wollt ihr?« Beide Begleiter schütteln wortlos lächelnd den Kopf. Auch Laura kann sich ein Lächeln nicht verkneifen, als Jojo seinen Namen nennt. Sie mustert ihn aufmerksam: Ein freundlich wirkender Mensch mit Rüschenhemd, Samtjäckchen und halblanger Hose mit knallgelben Socken, Schnabelschuhen und – völlig unpassend – einem offensichtlich mehrere Meter langen Tuch, unzählige Male um den Hals geschlungen, wie die beiden anderen ebenfalls eines tragen. Dies scheint der Umgebung hier geschuldet zu sein. Jojo, dem das Lächeln nicht entgangen ist und der es allem Anschein nach trefflich einzuordnen weiß, fügt hinzu:
»An sich heiße ich Johann Joachim, aber alle nennen mich …«
»Jojo«, flötet Laura.
»Wir sind«, fährt Jojo fort, »gekommen, dich bei uns willkommen zu heißen. Ist alles zu deiner Zufriedenheit? Kommst du mit dem Herd zurecht, ist das Bett auch bequem? Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Weißt du, wir machen hier nicht viel Aufhebens, wir kümmern uns um die kleinen Dinge des Lebens, die großen …«, er lacht, »die großen …, die kommen dann von ganz allein …« Laura findet die drei Besucher ausgesprochen sympathisch. Sie lächelt immerzu und bestätigt jede Frage mit Zufriedenheit. Alles sei im Lot, absolut tadellos, es sei ihr behaglich zumute, ganz wie zu Hause … Nur eine Kleinigkeit, eine winzige Kleinigkeit, die vermisse sie vielleicht doch. Sie habe ihre morgendlichen Pflichten beendet und könne sich nun gut vorstellen, sich mit einem Buch in aller Unschuld, sie lacht fast hysterisch bei dem Wort »Unschuld«, das habe sie irgendwo so gehört, das gefalle ihr, deshalb sage sie das einfach so, ja, »in aller Unschuld« könne sie mit einem Buch über den Tag kommen.
»Gibt es hier vielleicht eine Gelegenheit, ein Buch …?«
»Aber ja …«, erstmalig hat sich Jacques in die kleine Konversation eingemischt. Laura wendet ihren Blick dem schmalen Gesicht des Sprechers zu, der sein Halstuch abnimmt. Sein Hals wird dadurch nicht frei, da er darunter ein auberginefarbenes Rollkragenhemd trägt, darüber ein dunkles Wolljacket mit hochgeklapptem Revers.
»Wir haben nicht viele Bücher hier, aber einige kommen doch zusammen, und die meisten sind wundervoll erhalten, darunter ist sogar eines von Jojo!« Laura klatscht ungläubig in die Hände und ruft:
»Jojo, du schreibst!« Jojo weicht zur Seite und erzeugt, indem er den Kopf leicht neigt, einen leutseligen Eindruck. Er sagt:
»Einige kleine Gedichte …«
»Das ist ja wundervoll. Darf ich sie lesen?« Jacques scheint Jojos Verlegenheit zu bemerken und schaltet sich wieder ein:
»Falls du möchtest, kannst du gleich mit uns kommen. Wir zeigen dir alles und sehen nach, ob Jojos Büchlein gerade zur Verfügung steht. Falls nicht, besitzen wir daneben Bücher von Mateo, von Harry, von François und anderen.« Laura kennt François, von den anderen hat sie noch nie etwas gehört. Sollte das Buch von Jojo nicht da sein, hätte sie gerne etwas von … wie heißt er gleich noch mal … na ja, von einem, irgendeinem ihrer Lieblingsautoren gelesen. Sie sagt behutsam:
»Wenn wir tatsächlich gleich losgehen könnten, wäre das wunderbar.« Und spürt noch, ohne es konkret fassen zu können – einem Hauch aus einer fremden Welt gleichend – das Echo jener anderen, großen Namen.
»Dann lass uns gleich gehen!«, sagt Dhondu. »Du solltest dir vielleicht eine Jacke überziehen. Zu dieser Tageszeit ist es noch ganz schön frisch.« Wie selbstverständlich folgt Laura dem Rat. Und plötzlich holt Dhondu etwas hervor, das er die ganze Zeit hinter seinem Rücken versteckt hielt. Einen Schritt in Lauras Richtung setzend, sagt er:
»Darf ich?« Auf ihr Nicken hin schlingt er ein ähnliches Tuch um ihren Hals, wie er und seine beiden Begleiter es tragen. Dabei trabt er wie ein Kind im Kreis um sie herum und lacht. Das Halstuch, ein mattes Grün, passt gut zu Lauras brauner Jacke. Laura lacht und bedankt sich überschwänglich, worauf die kleine Gruppe zum Aufbruch drängt.
In der Gewissheit einer baldigen Rückkehr, verlässt sie ihr neues Heim und folgt ihnen. Im Freien atmet sie tief durch. Es ist eine wunderbare Luft. Von der Sonne, die noch recht niedrig steht, geht ein seltsam diffuses Zwielicht aus. Alle stecken ihre Hände wärmesuchend in die Jackentaschen, während sie in östlicher Richtung losmarschieren. Die Frau zieht den Kopf ein und kuschelt sich in die kleine Kostbarkeit um ihren Hals, als sei sie wieder ein Mädchen. Der nicht asphaltierte Weg gleicht einer Piste. Eine vereinzelte Windböe treibt die Selbstgewissheit des Mädchens in Staubwirbeln vor sich her. Die Häuser, an denen sie vorüber gehen, sind allesamt aus Lehm erbaut. Das Mädchen Laura gleitet in die Ratio der Erwachsenen zurück, als es sich fragt, ob später womöglich Sonnenhungrige auf den abgeflachten Dächern sitzen würden. Vor etwaigen Blicken wären diese durch meist vorhandene Balustraden geschützt. Die großen Abstände zwischen den Häusern geben die Sicht auf die dahinter liegenden Dünen frei. Nur selten verdecken Bauten in zweiter Reihe den Blick in die Wüste. Der verschwenderische Umgang mit potentiellem Baugrund erscheint der vollends Erwachsenen typisch für eine Gegend, in welcher der Boden keinen besonderen Wert besitzt. Es existiert kein abgetrennter Fußweg, ebenso wenig scheint es hier Fahrzeuge zu geben. Laura registriert das eher erleichtert als mit Bedauern. An einem größeren Gebäude erklärt Dhondu, er müsse sich leider von ihnen trennen, er habe noch etwas zu erledigen. Sicher sehe man sich des Abends im Bermuda-Dreieck. Er nickt ihnen zu und ist schon auf und davon. Laura sieht ihm nach, eine elegante Erscheinung. Selbst von hinten erkennt sie deutlich Dhondus stolzen, sehr aufrechten Gang. Nach wenigen Metern hebt sich die schlanke Gestalt kaum noch von der Umgebung ab, da seine Kurta, seine Hose sowie der Turban sich farblich kaum vom versandeten Weg unterscheiden. Schließlich wendet sie sich fragend an Jojo und Jacques:
»Bermuda-Dreieck? Was soll das sein?«
»Das ist unser Treff, eine Art Kneipe …«, antwortet Jojo.
»Und wo ist dieser Treff, kann ich da auch hinkommen?«
»Natürlich, und es ist nicht zu verfehlen«, mischt sich Jacques ein. »Du musst diesen Weg zurück, in Richtung Westen gehen, der letzte Bau rechter Hand, das ist das Bermuda-Dreieck.« Laura nickt und versucht, ein Bild von diesem Ort zu entwerfen, dem Treff mit dem seltsamen Namen. Jacques unterbricht sie:
»Wir sind gleich in der Kantine, wo wir dich den anderen vorstellen werden!« Womöglich ist der Gedanke aus der Scheu geboren, einer beachtlichen Menschenmenge vorgeführt zu werden oder er entspringt tatsächlich dieser ganz besonderen Umgebung und Stunde:
»Es würde mir nichts ausmachen, noch ein Stück zu gehen. Es ist ein derart wunderbarer Morgen!«, schwärmt Laura.
»Wir sind da!«, sagt Jacques, ohne auf Lauras Begeisterung einzugehen, öffnet eine einfache Holztür und lässt zunächst Laura und Jojo hindurch, bevor er selbst das Gebäude betritt.
Laura steigt ein wunderbarer Geruch in die Nase.
»Das riecht ja herrlich, wie in einer Bäckerei!«
»Ja«, bestätigt Jojo. »Unser Brot wird hier gebacken, wo es gleich nebenan die meisten Abnehmer findet. Du kannst dir übrigens nachher gern welches mit nach Hause nehmen …«
»Und wenn du Glück hast«, meldet sich Jacques, »kannst du dir außerdem ein Buch borgen, wie versprochen. Moment mal!« Sie haben einen Flur betreten mit drei abgehenden Türen. Die große führt geradeaus weiter, jeweils eine kleinere nach links und nach rechts. Jacques deutet zur rechten Tür und erklärt Laura, diese führe in besagte Bäckerei. Er öffnet die linke Tür, tritt ein und winkt Laura herein, während Jojo draußen bleibt. Nachdem Laura eingetreten ist, erkennt sie, dass Jojo vermutlich nicht nur aus einem Gefühl von Bescheidenheit nicht mitgekommen ist. Klein und fensterlos erinnert der Raum an eine Abstellkammer. Jacques hat eine bereitstehende Gaslampe entzündet. Lauras Augen gewöhnen sich nur langsam an das schummrige Licht. Jeder Zentimeter der Wände ist mit Regalen bestückt. Die Zahl der Bücher darin schätzt Laura auf etwa hundertundfünfzig. Die restlichen Regale sind bis zum Brechen vollgestopft mit Heften oder Akten. Auf dem Boden stehen weitere Hefte, zu Bündeln geschnürt.
»Herrje, was sind denn das für Papierstöße?«, entfährt es ihr.
»Das sind unsere Protokolle!«, sagt Jacques.
»Was für Protokolle?«, fragt Laura, tut einen Schritt nach vorne. »Darf ich mal reinschauen?« Bevor Jacques antworten kann, hat sie schon nach einem Heft gegriffen und die erste Seite aufgeschlagen. Sie liest: ›Erste Sitzung von Theodosia, protokolliert von Andras. Theodosia ging ohne Umschweife…‹ Wer mag diese Theodosia sein, denkt Laura, als unerwartet eine Hand von hinten nach dem Heft greift und es Laura sanft, aber bestimmt entwindet. Eine Stimme sagt:
»Du wolltest dir doch das Buch von Jojo mitnehmen, das ist mit Sicherheit eine schönere Lektüre als die langatmigen Protokolle unserer Sitzungen …« Jacques legt den Hefter auf den nächstbesten Stoß und rückt zur Seite, weg von Laura, die nicht lockerlässt:
»Was sind das für Sitzungen?«
»Die wirst du noch früh genug erleben. Sieh nur, was für ein Glück du hast, eine Riesenauswahl an Büchern!« Laura versichert sich mit prüfendem Blick, keine Bücher übersehen zu haben. Dann sieht sie in Jacques’ schmales Gesicht, seine Miene deutet auf eine ernst gemeinte Aussage hin. Er blickt sich kurz um und sagt:
»Jojos Buch scheint nicht da zu sein.«
»Wie konntest du das derart schnell sehen?«
»Ich war schon sehr, sehr oft hier …« Jacques vollführt eine Geste, die Laura als Einladung versteht, sich näher umzusehen. Sie betrachtet die Bücher eingehender, nimmt eines in die Hand und blättert darin. Anschließend widmet sie sich einem zweiten und einem dritten Buch, vergisst ihren Begleiter. Etwas länger verweilt sie bei dem Buch von jenem von Jacques erwähnten Harry: Der falsche Prinz. Leben und Abenteuer des Harry D. Sie entscheidet sich für dieses eine Buch, zwei oder gar mehrere mitzunehmen erscheint ihr angesichts der Knappheit wie ein Sakrileg.
»Eine interessante Wahl«, kommentiert Jacques und löscht die Gaslampe. Beide treten in den Flur zum wartenden Jojo, der Laura zulächelt.
»Dein Buch war leider nicht da!« Jojo zuckt mit den Schultern und lässt Laura den Vortritt, nachdem er die große Tür geöffnet hat. Sie betritt einen gut besuchten Saal, der Neuankommenden nur noch Restplätze offeriert. Ein unbestimmtes Rauschen von zahlreichen halblaut geführten Gesprächen füllt den Raum. Keiner der Frühstücksgäste sitzt allein. Laura zögert, weiterzugehen. Da kommt Jacques, der schon ein Stück vorausgegangen war, zurück und führt Laura nach vorne. Niemand kümmert sich um die Neuankömmlinge. An der Theke, wo eine Frau und ein Mann offenbar den Service bestreiten, versucht Jojo nicht etwa diesen in Anspruch zu nehmen, sondern die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, was ihm nach und nach gelingt. Die Unterhaltung schwillt ab. Jojo hebt an:
»Ich will nicht lange stören, doch möchte ich euch die Neue vorstellen, das ist Laura! Laura wohnt in dem Haus neben Judge-Joe und scheint ein angenehmer und fröhlicher Mensch zu sein. Ich möchte, dass ihr Laura begrüßt!« Daraufhin ruft jedermann Laura irgendwelche Begrüßungsworte zu. Nichts ist abgestimmt. Es gibt kein Ritual, keine Formel, keinen Puffer, nichts, was Koordination oder Ordnung mit sich bringen würde. Laura ist überwältigt. Während sie ihre Verunsicherung mit einem Lächeln zu überspielen versucht, vergleicht sie den Zustand im Saal mit einem von Kindern verursachten heillosen Durcheinander. Spürt dann doch, wie verkrampft ihr Lächeln wirken muss. Die Hände an die Außenseiten ihrer Oberschenkel gepresst, blickt sie verwirrt zu ihren beiden Begleitern. Jacques grinst, Jojo lächelt, fast gleichzeitig kommentieren sie:
»Sie mögen dich!«
Nur wenig Zeit hat sie heute mitgebracht, deshalb kann ich gleich weiterschreiben und muss nicht bis morgen damit warten. Sie hat bloß ein paar Kleinigkeiten in der Küche erledigt und ein bisschen hier und da herumgeräumt. Das nervt einerseits, hilft aber natürlich gleichzeitig. Ja, die ist schon nett, umsorgt mich wie ein Kind. Warum tut sie das? Wahrscheinlich plagt sie eine Art Fürsorglichkeitssyndrom. Zurück zu dir, wo war ich stehengeblieben? Ach ja, die Reisefreizügigkeit.
»Sie müssen sich bei Ortsabwesenheit abmelden!« Lach nicht, warte, wenn ich dich zwischen die Finger bekomme, Gnade dir Gott, ach was, der hilft keinem, der ist so was von tot, so was von. Diese Ortsabwesenheitsgeschichte war Teil der arbeitsagentürlichen Belehrung, die mir samt dieser Eingliederungsvereinbarung untergejubelt wurde. Stand doch tatsächlich »…vereinbarung« da, von wegen Vereinbarung. Das müsse ich unterschreiben. Und wenn nicht? Tja, in dem Fall begänne die Arbeitslosigkeit mit einer Sperre, erst mal sechs Wochen keine Knete. Gib zu, das sind deine Regeln. Das ist so richtig nach deinem Herzen, voll die Kante! Nach deiner Pfeife zu tanzen, das genügt dir nicht. Du liebst es, die Menschen darüber hinaus zu verarschen. Aber mit mir nicht, habe den Wisch genommen, den zweiten Teil durchgestrichen und mit »…zwangsbescheid« ersetzt. Daraufhin habe ich den Eingliederungszwangsbescheid unterschrieben. Und den Gedanken ausgeblendet, ob das irgendwelche Folgen nach sich ziehen könnte, indem vielleicht die Knete ausblieb. Doch alles verlief glimpflich. Die paar Kröten, die mir zustanden, habe ich überwiesen bekommen. Allerdings musste ich Monate später sehr schmerzhaft erfahren, dass diese Eingangsbelehrung, speziell die Geschichte mit der Ortsabwesenheit, nicht ohne war.
Einen Tag nachdem du diesen Autofahrer geblendet hast, der dann meine Mutter angefahren hat, bin ich zum Amt und habe Ortsabwesenheit, sprich: Urlaub angemeldet, weil ich zu ihr ins Krankenhaus in einer entfernten Stadt fahren wollte. Bin allerdings nur zwei Tage geblieben und das in den folgenden Wochen noch mehrmals, immer schön abgemeldet. Natürlich habe ich jedes Mal innigst gehofft, die Mutter möge wieder aus dem Koma erwacht sein, zumindest während der ersten beiden Wochen. Ein Ereignis in dieser Zeit hat mich besonders erschüttert. Ich stand etwas schüchtern bei der Mutter, als eine Krankenschwester kam und die Kanüle am linken Unterarm ersetzte. Wir begrüßten uns, als nächstes ermunterte sie mich, laut mit meiner Mutter zu reden. Sie könnte wach werden, wenn sie eine vertraute Stimme hörte. Wie das? Medizinisch stünde einem Aufwachen nichts im Wege. Ich traute meinen Ohren nicht. Dem Erwachen stand vom medizinischen Standpunkt nichts entgegen, wie konnte das sein? Verdammt … Ja, natürlich, jetzt bin ich klüger, jetzt weiß ich, wer die Schuld daran trägt, dass sie den Weg zurück in diese Welt nicht finden konnte. Und warum hat mich der zuständige Arzt nicht über diesen Umstand aufgeklärt? Egal wie, ich glaubte daran, es könnte gelingen, sie zurückzuholen. Zunächst schüchtern, weil ich’s etwas merkwürdig fand, in einem deutschen Krankenhaus italienisch zu reden. Aber natürlich stand ich dazu. Wir lebten zwar seit Jahrzehnten in diesem Land, und ich war mit einer Deutschen zusammen, ungeachtet dessen waren wir immer noch Italiener. Schließlich ermutigte ich mit immer festerer und lauterer Stimme, meine Mama zum Zurückkommen. »Wir lieben und wir brauchen dich«, wiederholte ich und sie möge keine Angst haben, alles würde gut werden, sie müsse nur wach werden. Doch vergeblich redete ich auf sie ein, sie rührte sich nicht. Nur einmal, als ich zum wiederholten Mal fragte, »Mama, hörst du mich«, glaubte ich ein fast unmerkliches Nicken wahrzunehmen. Aber die Wiederholung dieser Frage enttäuschte, nichts war zu sehen. Ich musste mich getäuscht haben. Nach ungefähr zehn Tagen wurde ich vom verantwortlichen Arzt darüber informiert, sollte die Mutter je wieder erwachen, bestünde die Gefahr eines Hirnschadens. Trotzdem versuchte ich es weiter, sie wachzurütteln, bin mir jedoch nicht sicher, ob ich es noch ehrlich meinte. Das hast du mir eingepflanzt, diesen Zweifel, diesen Keim einer Schuld. Ja, das ist eine deiner Spezialitäten, die kleinste Unsicherheit, die uns Menschen trifft, nutzt du aus, Zweifel zu nähren. Keine Gelegenheit lässt du aus, uns aus der Bahn zu werfen, unser mühselig aufgebautes System der Selbstversicherungen zu zerstören, das wir dringend benötigen, um uns zu schützen vor all den Angriffen gegen unsere Selbstbehauptung und letztlich gegen unsere Integrität. Oft genug steht dieses selbstgezimmerte System auf wackligen Beinen. Stimmen die Grundlinien unseres Lebens mit unseren Vorstellungen überein, dann kann das ein durchaus solides Gebäude sein und ein jeder von uns fühlt sich als ein hinreichend begabter Architekt seiner Zufriedenheit. Manches Mal jedoch, wenn winzige Abweichungen von unserem Weg, deren Wurzel vielleicht noch aus der Verletzlichkeit der Kindertage herrührt, einen Wind entfachen, der zwar die Standfestigkeit unseres inneren Gebäudes nicht wirklich bedrohen kann, aber doch die Angst schürt, er könnte zu einem Sturm anwachsen, der sehr wohl die Festigkeit der Mauern ernsthaft prüfen könnte, dann ist deine Zeit gekommen. Besteht nur die geringste Möglichkeit, ergreifst du sie. Diese kleine Unsicherheit, vom Tod meiner geliebten Mutter nicht mehr zu trennen, wird mich mein Leben lang begleiten, kein Sturm, nur ein stetes Lüftchen, ein Windchen, das sich jederzeit in einen Orkan wandeln kann.
Wie gesagt, einige Male habe ich meine Mutter besucht, mit höchstoffizieller Erlaubnis. Dann habe ich es einmal, ein einziges Mal gewagt, loszufahren, ohne mich abzumelden. Vier Wochen nachdem du Ungeheuer diesen Autofahrer geblendet hast, bin ich los. Ein letztes Mal wollte, sollte ich sie sehen, letzte Möglichkeit vor der absoluten Sackgasse. Was interessierte mich da die Ortsabwesenheitsmeldepflicht. Die finale Möglichkeit, da wurde aus der vorigen Ahnung deiner Existenz schon fast eine Gewissheit. Klar, dass du das eingefädelt hast. Hast ihnen einen Tipp gegeben. Der Bursche ist weg, verreist. Von wegen verreist. Unter »verreisen« verstehe ich etwas anderes. Das da, das war nicht mal mehr ein Krankenbesuch, das war der ultimativ letzte Besuch. Einmal noch habe ich ihre – schon kalt werdende – Hand gestreichelt, ihr ehemals schönes, nun aufgedunsenes und fleckiges Gesicht zärtlich berührt. Bis zum Hals war ihr vom Nierenversagen aufgeschwemmter Körper bedeckt. Verflucht noch mal, ich war lange kein Kind mehr, hatte selbst schon zwei, aber es war verdammt noch mal zu früh. Mein Vater, ihr Mann, mochte diesen letzten Gang nicht mehr tun. Ihm blieb zudem die Nachricht erspart, der Körper der geliebten Frau würde obduziert werden. Diese Handlungsweise sei vorgeschrieben nach einem Unfall mit Todesfolge und verspräche wissenschaftliche Erkenntnisse, da die Unfallverletzungen selbst zum Tode nicht hätten führen müssen, ein Rätsel. Mit dieser letzten Frage hast du mich sitzen lassen – ich bin ihr nie nachgegangen – und verhöhnst mich noch obendrein. Was ich wolle, es sei doch immer zu früh. Das eben übe den Reiz aus. Ja, das sieht dir ähnlich, das bist du. Je mehr wir leiden, je unerwarteter du uns triffst, umso mehr lebst du auf.
Sie haben mich also ertappt. Ortsabwesenheit ist eine Todsünde und wird mit hundert Prozent Abzug bestraft! Ich habe den Totenschein vorgelegt. Dafür könnte ich mich heute noch ohrfeigen. Intuitiv habe ich gleich gespürt, es stimmt irgendwie nicht. Ich hab’s auch nicht wegen des Geldes gemacht, sondern um denen zu zeigen, es gibt Wichtigeres als ihre Ortsabwesenheitsmeldepflicht. Das hatte etwas mit Würde zu tun. Und genau die habe ich mit dieser Tat selbst verletzt. Dass es bei der Strafe des Geldabzugs blieb, hat mir ein wenig über meine Scham hinweggeholfen. Habe mich im Grunde selbst bestraft und das tut im Sinne einer perversen, masochistischen Logik gut. Ja, du Schwein, das ist ein Schmankerl für dich, uns die Würde zu nehmen. Dafür hasse ich dich am meisten. Permanent hast du an meinem Selbstwertgefühl gebohrt und gerüttelt, hast mich verletzt, hast mich kleingemacht. Das kann nur einer, der weder Selbstachtung noch Würde besitzt. Jetzt aber kriegst du alles zurück. Ich mach dich platt. Die Würde kann ich dir nicht nehmen, weil vermutlich an ihrem Platz bei dir eine Pestbeule dein ohnehin abscheuliches Äußeres verunstaltet. So spucke ich dir ins Gesicht, von allen Wesen bist du das niedrigste, du bist ein Wicht, ein Nichts, das so manches Mal versucht, uns zu täuschen, indem es sich wie ein unschuldiges Kind gebärdet. Doch auch ein böses Kind, das um sich schlägt, um Aufmerksamkeit zu erregen, bist du nicht, weil alles Kindhafte an dir abprallt. Du hast Glück, ich darf mich nicht derart aufregen. Das sagt sie auch immer, es schade mir selbst. Vermutlich hat sie Recht, und ich sollte vorerst ablassen von diesen Gedanken und den Brief beiseiteschieben. Bevor ich mich weiter aufrege, sollte ich lieber eine Pause einlegen, besser noch ein Nickerchen.
»Hey Leute, kommt her! Kommt alle mal her! Ein Neuer!« Ein Haufen verwegen aussehender Gestalten kommt auf den Rufer zugerannt. Und bevor sie ihn erreicht haben, versuchen sie, mit ihren Blicken seiner waagrecht erhobenen Hand folgend, den Angekündigten zu erspähen. Im Nu haben sich um die hundert Personen eingefunden. Alle sind unterschiedlich gekleidet, mit Ausnahme eines meterlangen, meist hellen Halstuchs. Insgesamt ein Bild wie auf einem Kostümfest, vom mittelalterlichen Wams samt Pluderhose über die eng anliegende gefranste Leggins und die Wildlederjacke eines Waldläufers bis hin zu T-Shirt und Jeans ist alles vertreten. Der Poncho aus Wolle, den eine Frau trägt und die indische Kurta eines Mannes aus dem gleichen Stoff deuten auf eher frostige Temperaturen hin. Prägend hingegen ist die Djellabijah, das traditionelle Gewand der Wüstenvölker. Die Menschen schreien ungezügelt durcheinander wie in die Pause entlassene Kinder auf dem Schulhof:
»Wo denn …Ich seh nichts … Vielleicht könnt ihr mal …« Die meisten von ihnen drängen sich eng an den Mann, dessen Ruf sie gefolgt sind. Eingezwängt sieht er sich genötigt, seinen Arm zu senken:
»Wartet mal, ich seh ja selbst nichts mehr … Drängelt doch nicht … So geht doch ein wenig zur Seite … Wartet!«
»Seht nur, wie er stolpert!«, schreit jemand.
»Er rappelt sich wieder auf«, schreit ein anderer.
»Er will es nicht glauben«, schreit ein Dritter.
»Irgendwann wird er es schließlich begreifen …«, sagt derjenige, der die ganze Meute angelockt hat.
»Er probiert er es auf allen Vieren …«, ruft eine Frau.
»Ob das das Richtige ist?«, kommt der Zweifel aus der Schar.
»Glaub ich nicht.« Ein anonymer Widerruf, der gleich Recht erhält. Der Beobachtete ist wieder im Sand der leicht ansteigenden Düne weggerutscht, liegt auf dem Bauch, verdutzt, offensichtlich nicht wissend, was zu tun sei. Die Energie für einen neuerlichen Anlauf scheint ihm zu fehlen.
»Na los!«, wird er aus der Menge heraus angefeuert. Vergebens, der Neue kann die Rufe nicht hören, noch hat er die Schwelle nicht erreicht. Wieder kommt er ihr einige Meter näher. Mühsam hat er sich aufgerichtet, stolpert weiter.
»Gleich stürzt er wieder«, ruft es. Keine waghalsige Prognose, die den Mann dennoch einem Baume gleich zu fällen scheint.
»Da liegt er wieder auf der Nase.« Die Bestätigung kommt lapidar, keine Spur von Schadenfreude.
»Es ist doch echt nicht zu glauben, dass er es nicht begreifen kann. Mit ein wenig Einfühlungsvermögen muss er doch merken, welche Gangart für ihn die beste ist.«
»Du hast leicht reden, Laura, warst du selbst denn sensibel genug, es gleich zu merken und anzunehmen …?«
»Du hast Recht, Douglas, ich hab auch eine Zeitlang gebraucht, es zu akzeptieren … natürlich«, antwortet sie in normaler Lautstärke, da sich die Gruppe etwas beruhigt hat. Sie greift in ihre Haare und streift sie nach hinten zusammen zu einem Zopf, den sie mit einer Hand festhält, um den Wind daran zu hindern, die Haare weiter durcheinanderzuwirbeln. Als nächstes schiebt sie ihr Halstuch als Schutz vor dem feinen Sand über die Nase. Douglas und die meisten anderen tun es ihr gleich.
»Es geht los!«, ruft es aus der Gruppe. Überflüssigerweise, jeder kann den Wind spüren und weiß, was er zu bedeuten hat.
»Endlich hat er es begriffen«, ruft Douglas aus. »Seht nur, er schlängelt sich dahin wie ein Wurm!« Der Neue hat sich auf den Boden gelegt. Er winkelt die Beine an, drückt seine Oberschenkel mit der Innenseite auf den Boden und stößt seinen Oberkörper mit den Knien mühselig nach vorne. Dabei belässt er die Arme am Körper, anstatt die Ellbogen einzusetzen, um damit zu robben.
»… Ja, es geht mühsam, aber doch voran …« In der Zustimmung der Bemerkung liegt ihr Überhörtwerden durch die Gruppe.
»Gleich, gleich bist du drin«, sagt Laura, als wolle sie den Neuen antreiben. Der spuckt gerade etwas Sand aus und schiebt sich mit zusammengebissenen Zähnen weiter. Der Wind ist stärker geworden. Soweit Laura das erkennen kann, gilt dies nur diesseits der unsichtbaren Barriere. Die Gruppe ist noch enger aneinandergerückt, ein Bollwerk des Bewusstseins, des Wissens seiner zeitlichen Begrenztheit: Im Moment des Höhepunkts des dann zum Sturm angewachsenen Windes würde er abbrechen. Die Pforte würde sich wieder schließen. Unsichtbar wirksam. Mit bloßem Auge nicht zu erkennen.
Das Tal, das größtenteils von Sand bedeckt ist und ein Teil der ihn umschließenden Dünen, würde wieder abgetrennt sein, abgeschlossen von der übrigen Welt. Hermetisch, selbstvergessen, verschanzt in seiner Abgeschiedenheit. Der stärker werdende Wind zerrt an den Haaren der Leute. Und raubt jedem Einzelnen fast den Atem. Es scheint sie jedoch nicht sonderlich zu stören, vielleicht, weil sie zu sehr abgelenkt sind in der Beobachtung des Mannes jenseits der Barriere.
»Nur noch wenige Meter«, ruft jemand.
»Er schafft es!«, ruft Douglas.
»Er scheint an der Sperre angelangt zu sein«, sagt Laura.
»Hoffentlich begreift er, dass er kurz warten muss«, sagt jemand. Die meisten Mitglieder der Schar zappeln aufgeregt auf der Stelle, als müssten sie Wasser lassen, ein seltener Vorgang, da in dieser Umgebung jeder Tropfen Flüssigkeit vom Körper dankbar angenommen und verwertet wird.
»Bestimmt tut er das, hat er doch längst«, sagt Douglas.
»Was soll das denn jetzt?!«, kommt es überrascht aus der Menge. »Er muss sich noch kurz gedulden«.
»Nein, warte noch einen Augenblick!« Laura schreit, in dem Wunsch, der wie eine Schildkröte immer wieder gegen die Sperre andrückende Mann könnte sie hören oder gar verstehen, so laut sie dazu imstande ist. Wieder und wieder prallt er mit der Schulter, wobei er mit dem Kopf rechtzeitig vor dem Stoß zur Seite zuckt, gegen das unsichtbare Hindernis. Irgendwann hält er in seinen Anstrengungen inne, liegt da. Alle Zuschauer glauben in seinen Gesichtszügen das Bemühen herauszulesen, unbedingt eine Lösung, einen gangbaren Weg zu finden. Er steht auf, einige schnelle Schritte nach hinten, und dann unvermittelt das Losstürmen mit all der noch verbliebenen Energie. Gegen das unsichtbare oder doch nahezu unsichtbare Schild. Ein schwaches Flimmern verrät dem aufmerksamen Beobachter seine Anwesenheit. Im allerletzten Moment vor dem Aufprall schiebt der Mann eine Schulter nach vorne, als wolle er eine Tür aufbrechen. Dem ersten folgen weitere identische Anstrengungen, mit dem Unterschied, dass die nach vorne geschobenen Schultern einander abwechseln. Mal ist es, wie beim ersten Anrennen, die linke, als nächstes die rechte, wieder die linke … Einige der Zuschauer zucken im Augenblick des Aufpralls zusammen und ziehen erschreckt ihren Kopf ein. Nach bald einem Dutzend Versuchen hält der von der Mehrzahl der Menge solcherart Bemitleidete inne. Er schüttelt den Kopf.
»Er gibt auf!«, schreit jemand.
»Nein, das darf er nicht«, schreit Laura.
»Er hätte dabei bleiben sollen, sich wie eine Schildkröte fortzubewegen«, sagt jemand.
»Er hat sich abgewendet«, sagt Douglas. Seine Worte, die nicht sehr laut gesprochen sind, gehen in dem allgemeinen Geraune und Gemurmel, dem Enttäuschung anhaftet, fast unter. Jemand sagt:
»Er sollte es noch mal probieren.«
»Zu spät«, sagt Douglas, und ein jeder in der Gruppe spürt den abflauenden Wind und weiß, wie sehr er Recht hat. Die Chance ist vertan. Möglicherweise ergibt sich in Kürze eine neue, sicher ist es nicht. Fürs Erste jedenfalls ist es vorbei. Der Haufen zerfällt in gleichgültige Einzelteile, die in ihrer Buntheit vom Einerlei der Sandfarbe abstechen.
»Kommst du noch mit rüber ins Bermuda-Dreieck?«, fragt Douglas Laura. Er kümmert sich genauso wenig wie seine ebenfalls aufbrechenden Gefährten um den, der sich außerhalb der Sperre wieder aufrichtet. Dieser entfernt sich taumelnd immer weiter vom Ort seiner Niederlage weg, hinaus in die Wüste, den Dünen entgegen, ein für Klischees taugliches Bild der Einsamkeit. Die Breite seines Rückens verrät nichts über das Gewicht der Bürde, so er eine trägt. Statt einer Antwort, und bestünde sie nur in einem Kopfnicken, drückt sich Laura um die Spur enger an Douglas, die notwendig ist, um die kurze Wegstrecke im Gefühl der Gemeinsamkeit zurücklegen zu können. Laura sagt, und ihre Stimme wirkt bedrückt:
»Was wird mit ihm?«
»Er wird sich entscheiden müssen!« Laura ist keineswegs sicher, ob sie den Sinn dieser Aussage versteht. Ihr Inneres wehrt sich in Form des Gedankens, dass selbst ernsthafte Absichten an objektiven Hindernissen scheitern können, gegen jegliche tiefere Einsicht.
Ich habe eine Mordswut auf dich. Mischt du dich jetzt auch noch in ihr Leben ein? Reicht es dir nicht, meines zu zerstören? Musst du nun noch den letzten Menschen kaputtmachen, der es gut mit mir meint?! Allerdings muss ich sagen, manchmal meint sie es zu gut mit mir, und gelegentlich ist sie ein wenig eigenartig. Heute zum Beispiel hat sie doch tatsächlich behauptet, sie sei meine Tochter. Zuerst hat es mich fast umgehauen, dann war ich kurz davor, sie rauszuschmeißen. Ich wüsste doch wohl, wie meine Tochter aussieht, hätte ich eine. Dabei hatte ich mal eine Tochter, doch das ist lange her. Wer weiß, wo die jetzt steckt. Ich hatte auch einen Sohn, aber den habe ich nie richtig kennen gelernt. Die Beziehung mit der Mutter ging in die Brüche, bevor er noch eingeschult wurde. Ich weiß noch, was für ein hübsches Baby er war, fast noch hübscher als Jahre zuvor unsere Tochter. Sie war ein wenig pummelig, doch streckte sie sich allmählich und wurde schöner und schöner. Und sie hatte dunkles, fast schwarzes, gelocktes Haar, das sie lang trug, wie ihre Mutter. Die junge Frau, die immer zu mir kommt, hat zwar auch Locken, jedoch in einem Rotton, vermutlich Henna, und recht kurz. Und sie hat so gar keine Ähnlichkeit mit meiner Tochter … Wenn ich genau hingucke, sieht sie vielleicht ein wenig wie meine Geschiedene aus, nur so ganz oberflächlich. Doch was erzähl ich?! Vielleicht war das ja gar nicht schlecht, hat mich ein wenig von meiner Wut weggebracht, ich muss ja aufpassen, der Blutdruck … Aber hoher Blutdruck hin oder her, ich muss dich eindrücklich warnen, du lässt die Finger von ihr. Ihr ist da etwas passiert, das trägt eindeutig deine Handschrift, die Arme. Auch wenn ich glaube, sie nimmt die Sache zu ernst. Trotzdem muss ich dich warnen, sollte ich herausfinden, dass du damit etwas zu tun hast, dann werde ich wirklich sauer, ich werde dich zermalmen. Ich werde dir so lange die Fresse polieren, bis sie nur noch Matsch ist. Das ist echt zu viel! Sie sagt, ihr Bruder sei nicht nach Hause gekommen, die ganze Nacht sei er weggeblieben und bis jetzt nicht wieder zurück. Wie alt er überhaupt sei, habe ich sie gefragt. Vierzehn, hat sie geantwortet und da die Eltern sich nicht um ihn kümmern könnten, besorge sie das – mit dem Segen vom Jugendamt. Früher sei sie ja viel gereist, da hätte sie so eine Verpflichtung abgelehnt, aber jetzt mache sie das sehr gern. Und bislang habe alles wunderbar geklappt.
Was den mit den Eltern sei, habe ich nachgehakt, dass sie sich seiner nicht annehmen könnten.
»Ach, sie sind … krank«, hat sie geantwortet. Ob das für beide gelte, wollte ich wissen.
»In gewisser Weise schon … Das ist kompliziert.« Jedenfalls sei ihr Bruder, wie sie es ausdrückte, »ein ganz tougher Typ«.
Bei der Polizei sei sie nicht gewesen, weil sie Angst habe, das Jugendamt könnte sich einmischen und dann müsste ihr Bruder ins Heim. Das wolle sie unbedingt vermeiden. Praktisch betrachtet sei sie doch der einzige Mensch, den der Junge habe. Ich habe versucht, so gut ich’s eben kann, sie zu trösten. In dem Alter könne ein Junge schon mal eine Nacht wegbleiben. Ich fragte sie, ob das schon einmal passiert sei. »Nein«, sagte sie und war ganz aufgelöst und fahrig. Sollte ihr Bruder heute nicht wieder auftauchen, dreht sie mir noch durch, fürchte ich. Solltest du etwas damit zu tun haben, sorg dafür, dass der sich wieder einfindet. Von mir aus kannst du mich piesacken, aber lass das Mädel und ihren Bruder in Ruh’. Hey, hörst du mich, du alter Stinkstiefel, du Sackgesicht, du Fiesling, du Unheilsbringer du. Ich wünschte, Worte könnten töten … Die Angst um die junge Frau und ihren Bruder und die Schimpferei haben mich ermüdet, ich hab’s satt, ich mach mich lang, die Couch ruft, genug für heute.
Das Lokal erinnert zunächst an einen Saloon aus Westernfilmen. Dieser Eindruck verblasst rasch wieder, hat man erst einmal die Schwingtür durchschritten. Auf der dem Eingang gegenüberliegenden Seite zieht sich ein Tresen über die gesamte Breite des Raumes hin, gut und gern zehn Meter; nur die Breite der Toilettentür auf der linken Seite ist ausgespart. Rechts befindet sich innerhalb des Barbereichs eine weitere Tür, die vermutlich zur Küche führt. Der Ankommende hat beim Eintreten sofort die Bar im Blickfeld und kann den Barmann grüßen, wie dies Douglas gerade tut. Gleich neben dem Eingang, stehen zwei kleine Tische mit jeweils drei Stühlen an der Wand. Beliebte Plätze, die meist, wie auch gegenwärtig, besetzt sind. Doch beileibe nicht so beliebt wie die Tische an der gegenüberliegenden, der rechten Wand, die auf einer von einem Holzgeländer eingefassten Empore stehen. Vier kleine, jeweils für zwei Gäste vorgesehene Tische, die ebenfalls, wen wundert’s, schon besetzt sind. Nachdem Douglas hallo gesagt hat, stehen Laura und er für Augenblicke unschlüssig da, lassen ihre Blicke schweifen. Aus der Mitte des Raumes schält sich ein an Douglas gerichteter Begrüßungsruf, den dieser freundlich beantwortet. Laura kennt wenige, Douglas dagegen ausnahmslos alle Anwesenden zumindest vom Sehen. Bestimmten Blicken weicht er aus. An einem Dutzend Tischen sitzen, bis auf wenige Ausnahmen, jeweils zwei und mehr Leute. Die größte Gruppe sitzt an einer durch ihre Länge von etwa sechs Metern schmal wirkenden Tafel unterhalb des Podests auf der rechten Seite; vermutlich eine Art Stammtisch. Douglas ruft dem kleinen, sehr blassen Mann hinterm Tresen eine Bestellung zu. Daraufhin steuern sie einen der leeren Tische in unmittelbarer Nähe des Tresens an. Zwischen den einzelnen Tischen und Stühlen ist genügend Raum, die Sitzenden im Vorübergehen nicht zu stören. Nichtsdestotrotz drehen sich Gesichter nach ihnen um, Hallos werden ausgetauscht. Von einem der Tische ruft es laut:
»Hallo ihr Turteltäubchen, wollt ihr noch nicht ins Bettchen?« Ein herzhaftes Gelächter schließt sich an, in das die drei Tischgenossen des Spötters einfallen. Laura versucht, den Rufer zu ignorieren, Douglas sagt laut:
»Hallo Lucky, keine Zigaretten mehr?« Lucky verstummt sofort, wie durch einen Schlag unterhalb der Gürtellinie. Auch seine Tischgenossen hören auf zu lachen.
Douglas und Laura sind inzwischen an einem leeren Tisch angelangt. Kaum sitzen sie, kommt schon der Barmann mit den Getränken und stellt sie kommentarlos ab.
»Hallo Harry«, begrüßt Douglas ihn. »Seit wann trägst du denn den flotten Schnurrbart?«
»Seit ein paar Tagen«, antwortet Harry grinsend. »Wollte mal in eine andere Haut schlüpfen.« Ganze zwei Sekunden überlegt Douglas. Dann, als er hinter Harrys fein geschnittenem Gesicht jenes fast vergessene aus der anderen Welt entdeckt, erwidert er Harrys Grinsen.
»Das Errol-Flynn-Bärtchen steht dir echt gut, und es passt zu dir!«, sagt Douglas und spürt der Wirkung nach, die Harrys Schnauzer auf ihn ausübt: irgendwie vertrauenerweckend und gleichzeitig gaunerhaft.
»Wie soll ich dich jetzt nennen – Errol oder Harry?«
»Das kannst du halten, wie du willst.« Sagt’s und zieht sich immer noch grinsend zurück.
Laura sieht dem Barmann nach, dann sagt sie:
»Was sollte das eben mit den Zigaretten? Diesem Lucky ist wahrlich die Spucke weggeblieben … «
»Ach komm, du wirst doch wohl wissen …«, hebt Douglas forsch an. Als er jedoch erkennt, dass sie wirklich nicht zu wissen scheint, was diese Andeutung sollte, fährt er behutsamer fort:
»Eigentlich ist es nicht wichtig … So ’ne Art running gag …«
»Und worin besteht der?« Da schwingt die Saloontür auf, und Henry kommt mit einem jungen Mann, seinem Sohn, wie Douglas weiß, und acht weiteren Kameraden herein. Die Truppe ist bei jedermann sehr beliebt und ein allgemeines Hallo und Trara hebt an, in das Douglas einstimmt. Ein an Henry gerichteter flotter Spruch wird in gleicher Weise pariert. Stühle werden gerückt, endlose Minuten wird gepoltert, bis die Gruppe am Stammtisch, Platz gefunden hat. Herzliche Worte des Wiedersehens werden ausgetauscht. Fast ehrfürchtig begrüßen Henrys Begleiter den Mann an der Stirnseite, mit dem Henry selbst einige Worte wechselt, bevor er sich an die andere, bisher noch freie Stirnseite setzt. Sie sind die einzigen, die eine Halskrause tragen. Douglas kennt nicht nur Henry gut, sondern auch Mateo, wie der andere heißt. Sie sind sich äußerlich überhaupt sehr ähnlich. Das Auffälligste an ihnen neben den Halskrausen sind die gepflegten Schnurr- und Kinnbärte. Doch wirkt Henry insgesamt etwas weniger aristokratisch als Mateo. Erklären lässt sich dies vermutlich durch den Umgang mit seinen Begleitern, rauen Burschen. Von ihnen weiß Douglas nur so viel, dass sie mit Henry und seinem Sohn bei einem Massendurchbruch ins Tal gekommen und Matrosen des früheren Schiffskapitäns Henry sind.
Mateo scheint aus anderem Holz geschnitzt zu sein. Er hat sich, den Rücken zur dem Tresen gegenüberliegenden Wand, an die Stirnseite des langen Tisches gesetzt. Die Platzwahl rückt die überaus elegante Erscheinung seiner Gestalt mit der hohen Stirn, besagtem gepflegten Schnurr- und spitzlaufenden Kinnbart, dem kurzen Haar, das nach vorne gekämmt in einem widerborstig wirkenden Haarbüschel ausläuft, ins rechte Bild. Seine wachen Augen und die große, gebogene Nase unterstreichen den bemerkenswerten äußeren Eindruck, den die leicht abstehenden Ohren nicht beeinträchtigen können. Wie jedes Mal, wenn Douglas, ob von Nahem oder von Weitem, auf Mateo trifft, denkt er, nichts liege dieser Präsenz ferner als jegliche Form von Vagabundentum. Er behält diese Überlegung für sich, Laura soll sich ihr eigenes Urteil über die Menschen hier bilden können, denkt er und sagt möglichst beiläufig:
»Wollen wir vielleicht ’ne Kleinigkeit essen?«
»Douglas!!!«, kommt es laut und gereizt von Laura. »Wolltest du mir nicht gerade einen Zigarettenwitz erzählen …?«
»Ich glaube, das wäre nicht so passend«, sagt Douglas betont vertrauensselig. »Das ist … äähhh … eine Art Männerwitz …«
»Hältst du mich für ein Kind …. oder für prüde?«
»Nein … aber …«
»Douglas, du nimmst mich jetzt bitte ernst und erzählst mir sofort, was das mit den Zigaretten bedeutet. Kein Witz, nicht wahr?!«
»Doch, ein Witz, aber einer von der Sorte, die ans Eingemachte gehen!«
»Inwiefern?«
»Du weißt wirklich nicht, was es mit den Zigarettenholern auf sich hat?«
»Sollte ich das?«
»Nein, aber gerade dann, solltest du nicht darauf bestehen … Es gibt auch schädliches Wissen … Nein, nicht schädlich, Wissen ist nie schädlich, ich meine Wissen, das unser Innerstes anzugreifen im Stande ist …«
»Dass Lucky keine Zigaretten hat, könnte mein Innerstes erschüttern?« Douglas sagt nichts mehr. Er blickt Laura in die Augen und nimmt ihre Hand, schweigt noch immer. Laura erkennt sein Bemühen, seinen Kampf, ihr einerseits nicht das Gefühl zu geben, sie für dumm zu verkaufen, andererseits sie vor – seiner Überzeugung nach – Schädlichem zu bewahren. Sie entwindet sich seinem sanften Griff und sagt:
»Das Ganze hat mit draußen zu tun? Mit dem Warum …«, sie überlegt, sucht nach Worten, »… es hat mit der Ursache unseres Hierseins zu tun … Nicht wahr?!..«
»… Ja …«
»Das heißt … in seinem vorigen Leben …« Eine lange Pause entsteht. Laura scheint Steinchen für Steinchen das Mosaik zusammenzusetzen, ihr angespannter Gesichtsausdruck gibt Zeugnis davon. Sie nimmt den Faden auf:
»Lucky hat ein ganz normales Leben geführt … Eines Abends ist er los, bloß um Zigaretten zu holen … Und ist hier gelandet!«
»… Ja …«
»Das sind die Zigarettenholer … Gibt es viele von denen hier?«
»Sie stellen den größten Anteil dar.«
»Und es war so schwer, mir das zu offenbaren?«
»Der Punkt ist, wenn man nicht selber bereit ist für dieses Wissen, kann es sehr gefährlich werden …«
»Offenbar war ich bereit!«
»Ich hoffe es.« Schweigen kehrt ein. Douglas ahnt, was in Laura vorgehen muss. Aus dem allgemeinen Wissen um die Gründe des Erscheinens hier folgt zwangsläufig die Frage:
»Warum bin ich hier gelandet?« Laura wird blass. Douglas nimmt ihre Hand.
»Du musst dir Zeit lassen … Du solltest es nicht zu erzwingen versuchen … Nicht alles auf einmal …«
»Du hast gut reden … Weißt du, weshalb ich hier bin?«
»Nein!« Wieder schweigt Laura, dann:
»Du hast ihm ganz schön zugesetzt!«
»Was meinst du?«
»Ich meine Lucky«
»Das glaube ich nicht.«
»Das war nicht nett von dir!«
»Und wenn schon. Er hat es nicht anders verdient«, sagt Douglas. »Wer sich herausnimmt, ständig andere Leute auf den Arm zu nehmen, der muss auch mal was wegstecken können. Ich hoffe, das wird ihm eine Lehre sein!«
»Es hat ihm förmlich die Sprache verschlagen!«, sagt Laura. Douglas sieht sie an. Ihr Lächeln drückt Entschlossenheit wie Nachsicht aus: Sie scheint eine vorläufige Entscheidung gefällt zu haben und lässt ihren Blick durch den Raum wandern, dem Ort, wo die größte losgelöste Kommunikation zwischen den Bewohnern dieses Tals stattfindet. Die Wände sind mit einer dicken, ehemals grünen, nun zum Türkisfarbenen hin verwaschenen Plüschtapete beklebt, mit Fischen in verschiedenen Größen, die alle, wie von Kinderhand gemalt, in ein und dieselbe Richtung schwimmen.
Ohne Ausnahme halten sie sich seit fast einer Woche jeden Abend hier auf. Ihre erste Woche im Tal, wie ihr fast ständig bewusst ist, wie die Verwunderung ob der Tatsache, wie sehr sie sich hier von Anfang an zu Hause fühlt. Und er hat es nicht für nötig gehalten, sie einzuweihen … Vielleicht war’s tatsächlich besser so. Douglas bekümmert sich augenscheinlich um ihre seelische Balance. Unmöglich ist es nicht, dass seine Sorge berechtigt ist. Sie sollte ihm dankbar sein, anstatt sich aus Angst, ausgeschlossen zu werden, zu wehren. Sie lächelt nach innen: Obschon diese gewisse Spannung besteht, ist deutlich auch eine große Ruhe zwischen ihnen spürbar. Die Art von Gelassenheit, denkt sie, die für dieses Tal typisch ist, für die meisten seiner Bewohner, an und für sich für alle, die sie bisher kennen gelernt hat.
Lauras Bemühen, vernünftig zu sein – wie sie allein diesen Ausdruck hasst! – mag klug gewesen sein, von langer Dauer ist es nicht. Es droht zerstört, zerrissen zu werden von einem sich widersetzenden Gefühl. Außerstande, diese Empfindung genauer zu erfassen, verbleibt sie bei dem Ausdruck »Chaos«. Und allmählich schält sich aus dem Wust widerstrebender Emotionen ein anderes Wort heraus. Gehört hat sie diesen Begriff bereits mehrfach, sich jedoch nicht weiter darum gekümmert. Als ginge sie das einfach alles nichts an. Jetzt spürt sie deutlich, es hat definitiv mit ihr zu tun. Ihr Bestreben, Douglas’ schonende Art und Weise, mit ihr umzugehen, zu akzeptieren, geht endgültig über Bord. Mit entschlossener Stimme fragt sie Douglas:
»Wie ist das mit den Eismenschen?«
»Wäre es nicht wirklich besser, wir würden dieses Thema auf einen späteren Zeitpunkt verlegen?«
»Derselbe Zusammenhang oder? Zigarettenholer … Eismenschen …«
»… Ja … Du kannst dir denken, weshalb sie so genannt werden.«
»… Die Eismenschen … Natürlich … Da fällt mir eine Geschichte ein, die mir jemand … Warte. Wer hat mir diese Geschichte erzählt? Ja, natürlich! Mein Bruder, mein Bruder hat mir diese Geschichte erzählt!«
»Du hast … hattest einen Bruder und erinnerst dich an ihn?«
»Ja, natürlich erinnere ich mich an meinen Bruder … meinen Bruder … Francesco …«. Laura unterbricht sich. Ihr Gesicht verrät eine Spannung, die beides ausdrückt, Freude beim Gedanken an den geliebten Menschen wie Trauer über seinen Verlust. Sie versteht nicht, wie das sein kann, doch sie fühlt das allmähliche Verblassen des Bildes ihres Bruders. Je stärker sie sich daran zu erinnern versucht, desto schwächer wird es. Sie unterdrückt dieses neblige Etwas, das in ihr hochsteigen will. Hastig redet sie weiter:
»Mein Bruder, zumindest glaube ich, es war mein Bruder, der mir die Geschichte von Amundsen erzählte oder war’s Scott? Die beiden verwechsele ich immer … habe ich immer verwechselt …«
»Es war Roald … Amundsen!«
»Du kennst die Geschichte natürlich?!«
»Ja.«
»Demnach gehört also Amundsen – «
»Roald …«
»Von mir aus auch Roald … Der gehört zu den Eismenschen, zu jenen, die der Kälte des ewigen Eises entronnen sind, um hier in der Hitze des ewigen Sandes zu …« Es erscheint Laura zunächst ganz natürlich, dieser gewichtige Inhalt bedarf eines gewissen sprachlichen Pathos und eines angemessenen Abschlusses. Douglas hilft ihr nicht. Sie spürt, den Bogen überspannt zu haben.«
»… darben«, bringt sie es zu Ende, versucht, durch Überbetonung das Ganze zum Kippen zu bringen. Douglas erkennt unschwer ihre Absicht und ist erleichtert. Sie bemüht sich nun doch, dem Inhalt, dem ganzen Zusammenhang etwas von der ihm innewohnenden Dramatik zu nehmen. Er steigt angemessen ein:
»Darben? Findest du, wir darben hier?«
»Ein Bild, eine Analogie …«
»Wofür…«
»Glaubst du nicht, dass es uns hier am Wesentlichen mangelt?«, sagt Laura, wieder ernster werdend.
»Was da wäre?«
»Familie, zum Beispiel …« Für einen winzigen Augenblick drängt sich Laura der Eindruck auf, Douglas habe betroffen gewirkt. Doch schon im nächsten verflüchtigt sich dieses Gefühl, weil Douglas lächelnd sagt:
»Wusste gar nicht, dass du dermaßen häuslich …« Er unterbricht sich lachend, unsicher, ob er nicht zu weit gegangen ist. Den leichten Ton anzuschlagen, mag richtig sein, er sollte nur nicht ins Lächerliche abgleiten. Er nimmt ihre Hand, beugt sich über den Tisch und sagt:
»Du bist alles, was ich brauche!« Der Blick in ihre Augen war doch wohl ein wenig zu tief, um ernst gemeint gewesen zu sein, der Ton von zu viel Emphase getragen. Allerdings scheint er noch immer auf der richtigen Wellenlänge zu gleiten, denn Laura sagt trocken:
»Filmreif!« Sie lachen beide und sehen sich im Gastraum um; gewissermaßen nach Zuschauern schielend, die sie sich schließlich für diese Szene verdient haben, gleichzeitig aus Angst, das Ganze könne missdeutet werden. Plötzlich erschallt von einem der Nachbartische Lärm. Laura blickt sich erschreckt um. Es ist der Tisch, an dem Lucky sitzt oder besser gesagt: saß.
Lucky ist aufgesprungen, beugt sich jetzt über den Tisch und schnappt förmlich nach seinem Gegenüber. Er greift mit beiden Händen den nicht gerade schwächlichen Mann am Revers seines reichlich heruntergekommenen Sakkos und zieht ihn hoch. Der Attackierte reagiert sofort. Er reißt beide Arme von unten zwischen Luckys Armen hoch, wodurch jetzt dessen Arme in die Höhe geschleudert werden. Bevor sich Lucky auf die Gegenwehr einstellen kann, federt sein Gegenüber nach vorne und versetzt ihm einen Magenhieb, der Lucky von den Beinen holt. Ebenso langsam wie lautlos sinkt Lucky in sich zusammen.
Laura hat vor Schreck beide Hände vors Gesicht geschlagen. Douglas ist aufgesprungen, bereit, in den Kampf einzugreifen. Gnädigerweise scheint bereits alles vorbei zu sein. Dieser Eindruck wird unterstrichen durch die lässige Gangart, die der Barmann Harry vorlegt, als er sich dem Tisch der Streithähne nähert. Mit hochgekrempelten Hemdsärmeln und in die Hüften gestemmten Händen strahlt er Seelenruhe, gleichzeitig eine jederzeit zum Einschreiten bereite Entschlossenheit aus. Am Tisch angekommen bleibt er wortlos stehen und schüttelt den Kopf. Douglas ist in der Absicht diesem hochzuhelfen, ebenfalls zu Luckys Tisch gegangen. Er beugt sich dem verbissen am Boden Kauernden entgegen. Doch Lucky schlägt Douglas’ Hand weg und meckert:
»Lass mich in Ruhe!«
»Bitte! Kein Problem!« Offensichtlich unverletzt stemmt sich Lucky umständlich nach oben und sagt »Arsch!« zu seinem noch kampfbereiten Gegenüber. Er greift nach dem umgefallenen Stuhl, schiebt ihn zurecht und setzt sich, als sei nichts gewesen. Sein Kontrahent beginnt zu grinsen, nimmt die Spannung aus seinem Körper und setzt sich ebenfalls. Die beiden anderen Tischgenossen applaudieren lachend, an einigen anderen Tischen wird gleichfalls Beifall geklatscht. Harry und Douglas schütteln einträchtig den Kopf, grinsen sich kurz an, drehen sich um und streben anderen Sphären zu. Bei Laura angelangt, sagt Douglas:
»Willst du vielleicht gehen …«
»Aber wieso denn … Scheint sich ja alles beruhigt zu haben.«
»Gut. Was hältst du von ein wenig Musik?«
»Gute Idee! Ich komme mit!« An der Musikbox angekommen, beugen sie sich über die Anzeige.
»Sieh mal«, sagt Laura. »Hier gibt’s tolle Oldies, As Tears Go By zum Beispiel.« Während sie dies sagt, entsteht in ihrem Kopf die Melodie und bereitet den Boden für immer lebendigere Bilder aus ihrer Erinnerung. Dann konzentriert sie sich auf den Text des inzwischen angespielten Songs:
It is the evening of the day
I sit and watch the children play
»Dieses Stück habe ich seit meiner …«, sie schluckt, sie stockt, »Kindheit … nicht mehr gehört.« Sie hält einen Augenblick inne, dann redet sie weiter: »Damals gehörte diese Gruppe zu meinen Lieblingsbands.« Douglas nickt nur kurz und wählt.
»Was hast du denn gedrückt?« Noch während sie das sagt, fühlt sie sich in ihre Jugend zurückversetzt … Damals … Die ersten Treffen mit Jungs, mit dreizehn, vierzehn …. Die Lagerfeuerromantik.
»Wirst du gleich hören!« Da ertönt schon das laute Krachen, das Schlagen einer Gefängnistür.
»Das ist unglaublich!« Laura ist begeistert. Die Bilder sind undeutlich, doch stammen sie eindeutig aus ihrer Vergangenheit. Eine Göre war sie damals und gleichzeitig dabei, sich von der Kindheit zu verabschieden. Sie sagt:
»Ich glaube, ich war zwölf, als dieses Stück rauskam … Wahrhaftig, ich war noch ein Kind …« Laura verstummt. Douglas meidet ihren Blick. Beide wählen noch einige andere Stücke aus. Am Tisch zurück lauschen sie einige Minuten nur der Musik, dann eröffnet Laura wieder das Gespräch:
»Kommt dergleichen hier öfters vor?« Douglas weiß sofort, was sie meint, antwortet:
»Ganz selten …« Erst nachdem Laura eine volle Minute abwartend geschwiegen hat, fährt Douglas fort:
»Die Neuen haben manches Mal Schwierigkeiten, sich einzugewöhnen, einige reagieren mit Aggressionen!«
»Kommt es auch zu ernsthafteren Auseinandersetzungen?«
»Gelegentlich …« Dieses Mal schweigt Laura nicht, sofort hakt sie nach:
»Warum lässt du dir alles aus der Nase ziehen?«
»Tu ich doch gar nicht!«
»Tust du schon!«
Beide lachen, erneut scheint das Eis gebrochen, Douglas sagt:
»Ich finde es anstrengend und überflüssig, darüber zu reden, das sind solche Kindsköpfe …«
»Ach, der Herr gibt sich überlegen, selbstredend, wer einen solchen Grad von Reife erreicht …«, spöttelt Laura. Douglas sagt bloß:
»Was hältst du davon zu tanzen?«
»Tanzen, hier? Nein, das ist mir peinlich. Alle würden uns anstarren …«
»Lass sie starren, die sind doch nur neidisch …«
»Meinst du wirklich? Aber hier tanzt doch sonst nie einer!«
»Ich hab’ hier schon getanzt!«
»Wann, mit wem?« Laura würde sich am liebsten auf die Zunge beißen, doch es ist zu spät. Douglas lacht, aber antwortet.
»Zu meinem Jahrestag, mit einer jungen Dame …« Laura überhört geflissentlich die junge Dame, fragt weiter:
»Deinem Jahrestag? Meinst du Geburtstag?«
»Ach was, Geburtstag, so was gibt’s hier nicht, nein, zu meinem Jahrestag.«
»Hat der Jahrestag was mit der Ankunft hier zu tun?«, fragt Laura.
»Exakt!«, antwortet Douglas, steht auf, zieht Laura hoch und führt sie in die Mitte des Schankraums, wo eine kleine Fläche genug Raum bietet, auch für zwei, drei weitere Paare bieten würde. Doch sie sind und bleiben die Einzigen, die tanzen. Entgegen Lauras Befürchtung beachtet sie kaum jemand. Nachdem sie das registriert hat, lässt sie sich vom Rhythmus wiegen und in Douglas’ Arme sinken. In der sanften Bewegung durchlebt sie ein Unendliches, während sie die Augen geschlossen hält. Sie wieder öffnend, wird ihr bewusst, dass erst ein einziges Musikstück verklungen ist. Ein wenig aus Douglas’ Griff gelöst, blickt sie ihn an, empfängt sein Lächeln, lässt sich wieder fallen. Nach dem Ende des nächsten Stücks bringt Laura wieder etwas Distanz zwischen die aufgeheizten Körper, sie fragt:
»Du hast also bald wieder Jahrestag, den wievielten?«





























