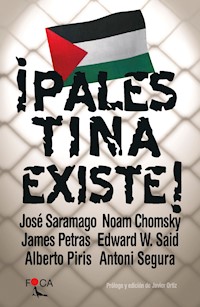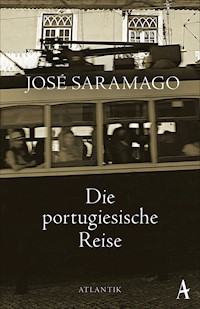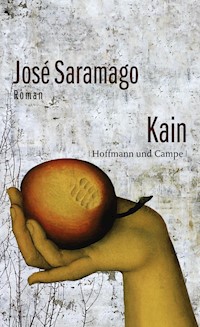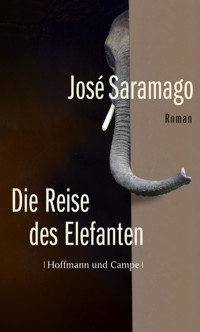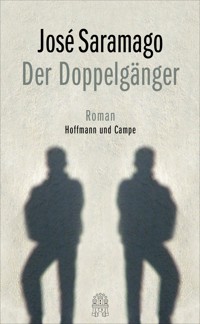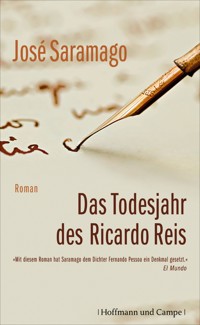
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine wunderbare Hommage an einen der bedeutendsten Dichter Portugals: Fernando Pessoa Die Romanfigur Ricardo Reis, Alter Ego des portugiesischen Dichters Fernando Pessoa, begegnet ihrem Schöpfer in einem Lissabonner Hotel ... Mit Phantasie, politischem Gespür und stilistischer Brillanz entwirft Saramago ein imaginäres Leben und verarbeitet es zu einem meisterhaften literarischen Vexierspiel. Als der Arzt Ricardo Reis 1935 erfährt, dass Fernando Pessoa gestorben ist, kehrt er aus Brasilien in seine Heimat Lissabon zurück. Ohne konkrete Pläne mietet er sich in ein Hotel ein, flaniert durch Lissabon, liest in Zeitungen über Hitlers Machtansprüche und den drohenden spanischen Bürgerkrieg - und beginnt zwei Affären: eine erotische mit dem Zimmermädchen Lídia und eine platonische mit der am Arm gelähmten Marcenda. Dann sitzt eines Tages unvermittelt der vermeintlich tote Pessoa in seinem Hotelzimmer, dem das Schicksal offenbar noch ein paar Monate zugestanden hat. Sie diskutieren über Politik, Einsamkeit und Tod, bis Ricardo Reis allmählich immer mehr verblasst und zu verschwinden droht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 744
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
José Saramago
Das Todesjahr des Ricardo Reis
Roman
Aus dem Portugiesischen von Rainer Bettermann
Hoffmann und Campe Verlag
Weise ist, wer sich mit dem Welttheater begnügt.
Ricardo Reis
Die Wahl der Art, nicht zu handeln, bestand während meines Lebens stets in der Obacht und im Bedenken.
Bernardo Soares
Sollte man mir sagen, es sei absurd, so von jemandem zu sprechen, den es nie gab, dann antworte ich: Ich habe auch keinen Beweis dafür, dass Lissabon jemals existierte, oderich, der ich hier schreibe, oder irgendetwas, wo es auchsein mag.
Fernando Pessoa
Hier endet das Meer, und das Land beginnt. Es regnet auf die fahlbleiche Stadt, die Wasser des Flusses ziehen lehmig trüb dahin, überflutet sind die Niederungen. Ein dunkles Schiff bewegt sich den düster schweigenden Strom hinauf, es ist die Highland Brigade, die am Kai von Alcântara festmachen will. Ein englisches Dampfschiff der Royal Mail, das auf der Atlantikroute eingesetzt ist, zwischen London und Buenos Aires, ein Schiffchen auf den Meereswegen, hierhin, dorthin, immer dieselben Häfen anlaufend, La Plata, Montevideo, Santos, Rio de Janeiro, Pernambuco, Las Palmas, in dieser oder umgekehrter Reihenfolge, und wenn es auf der Reise nicht untergeht, dann berührt es auch Vigo und Boulogne-sur-Mer, um schließlich in die Themse einzufahren, so wie jetzt in den Tejo; sag mir, welcher Fluss der größte ist und welcher Ort. Das Schiff ist nicht groß, vierzehntausend Tonnen, doch es hält sich gut auf dem Meer, wie es einmal auf der Überfahrt beweisen konnte, als trotz des ständig schlechten Wetters nur den Schiffsjungen übel wurde und jenen Seebären, die einem hoffnungslos empfindlichen Magen gehorchen müssen, und weil das Innere des Schiffes so häuslich und so gemütlich ist, erhielt es liebevoll, ebenso wie seine Zwillingsschwester, die Highland Monarch, den Beinamen Familiendampfer. Beide verfügen über ein geräumiges Oberdeck für Sport und Sonnenbäder, es erlaubt zum Beispiel, Kricket zu spielen, das, eigentlich ein Feldspiel, auch über den Wellen des Meeres ausgeübt werden kann, auf diese Art beweisend, dass dem britischen Empire nichts unmöglich ist, falls dies der Wille dessen sei, der da herrscht. An heiteren Tagen ist die Highland Brigade ein Park für Kinder und ein Paradies der Alten, heute allerdings nicht, denn es regnet, und einen anderen Nachmittag werden wir an Bord nicht mehr erleben. Durch die von Salzwasser getrübten Fenster schauen die Kinder auf die graue Stadt, die sich flach auf den Hügeln ausbreitet, als wäre sie nur aus erdnahen Häusern erbaut, verloren erhebt sich eine Kuppel, ein höherer Giebel, eine Silhouette, wohl die einer Burgruine, falls nicht alles eine Illusion ist, eine Täuschung der Sinne, eine Luftspiegelung, hervorgerufen durch wallende Regenschleier, die vom bedeckten Himmel herabfallen. Die fremdländischen Kinder, von der Natur am verschwenderischsten mit der Tugend der Neugier ausgestattet, wollen wissen, wie diese Stadt heißt, und die Eltern sagen es ihnen, oder die Ammen, die nurses, bonnes, Fräuleins, oder ein Matrose, der kurz vor dem Anlegemanöver vorbeieilt, Lisboa, Lisbon, Lisbonne, Lissabon, vier verschiedene Arten der Benennung, von den indirekten und ungenauen abgesehen, so erfuhren die Kinder, was ihnen bisher unbekannt gewesen war, und doch wussten sie nun genauso viel wie zuvor, nichts, einen Namen, nur halbwegs richtig ausgesprochen, was die jungen Hirne noch mehr verwirrte, mit dem eigenen Akzent der Argentinier, wenn es sich um diese handelte, oder dem der Uruguayer, Brasilianer und Spanier, die zwar kastilisch oder portugiesisch richtig Lisboa schreiben, es aber auf ihre Art aussprechen, fremd dem gemeinen Ohr und der Schreibweise. Wenn morgen früh die Highland Brigade die Mole hinter sich lässt, das Land noch in Sichtweite, sollte es wenigstens etwas Sonne geben und weniger bedeckten Himmel, damit der graue Nebel das vergängliche Gedächtnis der Reisenden nicht völlig trüben möge, jener Kinder, die zum ersten Mal hierhergekommen sind, den Namen Lisboa wiederholen und ihn auf ihre Art in einen anderen umwandeln, jener Erwachsenen, die die Brauen runzeln und bei der allgegenwärtigen Feuchtigkeit frösteln, die Holz und Eisen überzieht, als wäre die Highland Brigade aus der Meerestiefe emporgetaucht, ein Schiff, zwiefach Phantasma. Weder auf Wunsch noch aus reinem Vergnügen würde jemand in diesem Hafen bleiben wollen.
Nur wenige werden an Land gehen. Der Dampfer hat angelegt, schon ist die Gangway heruntergelassen, ohne Eile zeigen sich unten die Gepäckträger und Schauerleute, die diensthabenden Hafenpolizisten verlassen Wetterdächer oder Wächterhäuschen, Zöllner tauchen auf. Der Regen hat nachgelassen, kaum dass es noch nieselt. Oben an der Gangway sammeln sich die Reisenden, sie zögern, als glaubten sie nicht der Erlaubnis, von Bord gehen zu dürfen, als fürchteten sie eine Quarantäne oder die schlüpfrigen Stufen, doch was sie verschüchtert, ist die Stille in der Stadt, vielleicht sind die Bewohner alle tot, und der Regen fällt nur, um in Schlamm aufzulösen, was noch stehen geblieben ist. Entlang dem Kai schimmert es matt durch die Bullaugen anderer Schiffe, die hier festgemacht haben, die Ladebäume gleichen nackten schwarzen Ästen, die Kräne stehen still. Es ist Sonntag. Jenseits der großen Speicher am Kai beginnt die düstere Stadt, zurückgezogen hinter Fassaden und Mauern, vorläufig noch vor dem Regen geschützt, gelegentlich einen traurigen Vorhang aus Spitzen bewegend, schaut sie mit vagem Blick nach draußen, hört das Wasser über die Dächer plätschern, die Traufen hinunter, bis zur Bodenrinne aus Basalt, über das ausgespülte Pflaster der Gehwege zu den vollen Gullys, von denen sich bald hier, bald dort der Deckel durch die Überschwemmung hebt.
Die ersten Passagiere steigen hinunter, die Rücken unter dem monotonen Regen gebeugt. Sie tragen Säcke und Handköfferchen, es umgibt sie ein Hauch von Verlassenheit, gleich jenen, die die Reise wie einen Traum voll flüchtiger Bilder erlebten, zwischen Meer und Himmel, der Bug im Auf und Ab, im Gleichtakt eines Metronoms, das Balancieren der Welle, der hypnotisierende Horizont. Jemand trägt ein Kind auf dem Arm, ein portugiesisches wohl, still, wie es ist, es kam ihm nicht in den Sinn zu fragen, wo es sei, vielleicht wurde es ihm angekündigt, als man ihm, damit es schneller in der stickigen Koje einschlafe, eine schöne Stadt versprochen hatte und ein glückliches Leben, ein weiteres Zaubermärchen, denn jenen hat die Arbeit kein Glück gebracht. Eine ältere Frau, die sich verbissen müht, ihren Regenschirm aufzuspannen, lässt eine grün eingeschlagene Schachtel fallen, die sie unter dem Arm getragen hatte, auf den steinernen Kai aufschlagend birst das Behältnis, der gebogene Deckel löst sich, der Boden springt heraus, nichts Wertvolles ist darin, nur Erinnerungsstücke, bunte Lappen, einige Briefe, Bilder liegen verstreut umher, einige Perlen aus Glas, zersplittert, weiße Knäuel, nunmehr befleckt, einer ist zwischen Kaimauer und Schiffswandung verschwunden, die Frau ist ein Passagier der dritten Klasse.
Einer nach dem anderen setzen sie ihren Fuß an Land, sie laufen, um sich unterzustellen, die Ausländer murren über das widrige Wetter, als wären wir schuld daran, scheinbar haben sie vergessen, dass es in ihren französischen und englischen Gefilden meist viel schlimmer ist, nun ja, denen ist alles recht, die armen Länder zu schmähen, selbst der natürliche Regen, wir hätten bessere Gründe, uns zu beschweren, und stehen hier doch schweigend, dieser verdammte Winter, was hier alles an Erde weggeht, entrissen den fruchtbaren Feldern, und wie sie uns fehlt, ist doch unser Land so klein. Man hat schon mit dem Ausladen des Gepäcks begonnen, unter den glänzenden Überwürfen sehen die Matrosen wie Götzen mit Kapuzen aus, behänd bewegen sich da unten die portugiesischen Gepäckträger, mit Strohhütchen und in ihren Schaffelljacken, doch so gleichgültig gegenüber der durchdringenden Nässe, dass sich das Universum verwundert, vielleicht bewirkt diese Dürftigkeit, die Börsen der Reisenden zu erweichen, Portemonnaies, wie man heutzutage sagt, und mit dem Mitleid erhöht sich das Trinkgeld, zurückgebliebenes Volk, mit ausgestreckter Hand, verkaufe jeder, wovon er im Überfluss hat, Resignation, Demut, Geduld, auf diese Weise sind wir ständig auf der Suche, jemanden zu finden, der in der Welt mit solcherlei Waren Geschäfte macht. Die Reisenden sind zum Zollgebäude hinübergegangen, wenige, wie sich zeigte, trotzdem wird es seine Zeit dauern, bis sie da wieder herauskommen, denn es sind viele Papiere auszufüllen, und die diensthabenden Zöllner pflegen eine ordentliche Handschrift, mag sein, dass die flinkeren sonntags dienstfrei haben. Der Nachmittag dunkelt, doch es ist erst vier Uhr, etwas mehr Schatten, und die Nacht wäre perfekt, hier drinnen allerdings ist es so, als herrschte sie ständig, die schwachen Lampen bleiben den ganzen Tag über eingeschaltet, einige sind durchgebrannt, jene schon seit einer Woche, man hat sie noch nicht ausgewechselt. Die schmutzigen Fenster lassen eine wässrige Helligkeit hereinschimmern. Die Luft ist von dem Geruch nach durchnässter Kleidung geschwängert, es riecht penetrant nach dem Gepäck und dem Sackleinen der Bündel, Melancholie breitet sich aus, sie macht die Reisenden schweigsam, nicht der Schatten eines Frohsinns liegt in dieser Rückkehr. Der Zoll ist ein Vorraum, ein Limbus, wie mag es da draußen sein?
Ein grau melierter hagerer Mann unterschreibt die letzten Papiere, empfängt die Kopien und kann gehen, hinaus, auf festem Boden das Leben fortsetzen. Es begleitet ihn ein Gepäckträger, dessen Aussehen nicht näher beschrieben werden soll, oder wir müssten endlos in der Betrachtung fortfahren, damit keine Verwirrung im Kopf dessen entstünde, dem es darauf ankäme, wie einer vom anderen zu unterscheiden sei; wenn das gefordert würde, dann müssten wir von diesem sagen, dass er hager ist, grau meliert und brünett, mit glattrasiertem Gesicht, wie von jenem schon gesagt, letztlich jedoch sehr verschieden, Passagier der eine, Gepäckträger der andere. Dieser lädt den großen Koffer auf ein Metallwägelchen, die beiden anderen, die kleineren, trägt er an einer Kette, wie ein Joch oder eine Ordenskette um den Nacken gelegt. Draußen, unter dem Schutz des breiten Regendaches, setzt er die Last ab und geht ein Taxi suchen, meist ist das nicht nötig, gewöhnlich sind sie zur Stelle und warten auf die Dampfer. Der Reisende schaut zu den niedrigen Wolken, dann auf die Pfützen des unebenen Terrains, auf die Wasser des Docks, ölverschmutzt, Schalen, allerlei Abfälle, und dabei gewahrt er einige Kriegsschiffe, unauffällig, hier hätte er sie nicht vermutet, denn der eigentliche Standort dieser Seereisenden ist das offene Meer oder aber, wenn keine Kriegszeit, so auch keine Manöver, die weite Flussmündung, breit genug, dass alle Geschwader der Welt dort ankern könnten, wie man früher sagte und vielleicht auch noch heute, ohne zu bedenken, um welche Geschwader es sich handelt. Da kommen die anderen Passagiere von der Zollabfertigung, Träger folgen ihnen, und dann taucht das Taxi auf, Wasser spritzt zur Seite. Aufgeregt fuchteln die Ankommenden mit den Armen, der Gepäckträger springt aufs Trittbrett und macht eine einladende Handbewegung, für diesen Herrn. So beweist er, wie selbst ein bescheidener Dienstmann vom Lissabonner Hafen, wenn der Regen und die Umstände helfen, mit seinen Händen Glück verteilen, es in einem Augenblick geben oder nehmen kann, wie man meint, dass es Gott mit dem Leben hält. Während der Fahrer den Gepäckträger hinten am Wagen herunterklappt, fragt der Reisende und lässt dabei zum ersten Mal einen leichten brasilianischen Akzent erkennen, was machen die Schiffe dort am Dock, und der Gepäckträger, der dem Fahrer hilft, den großen, schweren Koffer hochzuhieven, antwortet keuchend, ach, das ist das Dock der Marine, wegen des schlechten Wetters haben sie’s gemacht, man hat sie gestern hierhergeschleppt, ansonsten hätten sie gut und gern in Algés festmachen können. Weitere Taxis sind eingetroffen, sie haben sich verspätet, oder der Dampfer hatte vor der erwarteten Zeit angelegt, jetzt herrscht freie Auswahl auf dem Vorplatz, die Befriedigung der Bedürfnisse ist nun ein Kinderspiel. Was schulde ich Ihnen, fragt der Reisende. Was über dem Tarif ist, liegt an Ihnen, antwortet der Gepäckträger, aber er sagt nicht, was das für ein Tarif oder was der reelle Preis für diese Dienstleistung sei, man überlässt es Fortuna, die die Kühnen beschützt, auch wenn es Kofferträger sind. Ich habe nur englisches Geld bei mir. Ah, das macht nichts, und in die ausgestreckte Rechte sieht er zehn Schilling fallen, eine Münze, die heller als die Sonne glänzt, zu guter Letzt ist es doch dem Sternenkönig gelungen, die auf Lissabon drückenden Wolken zu besiegen. Wegen der schweren Lasten und der tiefen Erregungen besteht die erste Bedingung für ein langes und erfolgreiches Gepäckträgerleben in einem robusten Herzen, von Bronze, sonst würde sein Besitzer glattweg zerschmettert niedersinken. Er möchte die übertriebene Freigebigkeit erwidern, wenigstens keine Worte schuldig bleiben, deshalb setzt er Erklärungen hinzu, um die ihn niemand gebeten hat, er fügt sie zu den ungehörten Dankesworten, es sind, Senhor, Torpedobootzerstörer, unsere, portugiesische, die Tejo, die Dão, die Lima, die Vouga, die Tâmega, das da, uns am nächsten, ist die Dão. Sie unterscheiden sich nicht voneinander, man könnte sogar ihre Namen austauschen, alle sind gleich, Fünflinge, todesgrau gestrichen, regenfeucht, ohne eine Spur von Leben auf den Decks, die Flaggen hängen wie Lappen, mit Verlaub und nicht ohne Respekt zu sagen, sei es, wie es sei, wir wissen nun, das ist die Dão, der Zufall will es, dass wir mehr über sie erfahren werden.
Der Gepäckträger lüftet die Mütze und bedankt sich, das Taxi fährt an, der Chauffeur möchte wissen, wohin, und diese so einfache, natürliche und den Umständen sowie dem Ort entsprechende Frage trifft den Reisenden unvorbereitet, als ob die Buchung der Passage in Rio de Janeiro ein für alle Mal die Antwort auf alle Fragen gewesen wäre, selbst auf jene früheren, die zu seiner Zeit nicht mehr als Schweigen fanden, kaum dass er nun an Land gegangen war, verstand er, warum nicht, vielleicht weil man ihm eine der zwei fatalen Fragen gestellt hat, wohin, die andere, die schlimmere wäre, wozu. Der Chauffeur blickt in den Rückspiegel, nimmt an, dass der Fahrgast nicht verstanden hat, öffnet schon den Mund, um zu wiederholen, wohin, aber die Antwort war schneller, noch unbestimmt, schwebend, in ein Hotel. Was für eins? Ich weiß nicht, und nachdem er dies gesagt, ich weiß nicht, weiß der Reisende, was er will, mit so fester Überzeugung, als hätte er während der ganzen Reise darüber gegrübelt, eins, das nahe am Fluss liegt, nach unten zu. Nahe dem Fluss gibt es nur das Bragança, am Anfang der Rua do Alecrim, ich weiß nicht, ob Sie es kennen. An das Hotel kann ich mich nicht erinnern, aber wo die Straße ist, weiß ich, ich habe in Lissabon gewohnt, bin Portugiese. Ach, Sie sind Portugiese, nach Ihrer Aussprache dachte ich, Sie sind Brasilianer. Merkt man es so sehr? Na ja, ein bisschen schon. Ich bin sechzehn Jahre nicht in Portugal gewesen. Sechzehn Jahre sind viel. Sie werden hier große Veränderungen antreffen, und mit diesen Worten verstummt der Chauffeur abrupt.
Dem Reisenden erscheinen die Veränderungen nicht so zahlreich. Die Avenida, die sie entlangfahren, stimmt im Allgemeinen mit seiner Erinnerung an sie überein, nur die Bäume sind höher, kein Wunder, immerhin sind sie in den sechzehn Jahren gewachsen, und außerdem waren sie in seiner vagen Erinnerung grün, jetzt aber lässt die winterliche Nacktheit der Zweige ihre wahre Größe geringer erscheinen, so kommt eins zum anderen. Der Regen hat nachgelassen, noch vereinzelte Tropfen fallen, nicht der winzigste blaue Spalt am Firmament, die Wolken lösen sich nicht voneinander, sie bilden eine breite, bleifarbene Decke. Hat es viel geregnet, fragt der Reisende. Eine Sintflut, seit zwei Monaten zerfließt der Himmel in Wasser, antwortet der Chauffeur und stellt die Scheibenwischer ab. Es fahren nur wenige Autos, vereinzelt Straßenbahnen, der eine oder andere Fußgänger, skeptisch den Regenschirm schließend, große Pfützen entlang den Gehwegen, von verstopften Gullys verursacht, dicht an dicht einige geöffnete Tavernen, düster, das diffuse Licht ist von Schatten eingekreist, das trübselige Bild eines schmutzigen Glases Wein auf einem zinkenen Tresen. Diese Fassaden sind die Mauern, die die Stadt verbergen, und das Taxi fährt ohne Eile an ihnen entlang, als suchte es eine Bresche, eine kleine Pforte, eine verräterische Tür, den Eingang zum Labyrinth. Langsam fährt der Zug aus Cascais vorbei, er bremst müde, er war noch schnell genug, das Taxi zu überholen, doch er bleibt zurück, er rollt in die Station, als das Taxi schon um den Platz fährt, der Chauffeur kündigt an, dort ist das Hotel, am Anfang der Straße. Er hält gegenüber einem Café und fügt hinzu, es wäre besser, erst zu fragen, ob Zimmer frei sind, ich kann nicht direkt vor dem Eingang halten, wegen der Elektrischen. Der Fahrgast steigt aus, schaut flüchtig auf das Café, Royal heißt es, kommerzielles Beispiel monarchistischer Sehnsüchte zu republikanischer Zeit oder ein Überbleibsel der letzten Regentschaft, hier auf Englisch oder Französisch getarnt, ein kurioser Fall, man schaut drauf und weiß nicht, wie man das Wort aussprechen soll, ob roial oder ruaiale, er hat Zeit, die Frage zu durchdenken, denn es regnet nicht mehr, und die Straße steigt an, dann stellt er sich vor, wie er vom Hotel zurückkommen würde, ein Zimmer oder keins, und vom Taxi keine Spur, verschwunden mit Gepäck und Kleidern, den ganz persönlichen Gegenständen, seinen Papieren, er fragt sich, wie er leben würde, wenn man ihn dieser und anderer Dinge beraubte. Er steigt schon die Stufen zum Hotel hinauf, als er begreift, dass ihm diese Gedanken kommen, weil er abgespannt ist, was er spürt, ist eine sehr große Müdigkeit, eine Mattheit der Seele, Hoffnungslosigkeit, wenn wir zur Genüge wissen, was das ist, um das Wort auszudrücken und verstehen zu können.
Beim Öffnen der Hoteltür ertönt eine elektrische Klingel, vor Zeiten wird es ein Glöckchen gewesen sein, klingling, doch man muss stets mit dem Fortschritt und seinen Verbesserungen rechnen. Eine steile Treppe, unten, am Anfang des Geländers eine gusseiserne Figur, im rechten Arm einen Globus aus Glas, die Figur stellt einen Höfling in Hoftracht vor, falls der Ausdruck durch die Wiederholung etwas gewinnen sollte, falls es nicht glatter Pleonasmus ist, denn niemand dürfte sich daran erinnern, einen Höfling gesehen zu haben, wenn nicht in Hoftracht, deshalb sind es eben Höflinge, deutlicher gesagt, ein Höfling als Höfling gekleidet, sichtbar durch den Schnitt der Kleidung, italienisches Modell, Renaissance. Der Reisende erklimmt die nicht enden wollenden Stufen, es scheint unglaublich, so hoch steigen zu müssen, um ein erstes Stockwerk zu erreichen, es ist der Aufstieg zum Everest, eine Heldentat, noch Traum und Utopie der Bergsteiger, zu seinem Glück erscheint oben ein schnurrbärtiger Mann mit einem aufmunternden Wort, hopp, er spricht es nicht aus, aber so kann man seine Art, zu schauen und sich vom hohen Treppenabsatz herabzubeugen, deuten, als wollte er erforschen, welche guten Winde und schlechten Wetter diesen Gast hergetrieben hatten. Guten Tag, Senhor. Guten Tag. Der Atem reicht nicht für mehr, der Schnurrbärtige lächelt verständnisvoll. Ein Zimmer, das Lächeln wird jetzt entschuldigend, in diesem Stockwerk gibt es keine Zimmer, hier sind Rezeption, Speisesaal, Aufenthaltsraum, dort drinnen Küche und Büfett, die Zimmer liegen oben, deshalb werden wir zum zweiten Stock hinaufmüssen, dieses hier taugt nicht, weil es zu klein und zu schattig ist, das da auch nicht, weil das Fenster zum Hinterhof geht, diese sind belegt. Mir würde ein Zimmer gefallen, von dem aus man den Fluss sehen kann. Ah, sehr wohl, dann wird Ihnen Zweihunderteins gefallen, es ist heute Morgen frei geworden, ich zeige es Ihnen gleich. Die Tür befindet sich am Ende des Flures, an ihr ist ein emailliertes Schildchen, schwarze Ziffern auf weißem Grund, wäre das kein bescheidenes Hotelzimmer ohne Luxus und lautete die Zimmernummer zweihundertzwei, da könnte der Gast Jacinto heißen und Besitzer eines Gutes in Tormes sein, doch diese Episoden spielten sich dann nicht in der Rua do Alecrim ab, sondern auf den Champs-Élysées, rechter Hand für den, der sie hinaufgeht, wie beim Hotel Bragança, doch nur darin ähneln sie sich. Dem Reisenden gefällt das Zimmer, oder besser, ihm gefallen die Zimmer, um ganz genau zu sein, denn es sind zwei, verbunden durch einen breiten Zwischenraum mit bogenförmiger Decke, dort ist der Schlafraum, Alkoven hätte man ihn früher genannt, hier das Zimmer, in dem man sich tagsüber aufhält, alles in allem eine Unterkunft ähnlich einer Wohnung, mit dunklem Mobiliar aus poliertem Mahagoni, Vorhängen an den Fenstern, gedämpftem Licht. Der Reisende hört das harte Rattern der Elektrischen, die die Straße hinauffährt, der Chauffeur hat recht gehabt. Jetzt kommt es ihm vor, als sei viel Zeit verflossen, seitdem er das Taxi verlassen hat, ob es noch da ist, innerlich muss er über seine Angst, bestohlen zu werden, lächeln, gefällt Ihnen das Zimmer, fragt der Hotelchef mit der Stimme und Autorität eines Menschen, der diese Funktion auch wirklich ausübt, aber freundlich, wie es dem Geschäft des Vermieters zukommt. Es gefällt mir, ich nehme es. Und für wie viel Tage? Das weiß ich noch nicht, das hängt von einigen Angelegenheiten ab, die ich erledigen muss, je nachdem, wie lange das dauert. Es ist der übliche Dialog, das in solchen Fällen übliche Gespräch, aber in diesem hier klingt ein falscher Ton mit, da der Reisende gar nichts in Lissabon zu erledigen hat, keinerlei Angelegenheiten, die eine derartige Bezeichnung verdienten, er hat gelogen, er, der einmal behauptete, jegliche Ungenauigkeit zu verabscheuen.
Sie gehen zum ersten Stock hinunter, der Hotelchef ruft einen Angestellten, Burschen für Botendienste und Mann für Lasten, damit er das Gepäck dieses Herrn holen möge, das Taxi wartet gegenüber dem Café, der Reisende geht mit hinunter, um die Corrida zu bezahlen, noch heute benutzt man dieses Vokabular der Kutscher und Postillione, auch will er nachsehen, ob nichts fehle, ein unbegründetes Misstrauen, ein ungerechtfertigtes Urteil, denn der Chauffeur ist eine ehrliche Person, er will nur, dass man ihm zahlt, was das Taxameter anzeigt, dazu das übliche Trinkgeld. Er wird nicht das Glück des Gepäckträgers teilen, es gibt keinen Goldregen mehr, weil der Reisende inzwischen an der Rezeption etwas von seinem englischen Geld umgetauscht hat, nicht dass wir der Freigebigkeit müde wären, aber einmal ist nicht alle Mal, und Prahlerei ist eine Beleidigung gegenüber den Armen. Der Koffer ist viel schwerer als mein Geld, und während er den Treppenabsatz erreicht, macht der Hotelchef, der ihn hier erwartet und seine Arbeit beobachtet hatte, eine helfende Bewegung, die Hand nach unten, symbolische Geste wie das Werfen eines Steines, denn die Last befand sich auf dem Rücken des Burschen, Bursche nur von Beruf, nicht vom Alter her, das dieser mit sich schleppt, so schleppt er den Koffer und denkt dabei an jene eingangs erwähnten Worte, von jeder Seite unterstützt durch zwecklose Hilfe, die zweite kommt vom Gast, den die Anstrengung dauert. Schon ist er unterwegs zum zweiten Stock, es ist die Zweihunderteins, Pimenta, diesmal hat er Glück, muss nicht in die oberen Stockwerke, während er hinaufsteigt, begibt sich der Gast zur Rezeption zurück, ein wenig atemlos von der Anstrengung greift er zum Federhalter und trägt sich in das Gästebuch ein, Angaben über seine Person macht er nur so weit wie notwendig, damit man über den Bescheid weiß, der erklärt, wer er sei, in das Karree der waagerecht und senkrecht linierten Seite hinein, Name Ricardo Reis, Alter achtundvierzig Jahre, gebürtig in Porto, Familienstand ledig, Beruf Arzt, letzte Anschrift Rio de Janeiro, Brasilien, von wo er herkommt, mit der Highland Brigade ist er gereist, es sieht wie der Beginn einer Beichte aus, einer intimen Autobiographie, alles Verborgene enthält diese beschriftete Linie, jetzt heißt es den Rest herausfinden. Mit langem Hals hatte der Hotelchef das Aneinanderreihen der Buchstaben verfolgt, um sie entziffern und daraufhin den Inhalt erschließen zu können, er vermeint nun, dass er dieses und jenes erfahren habe, und sagt, Senhor Doktor, das ist kein Anbiedern, ein Siegel ist es, Anerkennung eines Rechts, eines Verdienstes, einer Qualität, das erfordert, sofort Gleiches mit Gleichem zu vergelten, auch wenn es nicht geschrieben steht, mein Name ist Salvador, ich bin der Verantwortliche des Hotels, der Leiter, wenn der Senhor Doktor etwas benötigt, so muss er es mir sagen. Wann wird das Abendessen serviert? Das Abendessen ist um acht, Senhor Doktor, ich hoffe, dass Sie mit unserer Küche zufrieden sein werden, wir haben auch französische Gerichte. Doktor Ricardo Reis drückt mit einem Kopfnicken seine eigene Erwartung aus, greift nach Mantel und Hut, die er auf einem Stuhl abgelegt hatte, und zieht sich zurück.
Der Hoteldiener wartet in der offenen Zimmertür. Ricardo Reis sieht ihn vom Ende des Flures aus, dort angekommen, würde der Mann, wie er wusste, auf ihn zukommen, mit bittender, aber auch fordernder Hand, angemessen dem Gewicht des Gepäcks, während er den Gang entlanggeht, bemerkt er, was er vorher nicht wahrgenommen hatte, nämlich dass es nur auf einer Seite Türen gibt, die andere ist Wand, die das Treppenhaus bildet, er denkt darüber nach, als sei es eine wichtige Frage, die er nicht vergessen dürfe, er ist wirklich sehr müde. Der Mann erhält sein Trinkgeld, er fühlt es mehr, als dass er es sieht, das macht die Gewohnheit, er ist zufrieden, so sehr, dass er sagt, Senhor Doktor, vielen Dank, wir können nicht erklären, woher er es weiß, wenn er doch das Gästebuch nicht gesehen hat, es liegt daran, dass die niederen Schichten den studierten und kultivierten Leuten in nichts an Scharfblick und Scharfsinn nachstehen. Was Pimenta schmerzt, ist lediglich das eine Schulterblatt, da er beim Zurechtrücken des Koffers einmal nicht aufgepasst hatte, obwohl er eigentlich ein Mann mit Erfahrung in solchen Dingen ist.
Ricardo Reis setzt sich auf einen Stuhl, lässt den Blick umherschweifen, hier wird er für wer weiß wie viele Tage leben, vielleicht wird er eine Wohnung mieten und eine Praxis einrichten, vielleicht wird er nach Brasilien zurückfahren, vorläufig wird das Hotel genügen, ein neutraler Ort, ohne Verpflichtung, Ort des Übergangs und der Ungewissheit. Hinter den einfarbigen Gardinen sind die Fenster plötzlich hell geworden, es sind die Straßenlaternen. So spät ist es schon. Dieser Tag ist zu Ende, was von ihm übrig ist, schwebt draußen über dem Meer und entflieht, vor wenigen Stunden noch reiste Ricardo Reis über diese Wasser, jetzt ist der Horizont in Reichweite seiner Arme: Wände, Möbel, die das Licht wie ein dunkler Spiegel reflektieren, und anstatt des schweren Stampfens der Dampfmaschinen hört er das Summen, das Raunen der Stadt, sechshunderttausend seufzende Menschen, von weitem schreit es, jetzt einige vorsichtige Schritte auf dem Gang, eine Frauenstimme, die sagt, ich komme schon, es muss das Zimmermädchen sein, diese Worte, diese Stimme. Er öffnet eines der Fenster, schaut hinaus. Der Regen hat aufgehört. Feucht ist die vom Fluss herüberwehende frische Luft, die ins Zimmer dringt, sie mildert den dumpfen Geruch, der dem nach ungewaschener Wäsche gleicht, die in einer Schublade vergessen liegt, ein Hotel ist keine Wohnung, einige dieser oder jener Gerüche bleiben ihm haften, eine verschwitzte Schlaflosigkeit, eine Liebesnacht, ein durchnässter Mantel, der Staub abgebürsteter Schuhe zur Stunde des Aufbruchs, danach kommen die Zimmermädchen, um das Bett frisch zu beziehen, zu fegen, auch der ihnen eigene Geruch bleibt, nichts davon ist vermeidbar, es sind die Zeichen unseres Menschseins.
Er lässt das Fenster geöffnet und geht in Hemdsärmeln das andere öffnen, von einer plötzlichen Kraft belebt, beginnt er die Koffer auszupacken, in weniger als einer halben Stunde hat er sie entleert, er verteilt ihren Inhalt in die Möbel, in die Schubladen der Kommode, die Schuhe in die Schuhlade, die Anzüge auf die Bügel des Kleiderschranks, den schwarzen Arztkoffer in die dunkle Tiefe des Schranks und die Bücher in ein Regal, die wenigen, die er mitgebracht hat, einiges in klassischem Latein, was er längst nicht mehr regelmäßig las, einige abgegriffene Bücher englischer Dichter, drei oder vier brasilianische Autoren, keine zehn portugiesischen, und zwischen diesen findet er jetzt eins, das zur Bibliothek der Highland Brigade gehörte, er hatte vergessen, es vor dem Verlassen des Schiffes abzugeben. Wenn der irische Bibliothekar das Fehlen bemerkt hat, dann werden zu dieser Stunde grobe, schwerwiegende Vorwürfe gegen das lusitanische Vaterland erhoben, Land der Sklaven und Diebe, wie Byron gesagt hat und O’Brien sagen wird, aus solchen geringfügigen, lokalen Ursachen entstehen gewöhnlich große und globale Folgen, aber ich bin unschuldig, ich schwöre es, es war nur Vergesslichkeit und weiter nichts. Er legt das Buch auf den Nachttisch, um es an einem der folgenden Tage mit Genuss zu Ende zu lesen, The God of the Labyrinth lautet der Titel, sein Autor ist Herbert Quain, ebenfalls ein Ire, eine nicht seltene Übereinstimmung, aber der Name, ja, der ist besonders einmalig, denn ohne großen Aussprachefehler könnte man lesen quem, wer, man beachte Quain, quem, ein Schriftsteller, der nur deshalb nicht unbekannt ist, weil ihn jemand auf der Highland Brigade gefunden hat, nun ist selbst das nicht mehr möglich, falls es dort nur dieses einzige Exemplar gegeben hat, noch ein Grund mehr, uns zu fragen, quem? Die Langeweile während der Reise und die Suggestion des Titels hatten ihn neugierig gemacht, ein Labyrinth mit einem Gott, was für ein Gott wäre das, was für ein Labyrinth war das, was für ein labyrinthischer Gott, und zu guter Letzt war es ein simpler Kriminalroman, eine gewöhnliche Geschichte von Mord und Aufklärung, ein Verbrecher, ein Opfer, falls nicht im Gegenteil das Opfer vor dem Verbrecher da ist, und schließlich der Detektiv, alle drei Komplizen des Todes, ich sage euch, in Wirklichkeit ist der Leser von Kriminalromanen der einzige und reale Überlebende der Geschichte, die er gelesen hat, falls nicht überhaupt jeder Leser als einziger und realer Überlebender die ganze Geschichte liest.
Und es müssen Papiere verwahrt werden, diese mit Versen beschriebenen Blätter, das älteste ist vom zwölften Juni neunzehnhundertvierzehn datiert, Krieg kam, der Große, wie sie ihn später nannten, solange sie keinen größeren geführt hatten, Meister, ruhig sind alle Stunden, die wir verlieren, wenn in das Verlieren wir wie in eine Vase Blumen stecken, und dann schlussfolgert er, beruhigt verlassen wir das Leben, nicht einmal Reue kennen wir, gelebt zu haben. So aneinandergereiht steht es nicht da, jede Zeile hat ihren gehorsamen Vers, aber auf diese Weise lesen wir, fortlaufend, ohne eine andere Pause als die des Atemholens und des Rhythmus, das jüngste Blatt trägt das Datum vom dreizehnten November neunzehnhundertfünfunddreißig, anderthalb Monate sind seitdem vergangen, ein frisches Blatt noch, und es heißt dort, in uns leben Unzählige, wenn ich denke oder fühle, weiß ich nicht, wer denkt oder fühlt, ich bin nur der Ort, an dem man denkt und fühlt, und ohne hier zu enden, ist’s doch wie ein Ende, denn nichts gibt’s außer Denken und Fühlen. Wenn ich nur das bin, denkt Ricardo Reis nach dem Lesen, wer wird jetzt wohl denken, was ich denke, oder denke ich, dass ich an dem Ort denke, den ich denke, wer wird fühlen, was ich fühle, oder fühle ich, dass ich an dem Ort fühle, den ich erfühle, wer bedient sich meiner, um zu fühlen und zu denken, und wer von den Unzähligen bin ich, die in mir leben, welcher bin ich, wer, quem, Quain, welche Gedanken und Gefühle teile ich nicht, weil sie nur mir gehören, wer bin ich, ohne ein anderer zu sein, gewesen zu sein oder zu werden. Er ordnet die Blätter, zwanzig Jahre Tag auf Tag, Blatt auf Blatt, legt sie in eine Schublade des kleinen Schreibtisches, schließt die Fenster und dreht den Warmwasserhahn auf, um sich zu waschen. Es ist kurz nach sieben.
Pünktlich mit dem Nachhall des letzten Achtuhrschlages der Standuhr, einer Zierde der Etage, in der sich die Rezeption befindet, begibt sich Ricardo Reis zum Restaurant hinunter. Salvador lächelt, und unter dem Schnurrbart wird eine Reihe wenig gepflegter Zähne sichtbar, er beeilt sich, dem Gast die zweiflügelige Glastür zu öffnen, die mit dem Monogramm HB versehen ist. In verschlungenen Bögen und Gegenbögen, mit Anhängseln und Beifügungen in vegetabilen Formen, Reminiszenzen an Akanthus, Palmetten, verschnörkeltes Blattwerk, auf diese Art verleihen die angewandten Künste dem trivialen Hotelgewerbe etwas Würdevolles. Der Maître kommt ihm entgegen, es sind keine weiteren Gäste im Saal, nur zwei Kellner, die soeben die Tische gedeckt hatten, hinter einer anderen Tür, ebenfalls mit Monogramm, hört man Geschirrklappern, von dorther würden in Bälde die Terrinen, die zugedeckten Teller und Bratenplatten erscheinen. Das Mobiliar ist das übliche, wer einen dieser Speisesäle gesehen hat, hat alle gesehen, es sei denn, es handelt sich um ein Luxushotel, aber das ist hier nicht der Fall, einige schwache Lichter an der Decke und an den Wänden, einige Kleiderhaken, weiße Decken auf den Tischen, blütenweiß, rigorose Forderung der Direktion, von allem Schmutz in der Wäscherei befreit, falls nicht am Waschplatz von Caneças, wo man nur Seife und Sonne kennt, bei dem vielen Regen in den letzten Tagen muss mit Verzögerung gerechnet werden. Ricardo Reis setzt sich, der Maître erklärt, was es zu essen gibt. Suppe, Fisch, Fleisch, falls nicht der Senhor Doktor Diät bevorzugt, das heißt anderes Fleisch, anderen Fisch, andere Suppe, ich würde raten, sich langsam an diese neue Ernährung zu gewöhnen, wenn man gerade erst nach sechzehn Jahren Abwesenheit aus den Tropen zurück ist, das weiß man also sogar schon im Restaurant und in der Küche. Die Tür zur Rezeption wird aufgestoßen, ein Ehepaar mit zwei Kindern, Junge und Mädchen, wachsbleich, tritt ein, die Eltern mit leicht gerötetem Gesicht, aber alle durch die Ähnlichkeit als verwandt ausgewiesen, das Familienoberhaupt vorweg, Führer des Stammes, die Mutter den Nachwuchs, in der Mitte zwischen beiden, tätschelnd. Danach taucht ein dicker Mann auf, schwerfällig, mit einer goldenen Kette, die den Bauch überspannt, von Westentasche zu Westentasche, und gleich darauf ein anderer Mann, spindeldürr, mit schwarzer Krawatte und Trauerflor am Arm, in der nächsten Viertelstunde kommt niemand mehr, man hört, wenn die Bestecke die Teller berühren, der Vater der Kinder, herrschsüchtig, schlägt mit dem Messer an das Glas, um so den Kellner auf sich aufmerksam zu machen, der Hagere, verletzt in seiner Trauer und verärgert über solch ein Benehmen, blickt ihn ernst an, der Dicke kaut gleichmütig. Ricardo Reis betrachtet die Fettaugen auf der Hühnerbrühe, er hatte schließlich eine Diät gewählt, aus Gleichgültigkeit war er diesem Rat gefolgt, nicht weil er in ihm einen besonderen Vorteil erblickt hätte. Ein Trommeln gegen die Fensterscheiben macht ihn darauf aufmerksam, dass es wieder zu regnen begonnen hat. Diese Fenster gehen nicht zur Rua do Alecrim, was kann es für eine Straße sein, er erinnert sich nicht, falls er es überhaupt schon einmal gewusst hatte, doch der Kellner, der kommt, um den Teller zu wechseln, erklärt es ihm, das hier ist die Rua Nova do Carvalho, Senhor Doktor, und er fragt, nun, hat Ihnen die Brühe geschmeckt, an der Aussprache merkt man, dass der Kellner Galicier ist, sie hat geschmeckt, an der Aussprache hat man schon gemerkt, dass der Gast in Brasilien gelebt hat, ein gutes Trinkgeld hatte Pimenta bekommen.
Die Tür öffnet sich wieder, dieses Mal kommt ein Mann in mittleren Jahren herein, hochgewachsen, förmlich, mit langem, kantigem Gesicht, daneben eine junge Dame von etwa zwanzig Jahren, höchstens, dürr, wenn es auch genauer wäre, schlank zu sagen, sie wenden sich dem Tisch zu, der Ricardo Reis gegenübersteht, auf einmal wird klar, dass der Tisch sie erwartet hatte, wie ein Gegenstand die Hand erwartet, die ihn ständig sucht und benutzt, es sind Stammgäste, vielleicht die Besitzer des Hotels, es ist interessant, wie wir vergessen, dass die Hotels Besitzer haben, diese hier, Besitzer oder nicht, durchqueren gemessenen Schrittes den Saal, als befänden sie sich im eigenen Hause, solche Dinge fallen einem auf, wenn man aufmerksam hinschaut. Das Mädchen sitzt mit dem Profil zu Ricardo Reis, der Mann kehrt ihm den Rücken zu, sie unterhalten sich mit leiser Stimme, doch sie wird lauter, als sie sagt, nein, Vater, ich fühle mich gut, es sind also Vater und Tochter, eine in Hotels selten anzutreffende Konstellation, in diesem Alter. Der Kellner kommt herbei, um sie zu bedienen, zurückhaltend, aber doch irgendwie vertraulich, dann zieht er sich zurück, jetzt herrscht Stille im Raum, nicht einmal die Kinder heben die Stimmen, seltsam, Ricardo Reis kann sich nicht erinnern, dass sie gesprochen hätten, entweder sind sie stumm, oder ihre Lippen sind zusammengeklebt, zusammengehalten durch unsichtbare Klammern, absurder Gedanke, wo sie doch essen. Das hagere Mädchen ist mit der Suppe fertig, sie legt den Löffel fort, die rechte Handstreichelt die im Schoß ruhende linke, als wäre sie ein Haustierchen. Ricardo Reis bemerkt jetzt, überrascht von seiner eigenen Entdeckung, dass diese Hand von Anfang an unbeweglich geblieben war, er erinnert sich, dass nur die rechte Hand die Serviette aufgeschlagen hatte, jetzt fasst sie die linke, um sie auf den Tisch zu legen, sehr behutsam, zerbrechliches Kristall, und dort lässt sie sie ruhen, neben dem Teller wohnt sie dem Essen bei, die langen Finger ausgestreckt, bleich und abwesend. Ricardo Reis fühlt ein Schaudern, er selbst fühlt es, niemand, der es für ihn fühlte, auf und unter der Haut fröstelt es, er schaut fasziniert auf die gelähmte, blinde Hand, die nicht weiß, wohin, wenn man sie nicht führt, hierhin zum Sonnen, dorthin, um einem Gespräch zu lauschen, hierhin, damit dich jener Senhor Doktor sehe, der aus Brasilien gekommen ist, kleine Hand, zwiefach links, weil sie auf dieser Seite und weil sie linkisch ist, unbeweglich, schlaff, tote Hand, tote Hand, wirst nie klopfen an der Türe Rand. Ricardo Reis beobachtet, dass die Gerichte für das Mädchen bereits vorbereitet vom Büfett kommen, der Fisch ist entgrätet, das Fleisch geschnitten, das Obst geschält und zerteilt; es ist offenkundig, dass Tochter und Vater bekannte Gäste sind, das Haus ist an sie gewöhnt, vielleicht leben sie sogar im Hotel. Die Mahlzeit ist beendet, man zögert noch etwas, um Zeit zu geben, was für Zeit und wozu, schließlich erhebt er sich, er schiebt den Stuhl zurück, das ungewollt laute Schurren bringt das Mädchen dazu, ihm das Gesicht zuzuwenden, so von vorn wirkt sie älter als zwanzig Jahre, wie es anfangs schien, doch das Profil stellt ihre Halbwüchsigkeit sofort wieder her, der zerbrechliche Hals, die zarte Kinnpartie, die ganze schneeweiße, labile Linie des Körpers, unsicher, unvollendet. Ricardo Reis verlässt das Restaurant, er nähert sich der Tür mit dem Monogramm, hier muss er mit dem Dicken, der ebenfalls dem Ausgang zustrebt, Höflichkeiten austauschen, bitte schön, nach Ihnen, Exzellenz. Aber nicht doch, für wen diese Ehre, der Dicke eilt hinaus, vielen Dank, bemerkenswert, diese Art zu sprechen, für wen denn, wollten wir alles wortwörtlich nehmen, dann hätte Ricardo Reis der Vortritt gebührt, weil er Unzählige ist, so wie er sich selbst versteht.
Der Hotelchef, Salvador, streckt ihm bereits den Schlüssel zur Zweihunderteins entgegen, er hat die Absicht, ihn vorsorglich auszuhändigen, doch er unterbricht behutsam die Geste, vielleicht möchte der Gast ausgehen, um das nächtliche Lissabon und seine Geheimnisse zu entdecken, nach so vielen Jahren in Brasilien und so vielen Tagen der Überfahrt auf dem Ozean, obwohl die winterliche Nacht eher Gelüste auf die Geborgenheit des Gesellschaftsraums wecken dürfte, hier nebenan liegt er, mit seinen tiefen, hochlehnigen Ledersesseln, seinem Lüster mit dem kostbaren Tropfgehänge, dem großen Spiegel, der den gesamten Raum wiedergibt, der sich hier verdoppelt, in einer anderen Dimension, nicht die einfache Reflexion der gewöhnlichen, bekannten Dimensionen, die sich ihm gegenüberstellen, Breite, Länge, Höhe, denn sie gibt es dort nicht so jede für sich, bestimmbar, sondern verschmolzen in einer einzigen Dimension, wie ein unfassbares Phantasma einer entfernten und zugleich nahen Perspektive, falls in dieser Erklärung nicht ein Widerspruch liegt, hier steht Ricardo Reis in seine Betrachtung vertieft, in der Tiefe des Spiegels, einer der Unzähligen, der er ist, aber alle ermüdet, ich gehe nach oben, ich bin müde von der Reise, es waren zwei Wochen schlechten Wetters, wenn es ein paar Zeitungen von heute gäbe, könnte ich mich bis zum Einschlafen mit dem Vaterland vertraut machen. Hier sind sie, Senhor Doktor, und in diesem Augenblick erscheinen das Mädchen mit der gelähmten Hand und der Vater, sie steuern auf den Gesellschaftsraum zu, er voran, sie hinterher, einen Schritt voneinander entfernt, den Schlüssel hat Ricardo Reis bereits in der Hand, ebenso die graufarbenen, bräunlichen Zeitungen, ein Windstoß rüttelt an der Tür, die nach draußen führt, dort hinten an der Treppe, die Klingel ertönt, niemand, nur das sich verschlimmernde Unwetter, von dieser Nacht ist nicht mehr zu erwarten, als sie bereits bietet, Regen, Sturmwind an Land und auf dem Meer, Einsamkeit.
Das Zimmersofa ist bequem, die Federn haben sich durch das Gewicht so vieler Körper angepasst, sie bilden eine leichte Vertiefung, das Licht der Lampe über dem Schreibtisch beleuchtet die Zeitung aus günstigem Winkel, all dies ähnelt keinem Hotel, es gleicht mehr einem Zuhause, einem Schoß der Familie, einem Heim, das ich nicht habe, wenn ich es haben werde, sind das die Nachrichten meines Heimatlandes, und die lauten: Das Staatsoberhaupt eröffnete zu Ehren Mousinhos und Albuquerques im Hauptbüro für die Kolonien eine Ausstellung, man darf weder auf die imperialen Ehrungen verzichten noch die imperialen Persönlichkeiten vergessen. Große Befürchtungen in Golegã, ich kann mich nicht daran erinnern, wo das liegt, ach ja, im Ribatejo, wenn der Deich der Zwanzig bricht, seltsamer Name, wo er wohl herrührt, wird sich die Katastrophe von achtzehnhundertfünfundneunzig wiederholen, fünfundneunzig, da war ich acht Jahre alt, da kann ich mich natürlich nicht erinnern. Die größte Frau der Welt ist Elsa Droyon, sie ist zwei Meter fünfzig groß, die würde nicht vom Hochwasser überflutet werden, und das Mädchen, wie mag sie heißen, diese gelähmte Hand, so willenlos, rührt das von einer Krankheit her, von einem Unfall. Fünfter Schönheitswettbewerb der Kinder, eine halbe Seite mit Bildern von kleinen Kindern, alles Nackedeis, sichtbar die Fältchen, mit bulgarischem Milchpulver ernährt, einige dieser Babys werden Verbrecher werden, Strolche und Prostituierte, gerade weil sie so zur Schau gestellt wurden, in zartem Alter, den anzüglichen Blicken des Gewöhnlichen preisgegeben, der keine Unschuld respektiert, Operationen in Äthiopien fortgesetzt, und was haben wir aus Brasilien für Nachrichten, keine Neuigkeit, alles schon vorbei, Großoffensive der italienischen Truppen, keine menschliche Kraft vermag es, den italienischen Soldaten in seinem heldenhaften Vormarsch aufzuhalten, was könnte, was kann der abessinische Lazarus gegen ihn ausrichten, die armselige Lanze, der miserable Stutzsäbel. Der Advokat der berühmten Athletin gab bekannt, dass sich seine Mandantin einer wichtigen Operation unterzogen habe, um das Geschlecht zu ändern, in wenigen Tagen werde sie ein echter Mann sein, als wäre sie so geboren, wennschon, dennschon, sie sollte nicht vergessen, auch ihren Namen zu ändern. Bocage vor dem Tribunal des Heiligen Officium, ein Gemälde des Malers Fernando Santos, gute Kunst macht man hierzulande. Im Coliseu geben sie die Letzte Herrlichkeit mit der quecksilbrigen und bildschönen Vanise Meireles, brasilianischer Star, seltsam, in Brasilien ist sie mir gar nicht aufgefallen, meine Schuld, hier für drei Escudos normal und ab fünf gepolstert, zwei Vorstellungen, sonntags Matinee. Im Politeama zeigt man Die Kreuzzüge, ein düsterer historischer Streifen. In Port Said wurden zahlreiche englische Kontingente ausgeschifft, jede Zeit hat ihre Kreuzzüge, diese sind von heute, wenn man weiß, dass sie in Richtung Grenze nach dem italienischen Libyen führen, eine Aufstellung der in der ersten Dezemberhälfte in Brasilien gestorbenen Portugiesen, dem Namen nach kenne ich keinen, ich muss nicht bewegt sein, keine Trauer anlegen, aber es sterben dort wirklich viele Portugiesen, hier finden überall im Land Armenspeisungen statt, das Abendessen in den Asylen, wie gut in Portugal die Alten behandelt werden, gut behandelt die unglückliche Kindheit, Straßenblümchen, und diese Nachricht hier. Der Bürgermeister von Porto telegrafierte dem Innenminister, in Würdigung des Erlasses über die Unterstützung der Armen im Winter beglückwünscht die heute stattgefundene Sitzung des Stadtrates unter meiner PräsidentschaftEure Exzellenz zu dieser so einmalig herrlichen Unternehmung, und weiter, Verschlammte Brunnen, Anhäufungen von Viehmist, in Lebução und Fatela gehen die Pocken um, in Portalegre herrscht die Grippe und Typhusfieber in Valbom, ein Mädchen von sechzehn Jahren, zartes ländliches Blümlein, ist an den Pocken gestorben, Lilie, so früh und so grausam gebrochen. Ich besitze eine Foxhündin, nicht reinrassig, die schon zweimal geworfen hat, und immer wurde sie dabei ertappt, dass sie die Jungen fraß, nicht eines ist davongekommen, sagen Sie mir, Senhor Redakteur, was ich tun soll, Der Kannibalismus bei Hündinnen, verehrter Leser und Ratsuchender, entsteht im Allgemeinen durch schlechte Ernährung während der Tragezeit, zu wenig Fleisch, man muss der Hündin reichlich Fressen zukommen lassen, wobei Fleisch die Grundlage sein soll, doch darf es auch nicht an Milch, Brot und Gemüse fehlen, also eine umfassende Ernährung, wenn sie weiterhin von diesem Trieb beherrscht wird, ist nichts zu machen, töten Sie sie, oder lassen Sie sie nicht decken, sie muss mit der Laufzeit zurechtkommen, oder lassen Sie sie sterilisieren. Stellen wir uns einmal die während der Schwangerschaft schlecht ernährten Frauen vor, und das ist mehr als alltäglich der Fall, ohne Fleisch, ohne Milch, etwas Brot und Kohl, wenn sie ebenfalls ihre Kinder aufessen würden, und wenn wir uns das vor Augen führen und feststellen, dass dies nicht geschieht, dann ist es schließlich leicht, die Menschen von den Tieren zu unterscheiden, diesen Kommentar hat nicht der Redakteur hinzugefügt, auch Ricardo Reis nicht, der an etwas anderes denkt, welchen passenden Namen man dieser Hündin geben müsste, Diana oder Lembrada, die Unvergessliche, wird er sie nicht nennen, und was würde ein Name am Verbrechen oder seinen Motiven ändern, wird das abscheuliche Tier durch einen vergifteten Kuchen oder durch die Jagdflinte seines Herrn sterben, beharrt Ricardo Reis, und schließlich findet er den richtigen Namen, einer, der von Ugolino della Gherardesca kommt, überkannibalischer männlicher Graf, der Kinder und Enkel aß, was attestiert und verbürgt ist, im entsprechenden Kapitel über die Geschichte der Guelfen und Ghibellinen sowie auch in der Göttlichen Komödie, dreiunddreißigster Gesang der Hölle, so soll sie denn Ugolina heißen, diese Mutter, die ihre eigenen Kinder frisst, so widernatürlich, dass sich ihr nicht einmal vor Mitleid die Eingeweide im Leib umdrehen, wenn sie mit ihren Zähnen die warme und weiche Haut der Hilflosen reißt, sie zerstückelt, ihre zarten Knochen bricht, und die armen stöhnenden Hündchen sterben, ohne zu sehen, wer sie verschlingt, die Mutter, die sie geboren hat, Ugolina, töte mich nicht, denn ich bin dein Kind.
Das Blatt, das derartige Gräuelnachrichten bringt, sinkt ruhig auf die Knie des eingeschlafenen Ricardo Reis. Ein plötzlicher Schauer bringt die Scheiben zum Klirren, der Regen stürzt wie eine Sintflut herab. Durch die einsamen Straßen von Lissabon läuft die Hündin Ugolina, Blut geifernd, an den Türen knurrend, heulend auf Plätzen und in Parks, wild den eigenen Bauch beißend, in dem schon der nächste Wurf heranwächst.
Nach einer Nacht ungestümen Winterwetters, wütenden Sturmes, diese Worte sind schon zusammen geboren, die ersteren weniger, und die einen so treffend wie die anderen die Umstände bezeichnend, dass sie die Mühe erübrigen, an neue Schöpfungen zu denken, da könnte doch der Morgen schön, sonnenglänzend sein, mit einem blaustrahlenden Himmel und heiteren Taubenschwärmen. Doch die Sterne standen nicht so, die Möwen überfliegen weiterhin die Stadt, dem Fluss ist nicht zu trauen, die Tauben zeigen sich kaum. Es regnet, erträglich für den, der mit Mantel und Regenschirm auf die Straße gegangen ist, der Wind ist im Vergleich zu dem morgendlichen Wüten eine Liebkosung im Gesicht. Ricardo Reis hat das Hotel früh verlassen, er ist zur Handelsbank gegangen, um einiges von seinem englischen Geld in Escudos des Vaterlandes umzutauschen, für jedes Pfund wurden ihm einhundertundzehntausend Réis ausgezahlt, schade, dass jene nicht aus Gold waren, man hätte sie fast für das Doppelte tauschen können, trotzdem hat er keinen besonderen Grund zur Klage, dieser Heimkehrer, der mit fünf Contos in der Tasche die Bank verlässt, das ist ein Reichtum für portugiesische Verhältnisse. Von der Rua do Comércio, wo er sich befindet, bis zum Terreiro do Paço sind es nur wenige Meter, man ist versucht zu schreiben, es ist ein Schritt, doch Ricardo Reis wird nicht die Überquerung des Platzes auf sich nehmen, er schaut von weitem, unter dem Schutz der Arkaden, grau und aufgewühlt der Fluss, es ist Flut, wenn sich die Wellen zum Platz hin aufrichten, scheint es, als wollten sie das Gelände überfluten, ja untertauchen, aber es ist eine optische Täuschung, sie fallen an der Mauer in sich zusammen, ihre Kraft wird durch die Schräge des Kais gebrochen. Er erinnert sich daran, hier früher gesessen zu haben, so fern ist die Zeit, dass man in Zweifel gerät, sie selbst erlebt zu haben, oder ein anderer für mich, gleichen Gesichts vielleicht und Namens, ein anderer doch. Er spürt seine kalten, feuchten Füße und auch, wie ein Hauch von Unglücklichsein seinen Körper durchzieht, nicht seine Seele; ich wiederhole, nicht seine Seele, dieser Eindruck ist äußerlich, er könnte ihn mit den Händen fassen, hielten nicht beide den Griff des Regenschirms umklammert, der unsinnigerweise aufgespannt ist. So weltvergessen ist ein Mensch, so setzt er sich der Neckerei dessen aus, der vorbeigehend sagt, oh, Senhor, passen Sie auf, dass Sie da drunter nicht einregnen, aber der Spott ist freimütig und nicht boshaft. Ricardo Reis lächelt über seine Zerstreutheit, ohne zu wissen, weshalb, murmelt er die zwei Verse von João de Deus, vielgerühmt während seiner Schulzeit, unter jener Arkade verbrächte man gut die Nacht.
Er ist so nahe gekommen, um im Vorübergehen festzustellen, ob die alte Erinnerung an den Platz, scharf wie ein Stahlstich oder so in der Phantasie erstanden, dass es heute so scheint, annähernd mit der Realität eines auf drei Seiten von Gebäuden umgebenen Karrees übereinstimmt, mit einer königlichen Reiterstatue in der Mitte, mit dem Triumphbogen, den er von seinem Standort aus nicht sieht, letztlich ist alles diffus, nebulös die Architektur, die Linien verschwommen, vielleicht durch die vergangene Zeit, vielleicht durch seine schon müden Augen, nur die Augen der Erinnerung können so scharf sein wie ein Sperberauge. Es geht auf elf Uhr zu, unter den Arkaden ist viel Bewegung, Bewegung heißt nicht Schnelligkeit, diese Würde hat wenig Eile, die Männer alle mit weichem Hut, tropfenden Regenschirmen, kaum eine Frau, und so betreten sie die Dienststellen, um diese Zeit beginnen die Beamten zu arbeiten. Ricardo Reis entfernt sich in Richtung der Rua do Crucifixo, er erträgt die Hartnäckigkeit eines Losverkäufers, der ihm ein Zehntellos für die nächste Ziehung verkaufen will, es ist die Tausenddreihundertneunundvierzig, morgen dreht sich das Glücksrad, es war weder diese Nummer, noch dreht sich das Rad morgen, aber so klang die Stimme des Sehers, des mit einem Blechstreifen an der Mütze ausgewiesenen Propheten, kaufen Sie, Senhor, schauen Sie, wenn Sie nicht kaufen, könnten Sie’s bereuen, ich hab’s im Gefühl, und eine verhängnisvolle Drohung liegt in der Nötigung. Er biegt in die Rua Garrett ein, geht den Chiado hinauf, vier Lastträger stehen an den Sockel der Statue gelehnt, es ist die Insel der Galicier, inzwischen hat es aufgehört zu regnen, geregnet hat es, nun nicht mehr, hinter Luís de Camões ist eine strahlende Helligkeit, ein Heiligenschein, da sieht man wieder, was Wörter sind, dieses hier kann ebenso Regen wie Wolke bedeuten sowie leuchtender Kreis, und da der Seher kein Gott oder Heiliger ist und es auch nicht mehr regnet, so waren es nur die Wolken, die sich im Vorbeiziehen auflösten, wollen wir doch keine Wunder von Ourique oder Fátima beschwören, erst recht nicht solche simplen wie das Aufklaren des Himmels.
Ricardo Reis geht zu den Zeitungen, gestern hatte er sich die Adressen notiert, es wurde noch nicht gesagt, dass er schlecht geschlafen hatte, das Bett befremdete ihn, oder das Land, wenn man in der Stille eines noch fremden Zimmers auf den Schlaf wartet, den Regen auf der Straße hört, dann nehmen die Dinge ihre wahre Gestalt an, sind sie alle groß, ernst, schwer, wie lügnerisch ist doch das Licht des Tages, es macht aus dem Leben nunmehr einen verkürzten Schatten, nur die Nacht ist klar, doch sie wird vom Schlaf besiegt, vielleicht für unsere Ruhe und Erholung, Friede den Seelen der Lebenden. Ricardo Reis geht zu den Zeitungen, geht dorthin, wohin immer jedermann gehen wird, der von den Dingen der vergangenen Welt wissen will, hier im Bairro Alto, wo die Welt vorbeikam, hier, wo sie die Spur ihres Fußes hinterlassen hat, Fußabdrücke, zerbrochene Zweige, zertretene Blätter, Buchstaben, Nachrichten, das, was von der Welt geblieben ist, der Rest ist ein Stück nötiger Einbildung, damit diese Welt auch ein Gesicht erhalte, einen Blick, ein Lächeln, eine Agonie. Der unerwartete Tod von Fernando Pessoa verursachte tiefen Schmerz in den intellektuellen Kreisen, Poet des Orfeu, bewundernswerter Geist, der nicht nur die Poesie auf originelle Weise kultivierte, sondern auch die kluge Kritik, er starb gestern in aller Stille, so wie er immer gelebt hatte, doch da das Schreiben in Portugal niemanden ernährt, hatte sich Fernando Pessoa in einem Handelsbüro verdingt, und, einige Zeilen weiter, an der Grabstätte legten seine Freunde Blumen der Sehnsucht nieder. Mehr sagt die Zeitung nicht, eine andere sagt dasselbe auf andere Weise, Fernando Pessoa, der außerordentliche Poet der Mensagem, eines Poems voller nationalistischer Begeisterung, eines der schönsten, die je geschrieben, wurde gestern beigesetzt, der Tod hatte ihn auf einem christlichen Lager des São-Luís-Hospitals überrascht, am Samstag zur Nacht, in der Poesie war er nicht nur er, Fernando Pessoa, er war auch Álvaro de Campos, und Alberto Caeiro, und Ricardo Reis, da ist es geschehen, auf den Fehler war zu warten, die Unaufmerksamkeit, schreiben, was man vom Hörensagen kennt, wir aber wissen genau, dass Ricardo Reis dieser Mann hier ist, der mit seinen eigenen offenen und lebendigen Augen die Zeitung liest, Arzt ist er, achtundvierzig Jahre alt, ein Jahr älter als Fernando Pessoa, als man ihm die Augen schloss, diese wirklich toten, es bedurfte nicht weiterer Beweise oder Zeugnisse, dass es nicht um dieselbe Person geht, und sollte noch irgendjemand daran zweifeln, dann gehe er zum Hotel Bragança und spreche mit Senhor Salvador, dem Hotelchef, frage, ob dort nicht ein Senhor abgestiegen sei, der Ricardo Reis heiße, Arzt, aus Brasilien gekommen, und der wird es bestätigen, oder, Senhor Doktor kommt nicht zum Mittagessen, aber er hat gesagt, er würde zu Abend essen, wenn Sie eine Nachricht hinterlassen wollen, werde ich mich persönlich um die Übermittlung kümmern, wer würde es wohl wagen, am Wort eines Hotelchefs zu zweifeln, eines exzellenten Menschenkenners und Bestimmers von Identitäten. Aber damit wir uns nicht mit jemandes Wort begnügen, den wir so wenig kennen, ist hier jenes andere Journal, das die Nachricht auf die richtige Seite gesetzt hat, die der Todesanzeigen, und ausführlich den Verstorbenen identifiziert. Gestern fand das Begräbnis des Senhor Doktor Fernando António Nogueira Pessoa statt, ledig, siebenundvierzig Jahre alt, siebenundvierzig, merken Sie auf, gebürtig in Lissabon, in Geisteswissenschaften von der englischen Universität ausgebildet, ein in der literarischen Welt sehr bekannter Schriftsteller und Poet, auf seinem Sarg wurden Sträuße frischer Blumen niedergelegt, das Schlimmste an ihnen, den Ärmsten, sie welken so schnell. Während Ricardo Reis auf die Elektrische wartet, die ihn zum Prazeres-Friedhof bringen wird, liest er die am Grab gehaltene Trauerrede, er liest sie in der Nähe des Ortes, wo, wie wir wissen, vor zweihundertdreiundzwanzig Jahren, damals herrschte Don João V., der nicht in der Mensagem erwähnt wurde, wo also ein Genueser Hausierer gehängt wurde, der wegen eines Stücks halbwollenen Zeugs einen von den unseren, einen Portugiesen, tötete, indem er ihm ein Messer in den Hals stieß, dasselbe tat er dann mit der Haushälterin, die durch den Stoß tot am Platze blieb, einem Diener versetzte er zwei Stiche, die nicht tödlich waren, einem anderen stach er wie einem Kaninchen das Auge aus, und wenn er nicht noch mehr anrichtete, dann nur, weil sie ihn festnahmen, er wurde hierher zur Verurteilung geführt, weil es in der Nähe des Mordhauses war, viel Volk lief herbei, kein Vergleich mit diesem Morgen des Jahres neunzehnhundertfünfunddreißig im Monat Dezember, der dreißigste, der Himmel ist stark bewölkt, nur wer nicht anders kann, begibt sich auf die Straße, obwohl es genau in dem Moment nicht regnet, in dem Ricardo Reis, gelehnt an eine Laterne oben an der Calçada do Combro, die Trauerrede liest, nicht auf den Genueser, für den es keine gab, ausgenommen vielleicht Beschimpfungen seitens der Menge, doch auf Fernando Pessoa ja, den Poeten, frei von tödlichen Verbrechen, zwei Worte zu seinem Ableben, zwei Worte genügen für ihn, oder keines, besser wäre das Schweigen, das Schweigen, das bereits ihn und uns umgibt, das entspricht seinem Geist, für ihn ist gut, was in Gottes Nähe ist, doch jene, die in dem Zusammensein mit seiner Beleza bei ihm weilten, sollen und können ihn nicht sehen, wie er zur Erde herabsteigt oder, besser, die vorgegebenen Linien der Ewigkeit hinaufsteigt, ohne den stillen, aber menschlichen Zorn zu äußern, den seine Abreise in uns zurücklässt, seine Gefährten des Orfeu könnten es nicht, eher seine Brüder, vom gleichen idealen Blut seiner Schönheit, sie könnten ihn nicht, wiederhole ich, hierlassen, auf dieser letzten Erde, ohne nicht wenigstens über seinen gentilen Tod die weiße Lilie des Schweigens und des Schmerzes entblättert zu haben, wir beklagen den Menschen, den der Tod uns raubte, und mit ihm den Verlust des Wunderbaren seiner Gesellschaft und der Gnade seiner menschlichen Anwesenheit, nur der Mensch, hart, dies zu sagen, denn seinem Geist und seiner schöpferischen Kraft hat das Schicksal eine fremdartige Schönheit verliehen, die nicht stirbt, das Übrige ist der Genius Fernando Pessoas. Na, immerhin finden sich noch Ausnahmen in den Regeln des Lebens, seit Hamlet sagen wir immer wieder, der Rest ist Schweigen, letztlich ist der Genius derjenige, der sich des Restes annimmt, und wenn es dieser ist, dann jeder andere auch.
Die Elektrische war schon angekommen und fuhr los. Ricardo Reis sitzt darin, allein auf der Bank, er hat seinen Fahrschein bezahlt, fünfundsiebzig Centavos, mit der Zeit wird er sagen lernen, einen zu siebeneinhalb, und er liest weiter, über den letzten Abschied, er kann sich nicht davon überzeugen, dass es um Fernando Pessoa geht, der wirklich tot ist, wenn wir die Einmütigkeit der Nachrichten betrachten, doch die grammatische und lexikalische Hölzernheit, die er so hasste, wie schlecht kannten sie ihn, so zu ihm oder von ihm zu sprechen, sie haben den Tod ausgenutzt, Füße und Hände waren ihm gebunden, man stellte ihn sich als weiße, entblätterte Lilie vor, wie ein vom Fleckfieber dahingerafftes Mädchen, und dann das Beiwort gentil, mein Gott, welch ein blöder Gedanke, Verzeihung für das vulgäre Wort, wo doch der Redner dort den wirklichen Tod vor sich hatte, hätte er so was vermeiden müssen, und besonders das von dem Rest, alles zu gering, und da gentil edel bedeutet, herrschaftlich, stattlich, elegant, angenehm oder höflich, welches davon hätte er gewählt, wenn es ihm auf der Lagerstatt des São-Luís-Hospitals erlaubt gewesen wäre auszuwählen, Lob den Göttern, wenn es angenehm gewesen wäre, mit einem solchen Tod würde man nur das Leben verlieren.