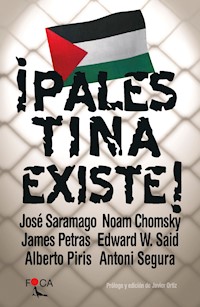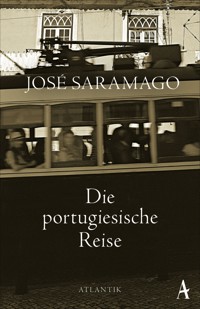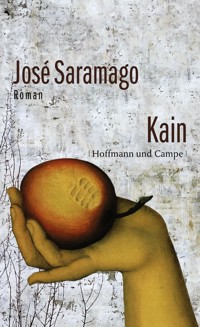12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In seinen feinfühligen Prosaminiaturen zeichnet José Saramago eindrückliche Bilder vom Leben auf dem portugiesischen Land, wohin er auch nach dem Umzug nach Lissabon immer wieder zurückkehrt. Er erzählt von schwächlichen Ferkeln, die nachts im Ehebett schlafen dürfen, von aufgeschlagenen Knien, Steinschleudern oder der Jagd nach Fröschen, aber auch vom geliebten Großvater, davon, wie er sich selbst das Schreiben beibrachte und in der Schule zum Klassenbesten wurde. Unter die privaten Erlebnisse mischen sich poetische Reflexionen und Betrachtungen über Gott und die Welt, die diese kleinen Erinnerungen zur großartigen Lektüre machen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 169
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
José Saramago
Kleine Erinnerungen
Aus dem Portugiesischen von Marianne Gareis
Hoffmann und Campe
Für Pilar, die noch nicht geboren war und noch lange auf sich warten ließ.
Lass dich von dem Kinde führen, das du einmal warst.
Buch der Ratschläge
Azinhaga nennen sie das Dorf, das praktisch seit Anbeginn der Nation an dieser Stelle steht (bereits im dreizehnten Jahrhundert besaß es einen königlichen Freibrief), doch aus dieser wundersamen alten Zeit ist nichts geblieben außer dem Fluss, der vermutlich seit Erschaffung der Welt am Dorf entlangführt und, so weit ich zurückdenken kann, niemals seinen Lauf geändert hat, obgleich er unzählige Male über die Ufer getreten ist. Einen knappen Kilometer südlich der letzten Häuser trifft sich der Almonda, so heißt der Fluss meines Dorfes, mit dem Tejo, dem er schon in früheren Zeiten geholfen hat, mit seinen bescheidenen Wassermengen die Niederungen zu überschwemmen, wenn im Winter wolkenbruchartige Regenfälle auf die Erde niedergingen und die randvollen, flussaufwärts gelegenen Staudämme ihr überschüssiges Wasser ablaufen lassen mussten. Das Land ist flach und glatt wie eine ausgestreckte Hand, ohne nennenswerte orographische Besonderheiten, die wenigen Deiche dienten eher dazu, die Fluten dorthin umzuleiten, wo sie weniger Schaden anrichteten, als dem gewaltigen Ansturm des Hochwassers standzuhalten. Schon in diesen alten Zeiten haben die in meinem Dorf geborenen und ansässigen Menschen gelernt, mit diesen beiden Flüssen umzugehen, die ihm letztlich seinen Charakter verliehen, mit dem Almonda, der direkt nebenan vorbeiströmt, und dem Tejo, der etwas weiter südlich verläuft, versteckt hinter einer säumenden Mauer aus Pappeln, Eschen und Weiden, von denen einige aus guten oder schlechten Gründen in der dörflichen Erinnerung (und Überlieferung) allgegenwärtig sind. Dort kam ich zur Welt, dort wurde ich, weil die Not meine Eltern nach Lissabon trieb, als knapp Zweijähriger wieder herausgerissen und in eine andere Art, zu fühlen, zu denken und zu leben, eingeführt, als sei mein Geborenwerden an diesem Ort ein gerade noch aufzuhebender misslicher Zufall, ein Versehen des Schicksals gewesen. Zu spät. Von aller Welt unbemerkt, hatte das Kind Ranken und Wurzeln geschlagen, hatte dieser zarte Keim, der ich damals war, die Zeit genutzt, seine winzigen, unsicheren Beinchen auf den Lehmboden zu setzen, um von diesem unauslöschlich das Siegel der Heimat eingebrannt zu bekommen, von diesem mal schlammigen, mal trockenen wandelbaren Grund unter dem weiten Ozean der Lüfte, bestehend aus pflanzlichen und tierischen Überresten, aus allerlei Abfällen, aus gemahlenem, pulverisiertem Felsgestein, aus vielfältigen, kaleidoskopartigen Substanzen, die das Leben durchlaufen hatten und zum Leben zurückgekehrt waren wie Erde und Mond, Trockenzeit und Regenzeit, Kälte und Hitze, Wind und Windstille, Schmerz und Freude, Sein und Nichts. In dem geheimnisvollen Buch des Schicksals und den dunklen Wirren des Zufalls stand geschrieben, und ich allein wusste das, ohne mir dessen bewusst zu sein, dass ich nach Azinhaga zurückkehren sollte, um fertig geboren zu werden. Meine ganze Kindheit und frühe Jugend über war dieses arme, einfache Dorf mit seiner rauschenden Grenze aus Wasser und Grün, seinen von silbrigen Olivenhainen gesäumten Häuschen, die im Sommer in der Sonne sengten, im Winter in mörderischem Frost erstarrten oder in den Fluten ertranken, der Geburtsort, in dem ich noch immer ausgetragen wurde, der schützende Beutel, in dem dieses kleine Beuteltier steckte, um im Guten und vielleicht auch im Schlechten das aus sich zu machen, was es heimlich, still und leise nur für sich alleine machen konnte.
Kluge Leute behaupten, das Dorf sei entlang eines Hohlweges, einer azinhaga, entstanden, wobei der Begriff auf das arabische as-zinaik, schmale Straße, zurückgeht, doch das war es damals bestimmt nicht, denn eine Straße, egal ob schmal oder breit, bleibt immer eine Straße, während ein Pfad nie mehr als ein Schleichweg ist, eine Abkürzung, auf der man schneller ans Ziel gelangt, und in der Regel auch ohne größere Zukunft oder vermessene Ambitionen hinsichtlich seiner Länge. Ich habe keine Ahnung, wann der extensive Olivenanbau in dieser Gegend eingeführt wurde, zweifle jedoch nicht an der Überlieferung der Alten, nach der die ältesten Olivenhaine bereits zwei, drei Jahrhunderte auf dem Buckel hatten. Weitere werden sie nicht erleben. Vor einigen Jahren wurde Hektar um Hektar dieses mit Olivenbäumen bestandenen Landes unbarmherzig abgeholzt, Hunderttausende von Bäumen wurden gefällt, alte Wurzeln ausgegraben oder der Fäulnis überlassen, Wurzeln jener Bäume, die viele Generationen lang Öllampen gespeist und Suppen verfeinert hatten. Für jeden gefällten Olivenbaum bezahlte die Europäische Gemeinschaft den Landeigentümern, mehrheitlich Großgrundbesitzer, eine Prämie, und heute erstreckt sich vor unseren Augen anstelle der geheimnisvollen, etwas unheimlich anmutenden Olivenhaine aus meiner Kindheit und Jugend, anstelle der knorrigen, mit Moos und Flechten bewachsenen Bäume mit ihren Schlupflöchern für die Eidechsen, anstelle jener Himmelsdächer aus olivenbehangenen und mit Vögeln bevölkerten Ästen ein endloses, monotones Meer aus Hybridmais, die Pflanzen alle gleich hoch, vermutlich mit derselben Anzahl von Blättern und morgen vielleicht derselben Anordnung und Zahl von Maiskolben und jeder Maiskolben mit derselben Anzahl von Körnern. Ich klage nicht, weine nicht einer Sache nach, die gar nicht mein Eigen war, versuche nur zu erklären, dass diese Landschaft nicht mehr die meine ist, dass dies nicht der Ort ist, an dem ich geboren wurde, dass ich hier nicht aufgewachsen bin. Natürlich weiß ich, dass der Mais zu den Grundnahrungsmitteln zählt, für viele Menschen sogar mehr als das Olivenöl, und ich selbst bin in meinen frühen Jugendjahren auch mit einem Stoffbeutel um den Hals durch die damaligen Maisfelder gestreift, um nach erfolgter Ernte die Kolben einzusammeln, die den Landarbeitern entgangen waren. Aber ich muss gestehen, dass ich heute unweigerlich eine Art boshafte Genugtuung verspüre, wenn ich Leute aus dem Dorf sagen höre, die alten Olivenhaine abzuholzen sei ein Fehler, eine Riesendummheit gewesen. Auch dem Olivenöl wird man umsonst nachtrauern. Heute, erzählen sie mir, werden wieder Olivenbäume angepflanzt, aber solche, die unabhängig vom Alter immer klein bleiben. Sie wachsen schneller, und die Oliven lassen sich leichter ernten. Wo sich allerdings die Eidechsen verstecken sollen, weiß ich nicht.
Das Kind, das ich war, sah die Landschaft nicht so, wie der spätere Erwachsene sie sich von seiner Manneshöhe herab vielleicht vorstellt. Das Kind war einfach in dieser Landschaft, war Teil von ihr, hinterfragte sie nicht, dachte weder mit diesen noch mit anderen Worten: ›Was für eine schöne Landschaft, was für ein wunderbares Panorama, was für eine grandiose Aussicht!‹ Natürlich konnten seine jungen Augen, wenn es auf den Glockenturm der Kirche stieg oder die Wipfel einer zwanzig Meter hohen Esche erklomm, die weiten Räume vor sich erkennen und auch ermessen, doch richtete es sein Augenmerk lieber auf Dinge und Wesen, die sich in seiner Nähe befanden, die greifbar waren, oder aber auf solche, die es unbewusst zu verstehen und aufzunehmen galt (es muss wohl nicht eigens erwähnt werden, dass das Kind damals nicht ahnte, einen solchen Schatz in sich zu tragen), sei es eine flüchtige Schlange, eine Ameise mit hochaufgerichteter Weizengranne, ein aus dem Trog fressendes Schwein, eine Kröte mit angewinkelten Beinen oder einen Stein, eine Spinnwebe, die Furche, die der eiserne Pflug hinterließ, ein verlassenes Nest, die Träne aus Harz, die aus dem Pfirsichbaum tropfte, den glitzernden Raureif auf dem Gras. Oder den Fluss. Viele Jahre später sollte der Jugendliche, bereits mit den Worten des Erwachsenen, ein Gedicht über diesen Fluss schreiben – diesen bescheidenen, heute schmutzig stinkenden Wasserlauf –, in dem er gebadet und den er befahren hatte. Protopoem hat er es genannt, und hier ist es: ›Dem wirren Knäuel der Erinnerungen, dem Dunkel der doppelten Knoten, entnehme ich einen Faden, der mir lose erscheint. / Ich ziehe ihn langsam heraus, aus Angst, er könnte zwischen meinen Fingern zerfasern. / Es ist ein langer Faden, grün und blau, mit dem Geruch nach Algen und der warmen Weichheit beseelten Schlamms. / Es ist ein Fluss. / Er fließt durch meine Finger, die nun nass sind. / Seine Wasser rinnen über meine offenen Handflächen, und auf einmal weiß ich nicht, ob sie aus mir strömen oder zu mir fließen. / Ich ziehe noch mehr hervor, nicht nur die bloße Erinnerung, sondern den eigentlichen Körper des Flusses. / Auf meiner Haut fahren Boote, ich bin diese Boote, bin der Himmel, der sie überspannt, die hohen Pappeln, die träge über die glänzende Haut meiner Augen gleiten. / Fische schwimmen in meinem Blut, sie schwanken zwischen zwei Wassern wie vage Impulse der Erinnerung. / Ich spüre die Kraft meiner Arme und die Stange, ihre Verlängerung. / Tief wie ein langsamer, kräftiger Herzschlag taucht sie in den Fluss, taucht in mich ein. / Der Himmel ist nun näher und hat seine Farbe verändert. / Er ist ganz grün und geräuschvoll, denn Ast für Ast erwacht das Vogelgezwitscher. / Und wenn das Boot an einer breiten Stelle anhält, glänzt mein nackter Körper in der Sonne über dem noch helleren Funkeln der Wasseroberfläche. / Diffuse Erinnerungen an die Vergangenheit und die jähe Zukunft verschmelzen hier zu einer einzigen Wahrheit. / Ein namenloser Vogel stößt von irgendwoher herab und ruht stumm auf dem strengen Bug des Bootes. / Reglos warte ich darauf, dass das Wasser sich blau färbt und die Vögel auf den Ästen verkünden, warum die Pappeln so hoch und ihre Blätter so laut sind. Nun fahre ich weiter, verschmolzen mit Boot und Fluss, in Richtung des goldenen, von vertikalen Schwertern gesäumten Stauwassers. / Dort werde ich meinen Stab hinabsenken, drei Handbreit tief, hinunter zum lebenden Stein. / Die große Urstille wird herrschen, wenn Hände sich zu Händen gesellen. / Danach werde ich alles wissen.‹ Man weiß nicht alles, wird nie alles wissen, aber es gibt Stunden, in denen wir das glauben, vielleicht weil in solchen Augenblicken nichts anderes Platz hat in unserer Seele, unserem Bewusstsein, unserem Geist, wie immer wir das nennen wollen, was uns einigermaßen menschlich macht. Ich blicke vom Steilufer hinab auf die Strömung, die kaum vom Fleck kommt, auf das nahezu stehende Wasser, und stelle mir absurderweise vor, alles würde wieder werden, was es einmal war, wenn ich noch einmal meine kindliche Nacktheit dort eintauchte, wenn ich noch einmal die lange, feuchte Stange oder die klatschenden Ruder von damals in meine heutigen Hände nähme und das altmodische Boot auf der glatten Wasseroberfläche vorantriebe, das einst jenes Wesen, das ich war und das irgendwo in der Zeit gestrandet ist, an die Schwelle des Traumes trug.
Das Haus, in dem ich geboren wurde, existiert nicht mehr, aber das ist mir gleichgültig, denn ich habe keine Erinnerung daran, dass ich je darin gelebt habe. Ebenfalls in Trümmern liegt jenes andere Haus, das zehn bis zwölf Jahre lang mein erstes, intimstes und eigentliches Zuhause war, nämlich das karge Heim meiner Großeltern mütterlicherseits, Josefa und Jerónimo, dieser magische Kokon, in dem sich für mich die entscheidende Metamorphose vom Kind zum Jugendlichen vollzog. Dieser Verlust erfüllt mich jedoch schon lange nicht mehr mit Bedauern, denn dank der Rekonstruktionsfähigkeit meines Gedächtnisses kann ich seine weißen Wände jederzeit neu errichten, den Olivenbaum wieder pflanzen, der seinem Eingang Schatten spendete, kann das Guckloch in der Tür, das Tor zum Garten, an dem ich einst eine kleine, eingerollte Schlange sah, öffnen und schließen, kann die Schweineställe betreten und den Ferkeln beim Nuckeln zusehen, in die Küche gehen und mit der großen Karaffe meinen Emaillebecher mit dem Wasser füllen, das zum tausendsten Mal meinen sommerlichen Durst stillt. Dann sage ich zu meiner Großmutter: ›Oma, ich mach eine kleine Wanderung.‹ Sie antwortet: ›Ja, mach nur‹, aber sie ermahnt mich nicht, vorsichtig zu sein, denn damals hatten die Erwachsenen noch mehr Vertrauen zu den Kindern, die sie erzogen. Ich stecke ein Stück Maisbrot, eine Handvoll Oliven und getrocknete Feigen in meinen Rucksack, schnappe mir einen Stock für den Fall, dass ich einen Hund abwehren muss, und ziehe ins Land hinaus. Die Auswahl ist nicht groß: Entweder gehe ich zum Fluss mit seiner schier undurchdringlichen, schützenden Ufervegetation oder zu den Olivenhainen und den stoppeligen, bereits gemähten Weizenfeldern oder flussabwärts in den dichten, aus Tamarisken, Buchen, Eschen und Pappeln bestehenden Wald am Tejo-Ufer, nach dessen Vereinigung mit dem Almonda. Oder ich gehe nach Norden zu einem fünf bis sechs Kilometer vom Dorf entfernten sumpfigen See namens Paul do Boquilobo, einer Art Weiher, den der Schöpfer der Landschaften vergessen hat mit ins Paradies zu nehmen. Die Auswahl war nicht groß, nein, aber für dieses melancholische Kind, für diesen nachdenklichen und nicht selten traurigen Jugendlichen bedeutete sie die vier Himmelsrichtungen des Universums, wenn nicht gar jede für sich das gesamte Universum verkörperte. Mochte das Abenteuer auch Stunden dauern, er gab nicht auf, ehe er sein Ziel erreicht hatte. Allein in sengender Hitze die weiten Olivenhaine zu durchqueren, sich einen Weg durch Büsche, Unterholz, Brombeergestrüpp oder die nahezu unpassierbare Mauer aus Kletterpflanzen an den Flussufern zu schlagen, auf einer schattigen Lichtung der nur von Vogelgezwitscher und Blätterrauschen durchbrochenen Stille zu lauschen, sich an den Trauerweiden von Ast zu Ast über den Sumpf zu hangeln sind, wie man meinen könnte, keine nennenswerten Heldentaten in einer Zeit, in der jedes Kind der zivilisierten Welt, und sei es auch ein noch so träger Stubenhocker, im Alter von fünf, sechs Jahren bereits zum Mars gereist ist, um einen Haufen grüner Männchen abzuknallen, das schreckliche Heer der mechanischen Drachen dezimiert hat, die das Gold von Fort Knox bewachen, ohne Taucherausrüstung oder Tiefseeboot in die entlegensten Gräben hinabgestiegen ist und außerdem die Menschheit vor dem monströsen Meteoriten gerettet hat, der die Erde zerstören sollte. Derart glorreichen Heldentaten hätte der kleine Junge aus Azinhaga höchstens entgegensetzen können, dass er den Wipfel der zwanzig Meter hohen Esche erklomm oder, etwas bescheidener, dafür aber kulinarisch interessanter, frühmorgendlich den heimischen Feigenbaum erkletterte, um die taufeuchten Früchte zu pflücken und wie ein naschhafter Vogel den süßen Honigtropfen abzulecken, der aus ihnen ausgetreten war.
Es gibt Menschen, die behaupten allen Ernstes, und das untermauern sie dann noch mit irgendeinem klassischen Zitat, die Landschaft sei ein Seelenzustand, was einfacher ausgedrückt heißt, das, was die Betrachtung einer Landschaft in uns auslöst, hänge stets von der Gemütsverfassung und Laune ab, in der wir uns im Augenblick des Betrachtens befinden. Ich wage nicht, das zu bestreiten. Doch wird damit unterstellt, Seelenzustände seien ausschließlich Volljährigen vorbehalten, großen Leuten also, die bereits in der Lage sind, die ernsthaften Gedankengänge, mit denen derart subtile Vorgänge analysiert, definiert oder ausgeführt werden, einigermaßen zu erfassen. Etwas für Erwachsene, die alles zu wissen meinen. Der Jugendliche, um den es hier geht, wurde beispielsweise nicht gefragt, wie seine Stimmung war und was für interessante Schwingungen der Seismograph seiner Seele gerade verzeichnete, als er eines unvergesslichen Tages zu noch nächtlicher Stunde aus dem Pferdestall trat, wo er zwischen den Pferden genächtigt hatte, und an Stirn, Gesicht, Körper und auch an etwas außerhalb des Körpers Befindlichem vom Glanz des leuchtendsten Mondes berührt wurde, den menschliche Augen je gesehen haben. Und auch nicht, was er empfand, als er bei bereits hoch am Himmel stehender Sonne seine Schweine, von denen er einen Großteil auf dem Markt verkauft hatte, über Hügel und Täler zurücktrieb und bemerkte, dass seine Füße auf ein grobes, aus schlechtgefügten Steinplatten bestehendes Pflaster traten, eine höchst ungewöhnliche Entdeckung in einer Wildnis, die seit Urzeiten einsam und verlassen zu sein schien. Erst viele Jahre später sollte er begreifen, dass es sich um die Überreste einer Römerstraße handelte.
Doch sind diese kleinen Wunder, die meinen wie die der frühreifen Herrscher über virtuelle Reiche, nichts gegen das eine Mal, da ich kurz vor Sonnenuntergang Azinhaga und das Haus meiner Großeltern verließ (ich muss ungefähr fünfzehn gewesen sein), um mich in einem benachbarten Dorf auf der anderen Seite des Tejo mit einem Mädchen zu treffen, in das ich verliebt zu sein glaubte. Ein alter, von Sonne und Schnaps geröteter Fährmann namens Gabriel (die Leute aus dem Dorf nannten ihn Graviel), eine Art Riese mit weißem Haar, kräftig wie der heilige Christophorus, sollte mich ans andere Ufer bringen. Ich hatte mich auf den Planken der diesseitigen Anlegestelle, die wir Hafen nannten, niedergelassen und wartete, bis ich auf dem von letzten Sonnenstrahlen erhellten Wasser das rhythmische Schlagen der Ruder vernahm. Er näherte sich langsam, und ich spürte (wegen meines Seelenzustands?), dass ich bald etwas Unvergessliches erleben würde. Oberhalb des gegenüberliegenden Hafens stand eine riesige Platane, unter der die Rinderherde des Gutshofes ihren Mittagsschlaf zu halten pflegte. Ich machte mich auf den Weg, mitten durch Brachland, Gräben und Pfützen, über die Deiche hinweg, wie ein heimlicher Jäger auf der Suche nach einer seltenen Beute. Die Nacht war hereingebrochen, und in der ländlichen Stille waren nur meine Schritte zu hören. Ob das Rendezvous glücklich oder unglücklich verlief, will ich später erzählen. Es gab einen Ball, ein Feuerwerk, und ich glaube, ich verließ das Dorf erst gegen Mitternacht. Ein Vollmond, weniger leuchtend als der andere, erhellte die Landschaft. Kurz vor der Stelle, an der ich von der Straße abbiegen und querfeldein gehen musste, schien der schmale Weg, auf dem ich marschierte, auf einmal zu enden oder hinter einem hohen Wall zu verschwinden, und vor mir stand, als wollte er mir den Weg versperren, ein hoher Baum, der vor dem klaren Nachthimmel zunächst sehr dunkel wirkte. Da erhob sich eine Bö. Sie ließ die zarten Grashalme, das scharfe grüne Schilf erzittern und kräuselte das schlammige Wasser einer Pfütze. Wie in einer Wellenbewegung richtete sich das breitgefächerte Geäst des Baumes auf und stieg rauschend den Stamm empor, bis auf einmal alle Blätter ihr verstecktes Gesicht dem Mond zuwandten und die Buche (es war ein Buche) bis in ihre obersten Wipfel in weißem Glanz erstrahlte. Es war nur ein Augenblick, nichts weiter als ein Augenblick, doch die Erinnerung an ihn wird so lange währen wie mein Leben. Es gab keine Tyrannosaurier, keine Marsmännchen oder mechanischen Drachen, zwar flog ein Meteorit durch die Luft (das zu glauben fällt nicht schwer), aber die Menschheit war, wie sich später herausstellte, nicht in Gefahr. Nach langem Marsch stieß ich auf freiem Feld auf eine Strohhütte, in der ich ein Stück angeschimmeltes Maisbrot fand, um meinen Hunger zu überlisten, denn bis zum Morgengrauen war es noch lang. Dort übernachtete ich. Als ich beim ersten Morgenlicht aufwachte und augenreibend in den flirrenden Dunst trat, durch den die umliegenden Felder kaum zu erkennen waren, spürte ich, wenn ich mich richtig erinnere und es nicht jetzt gerade erfinde, dass ich endlich fertig geboren war. Es war auch an der Zeit.
Warum nur diese Angst vor Hunden? Warum diese Faszination für Pferde?
Die Angst, die mich trotz späterer positiver Erfahrungen mit Hunden noch immer befällt, wenn ich mich einem unbekannten Vertreter dieser Spezies gegenübersehe, geht bestimmt auf das schreckliche Erlebnis zurück, das ich mit etwa sieben Jahren hatte, als ich bei einbrechender Dunkelheit, die Straßenlaternen brannten schon, jenes Haus in der Rua Fernão Lopes (am Saldanha) betreten wollte, in dem wir mit zwei weiteren Familien in häuslicher Gemeinschaft lebten. Auf einmal ging die Tür auf, und der Wolfshund unserer Nachbarn kam wie die schlimmste aller malaiischen oder afrikanischen Bestien herausgeschossen. Er machte seinem Namen alle Ehre, als er sofort lautstark bellend auf mich losging, während ich in meiner Verzweiflung um Bäume Haken schlug und um Hilfe rief. Besagte Nachbarn, die ich nur so nenne, weil sie im selben Haus wohnten, und nicht, weil sie etwas mit diesen armen Schluckern, nämlich uns, die wir die Mansarde im sechsten Stock bewohnten, gemein hatten, brauchten lange, bis sie das Tier riefen, länger, als einfache Nächstenliebe verlangt. Und falls mein Gedächtnis mich nicht trügt und ich dem Schrecken nicht auch noch die Schmach hinzufüge, dann haben sich die Hundebesitzer, feine, elegante junge Leute (es waren die jugendlichen Kinder der Familie, ein Junge und ein Mädchen), an dem Schauspiel auch noch ergötzt, wie man früher zu sagen pflegte. Dank meiner flinken Beine konnte ich dem Tier entwischen, sodass es mich nicht gebissen hat, aber vielleicht wollte es das ja gar nicht, womöglich hatte es sich nur selbst erschrocken, als ich so unvermittelt an der Eingangstür auftauchte. Wir hatten Angst voreinander, das war es. Das Gemeine an dieser Geschichte, die ebenso banal ist wie die übrigen, war jedoch, dass ich jedes Mal, wenn ich draußen vor der Tür stand, das Gefühl hatte, der Hund, genau dieser Hund würde dort drin auf mich warten, um mir an die Gurgel zu gehen … Ich hatte dieses Gefühl, man frage mich nicht, weshalb, ich hatte es einfach.
U