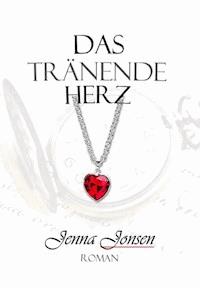
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit der Geburt von Tochter Lee nimmt Jennas bisher eher wenig opulentes Leben, im Alter von 19 Jahren, seine erste Wendung. Doch schon kurze Zeit später scheitert die Beziehung zu Sims, dem Kindesvater, als Jenna zufällig Miky begegnet. Seine charmante Ader, sein gutes Aussehen und sein Erfolg ziehen sie sofort in seinen Bann. Hoffnungslos ist sie seiner Liebe verfallen. Das frische Liebesglück soll nicht lange währen und wird abrupt wieder getrübt. Miky, kein Mann großer Worte, gibt alles für sein Herzblatt, wenn er auch nicht immer fair zu bleiben weiß. Wie sehr er sich quält merkt Jenna erst spät, zu spät! Beginnend, seinen Kummer mehr und mehr im Alkohol zu ertränken, repräsentiert sich dieser riesige, schier unüberwindbare Scherbenhaufen, dem Jenna zu guter Letzt die krönende Spitze aufsetzt. Lee, ohne Widerrede gezwungen ihr komplettes Leben umzukrempeln, hat den großen Knall bereits für einen späteren Zeitpunkt vorprogrammiert, während Örlin Dindler, der penetrante Ober-Stalker aus demselben Haus, Jenna, wie ein Dackel, auf Schritt und Tritt folgt. Es beginnt ein Wettlauf um die Liebe und der erbarmungslose Kampf ums eigene Überleben… Eine ungewöhnliche, knallharte Liebesgeschichte. "Wer nicht liebt, lebt nicht." "Wer liebt, erfährt Leben."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 220
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Jenna Jonsen
Das tränende Herz
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Titel
Widmung
Zum Buch
Prolog
Kapitel 1 – Früher Vogel
Kapitel 2 – Kollos auf Zeit
Kapitel 3 – Wein & Kerzenschein
Kapitel 4 – Wer suchet…
Kapitel 5 – Halliston Ahoi
Kapitel 6 – Durchatmen
Kapitel 7 – Godspeed
Kapitel 8 – Adios Compaňero
Kapitel 9 – Barbarische Modifikation
Kapitel 10 – Aus Fehlern lernt der Mensch
Kapitel 11 – Kill Örlin
Kapitel 12 – Zug um Zug
Kapitel 13 – (Ein) Schnitt
Kapitel 14 – Objekt der Begierde
Kapitel 15 – Totes Tier gefällig?
Kapitel 16 – Ausgebrannt
Kapitel 17 - Ich bin dann mal am Leben
Epilog
Impressum neobooks
Titel
Das tränende Herz
von
Jenna Jonsen
Originalausgabe Juli 2016
© Jenna Jonsen, alle Rechte vorbehalten
Aus datenschutzrechtlichen Gründen und zum Schutz jeglicher Persönlichkeitsrechte wurden Namen handelnder Personen geändert. Ähnlichkeiten oder Übereinstimmungen sind deshalb zufällig und ohne Absicht. Texte und Bilder dieses Werkes stellen urheberrechtlich geschütztes Material dar und sind ohne explizite Erlaubnis des Urhebers, Rechteinhabers und Herausgebers für Dritte nicht frei nutzbar.
Widmung
Für den Mann, der mein Herz zutiefst berührt und mein Leben für immer verändert hat. Du hast mir beigebracht, eine andere Sichtweise an den Tag zu legen. Ich werde dich niemals vergessen. Vielen Dank für die wunderschöne Zeit…
Einen riesigen Dank auch an meine Tochter Lee. Ich werde zu jeder Zeit für dich da sein, dich lieben und dich bis zum letzten Atemzug in meinem Herzen tragen.
Mama: Ich bin froh dich zu haben und danke dir für alles was du je für mich getan hast, auch wenn wir früher nicht immer das beste Verhältnis pflegen konnten. Love you!
Der letzte Dank geht an Ela, ohne dich wäre ich nur halb so viel, wie Yin ohne Yang. Take-Team forever!
»Denn wer liebt, der ist voller Sehnsucht
und findet nie ruhigen Schlaf,
sondern zählt und berechnet die ganze
Nacht hindurch die Tage,
die da kommen und gehen…«
Chrétien de Troyes
(1140 – 1190 v. Chr.), altfranzösischer Dichter.
Zum Buch
Mit der Geburt von Tochter Lee nimmt Jennas bisher eher wenig opulentes Leben, im Alter von 19 Jahren, seine erste Wendung. Doch schon kurze Zeit später scheitert die Beziehung zu Sims, dem Kindesvater, als Jenna zufällig Miky begegnet. Seine charmante Ader, sein gutes Aussehen und sein Erfolg ziehen sie sofort in seinen Bann. Hoffnungslos ist sie seiner Liebe verfallen.
Das frische Liebesglück soll nicht lange währen und wird abrupt wieder getrübt. Miky, kein Mann großer Worte, gibt alles für sein Herzblatt, wenn er auch nicht immer fair zu bleiben weiß. Wie sehr er sich quält merkt Jenna erst spät, zu spät!
Beginnend, seinen Kummer mehr und mehr im Alkohol zu ertränken, repräsentiert sich dieser riesige, schier unüberwindbare Scherbenhaufen, dem Jenna zu guter Letzt die krönende Spitze aufsetzt.
Lee, ohne Widerrede gezwungen ihr komplettes Leben umzukrempeln, hat den großen Knall bereits für einen späteren Zeitpunkt vorprogrammiert, während Örlin Dindler, der penetrante Ober-Stalker aus demselben Haus, Jenna, wie ein Dackel, auf Schritt und Tritt folgt.
Es beginnt ein Wettlauf um die Liebe und der erbarmungslose Kampf ums eigene Überleben…
Eine ungewöhnliche, knallharte Liebesgeschichte.
»Wer nicht liebt, lebt nicht.«
»Wer liebt, erfährt Leben.«
Prolog
Ich wachte durch und durch schweißgebadet auf. Mir war glühend heiß. Abgedeckt. hatte ich mich anscheinend schon während des Schlafs. »Jedes Mal wieder ein und dasselbe Spielchen…«, murmelte ich benommen, im Halbschlaf, vor mich hin. Mein hellblaues Baumwoll-Schlafshirt war pitschnass, fast zum Auswinden bereit, die oliv-gestreifte Bettdecke aus weichem Satin ebenso. Das Kopfkissen lag zerknittert am Boden. Ich konnte nur die Umrisse im Dunkeln erkennen. Wieder durchlebte ich eine dieser scheinbar endlosen Nächte, die sich in letzter Zeit mehr als genug häuften. Es war eine dieser Nächte, in der mich der seltsame, zermürbende Traum verfolgte. Ich fühlte mich zerstreut. Mein Kopf schien wie von einem D-Zug überrollt. Seitdem ich klein war, ungefähr sieben Jahre alt, träumte ich beinahe jede Nacht denselben Traum…
…von einem düsteren schwarzen Ritter auf seinem stolzen, braunen Hengst, wie er mit lautem Hufschlag auf mich zugeritten kam. Sein Gesicht erkannte ich nie, der schwere, eiserne Helm wusste es gut zu verbergen. Sein schneller Atem und das laute Pferde-Gewieher übertönten kurzzeitig wiederholend die angespannte Situation. Er trug einen laut klimpernden Sack glänzender Goldstücke bei sich, der an seinem schwarzen Gürtel, aus geflochtenem Rindsleder, hing. Ich griff nicht nach seiner mächtigen, in eiserne Klumpen gepackte, Pranke, die nach der Meinigen zu greifen versuchte, ich streckte meine Rechte nach dem Sack voll Gold aus. Mit Müh und Not erreichte er meine Hand und zog mich hurtig auf sein Pferd. Affenartig klammerte ich mich um seine Lenden, so furchtbar fest, dass sich das Muster seiner schweren, eisernen Rüstung deutlich in der Haut meiner beiden dünnen Unterarme abzeichnete. Gemeinsam ritten wir entlang der Festung, an dessen weiß-rote Fensterläden aus Holz ich mich gut erinnerte. Wieder und wieder spiegelte meine Traumwelt die gleichen Szenen, an ein- und demselben Ort. Und dann endete die Träumerei, immer schlagartig an gleicher Stelle…
…und das seit Jahren, nein, seit über einem ganzen Jahrzehnt.
Wie fanatisch versuchte ich, in einem eigenen Ritual, jeden Abend vorm zu Bett gehen, meine Träume auf Biegen und Brechen zu beeinflussen. Dass das keineswegs funktionierte, begriff ich aber recht zügig. Zu wissbegierig schien ich über dessen Bedeutung inklusive Fortsetzung. »Es muss doch irgendetwas aussagen, nicht umsonst wiederholen sich diese Szenarien in meinem Unterbewusstsein, Nacht für Nacht, seit Jahren!«, war ich demnach felsenfest überzeugt. Doch jedes Buch, das mir über Traumdeutung oder ähnliche Thematiken durch die Finger rutschte, führte zu einem anderen Entschluss. Ich hätte also genauso gut einen Glückskeks kaufen und mich auf den Spruch in seinem Innenleben verankern können, so vielfältig und unsicher waren die jeweiligen Bedeutungen gewesen.
Eine Weile in meinem Leben verfolgte er mich nicht, dieser eiserne Kerl, sogar eine ganze Zeit lang. Ob er mir nach einem gewissen Prinzip, auf beruhendem Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung bestimmter Ereignisse, wie in einer Art Kausalzusammenhang, den Schlaf raubte? Anfangs fühlte ich mich, als wäre ein immens bedeutender Teil von mir verloren gegangen, später war ich dennoch heilfroh, dass den nächtlichen Träumereien, samt unkontrollierbaren Schweißausbrüchen und ekelhaftem Zahngeknirsche, ein Ende gesetzt war. Und plötzlich war er wieder da…
…der Traum…
…dieser Ritter aus meiner Kindheit…
…der mir mit den Jahren und zunehmendem Alter vertrauter geworden war. Früher versetzte er mich, mit seinem dominanten, düsteren Auftritt, in Angst und Schrecken. In meinen Träumen schuf ich mir einen »Flucht-Button«für Notsituationen, in denen es brenzlig wurde oder ich starke Angst verspürte. Das klappte in der Regel ganz gut, meist zumindest.
Bis jetzt…
Wieder war ich klitschnass. Mein Körper zitterte von der ersten Haarwurzel meines Oberkopfes angefangen, bis in die letzte Nervenzelle des kleinen Zehs. Ich hörte mich im Schlaf wirres, zusammenhangloses Zeug nuscheln, dann öffnete ich blitzschnell erschrocken, mit fest zusammengebissenem Ober- und Unterkiefer, meine Augenlider…
Mein Hals war pfurztrocken, ich konnte kaum mehr schlucken. Mein Gaumenzäpfchen fühlte sich an, als hätte es den Aufräum-Flash der durchbrausenden Wüstenkolonne, die mir dieses staubige Dürregefühl im Mund bescherte, nicht annähernd überstanden. Ich fühlte mich, als müsse ich bald ersticken.
»Sofort aufstehen!«
»Ein Glas Wasser, junge Lady...«
Das Glas unter dem Hahn randvoll mit eiskaltem Leitungswasser gefüllt, und auf einen Satz durch die Kehle gegurgelt, holten mich, trotz Müdigkeit und Benommenheit, die Gedanken Stück für Stück wieder ein.
»Bravo!«
Wieder kreisten sie um ein und dieselbe Person: Miky Dut.
Wie es ihm wohl gerade erging, ob er auch nicht schlafen konnte?
Ein leerer Blick zur Decke, ein leises »Hhmmm«, gefolgt ein langer, tiefer Seufzer. Irgendwie fühlte ich mich ihm gegenüber immer ziemlich verbunden. Ich fühlte, wenn es ihm nicht gut ging oder sich Probleme anbahnten. Ich fühlte, wenn er bei einem gemeinsamen Ausflug mit seinen Gedanken ganz woanders zu sein schien und ein mildes, bedeutungsloses »Ja, ja« am Satzende über seine Lippen glitt. Ich fühlte es, wenn er in der Klemme steckte und sofortige Hilfe brauchte. Und ich fühlte, wenn er mir Dinge unter die Nase reiben wollte, die nicht der Wahrheit entsprachen und am Ende womöglich noch probierte, mich für dumm zu verkaufen…
Ich kannte jeden seiner Blicke. Blicke, die manchmal gerne hätten gemordet, manchmal gerne geliebt. Nach gewisser Zeit wusste ich, wie er in diversen Situationen reagierte. Ich fühlte, wenn ihm etwas wichtig oder egal war. Wenn ihn etwas verärgerte, drehte sich seine fröhliche Stimmung schnell um 180 Grad und er wanderte in Richtung Decke. Er kochte vor Wut, sobald seine Ohren feuerrot wurden, sich seine Stimmlage, aus einem eben noch angenehm weichen Ton, in ein schrilles, unerträgliches Gemecker hob und seine Blicke wie fanatisch den Brandpunkt fixierten, von dem sie keine Millisekunde mehr abwichen. Andersrum war er der großherzigste und liebste Mann den man sich vorzustellen vermochte. Ohne ein Wort las er mir beinahe jeden Wunsch von den Augen ab, und war er noch so winzig. Gerne besiegelte er seine Liebe immer wieder aufs Neue mit kleinen Aufmerksamkeiten. An seiner Seite fühlte ich mich wie eine stolze Gewinnerin des Jackpots der Liebe…
Die Vergangenheit war abermals präsent und die Gedanken daran, dass mein Leben hätte gerade so schön verlaufen können, holten mich erneut ein. Wäre da nicht dieses verdammte »Hätte« gewesen. Und dabei war mein Plan zu anfangs eigentlich ganz simpel: »Glücklich und zufrieden mit meinen Liebsten alt werden…
…ein Haus am See, mit großer knarzender, dunkler Holzterrasse, eigenem kleinen Garten samt mehrerer Gemüsebeete, und dazu ein Hausboot, kaufen, das ganze Pipapo eben«, so und nicht anders sollte sich das Netz meines Vorhabens um uns herum spinnen!
Auch wenn Miky nicht der leibliche Vater von Lee, meiner Tochter, war, kannte er sie fast ihr gesamtes Leben lang. Als Lee sechs Monate alt wurde und noch nicht laufen oder sprechen konnte, lernten Miky und ich uns kennen. Zwar stand von Anfang an fest wer Lees leiblicher Daddy war, trotzdem betitelte sie ihn oft als »Papa«. Er schien manchmal etwas streng, doch dann griff ich sogleich ein und ging, wenn nötig, auf Vollkonfrontation. Miky hatte keine eigenen Kinder und somit wenig Erfahrung. Obwohl schlimmste Schmerzen die Geburt meiner Tochter begleiteten, genauer gesagt die ärgsten die ich je ertragen musste, ist die kleine Prinzessin aus meinem Leben nicht mehr wegzudenken. Für Lee war Miky, neben mir, die wichtigste Bezugsperson. Und für mich war er…
…mein Ein und Alles!
Und jetzt sollte ich nicht mehr jeden Morgen neben ihm aufwachen…
Ich sollte ihm beim Aufstehen keinen Kuss mehr auf seine glänzende, praktisch faltenfreie Stirn drücken und ihn dabei so herzhaft süß Grinsen sehen. Ich sollte seine funkelnden, fast schon in ein edles Smaragd-grün eintauchend, tiefgrünen Augen nicht mehr sehen, die ich so sehr an ihm liebte. Ich sollte seine Schmolllippen, wenn er ein zärtliches »Guten Morgen, Schnecke! Na, gut geschlafen?« über sie blies, nicht mehr aufeinandertreffen hören. Ich sollte ihn nicht mehr umarmen und den rosigen Duft seiner warmen, weichen Haut riechen, wenn er frühmorgens aus dem Bett kroch, um sich seinen Kaffee aus der Maschine aufzubrühen, die lauter als ein Baustellenfahrzeug war und einen automatisch senkrecht ins Bett stellte, bevor er sich montags bis freitags für die Arbeit schniegelte und striegelte. Ich sollte seinen süßen Apfelarsch nicht mehr sehen, wenn er fast nackt, halbverschlafen und noch derbe verpeilt, durch die Wohnung rannte und eine undefinierbare, dennoch klangvolle, Melodie vor sich hin pfiff. Ja, sogar die morgendlichen Aufräumattacken, nachdem er das Haus verlassen hatte und ich das halbe Waschbecken mit Zahnpasta verschmiert vorfand, oder der Kaffeefleck auf dem schwarz glänzenden Glastisch in der Küche, der zusammen mit den verteilten Zuckerstreuseln seine halbe Sitzseite verklebte, fehlten mir nun. All diese und viele andere Kleinigkeiten…
Zuvor war meine Aufmerksamkeit nie bewusst auf Derartiges gerichtet. Mit dem Lauf der Zeit flossen diverse Handlungen automatisch in den Alltag mit ein. So verlor beispielsweise ein gemeinsames Abendessen an Bedeutung und die Abende vor dem Fernseher verliefen zunehmend schweigsam, weil sie sich in die Kategorie »Selbstverständlichkeit« einordnen ließen. Das alles gab es jetzt nicht mehr. Und das war mitunter mein eigen praktiziertes Werk.
»Herzlichen Glückwunsch, mit vollem Körpereinsatz die Zonk-Karte gezogen«, wusste ich ganz klar!
Und das, das blieb selbst nach dieser Zeit unverarbeitet. Zu sehr glich mein Kopf einem undurchdringlichen, tiefen Dschungelgestrüpp, Desorganisation lässt grüßen…
Kapitel 1 – Früher Vogel
Nicht grundlegend rosig, erlebte ich im Großen und Ganzen eine schöne Kindheit. Zu meiner Zeit, als Google & Co noch nicht existierten und die ersten Mobiltelefone, mit ausziehbarer Zahnstocher-Antenne, überwiegend als Schlagknüppel zu nutzen waren, in der das versehentliche Drücken des Internet-Buttons eine wahre Nerven- und Kostenkatastrophe auslöste, gab es für jegliche Blödsinns-Attacken keinerlei Beweise, es sei denn man ließ sich auf frischer Tat ertappen und konnte so direkt zur Rechenschaft gezogen werden. Heute bleibt, dank fortschreitender Entwicklung, nichts mehr dem Zufall überlassen geschweige denn unentdeckt. Und wer konnte schon bisher jemals behaupten, dass er mit einer Handyhalterung am Rollator, womöglich inklusive höchstsensibler Freisprecheinrichtung, sein Haus verlässt?
Bis zum Alter von zwölf Jahren wuchs ich auf einem Bauernhof, in einem kleinen Dorf mit sieben alten Häusern, auf, wie in Schlumpf-hausen, Tür an Tür mit den Anrainern. Ein Geschäft oder Ähnliches gab es nicht. Selbstversorgung stand, neben dem täglichen Schul-Wahnsinn, auf dem Programm. Die nächste Einkaufsmöglichkeit erreichte man nach drei Kilometern, die umliegende Schule nach rund zwanzigminütigem Fußmarsch. Dass mein Schulweg in der kalten Jahreszeit kein Pappenstiel war begriff ich erstmals, als ich die winterlichen Schneemassen mit meinem gelben 5-Gang-Drahtesel zu bekämpfen versuchte und dabei vom Schneepflug ausversehen über den Haufen geräumt wurde. Durch Zufall, auf seinem täglichen Arbeitsweg, entdeckte Onkel Fidy, der Bruder meiner Mutter Regine, mit dem ich zu Kindeszeiten unter einem Dach lebte, mich unter dem großen, eisigen Schneehaufen, vom Pflug zusammengeschert, aus dem ich nicht mächtig war mich eigenständig zu befreien. Zum Glück ragte der Hinterreifen meines Fahrrads aus der Schneemasse heraus, sonst hätte mich wohl niemand so rasch gefunden. Dennoch mochte ich mein zu Hause. Hier durfte ich unbeschwert Kind sein und meine Freizeit, nach den Hausaufgaben, in der Natur oder bei Freunden genießen. Langeweile, ein Fremdwort!
Oma Rosalie, auf deren Hof ich aufwuchs, war Bäuerin und stand jeden Morgen um 3.30 Uhr auf der Matte, wenn der uralte, zerrupfte Nachbarsgockel den ersten grässlichen Schrei von sich stieß, der sich eher dem lauten Gejammer eines brünftigen Hirsches unterordnen ließ. Sämtliches Ungeziefer seines dreckigen Federkleides dürfte auf diese Weise freiwillig das Weite ersucht haben. Rosalie bereitete mir täglich mein Frühstück zu, nachdem sie vom Kühe melken aus dem Stall, mit frisch gezapfter Milch, zurückkehrte. Bei Oma Rosalie und Opa Raimund standen 18 Milchkühe im Stall, die täglich zwei Mal gemelkt werden wollten. So erarbeiteten sich die beiden, neben dem Verkauf von eigen angebautem Obst und Gemüse aus dem Garten, ihr tägliches Brot…
Meine Mutter bekam ich überwiegend an den Wochenenden zu Gesicht, da sie Vollzeit berufstätig war. Schon als Winzling lebte ich somit erstmals bei meinen Großeltern, väterlicherseits, Abery und Hugo. Später pendelte ich wöchentlich zwischen beiden Paaren hin und her. Mein Vater, Sigi, holte mich freitags nach Schulschluss in Obsor, dem kleinen Bauerndorf, ab und fuhr mich zu Abery, wo ich jedes Wochen-ende verbrachte. Meiner Mum nahm ich die seltenen Treffen mit zunehmendem Alter definitiv übel. Als Teenie blieb mir unverständlich, dass Geld nicht auf Bäumen wächst und von irgendwoher kommen musste. Jeden Sonntag kutschierte mich Regine zurück nach Obsor, da ich schulpflichtig war und zuerst die Grundschule, später die fünfte und sechste Klasse der Gesamtschule, besuchte…
Nach zwölf Jahren hatte ich die Nase vom Bauernhofdasein, trotz der Pendelei am Wochenende, gestrichen voll, es fehlte an Abwechslung. »Neue Pflaster beschreiten und eigene Wege gehen«, sollten sich meine Zukunftspläne, Masche für Masche, fest ineinander verstricken. Mein Leben schrie förmlich nach Veränderung. So zog ich zu Oma Abery ins rund 20 Kilometer entfernte Genimo. Die lebte in ihrer 84-Quadratmeter-Parterrewohnung, inmitten der kleinen »Ghetto-Siedlung«, unweit von Schulen und dem »Zentrum des Geschehens« entfernt, wenn es dieser Bezeichnung denn überhaupt würdig war. Beim Einzug in mein Reich, ein rund zwölf Quadratmeter großes, quadratisches Zimmer mit Norm-Fenster, half mir Nachbar Flo, gelernter Maler, nach einer Schnelleinführung in die Fertigkeiten der Wischtechnik, zwei Wände in Gelb zu bepinseln. Ansonsten lebte ich schlicht und einfach, wie es zu meiner Zeit eben so üblich war. Ein Bett, ein Tisch mit Nachttischlampe samt Stuhl, über den ich abends vorm zu Bett gehen die tagsüber getragene Kleidung hängte, und ein kleiner Schrank, in dem meine Klamotten Platz fanden, war so relativ alles was ich besaß. Markenklamotten oder Tablets und Handys spielten keine Rolle. Und das brauchte ich als Kind auch nicht. »Natur pur!« wurde mir zwar zugegeben mit zunehmendem Alter zu öde, doch hätte ich mir keine schönere, unbeschwertere Kindheit vorstellen können. Andererseits gab es für mich keinen schlimmeren Gedanken als Stillstand. Stillstand bedeutet automatisch Rückstand. Und ich wollte mich nicht zurückentwickeln, sondern fortbilden…
Kein Kind von Traurigkeit bildete ich auch in der neuen Klasse der Mädchenrealschule, die Klosterschwestern betreuten, unter den Schülern als »Watschelpinguine« verschrien, rasch Kontakte zu anderen Mitschülerinnen.
»Gesicherte Freizeitaktivitäten!«
Zwar nicht die hellste Leuchte, aber immerhin nicht ganz auf der Brennsuppe daher geschwommen, fiel es mir nicht sonderlich schwer, mich an den übermäßigen Lernstoff, den ich so von der Gesamtschule bisher nicht kannte, zu gewöhnen…
Alles lief rundum gut, dann landete Abery plötzlich im Krankenhaus. Dass sie schwer krank war, wusste ich ja schon als Kind. Aber als Teenie nahm ich nie richtig wahr, was mir meine Eltern da eigentlich erzählten, bis es mir selbst die Augen öffnete und das Leben mich, »Klatsch-Boom«, vor vollendete Tatsachen stellte. Eben wie bei Kleinkindern, nach dem Motto »learning by doing«, so bleibt es oft weiterhin im Erwachsenenalter.
Und da lag sie…
…mit einem Schlauch in der Nase und der Nadel mit 200 Milliliter Infusion im Arm, die ihr angeblich Flüssigkeit zuführen sollte. »Peeeeep…, Peeeeep…, Peeeeep…«, dröhnte es gleichmäßig neben ihr aus dem Puls- und Herzfrequenzmesser, an den sie mit dem linken Zeigefinger, über eine Art kleiner grauer Sensor, angeschlossen war. Das weiße Nachthemd, in das sie die Schwestern bei der Einlieferung gehüllt hatten, glich haargenau ihrer derzeitigen Gesichtsfarbe, käsebleich und weiß wie eine frisch gestrichene Wand. Dass Abery so mit ihrer Gesundheit kämpfte, begriff ich erstmals, als ich sie dort so hilflos liegen sah…
Da sie trotz ihres schweren Herzinfarkts »die Tapfere« spielte und selbst im ärgsten Schmerz keine Mine verzog, wurde sie erst Stunden später in die umliegende Klinik eingeliefert. Zuvor verbrachte sie die halbe Nacht am sperrangelweit offenen Fenster, mit aufgeknöpftem Nachthemd und ihrer Lippenbremsen-Atmung, die sie sich über Dr. Kraus Jahre zuvor für den Ernstfall angeeignet hatte, immer wieder nach Luft ringend. Ich erwachte durch die entstandene Zugluft und nahm ein leises »Au…, Aua…« aus Aberys Schlafzimmer, schräg gegenüber, wahr. Sofort alarmierte ich den Notarzt, der die gebrechliche alte Dame rund 15 Minuten später, lauthals mit Sirene und Blaulicht, ins nächstgelegene Krankenhaus, die Untersberg-Klinik, verfrachtete. Das Nötigste in eine riesige braune Reisetasche aus Leder zusammengewürfelt, fetzte ich mit dem Fahrrad, so schnell meine Beine traten, hinterher in Richtung Notaufnahme, wo Abery zwischenzeitlich gründlich untersucht wurde. »Warum kommen Sie erst jetzt, Frau Fröhlich?«, testete der Kardiologe fragend, mit seiner schwarzen Taschenlampe, das linke Auge fest zugekniffen, ihre momentane Pupillenreaktion. »Na hätten Sie sich mal lieber früher einliefern lassen!«, folgte es weiter in strenger Tonlage.
»Hätte, hätte Fahrradkette…«
»Alles klar. Und hätte, hätte spielt gerade Klarinette«, entgegnete Abery gleich zynisch. »Jegliche Vorwürfe verbessern ihren derzeitigen Zustand natürlich wesentlich!«, musste ich seine zuvor getroffene Aussage abrunden. Vorerst gab es keine genaueren Untersuchungsergebnisse…
Schwester Erika, aktiver Nachtdienst der Station 1, brachte Oma Abery, in ihrem Bett auf Rädern, mit dem Personenaufzug auf Zimmer 101, erster Stock. Hier sollte sie vorerst für unbestimmte Zeit einquartiert werden. Links auf der Fensterseite des Dreibettzimmers abgestellt, die bunten, der Länge nach linierten, Vorhänge zugezogen, noch eine Flasche stilles Wasser hingestellt und schon setzte Erika pfeifend, ohne Weiterbeachtung, den Trott ihrer Nachtschicht fort. »Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich…
…so ausgesprochen fröhlich?«, hörte ich sie unmusikalisch, ihre Crocks quiekend, den langen Gang hinunter, vor sich hin piepen.
»Ihr Ernst?«
Abery lauschte damals meinem ersten Schrei, wir pflegten eine besonders eminente Bindung zueinander. Gerne betonte sie ihre Druckmethoden an meinem Geburtstag, denn ich sollte um jeden Preis vor der Sonntagsmesse geboren werden, die Abery nie versäumte. Am 31.01.1988, um 11.05 Uhr, erblickte ich sodann, verschrumpelt und erschöpft, mit einem lauten Schrei, das Licht der Welt. Geboren unter 86-prozentigem Mondeinfluss, im Aszendenten Stier, vom Sternzeichen Wassermann, gehörte ich, Jenna Nicola Jonsen, laut Terlusollogie, zur Gruppe der lunaren Einatmer. Was das für mich und meine Lebensweise bedeuten sollte, stellte sich erst viele Jahre später heraus, als lästige Hautekzeme, die von zahlreichen Ärzten, nach ellenlangem Rätselraten und Rumgedoktore, mit »psychosomatischer Ursache« abgestempelt worden waren, meine Lebensqualität einschränkten…
Bereits beim Betreten des Flurs im ersten Stock rannte mir kalter Schweiß über den Nacken in den Rücken, zwischen meinen beiden knochigen Schulterblättern hindurch, hinab durch die vielen kleinen Brustwirbel, bis in den letzten Lendenwirbel. Haar für Haar sträubten sich meine Nackenhaare und stellten sich einzeln senkrecht gegeneinander auf. Mit einem Schlag wurden meine Hände pitschnass. »An der Hose abwischen«, dachte ich nur. Doch sobald ich sie abgestreift hatte, waren sie sofort wieder mit vielen winzigen, eiskalten Schweißperlen durchtränkt. »So kann ich die Türklinke unmöglich anfassen«, wusste ich. »Päh!, Bakterienschleuder. Nichts Schlimmeres als Krankenhauskeime!«, warf ich geekelte Blicke auf meine beiden Pratzen. Vor jeder Eingangstür befanden sich Spender mit hellblauer Flüssigkeit, Desinfektionsmittel. Ich desinfizierte mir gründlich, Finger für Finger, angefangen mit dem linken Daumen, beide Hände. Der goldene Ring mit weißer Diamanteinfassung, ein Geschenk meiner Mutter, musste dafür ab.
»Bloß keine Viren oder Bakterien in Aberys Zimmer, auch wenn dieses Zeug abartig grausig müffelt!«
Das übernahmen meiner Meinung nach schon die Ärzte, Schwestern und Besucher der zwei halbtoten Bettnachbarn, Frankensteins Kinder persönlich, denen jeweils nur die Korken links und rechts der Halsschlagader fehlten, makaber aber wahr. Diesen sterilen Geruch, der sich rasend schnell über den gesamten Flur ausbreitete, nahm ich unmittelbar nach Betreten der Eingangstür wahr. Er bohrte sich in meine beiden schlanken, dennoch aufnahmefähigen, Nasenlöcher. Dieser, fast schon penetrante, Gestank befahl meinen Nasenflügeln sich mit dem nächsten Wimpernschlag zu Rümpfen und den Ekel unter keinen Umständen unbemerkt vorbeiziehen zu lassen!
Krankenhäuser mochte ich generell noch nie, aus Prinzip. Als sich mein Vater, Sigi, damals dann, nach seiner Knie-Operation am Meniskus, die ohnehin eher miss- als gelungen verlief, mit einem merkwürdigen Krankenhauskeim infizierte, leuchtete mir recht schnell ein, dass auch Ärzte nur Menschen waren, die hin und wieder Fehler begingen. Irren bleibt schließlich menschlich. Und bei dieser Anzahl an Arbeitsstunden, die zweifelsohne an abartige Akkordarbeit grenzte, konnte die Konzentration niemals dauerhaft auf Hochtouren bleiben, bei Robotern vielleicht, ja. Abery aber war eine alte Frau von 78 Jahren. An ihr konnte man nicht einfach so, mir nichts dir nichts, herumexperimentieren…
»Die warten hier doch nur auf meine Organe. Gleich wenn der Arzt meinen Hirntot diagnostiziert hat, werden die anfangen mich aufzuschnipseln, wirst sehen!«, pfiff sie, mit einem schelmischen Lächeln auf den Lippen, über die Bettkante. »Hör bloß auf damit, du weißt genau, dass ich mir immer alles bildlich vorstellen muss«, erwiderte ich kopfschüttelnd und nicht gerade amüsiert über ihre Aussage. »Ist doch wahr. Da blitzen nur die Euro-Scheine in den Pupillen. Wusstest du eigentlich, dass die für jeden Toten einen Haufen Geld kassieren?«, folgte es weiter kühl aus ihrem Mund. Eine fast erdrückende Stille durchschwebte den kahlen, übersichtlichen Raum. Vorzugsweise hätte ich die Frau, die ihre eigene Angst gerne mit schlag-fertigen Kommentaren übertrumpfte, in den komischen Plumps-Rollstuhl gesetzt, den Schwester Erika neben ihrem Bett geparkt hatte, als Nacht- oder Rollstuhl nutzbar, und wäre mit ihr auf die »In-Ordnung-Wiese« gefahren. Als Kind gab es die für mich. Immer dann, wenn ich verzweifelt war, mich unwohl oder einsam fühlte, spazierte ich zu meiner Lieblingswiese und legte mich dort zu Boden, völlig egal ob es aus Kübeln schiffte, wie wild schneite oder die Erde von der Sonne mit warmen Strahlen geküsst wurde. Kurze Zeit später fühlte ich mich besser, frei, so bescheuert es klingen mag, geerdet. So gerne hätte ich auf diese Weise auch Abery geholfen, dass das aber nicht möglich war, wusste ich ebenso. »Zeit mit ihr verbringen, denn ich weiß nicht, wie lange ich sie noch bei mir habe und sie erzählt schließlich die schönsten Geschichten«, schoss es mir durch den Kopf, als ich ihr Krankenzimmer betrat. Oft war unmöglich zu unterscheiden, ob Aberys Erzählungen der Realität zuzuordnen oder frei erfunden waren, zu glaubhaft erzählte sie…
Trotzdem ihr Körper durch den erlittenen Infarkt sehr schwach war, fing sie, als konnte sie meine Gedanken lesen, sofort nach der Begrüßung wie so oft, an: »Als kleines Mädchen, zweiTage nach meinem achten Geburtstag, schlenderten meine Mutter und ich durch den Wald, um Pilze zu sammeln. Als wir mit vollen Körben den Heimweg antraten, stießen wir am Wegrand auf ein Reh, verfangen in einer Falle. Beim Versuch das Tier zu befreien, geriet meine Mutter selbst mit der Hand in die Schnappfalle. Ich war klein und wusste mir keinerlei Rat…
Mutter, deren Hand bereits nach kürzester Zeit völlig blutdurchtränkt war, schickte mich durch den endlosen, düsteren Wald, um im Dorf Hilfe zu holen. Was blieb mir für eine Wahl, ich musste sie alleine lassen, sie wäre sonst jämmerlich verblutet…
Also lief ich, durch die grünen Tannen, Eichen, Ahorn und Kastanien. Plötzlich kreuzte, wie es der Zufall wollte, ein Jäger meinen Weg. Aufgeregt erzählte ich, ohne Luft zu holen, was geschehen war, doch er schenkte mir keinen Glauben und wollte auf seinen Thron, hoch oben zwischen den Bäumen, versteckt im Geäst, zurücksteigen. Ich aber blieb hartnäckig und zerrte ihn am Arm…«
Und dann wurde sie durch ein tiefes Räuspern der blonden Schwester Erika, die schon eine ganze Weile an ihrem Bett stand und aufmerksam der Geschichte lauschte, unterbrochen und aus der Welt der Fantasie entrissen. »Ihre Medikamente, Frau Fröhlich«, hörte ich die raue, rauchige Whiskey-Stimme sagen. »Noch mehr Medikamente? Wozu sollen die denn wieder gut sein?«, fragte ich entsetzt. »Ein regelrechtes Vollgepumpe ist das hier. Ernähren will ich mich von diesen gummiüberzogenen Smarties, die mein Gehirn verkalken, nicht!«, scherzte Abery. Sie sollte also noch mehr Tabletten schlucken. Und das, obwohl ihr Herz ohnehin schon schwach war!





























