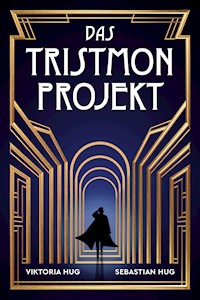
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Das Leben des verunglückten Minenarbeiters Yan Pavel nimmt eine jähe Wendung, als er Professor Richmuth-Tristmon begegnet. Der brillante Wissenschaftler bietet ihm eine Aufgabe in seinem Regierungsprojekt an, das die Welt verändern wird. Es soll nicht nur den Vernichtungskrieg zweier Kaiserreiche beenden, sondern die Menschheit vor einer noch größeren Bedrohung retten: dämonischen Wesen, die aus dem Gebirge an die Grenzen der Zivilisation drängen. Doch auf der geheimen Forschungsstation in den Bergen wird Yan klar, dass das Projekt die Dämonen nicht aufhalten wird. Und er stellt die Frage, die niemand zu stellen wagt: Woher kommen die Dämonen und was wollen sie? Zusammen mit Anasteïs, der Tochter des Professors, muss er sich den Befehlen des Kaisers widersetzen, um sie alle zu retten. Dabei blickt er in die Abgründe einer maroden Gesellschaft und muss sich seiner eigenen Finsternis stellen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über die dnb.dnb.de abrufbar.
© 2022 Viktoria und Sebastian Hug; hugwriting.com
Alle Rechte vorbehalten.
Printversion erhältlich bei: BoD – Books on Demand, Norderstedt
Covergestaltung und Karten: Vanessa Landolt
Lektorat und Korrektorat: Lisa Reim
Soundtrack zum Buch: Jan Kohl
Willkommen
Willkommen im Tristmon-Projekt!
Wir freuen uns, dass du unseren Roman auf deinen Reader geladen hast. Hinterlass uns nach dem Lesen gerne eine Rezension auf einer Plattform deiner Wahl. Damit unterstützt du unsere Arbeit als passionierte Selfpublisher. Wir schätzen deine Rückmeldung :)
Mehr über uns und unsere Bücher erfährst du auf unserer Website und auf Social Media:
Hugwriting.com
YouTube
Viel Vergnügen beim Lesen!
Das Tristmon Projekt
Viktoria und Sebastian Hug
Bezirk 73
Es geschah in der ersten Schicht. Fünfundzwanzig Leiber, eingepfercht in einen Aufzug, wurden in den Untergrund hinabgelassen. Zehn, zwanzig, hundert Meter. Das Rattern dröhnte ihnen in den Ohren, ihre Arbeitskleidung war starr vor Lehm. Die Luft wurde wärmer, je tiefer der Aufzug in den Bauch der Erde fiel.
Einer der Männer hielt sich am Seitengitter fest. Seine Augen waren glasig wie die Oberfläche gefrorenen Wassers, während er den Schweiß seines Vordermanns roch und darauf wartete, dass die Sonne irgendwo da oben auf- und wieder unterging.
Yan Pavel stand in seinem Ausweis, doch den hatte er schon lange nicht mehr gesehen. Er wurde unter Verschluss gehalten, bis er seine Schuld abgearbeitet hatte. Es würde noch Jahre dauern. Niemand hielt so lange durch, und Yan Pavel wusste das.
Dennoch hatte er die Hoffnung nicht aufgegeben, obwohl es manchmal Tage gab, an denen er außerstande war, zwischen dem Rost, dem Kohlestaub und Schlamm noch Farben zu entdecken; alles vermengte sich zu einem eintönigen Brei, der auch in seinen Geist kroch und sich zwischen ihm und der Welt zur Mauer verhärtete. Besonders schlimm war es, wenn er sogar seine Wut auf jene vergaß, die ihn in diese Misere gestürzt hatten. Während der ersten Jahre Zwangsarbeit hatte er noch damit gehadert, dass die Bürger der umliegenden Städte sich nicht für die Quelle ihres Wohlstands interessierten, für die scheinbar unerschöpflich fließende Energie. Inzwischen war er verstummt. Er hatte akzeptiert, dass kaum jemand, erst recht kein Mitglied der gehobenen Stände, je einen Fuß auf diesen schattigen Flecken Erde setzte.
Die Förderanlage, in der Yan seinen Dienst verrichtete, befand sich im Umland der Hauptstadt Tormar, am Ende einer holprigen Straße, wo die Luft noch seifiger war und die künstlich aufgeworfenen Hügel das Tageslicht rasch verschluckten. Türme aus Stahl ragten wie Finger aus dem Boden. Baracken kauerten sich dicht aneinander. Dazwischen lagen Rohre, fett wie Lindwürmer. Dafür, dass es sich um die größte Kohlemine der Nation handelte, trug sie einen unspektakulären Namen: Bezirk 73.
Die Sekunden schälten sich durch die Dunkelheit, bis der Käfig endlich zum Stillstand kam und die Mannschaft ausspuckte, hineindrückte in eine Welt nass schimmernder Felswände und Lampen, deren Schein nur hell wirkte, weil der Rest Schwärze war.
Vor Yan lag ein Labyrinth aus Stollen und Schächten. Die Räderwerke schickten quälenden Lärm durch die Gänge, die so instabil waren, dass ein Funken genügte, um alles zum Einsturz zu bringen.
Das Problem, das Yan mit seinem Arbeitsort hatte, war jedoch nicht die Enge. Daran hatte er sich gewöhnt. Es war die Temperatur. Sie war schlimmer als das Gefängnis aus Wänden und Decken, denn sie dämpfte seine Sinne, drang in seine Lunge ein und füllte sie bis zum Rand mit Druck. Das Atmen fiel ihm schwer, Schweiß biss in den Augen, und doch machte Yan weiter, grub, hackte, dumpf darüber nachsinnend, dass der Mensch nicht geschaffen war für einen solchen Ort. Und es war ein Merkmal von ersten und letzten Schichten, dass die Unfallgefahr zu dieser Zeit am größten war.
Hereinbrechende Gesteinsmassen, Wassereinbruch, Schlagwetterexplosionen. Es gab viele Möglichkeiten, untertage zu verunglücken. Yan hatte Geschichten gehört. Die meisten stammten aus zweiter Hand, von Kameraden oder Angehörigen. Aber erst als er sah, wie die Realität um ihn herum zerbrach, fühlte er diese Geschichten erwachen.
Hinter ihm, aus der Dunkelheit des Minengangs, bollerten die Flammen heran, sprossen auf wie eine Rose. Er sah, wie sich das Feuer unaufhaltsam zu ihm fraß und die Finsternis zerriss. Die Gleise wölbten sich unter der Hitze. Er hörte das Ächzen von Gestein, das Zischen des Wassers, das entlang der feuchten Wände verdampfte, und einen Laut, der noch schauriger klang als das: seine Kumpels, die in den Seitengängen eingeschlossen waren. Die Hölle hatte ihren Rachen geöffnet, ihr Atem verbrannte seine Haut. Letzte Worte hatte er keine. Sein Kopf war angefüllt mit einer einzigen Empfindung, einem Schrei, so körperlich und wirklich wie nichts anderes in diesem Inferno: Schmerz. Er war so allumfassend, dass er Gott aus seinem Flehen verbannte.
Ebenso schnell, wie das Feuer gekommen war, verschwand es wieder. Ein gewaltiger Sog zog es zurück in die Tiefe, als sei es auf einmal all seiner Kraft beraubt. Yan Pavel riss den Mund auf, versuchte zu atmen. Erfolglos. Das Feuer hatte alles genommen.
»Was hat die Katastrophe verursacht, Herr Direktor?«
»Die Jungs in Sektor 18 haben wohl eine unterirdische Gaskammer angebohrt. Die Kerze einer Sicherheitslampe hat die Gase entzündet.«
Zwei Stimmen. Eine davon kannte Yan, dessen Augenlider schwer aufeinanderklebten. Sie gehörte dem Direktor des Förderbetriebs, einem vielbeschäftigten Mann und Großmagnaten seiner Branche.
»Ein Versehen?«, fragte der andere.
»Was glauben Sie denn?«, erwiderte der Direktor.
»Entschuldigen Sie bitte, ich wollte Sie keinesfalls beleidigen. Allerdings gibt es heutzutage die unglaublichsten Geschichten …«
»Bezirk 73 ist ein Vierundzwanzigstundenbetrieb. Wir liefern dreizehn Prozent des nationalen Kohlebedarfs. Uns bleibt keine Zeit für Versicherungsbetrug.«
»Natürlich, natürlich. Erlauben Sie mir, Ihnen mein tiefstes Bedauern über das Unglück auszusprechen, auch im Namen der Regierung und Ihrer Majestät, des Kaisers.«
Der Direktor schwieg. Yan versuchte sich zu bewegen, doch sein Körper gehorchte ihm nicht mehr. Schmerz pochte durch seine Glieder, dumpf, aber erträglich. Wie viel Morphium hatten sie ihm gegeben?
»Wer ist das, Doktor?«, fragte der Direktor.
»Yan Pavel, Nummer 349. Er hat überlebt. Bedauerlicherweise als Einziger.«
»Seine Verletzungen?«
Das Zögern des Doktors sagte Yan, dass etwas nicht stimmte. Seine schlimmsten Befürchtungen wurden bestätigt, als sich der Arzt endlich entschloss, das Schweigen zu brechen.
»Nummer 349 wurde von seiner Lore gegen den Türstock geklemmt. Neben mittelschweren Verbrennungen am Unter- und Oberkörper hat er Quetschungen im Brustbereich. Und sein rechter Arm ist von der Hand bis zum Ellenbogen zertrümmert.«
Unter größter Anstrengung öffnete Yan die Augen. Er erkannte die Decke des Lazaretts. Obwohl die Umgebung nur durch das schale Licht einer Petroleumlampe erhellt wurde, begannen seine Augen sofort zu tränen. Sie hatten sich an die ewige Dämmerung untertage gewöhnt. Trotzdem zwang sich Yan, sie offen zu halten.
Über ihm schwebten drei Gesichter. Er kannte nur das des Direktors, sein frisiertes Haar schimmerte wie das Silberbesteck, von dem er zu speisen pflegte. Der Kerl rechts neben ihm musste der Regierungsinspektor sein. Links, in einer grauen Schürze, stand der Arzt.
Der Direktor musterte den Körper vor sich. Yan versuchte seinen Blick aufzufangen, ihn mit den Augen um Hilfe zu bitten. Ohne Erfolg. Bleierne Müdigkeit überfiel ihn, aber er wehrte sich mit aller Kraft dagegen, einzuschlafen. Er durfte nicht schlafen. Etwas war im Gange. Die Gesichter der drei Herren waren zu ernst.
»Man, ähm, müsste operieren«, sagte der Arzt und betastete das Klemmbrett, das er in der Hand hielt.
»Dienstzeit?«, fragte der Direktor.
»Verzeihung?«
»Wie lange arbeitet Nummer 349 schon in den Minen?«
Der Arzt konsultierte das Klemmbrett. »Sechs Jahre, Herr Direktor.«
»Eine lange Zeit. Haben Sie die Studie von Ruge gelesen? Sie wurde erst kürzlich publiziert. Kluger Kopf, Arbeitswissenschaftler. Nach spätestens sieben Jahren verliert der Körper bei monotoner Belastung seine Spannkraft. Er ist weniger effizient, es passieren Fehler. Man sollte ihn austauschen.«
Yan öffnete den Mund und stöhnte in dem Bestreben, sich zu verteidigen. Wie lange hatte er geschuftet? Wie folgsam hatte er sich durch die Schichten gequält? Wofür, wenn er jetzt …
»Arbeitsunfähig.« Der Direktor hatte offenbar vergessen, dass Yan über so etwas wie ein Gesicht verfügte. Er warf seiner zertrümmerten Brust einen letzten Blick zu, schnalzte mit der Zunge, als sei ihm sein Taschentuch in den Straßengraben gefallen, und ging. Der Inspektor schloss sich ihm an.
»Tut mir leid, mein Junge«, murmelte der Arzt. Dann zückte er einen Stift und strich seinen Namen von der Liste.
I
Die Burg
Tarton 4 Zylinder
Ein Kohlelieferant brachte Yan nach Tormar. In den dunkleren Straßen der Hauptstadt, abseits der Alleen und Parks, gab es genug Platz, um ungestört zu sterben.
Nachdem ihn der Lieferant in einem Hinterhof von der Ladefläche gescheucht hatte, irrte Yan durch die Stadt. Die Wirkung des Morphiums hatte nachgelassen, der Schmerz kehrte in seinen Körper zurück wie ein langsam wirkendes Gift. Wohin er gehen sollte, wusste er nicht. Er kannte niemanden und sobald er sich den wenigen Passanten zuwandte, duckten sie sich tiefer unter ihre Hüte und eilten geschäftig weiter. Wie kalt diese Stadt doch war, wie dreckig, nicht einmal der Regen konnte etwas daran ändern. Der Himmel glänzte fettig, hohe Schornsteine pufften dichten Qualm in den Äther. Der Odem einer Industrie, die sich längst selbst verschlungen hatte.
Wohin, wohin, dachte Yan träge. Am Ende seiner Kräfte brach er an einem Laternenpfosten zusammen.
Es war keine unbedeutende Straße, an deren Rand er sich geschleppt hatte, sondern eine von vielen Leuten frequentierte Achse nahe des Regierungsdistrikts. Edle, bunt gekleidete Damen und noble Herren mit Hüten schritten an ihm vorbei und verschwammen vor seinen Augen zu Schemen. Niemand sah sich nach ihm um, nicht einmal die Hunde, die an den Leinen ihrer Besitzer zwischen den Menschenbeinen hindurchtrippelten. Droschkenräder klapperten über das Pflaster. Ab und zu hörte man ein Automobil tuckern.
Arme und Krüppel gehörten nicht ins Stadtzentrum, doch Yan war zu erschöpft, um seine Lage in ihrem ganzen Ausmaß zu begreifen. Lange saß er nur da und starrte auf seine Hände, die in seinem Schoß ruhten.
Er versuchte zu verstehen, was geschehen war. Wie er auf diesen Randstein gelangt war, auf dessen Pflaster Flugblätter und Zigarettenstummel klebten. War es wirklich er, der hier saß und fühlte, wie aschiger Regen seine Kleider durchnässte? Der den Schmerz wahrnahm, der an seinen Gliedern zerrte und entlang des Rückens hinauf in die Gedanken faserte?
Was hatte er getan, um das zu verdienen? Hatte es in seinem Leben einen Punkt gegeben, einen fatalen Moment, der ihn an diese Straße geführt hatte? Oder war dies alles die Verkettung makabrer Zufälle, die, außer für ihn, nicht weiter bemerkenswert waren?
Er presste die Augen zusammen, suchte nach einer Antwort. Doch seine Gedanken irrlichterten durch lähmende Dunkelheit. Seine Vergangenheit – scheinbar fort. Die Minen. Die Zeit davor. Sein Leben schien nicht mehr zu sein als angestaute Erinnerungen, die sich blass ineinander verwoben wie ein Teppich, dessen Muster längst verblichen war.
Etwas jedoch glaubte er in seiner Vorstellung noch zu finden. Er sah einen Brunnen in der Mitte eines Hofs, ringsherum Stallungen. Das Bild weiter Felder drängte heran, endloser Himmel über gelben Flächen. Und eine Birke, unter deren Ästen er neben einem Mädchen lag und lachte. Es war sein Leben vor den Minen. Doch er fühlte nichts. Es war, als blättere er im Familienalbum eines Fremden. Er hörte Stimmen, die er nicht zuordnen konnte, und erschrak über Gerüche, die ihn ebenso unerwartet wie plötzlich anfielen. Kurz blitzte eine Erkenntnis auf, zerbrechlich wie eine Blume: der Gedanke, dass es vielleicht noch nicht zu spät war; der Mensch, der er einmal gewesen sein mochte, der sich in den Stollen verloren hatte – möglicherweise lebte er noch.
Dann bekam er Panik. Sie war so stark, dass sie Yans Erinnerung verschluckte. Sein Atem stockte. Er öffnete den Mund, doch da war nichts, keine Luft, die er atmen konnte. Sein Sichtfeld schrumpfte auf einen schmalen Korridor zusammen, an dessen Ende er seine Hände erkannte, die nutzlos in seinem Schoß lagen. Arbeitsunfähig. Die Quintessenz nach sechs Jahren harter Arbeit. Es war nichts geblieben außer Schmutz unter den Fingernägeln.
Als Yan den Kopf hob, sah er zwei Kinder, die sich als Einzige nicht scheuten, ihn anzusehen. Nein, eigentlich sahen sie nicht – sie starrten. Starrten, wie Kinder nun einmal starren, wenn sie etwas Ungewöhnliches erblicken. Der Junge und das Mädchen, vermutlich Geschwister, mochten etwa sieben Jahre alt sein. Ihre Haut war schneeweiß, das Haar sorgsam gekämmt.
Von dumpfer Faszination gepackt starrte Yan zurück. Sein rechter Mundwinkel hob sich. Das Mädchen lächelte verschmitzt und für einen Augenblick erwachte etwas in Yan. Was genau es war, konnte er nicht sagen, doch es verdrängte die Dunkelheit, die sich hinter seiner Stirn ausgedehnt hatte.
Der Moment verpuffte mit dem Erscheinen einer Frau, die niemand anderes als die Gouvernante sein konnte. Um die Fünfzig, streng zurückgebundenes graues Haar, graue Kleidung, schmaler Mund. Das Mädchen sagte etwas und die Frau sah zu Yan herüber. Als sich ihre Blicke trafen, wurde ihm kalt und er senkte rasch den Kopf.
»Willemar, Joëme, hört auf zu gaffen und kommt endlich. Euer Vater wartet. Was gibt es denn da?« Imgrin Traudhild sah auf, bemerkte die zusammengesunkene Gestalt am Straßenrand und verzog die Lippen. »Diese Stadt macht mich wahnsinnig. Nichts als Gesindel auf den Straßen.«
Sie scheuchte die Kinder weiter. Womöglich war der Kerl eine Gefahr. Sie hatte die schwarze Binde an seinem linken Oberarm bemerkt.
»Fräulein Traudhild? Warum weint der Mann? Männer weinen doch nicht«, quäkte Willemar.
»Warum, warum! Darum, Kind.« Fräulein Traudhild zupfte ungeduldig die Kapuze des Knaben zurecht und bugsierte ihn vorwärts.
Trotzig stopfte Willemar die Fäuste in seinen Regenmantel, wagte aber nicht zu widersprechen. Der Regen fiel dicht und kalt. Mit Genugtuung bemerkte Fräulein Traudhild, dass die Kinder ihren Wunsch, zu Fuß zu gehen, bereits bereuten. Mit eingezogenen Köpfen tapsten sie vor ihr durch die Menge. Erst als Joëme schniefend bat, sie mögen doch eine Droschke nehmen, hob Fräulein Traudhild eine behandschuhte Hand. Die Droschke kam, woraufhin die Kinder dankbar ins Trockene huschten.
»Mauerabschnitt 59, Generalhauptquartier, Anlieferungszone«, befahl sie und klopfte an die Innenwand.
Fräulein Imgrin Traudhild war eine strenge Person und stolz darauf. Fleiß, Disziplin und Ordnung. So war die Welt errichtet worden, so war sie zerstört worden, sukzessive, mit der Akribie eines Chirurgen. Und so würde sie von dem Übel befreit werden, das sie befallen hatte.
Fräulein Traudhild lebte nach diesen Prinzipien. Sie versprachen eine Regelmäßigkeit, wie sie dem Heute abgingen. Seit zehn Jahren arbeitete sie für die Familie Germont, besorgte den Haushalt und erzog die beiden Kinder. Frau Germont verließ ihr Zimmer selten, sie war schwer krank. Herr Germont war Generalfeldmarschall der Kaiserlichen Streitkräfte und betrat seine Villa fast nie. Das Steuer lag in Fräulein Traudhilds Hand. Jeden Tag stand sie um sechs Uhr auf, zog eine weiße Bluse mit steifem Kragen, einen grauen Gehrock und eine grauschwarz karierte Schürze an und kochte Grießbrei für die Kinder und die kranke Frau Germont. In aller Augen war sie die perfekte Gouvernante. Doch der Schein trog.
»Generalhauptquartier 59. Sechs Kronmark, bitte.« Der Kutscher streckte die Hand aus. Fräulein Traudhild entlohnte ihn und scheuchte die Kinder durch ein großes Tor, über dem das Wort Anlieferung zu lesen war.
Sie betraten einen großen Innenhof. Links standen in Reih und Glied Geschütze, die von Rekruten gewartet wurden. Rechts erhob sich etwas, das wie ein künstlicher Berg aus Beton aussah. Es war ein Teil des äußersten Mauerrings, eines gigantischen Walls, der die gesamte Stadt umschloss. Jenseits der Verteidigungsanlage erstreckte sich das Niemandsland, ein Todesstreifen, der die verfeindeten Nationen Averon und Reveron schon seit Jahrzehnten trennte.
»Guten Tag, gnädiges Fräulein!« Die wachhabenden Soldaten salutierten. Fräulein Traudhild musste sich nicht mehr ausweisen; General Germont hielt es für pädagogisch wertvoll, seinen Kindern die ganze Schlagkraft Reverons zu demonstrieren, weshalb sie hier ein- und ausgingen.
»Das ist aber nicht der Weg zu Vaters Arbeitszimmer«, stellte Joëme fest, als sie den Innenhof durchquerten und ein Materiallager betraten, welches sich direkt im mächtigen Leib der Mauer befand.
»Sehr richtig, kluges Kind«, entgegnete Fräulein Traudhild barsch und steuerte auf den Durchgang am anderen Ende der Halle zu. Das scharfe Klack-klack ihrer Schuhe brach sich an den Betonwänden. Das Licht von Öllampen huschte über Stahlträger und erhellte Kanonen, Munitionskisten, gepanzerte Wagen, Gewehrrechen, Sprengstoff. Ein Vermögen lagerte in der Mauer – das Potenzial, dem Feind Averon immer wieder empfindliche Verluste zu bereiten.
Willemar schniefte.
»Fräulein Traudhild? Mir ist ganz malade zumut.« Er zog dramatisch die Nase hoch. »Darf ich ein Schnupftuch haben? In Ihrer Tasche ist doch bestimmt eines.«
Fräulein Traudhild umgriff die Handtasche fester.
»Wisch dich mit dem Ärmel sauber. Das tun doch Jungs in deinem Alter.«
»Aber Fräulein–«
»Hab dich nicht so!« Sie gab dem Wachmann an der Tür ein Zeichen und schnaubte, als sie Willemar flennen hörte. So war sie, die strahlende Jugend Reverons. Und dieses Volk wollte behaupten, etwas Besseres zu sein.
Der Wachmann öffnete die massive Tür am Ende der Halle.
»Sie erlauben?« Er griff in seinen Militärmantel und zog ein Taschentuch hervor, das er Willemar reichte. Fräulein Traudhild wurde allmählich nervös, doch sie hatte sich soweit im Griff, dass sie ein dünnlippiges Lächeln zustande brachte.
Als der Mann die Türe wieder geschlossen hatte, befahl Traudhild den Kindern zu warten und ging eine steile Metalltreppe hinunter, an deren Ende sie einen Nebenraum betrat.
Hier gab es nur rötlich glühende Sicherheitslampen. Metalltanks in der Größe von Kutschen lagen aufgebockt nebeneinander. Ein Wirrwarr an Rohren zweigte von ihnen ab und verlor sich in den Wänden. Der Heizungstrakt.
»Ich habe Stimmen gehört«, sagte ein Mann, der aus dem Schatten eines Metalltanks hervortrat. Er trug Arbeitskleidung, gehörte aber zum eingeweihten Kreis.
»Die Kinder. Sie sind oben.«
»Es ist riskant, sie hierher mitzunehmen.«
»Nur wenn ich sie bei mir habe, darf ich mich hier frei bewegen.«
»Ist sie das?« Der Mann nickte auf die Handtasche.
Anstelle einer Antwort legte Fräulein Traudhild die Tasche behutsam auf einen Metallwagen neben ihnen. Ihre Nasenflügel blähten sich, als sie den Mann mit einem Blick bedachte, der deutlicher als Worte sagte, wie wichtig das Gelingen ihrer Mission war. Jeder Treffer konnte den Ausschlag zum finalen Waffensturm geben. Den Ausschlag zum Sieg. Und zum Frieden. Der Mann nickte, er hatte verstanden, und Fräulein Traudhild ging, um die Kinder zum General zu bringen.
Yan zog sich weiter auf den Gehweg zurück, als ein Geschützwagen die Straße passierte. Tormar lag direkt an der Front und befand sich deshalb immer in Alarmbereitschaft. Soldaten marschierten mit aufgestecktem Bajonett durch die Straßen. Ihre Augen blickten stets geradeaus, als gäbe es am Horizont etwas zu sehen, das anderen entging. Misstrauisch sah er ihnen nach, bis etwas anderes seine Aufmerksamkeit erregte.
Ein senfgelbes Plakat. Es klebte an einer Litfaßsäule. Offenbar war es in großer Eile dort befestigt worden, denn es hing schräg und die oberen Ecken schälten sich bereits vom Untergrund.
Yan hatte von diesen Plakaten gehört. Er betrachtete das Symbol, das darauf abgebildet war. Ein stilisiertes M. Kurz wunderte er sich darüber, dass die Kaiserlichen es nicht schon längst abgerissen hatten. Im nächsten Moment driftete sein Geist auch schon wieder ab, fort von dem Plakat, in eine nebeldurchzogene Halbwirklichkeit.
Irgendwann, es mochte eine Stunde vergangen sein oder auch nur eine Minute, fiel sein Blick auf einen Gegenstand, der unweit neben ihm lag. Eine Zigarette, bloß zur Hälfte geraucht. Nur die gehobene Bürgerschicht war verschwenderisch genug, so etwas Kostbares wegzuwerfen. Tief in seinem Hinterkopf spürte er Interesse aufkeimen, einen Funken nur, doch er genügte, dass er lächelte. Sein Leben war selten nach Plan verlaufen, aber noch nie hatten die Zeichen so schlecht gestanden. Der Anblick der halb gerauchten Zigarette jedoch trug Hoffnung in sich, die zwar spärlich, aber greifbar war.
Feuer, dachte Yan träge, ich brauche Streichhölzer. Die Kälte schien seine Gedanken eingefroren zu haben und mit ihnen die Gesichter der Menschen, die ihn achtlos passierten. In der Jacke hatte er noch ein paar Schwefelhölzer. Umständlich steckte er den Zigarettenstummel zwischen die starren Finger seiner zertrümmerten Hand und zog sie mit der anderen hervor. Werknecht & Söhne stand darauf, der Konzern, dem Bezirk 73 gehörte. Mit dem Daumen der linken Hand schob er die Schachtel auf und griff mit Zeige- und Mittelfinger nach einem Streichholz.
Entzünden. Es war eine so routinierte Bewegung. Aber sie erforderte zwei Hände. Mit aller Konzentration, die er aufbringen konnte, versuchte Yan die rechte Hand zu bewegen, nur ein Stückchen. Jede Faser seines Bewusstseins verwandte er darauf, als könne er allein durch Willenskraft das Unmögliche erreichen. Sein rechter Arm zitterte. Der Zigarettenstummel entglitt den steifen Fingern und fiel zu Boden.
»Fräulein Traudhild?«, fragte Joëme. Halb rennend versuchten die Kinder mit der Gouvernante Schritt zu halten. »Sie haben Ihre Handtasche bei dem Mann vergessen.«
»Himmel, du hast recht, Kind. Ich werde sie wohl später holen müssen«, antwortete Traudhild, ohne sich umzusehen. Das Herz schlug ihr bis zum Hals, sonderbarerweise erst jetzt, da sie die Verantwortung abgegeben hatte.
»Der Generalfeldmarschall befindet sich noch in einer Sitzung«, teilte ihr Generaloberst Menmenfels mit, als sie das Hauptquartier betraten. Sie kannte ihn, da er sich häufiger auch privat mit General Germont traf. »Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten?«
»Ein Brandwasser, Generaloberst«, bat Fräulein Traudhild. »Ich fürchte fast, das kühle Wetter bekommt mir nicht.«
Der ältere Mann lächelte. »Die Herren Offiziere pflegen aus geringerem Anlass ein Wässerchen zu sich zu nehmen. Was soll ich den Kindern bringen?«
»Nehmen Sie sie doch mit in die Küche. Dort können sie sich etwas aussuchen«, sagte sie. Glücklicherweise brachen die Kinder in ebenjenem Moment, da ihr die Stimme zu versagen drohte, in Jubel aus. In der Küche war immer etwas los.
Als die Tür zufiel und die Kinder zusammen mit Menmenfels fort waren, lehnte sich Fräulein Traudhild zitternd gegen den Sitzungstisch. Den Kindern entging auch nichts. Zwar hatten sie ihren Umweg durch das Materiallager nicht besonders spannend gefunden, erst recht nicht spannend genug, um irgendwem etwas davon zu erzählen. Doch sie hatten bemerkt, dass die Handtasche fehlte. Fräulein Traudhild würde sich eine Geschichte einfallen lassen müssen, um den Kindern die Lippen zu versiegeln.
Was ist schon eine weitere Geschichte, wenn es ums Überleben geht, dachte sie und trat an die Fensterfront, die sich entlang der Kommandozentrale erstreckte.
Das Hauptquartier des Mauersektors 59 bestand aus zwei Sitzungsräumen, dem großen Mannschaftsraum, mehreren Arbeitszimmern, einer Kantine, dem Waffenarsenal und der Kommandozentrale. Letztere thronte auf der Mauerkrone, geschützt durch Zinnen und Kugelblenden aus Stahl. Durch die Fensterfront konnte man auf das Land jenseits der Mauer blicken. Ein breiter Streifen Nichts, kahl wie die Oberfläche des Mondes und schwarz vom Feuer der Geschütze. Niemandsland. Das Resultat nach dreißig Jahren Krieg.
Fräulein Traudhild hatte den Krieg als junge Frau aus nächster Nähe gesehen. In den Schützengräben und Lazaretten, in denen sie als Barmherzige Schwester Dienst getan hatte, musste etwas verloren gegangen sein. Denn so schrecklich der Anblick des talweiten Niemandslands war, übersät mit den erstarrten Leichen unzähliger Soldaten, er berührte sie nicht mehr. Reveroner, Averoner. Es machte keinen Unterschied, die Toten sahen alle gleich aus: grau, ledrig, nur die Zähne blitzten weiß, sodass es wirkte, als würden sie grinsen.
Fräulein Traudhild starrte in die Ferne. Auf der anderen Seite des Tals, unsichtbar durch die Distanz und den Smog, erhoben sich die Festungsmauern von Varschanz, der Hauptstadt Averons.
Das Fräulein hörte Schritte hinter sich, Menmenfels kam. Ihre Anspannung legte sich ein wenig, denn sie spürte, wann Menschen misstrauisch waren. Menmenfels hatte keine Ahnung.
Er reichte ihr das Brandwasser, stellte sich neben sie und streckte den Bauch in die weite Welt. Eine Weile herrschte Schweigen, vielleicht erwartete er eine nette Plauderei, aber da schätzte er Fräulein Traudhild falsch ein.
Der Generaloberst räusperte sich. »Wissen Sie noch, wie es angefangen hat?«
»Was?«
»Na, das hier. Der Krieg.«
Das Fräulein stutzte. Wurde der Generaloberst gar sentimental? Oder hegte er doch einen Verdacht, gab es ein Leck, durch das Informationen über ihre wahre Identität gesickert waren? Sie beschloss, auf der Hut zu sein.
»Gibt es für so etwas nicht Geschichtsbücher?«
»Durchaus, durchaus.«
Fräulein Traudhild setzte sich auf einen der Sessel, die vor dem Fenster für die Offiziere bereitstanden.
»Ich habe einen Glückstaler, wissen Sie. Diese Münze hier.« Er streckte ihr eine massige Hand entgegen, in der ein bronzenes Metallstück glänzte. »Betrachten Sie sie ganz genau. Sehen Sie die Gravur am Rand?«
Lustlos studierte das Fräulein die achteckige Münze. Sie war so abgegriffen, dass die Gravur beinahe nicht mehr zu erkennen war. Doch bei genauem Hinsehen ragte ein 1 Mark – Freihandelsunion aus der Oberfläche.
»Ein Geldstück hat immer zwei Gesichter«, schwadronierte der Offizier. »Das Emblem befindet sich auf der einen, der Wert der Münze auf der entgegengesetzten Seite.«
»Und was wollen Sie mir damit sagen?«
»Wir hatten eine gemeinsame Währung, früher. Ist lange her, ich war noch jung, hab mir noch nicht den Kopf darüber zerbrochen. Aber damals, da hat es irgendwie funktioniert mit uns. Averon und Reveron, meine ich.«
»Es gibt viele, die Ihnen diese Aussage übelnehmen würden.«
»Gewiss. Aber Sie verstehen mich, gnädiges Fräulein, das spüre ich.«
Fräulein Traudhild nippte an ihrem Getränk. Wenn Menmenfels wüsste, wie sehr er sich irrte. Averon und Reveron als Handelspartner. Das mochte einmal gewesen sein, doch nach allem, was sich die beiden Nationen angetan hatten (und was Reveron ihr angetan hatte!), erschien ihr Frieden undenkbar.
»Befürchten Sie nicht auch, dass es schon längst zu spät ist?«, murmelte sie.
»Manchmal.« Menmenfels hob die Augenbrauen. »In meinen Albträumen.«
Yan Pavel zog die Beine an. Sie schmerzten entsetzlich, denn der Arzt hatte die Verbrennungen nur notdürftig versorgt. Außerdem war ihm kalt. Der Wind trieb den Regen über das Pflaster. Er hatte alle Passanten verscheucht und Yan die letzte Chance auf ein Stück Brot geraubt. Das hohe Gebäude, an das er sich drückte, gehörte der Stadtverwaltung, und ehe er an deren Tür klopfte, konnte er genauso gut eine Litfaßsäule um Nahrung bitten. Sein Magen knurrte. Leer starrte er die Straße entlang ins Nichts. Und dann geschah es.
Das Nichts starrte zurück.
Yan fuhr erschrocken aus seinem Dämmerschlaf auf, blinzelte.
Etwas war dort. Zwei große, runde Augen. Ein Stück entfernt und unnatürlich hell.
Der Herzschlag kroch ihm bis zum Hals. Die Augen näherten sich und nun konnte er das leise Atmen hören, ein Schnurren, ein Stottern. Es knatterte, schwoll an zu einem Rauschen, und endlich formte sich in seinem von Hunger und Schmerz eingehüllten Verstand eine sinnvolle Erklärung.
Ein Automobil durchbrach die Regenschleier. Es war eleganter als alle, die Yan je gesehen hatte. Grüne Streifen zierten die silberne Karosserie. Messing glänzte an den Fassungen der Windschutzscheibe. Kolben arbeiteten hinter den seitlichen Lüftungskiemen. Ein Dröhnen, dann brauste es vorüber.
Yan starrte ihm nach. Unter der Heckscheibe stand groß in goldenen Buchstaben der Name TARTON und darunter in kleinerer Schrift 4 Zylinder.
Auf einmal erwachte sein Instinkt. Wenn er jetzt nichts tat, das wusste er, würde er in zwei Tagen genau an der gleichen Stelle liegen und tot sein.
Yan zwang sich auf die Beine. Er holte zitternd Luft und zuckte unter dem heftigen Brennen in seiner Brust zusammen. Die zertrümmerte Hand an sich gepresst, stolperte er einige Schritte auf die Straße hinaus.
Gleichzeitig zerrte er an der schwarzen Armbinde. Er musste sie loswerden, sich von dem Stigma befreien, das an ihm haftete. Andernfalls würde er es nicht schaffen. Als es ihm endlich gelang, das Ding abzureißen, keuchte er vor Erleichterung. Angewidert warf er den Stofffetzen zu Boden.
Die Beine wollten Yan kaum tragen. Trotzdem taumelte er weiter. Seine Augen fixierten die roten Punkte des Hecklichts, die im Dunkel zu verschwinden drohten.
Der Regen wurde dichter. Yan stolperte auf den Torbogen zu, durch den das Automobil gefahren war, und trat auf einen großen Platz. Ringsherum stapelten sich Stockwerke von Bürohäusern. Regierungsgebäude mussten es sein, denn nirgends sonst flatterten so viele Fahnen mit dem Emblem Seiner Kaiserlichen Majestät. Scheu ging Yan weiter. Er hatte hier nichts zu suchen.
Der Tarton parkte auf dem Vorplatz des weißen Staatsgebäudes. Der Fahrer stieg aus und öffnete erst einen Schirm und dann die Tür des Fonts.
Ein absonderlicher Mann stieg aus, der niemand anderes als der Besitzer des Wagens sein konnte. Zu Yans Verwunderung war er in einen schlichten, nachtblauen Anzug gekleidet. Sein einziger Luxus bestand aus einem Zylinder, den er sich energisch aufs Haupt pflanzte.
Bescheiden für einen aus der Oberschicht, dachte Yan. Für gewöhnlich trugen wohlhabende Bürger bunte und ausgefallene Kleidung, denn nur sie konnten sich die farbigen Stoffe leisten. Sie gingen zu Bällen und opulenten Versammlungen, die nur einem Zweck dienten: Zerstreuung in einer in Auflösung begriffenen Welt. Doch bei aller Farbigkeit konnten das schönste Ballkleid, der prächtigste Anzug nicht verbergen, dass etwas fehlte. Die Menschen wirkten durchsichtig, kaum zu unterscheiden von der Arbeiterklasse in Schwarz und Braun.
Yan blieb im Schatten eines Reiterstandbilds stehen und kniff die Augen zusammen. Von plötzlicher Erschöpfung ergriffen stützte er sich am Sockel ab.
Der Herr im blauen Anzug war bereits im fortgeschrittenen Alter. Er hatte fast weißes Haar und viele Runzeln im Gesicht. Doch seine Art sich zu bewegen, das schnelle Kopfnicken, das energische Zurückweisen des Gehstocks, den der Fahrer ihm reichte, ließen ihn jünger wirken, als er vermutlich war.
Yan überwand den Schmerz und setzte sich in Bewegung. Eine seltsame Zuversicht hatte ihn gepackt und er spürte, wie etwas in ihm die Führung übernahm. Die einzige Hoffnung, der letzte Versuch. Nur der Mann mit dem Zylinder konnte ihm noch helfen.
Der Mann war weitergegangen, Richtung Gebäude, fort von Yan. Immerhin zum Automobil wollte Yan es schaffen. Er humpelte voran und ignorierte die weißen Punkte, die am Rand seines Sichtfelds entlangwanderten.
»He!« Der Fahrer war auf ihn aufmerksam geworden.
Yan blieb stehen. Er wollte um Hilfe bitten. Doch die Feindseligkeit in den Augen des Fahrers erstickte den Versuch.
»Na los, zieh Leine«, knurrte der Mann und hob den Gehstock.
Yan wollte nicht zurückweichen, doch der schwarzhaarige Kerl vor ihm sah aus, als benütze er den Stock nicht zum ersten Mal als Waffe. Der feine Anzug passte nicht zu dem Raubtier, das in seinem Blick lauerte.
»Bist du taub, Mann?« Der Fahrer kam auf ihn zu. »Willst du eins aufs Maul? Ich hab gesagt, du sollst verschwinden.«
Yan wollte etwas sagen, aber da schlug der Kerl auch schon zu. Er taumelte und fiel rücklings auf das Pflaster.
Durch den Regen wehte Gelächter. Unter der überdachten Galerie eines Hauses lungerten drei rauchende Soldaten, die das Spektakel beobachtet hatten. Während sich Yan mühsam emporstemmte, wurde ihm klar, wie er aussehen musste: zerlumpt, mit ungewaschenen Haaren und schwarz vom Kohlenstaub. Er kannte ihre Perspektive. Oft genug hatte er den Mund verzogen, wenn Bettler die rohen Hände nach ihm ausgestreckt hatten, eine Zigarette, guter Mann, nur eine Zigarette. Hastig war er weitergeeilt, hatte den Mantel enger um sich geschlungen, als empfinde er eine körperliche Bedrohung. Zugeschlagen hatte er nie, doch er war auf andere Art grausam gewesen. Da klaffte eine Lücke, nicht fassbar, aber mächtig genug, den anderen in die Unsichtbarkeit zu drücken. Yan hatte sie nicht bemerkt, bis er auf die andere Seite gefallen war.
Der Herr mit Zylinder! Jäh erinnerte er sich, weshalb er sich hatte niederschlagen lassen. Der Mann im blauen Anzug, er würde ihm helfen. Woher er die Ahnung nahm, dass unter all den Menschen, die heute an ihm vorbeigeeilt waren, ausgerechnet dieser imstande war, über die Lücke hinwegzuspähen, wusste er nicht. Doch er hoffte inständig, dass ihn sein Instinkt nicht trog.
Abwägend betrachtete Yan die Treppe, über die der Herr mit Zylinder in das Gebäude verschwunden war. Die frische Platzwunde an der Stirn schmerzte und der Regen ließ ihn kaum etwas sehen. Der Fahrer beobachtete ihn. Das harte Glitzern in seinem Blick machte klar, dass er gewillt war, noch einmal zuzuschlagen.
Mit schweren Beinen humpelte Yan an der Hausfassade entlang. Er würde das Gebäude umrunden und von der anderen Seite den Herrn mit Zylinder erreichen, noch ehe ihn der Fahrer daran hindern konnte.
»Immer dieser Regen. Seit Tagen schon«, brummte Menmenfels. »Verflucht kalt geworden ist es. Und bei der Kohle gibt es Lieferengpässe. Haben Sie von dem Unglück gehört?«
»Am Rande.«
»Scheußliche Sache.«
Traudhild hätte dem Generaloberst gerne das Brandwasser ins selbstgerechte Gesicht gespritzt. Obwohl sie wusste, dass sie von einem Reveroner nicht mehr erwarten durfte, erzürnte sie das geheuchelte Mitgefühl doch jedes Mal aufs Neue. Dabei war das Problem weit größer.
Oft verbot sie sich, darüber nachzudenken, aber unverkennbar ging es mit der Welt zu Ende. Straßen und Eisenbahnschienen zerschnitten die Landschaft, Rohstoffe wurden aus der Erde gerissen. Die letzten beiden Jahrhunderte waren von einer rasanten technologischen Entwicklung gezeichnet gewesen. Doch nun, inmitten des entsetzlichen Kriegs, wurden die Ressourcen knapp.
»Wenn Sie so ein verständiger Mann sind, Herr Generaloberst … Glauben Sie nicht, dass uns dieser Krieg verschlingt?«, hörte sich Traudhild zu ihrer eigenen Überraschung sagen. Im selben Moment schon hätte sie sich auf die Zunge beißen können. Es war nicht ratsam, Menmenfels zu provozieren.
»Lassen Sie mich Ihnen versichern, es ist alles in bester Ordnung. Reveron hat genug Männer und Material, Averon endgültig in die Knie zu zwingen. Und sobald das geschehen ist, werden wir Averons Rohstoffe in unsere Wirtschaft überführen. Keine Engpässe mehr, Energie ohne Ende.«
»Ist das so?«, entfuhr es Traudhild.
»Gewiss, meine Liebe, gewiss.«
»Ich befürchte, auch Averons Rohstoffe werden nicht ewig halten. Und wir haben alle das gleiche Problem: Wir sind von der Außenwelt abgeschnitten und können uns keine Hilfe holen, wenn es soweit ist.«
»Wenn was soweit–? Ah … Sie meinen …« Unbehaglich kratzte sich Menmenfels am Kinn. »Dieses verdammte Gebirge.«
Endlich war das Grinsen fort. Endlich hatte sie den Generaloberst von seinem hohen Ross geholt. Allein dafür hatte es sich gelohnt, ihre düsteren Gedanken auszusprechen. Und vielleicht war es der Operation sogar dienlich, dass Menmenfels in Grübeleien versunken war. Für einmal nicht an den Sieg dachte, sondern an die Bedrohung, den unsichtbaren dritten Feind.
»Am Ende gibt es nur noch sie oder uns«, sagte das Fräulein.
»Wir werden einen Weg finden.« Menmenfels stierte auf das Schlachtfeld. »Rückzug ist keine Option.«
Dieses Mal entstammte seine Äußerung nicht der Kriegsrhetorik, sondern war ein geografischer Fakt. Im Süden und Westen wurden die Länder von einem Meer begrenzt, im Norden und Osten von einem Gebirge. Alles, was darüber hinausging, war verbotener Boden.
Es war nicht so, dass Averons und Reverons Ingenieure keine Schiffe oder Passstraßen bauen konnten. Natürlich hatten sie beides versucht. Kanonenbewehrte Kreuzer waren Richtung Südwesten in See gestochen. Gepanzerte Züge mit Bohrmaschinen und Gleiselementen hatten sich in die Berge vorgearbeitet. Doch dort draußen, in der Tiefsee und jenseits des Grenzwalls, lauerte eine Gefahr, deren Ausmaße niemand gänzlich begriff. Die Schiffe, die aufs Meer hinausfuhren, kehrten als Geisterschiffe an den Strand zurück. Und wer sich ins Gebirge des Nordens wagte, kam nicht wieder.
Dabei endete die Welt nicht an diesen Todeszonen. Hinter den Bergen und dem Meer gab es womöglich immer noch andere Länder, fremde Kulturen mit wertvollem Wissen und Rohstoffen. Vor langer Zeit hatte es eine Passage durch die Berge und Seewege über das Meer gegeben. Händler hatten Waren und Technologien gebracht. Doch diese Zeit wirkte ebenso entrückt wie die Märchen, die Mütter ihren Kindern vor dem Schlafengehen vorlasen, und oft konnte man sich nicht sicher sein, ob nicht eine eigentlich wahre Erzählung aus den Ländern jenseits der Berge zur Legende geworden war.
»Meine Tochter hat eine Heidenangst gekriegt, als ich ihr davon erzählt habe«, gestand Menmenfels. »Aber irgendwann musste ich es ihr ja sagen. Sie hat mich gefragt, wissen Sie … Warum wir nicht verschwinden und uns ein schönes Fleckchen Erde suchen. Erklären Sie das mal einem Kind!«
»Hat Ihre Tochter den Wall schon gesehen? Wenn nicht, belassen Sie es dabei. Kinder müssen nicht alles wissen. Und sie sollten verdammt nochmal nicht alles sehen.« Gegen ihren Willen spürte Fräulein Traudhild eine zerbrechliche Verbundenheit mit dem Mann, der um seine Tochter fürchtete.
Sie selbst würde den Tag nie vergessen, an dem sie zum ersten Mal den Schutzwall betrachtet hatte, der die Zivilisation vom Gebirge trennte. In kalten Winternächten, wenn den Wachposten der Atem zu Nebel gefror und die Wälder schneebedeckt glitzerten, konnte man die Kreaturen hören. Ein Wispern huschte durch die steilen Täler, ein Raunen brachte die Eiszapfen an den Tannen zum Klingen. Der frühere Kaiser Averons, Nulfred II. aus dem Hause Arnenmark, hatte Patrouillen ausgesandt, um das Geheimnis zu ergründen und die todbringenden Wesen zu stellen. Als keine einzige zurückkehrte, wurde das Unternehmen abgebrochen. Seitdem wagte es niemand mehr, in das Gebirge vorzudringen. Verschwand ein Wächter spurlos, so vermerkte der befehlshabende Offizier: bei der Verteidigung des Vaterlands gegen die Anderen gefallen. Wer auch immer sie waren, woher sie auch kamen.
Dämonen, Geister, die Anderen … Sie wurden nicht so genannt, weil man erkannt hatte, was sie waren, sondern weil Namen beschreibbar machten, was niemand verstand. Ein Name grenzte ein. Er vermittelte die Illusion, dass man wusste, wovon man sprach. Tatsächlich aber hatte auch die Kaiserliche Akademie der Wissenschaften zu Tormar keinen Schimmer, welche Dimensionen das Problem angenommen hatte. Nichts war über die Anderen bekannt, außer dass kein Mensch einen Kontakt überlebte.
»Sie haben wahrscheinlich recht, Fräulein Traudhild. Es dürfte schwer sein, wenn nicht unmöglich, rechtzeitig Frieden mit Averon zu schließen. Und deshalb stehe ich genau hier, auf dieser Brücke.« Er nickte und stemmte die Hände in die Hüften. »Wenn wir diesen Krieg gewonnen haben, werden wir die Dämonen jagen, bis sie uns in Ruhe lassen. Mit der Bodrom VI werden wir sie zerstäuben! Vertrauen Sie auf die Technik, sage ich. Die Technik wird unsere Zukunft sichern.«
»Unsere Wissenschaftler sollten sich besser auf Agrarforschung konzentrieren, anstatt noch mehr Kanonen zu erfinden«, fauchte Fräulein Traudhild. Das zarte Band zwischen ihnen war zerrissen.
»Das ist eine Angelegenheit der Männer des Militärs, darüber müssen Sie sich keine Gedanken machen.« Menmenfels lachte. »Nein, beim besten Willen nicht!«
Traudhild schluckte ihre Wut herunter und blickte auf ihre Taschenuhr. Der Augenblick war gekommen. Sie glaubte zu spüren, wie General Offenmarth von den averonischen Streitkräften Befehle ins Telefon bellte und wie seine Soldaten sich durch die Ebene unter ihnen stahlen. Die Vorzimmerdamen hämmerten auf ihre Schreibmaschinen ein, empfingen Telegramme von anderen Mauerabschnitten. Die geheime Offensive wurde vorbereitet. Die Einsatzleiter warteten nur noch auf das Signal: die Detonation, die Tormars Mauersektor 59 zum Einsturz bringen würde.
Yan strich um die nächste Ecke des Gebäudes. Eine breite, beinahe leer gefegte Straße lag vor ihm und nur manchmal huschte eine verschwommene Gestalt durch den Regen.
»… wahrhaft wundervolles Automobil. Ich würde es zu gerne einmal aus der Nähe bewundern. Es ist ein Tarton, nicht wahr, Prototyp?« Eine kräftige Bassstimme wehte aus einem Fenster über Yan und er blieb abrupt stehen.
»Ja«, sagte eine Frauenstimme, die Sekretärin, »aber der Herr hat soeben den Raum verlassen, er wollte nur die Akten abholen, war wohl in Eile. Wenn Sie ihn noch abpassen wollen, sollten Sie sich beeilen.«
Yan sog zischend die Luft ein, wobei sich seine gequetschte Lunge schmerzhaft dehnte, und hastete zum Parkplatz zurück. Panik ergriff ihn. Da sah er den Zylindermann am unteren Ende der Treppe. Entsetzt bemerkte er, dass er es nicht schaffen würde. Der Herr war schon bei seinem silbergrünen Wagen angelangt.
»Professor, so warten Sie doch!« Die Bassstimme stand oben an der Treppe. Vor den aufgedunsenen Backen zitterte ein Schnurrbart mit großen Kringeln. »Es wäre mir eine große Ehre, wenn Sie mir Ihr Automobil vorführen würden. Ich muss gestehen, ich hatte nicht damit gerechnet, dass die Gerüchte tatsächlich wahr sind. Wann geben Sie ihn in Produktion?«
Der Herr im blauen Anzug drehte sich um. Unter dem Zylinder wölbten sich die buschigen weißen Augenbrauen, als er zu der wuchtigen Gestalt emporsah. Plötzlich wirkte er fast etwas farblos, denn sein Gegenüber steckte in einem herbstroten Anzug mit gelben Manschetten und weißem Kragen.
»Ich habe es eilig«, sagte der Professor. »Der Nachmittag ist schon fortgeschritten und es wird dunkel. Und wo ich hinfahre, müssen wir vorsichtig sein. Sie wissen ja …«
»Selbstverständlich. Ein andermal dann, ein andermal, Professor.« Er winkte zum Abschied und wollte sich gerade umwenden, als ein dumpfes Geräusch ertönte.
Von plötzlichem Schwindel gepackt war Yan gegen eine abgestellte Droschke gestürzt. Verwirrt betrachtete er das eisenbeschlagene Hinterrad, an das er sich klammerte.
»Grundgütiger Torneon!«, rief der Professor aus und eilte zu ihm. »Marfried, helfen Sie mir!« Der Ruf galt dem Fahrer des Wagens, der bei den Soldaten stand und rauchte. »Hier, kommen Sie, ich helfe Ihnen auf. Himmel, wo kommen Sie nur her?«
Yan griff ungeschickt nach der Hand des Mannes.
»Professor, ich bitte Sie, was um alles in der Welt tun Sie denn da?«, bellte die Bassstimme. »Gehen Sie von ihm weg, lassen Sie Ihren Lakaien das erledigen. Vielleicht hat der Kerl Flöhe oder Schlimmeres.«
»Geht es Ihnen gut?« Der Professor drückte besorgt Yans linke Hand. Yan hatte es mittlerweile auf die Beine geschafft, doch sie zitterten so stark, als wollten sie jeden Moment unter ihm wegbrechen.
Marfried kam zu ihnen und als er sah, wer ihm da gegenüberstand, verzogen sich seine Lippen zu einem schmalen Strich.
»Es reicht, was für ein Skandal!«, polterte die Bassstimme. »Ich beschwöre Sie in aller Dringlichkeit, überlassen Sie diese verwahrloste Gestalt Ihrem Bediensteten. Aus solchen Szenen ist noch nie etwas Gutes entstanden … Er wird Sie ausrauben, sobald er Gelegenheit dazu hat, der Landstreicher.«
Der Professor richtete sich auf. Doch ehe er etwas sagen konnte, tat die Welt einen Ruck.
Ein ohrenbetäubendes Krachen zerschnitt die Luft, ein Blitz strahlte zwischen den Häuserschluchten hindurch, der Boden erzitterte. Einige Sekunden verstrichen, dann heulten die Sirenen auf.
»Wir werden angegriffen!«, keuchte der Dicke und starrte nach Nordwesten, wo sich in einiger Entfernung die Mauer vor dem Niemandsland erhob.
Haushohe Flammen hüllten Sektor 59 ein.
Automatisch duckte sich Yan. Keinen Lidschlag später fühlte er die Veränderung in der Luft. Es rauschte leise, als flöge ein großer Vogelschwarm über sie hinweg. Dann erfüllte ein mechanisches Jaulen die Luft. Armlange Geschosse prasselten auf die Stadt hinab, explodierten und verschlangen alles, was ihnen im Weg stand.
Augenblicklich erwachte die dämmrige Stadt zum Leben. Zu den Sirenen gesellten sich Alarmrufe, Pferdegewieher, Hufgeklapper und das Trappeln unzähliger Soldatenstiefel. Motoren knallten im Zwielicht, Panzerketten ratterten. Aus den umliegenden Gebäuden des Platzes, auf dem Yan stand, stürmten Menschen. Ihre Gesichter waren angstverzerrt. Die meisten hatten ihre Aktentaschen und Mäntel zurückgelassen und rannten auf den Schutzbunker zu, dessen Eingang Yan am anderen Ende des Platzes zu erkennen glaubte. Aus einer der abführenden Straßen polterte eine Kompanie Infanteristen heran, begleitet von Geschützfahrzeugen. Noch ehe sie den Platz erreicht hatte, schlug ein Geschoss in die Treppe des weißen Gebäudes ein. Ein Blindgänger. Doch die Wucht des Aufpralls genügte, die breite Prunktreppe zu zerschmettern. Die Bassstimme verschwand in einer Gesteinswolke.
Für einen Moment war Yan orientierungslos. Er fühlte sich, als hätte man ihn ins Wasser geworfen. Wo zuvor noch das Bild der zerstiebenden Treppe gewesen war, war nichts mehr. Ein hoher Ton surrte in seinen Ohren.
Doch ebenso plötzlich, als habe sich sein Körper erinnert, dass er in Lebensgefahr schwebte, kehrten die Bilder zurück und Yan konnte wieder sehen. Rußpartikel kratzten in seinen Augen, trotzdem erkannte er die Gestalt, die keinen Meter vor ihm auf dem Boden lag.
»Kommen Sie, kommen Sie!« Nun war es Yan, der mit seinen letzten Reserven dem Mann auf die Beine half.
»Danke … vielen Dank. Zum Wagen! Marfried, wo bleiben Sie?« Der Herr im blauen Anzug deutete auf den Tarton und zusammen kämpften sie sich durch den dichten Trümmernebel. Weitere Explosionen rissen die Straße auf. Steinsplitter regneten auf sie herab.
Der Fahrer stürmte auf sie zu, packte seinen Herrn und bugsierte ihn in den Wagen, ehe er sich hinters Steuer warf. Yan dachte keine Sekunde lang nach, sondern hastete ebenfalls in den Font, neben den Professor. Seine schmutzigen Hände hinterließen Spuren auf dem weißen Leder, doch er hatte keine Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Er blickte gehetzt durch die Heckscheibe. Die Bassstimme hatte überlebt und floh mit einigen Mitarbeitern über die Trümmer Richtung Schutzbunker, Papier segelte aus den oberen Stockwerken des getroffenen Gebäudes. Soldaten strömten auf den Platz, die Gewehre kampfbereit in der Hand.
Marfried warf den Motor an, der mit einem lauten Knall zum Leben erwachte. Dann drehte er sich zu ihnen um.
»Was tun Sie denn da, Professor? Wir können ihn nicht mitnehmen!«
»Wir können ihn nicht hierlassen! Fahren Sie los, wir haben keine Zeit.«
»Denken Sie an die Vorschriften! Er darf nicht mitkommen. Er wird das ganze Projekt gefährden. Wie wollen Sie das dem Ministerium erklären?«
Der Herr, inzwischen ohne Zylinder, zögerte. Von welchem Projekt sein Fahrer sprach, wusste Yan nicht. Aber es war wohl eine ganz geheime Sache. Und das machte ihm klar, dass er sich geirrt hatte. Der Professor würde ihm nicht helfen. Er durfte es nicht.
Dumpf starrte Yan durch das Seitenfenster. Die Erinnerung an den Arzt aus Bezirk 73 dümpelte vor seinen Augen. Tut mir leid, mein Junge. Der Bleistift kratzte über die Liste und zersägte seinen Namen.
»Wie heißen Sie?«, fragte der Professor.
»Yan Pavel, Nummer 349.« Yan versuchte sein Gesicht zu entschlüsseln. Sah er dort Mitleid, Bedauern?
Der prüfende Blick streifte Yans zerstörten Arm, seinen Körper, seine Augen. Dort verweilte er.
Eine weitere Detonation ließ sie alle zusammenzucken.
»Wenn ich Sie mitnehme, Herr Pavel, gibt es kein Zurück mehr«, sagte der Professor.
Yan erwiderte seinen Blick. Doch er sah nicht in die wachen hellblauen Augen seines Gegenübers, sondern auf die einzige Zukunft, die er hatte. Und während der Schmerz mit aller Macht zurückkehrte und Erschöpfung seinen Geist erfasste, nickte er.
»Fahren Sie los!«, wies der Professor seinen Fahrer an.
Marfried drückte das Gaspedal durch. Yan wurde an die Tür gedrückt, als der Tarton mit quietschenden Reifen wendete. Dann jagten sie die Straße runter, vorbei an scheuenden Pferden und hinein in eine diffuse Welt aus grauem Licht.
Die Grenze
In dem Durcheinander rennender Soldaten und Zivilisten hatten sie es nach einer halben Stunde geschafft, aus der Stadt zu flüchten. Hinter ihnen brannte Tormar, und Kanonenschüsse zerfetzten die Mauern. Das Feuer der Straßenschlachten erhellte den Nebel in einem geisterhaften Zwielicht.
Während sich erste Widerstandsnester in Hausruinen sammelten, drangen die averonischen Einheiten weiter vor. Generaloberst Santenborg beschloss schon nach einer Stunde, sich auf eine zweite provisorische Stellung zurückzuziehen. Das sei die einzige Möglichkeit, die Invasion kontrolliert einzudämmen, bellte er ins Fernsprechgerät. Als er aus dem Hörer keine Antwort erhielt, musste der Generaloberst feststellen, dass die Telefonzentrale in die Luft gesprengt worden war.
Doch das waren Sorgen, die Yan nicht teilte. Sie flohen über eine schmutzige Straße nach Westen. In jedem Dorf, das sie passierten, rannten ihnen hungrige Kinder nach und bettelten um Brot. Am Straßenrand kauerten zerlumpte Gestalten, Versehrte. Der Krieg wurde nicht nur im Schützengraben gefochten.
Bald war die Straße nur noch eine schlammige Fahrrinne und die Nacht wölbte sich über das Land. Fieber kroch durch Yans Körper. Seine Finger krallten sich zitternd in die Kleidung, ein schaler Geschmack lag ihm auf der Zunge. Aber das Schlimmste waren die eigenen Gedanken, als er allmählich die Tragweite seiner Situation begriff. Alles hing davon ab, wie der Mann neben ihm, dessen Namen er nicht kannte, mit ihm verfuhr; ein Krüppel hatte keine Zukunft außerhalb der Barmherzigkeit anderer.
Seine Nasenflügel bebten, während er durch das Fenster nach draußen starrte. Aufzugeben war noch nie so einfach gewesen, sonderbarerweise genau jetzt, da die Ereignisse eine unvorhergesehene Wendung genommen hatten. Dabei war es ihm schon schlechter ergangen. Er erinnerte sich an den Massenschlag, einen langen Barackenbau. Zusammengezimmert aus drei Zentimeter dickem Fichtenholz, nicht für die Ewigkeit gebaut, sondern nur für die Lebensdauer eines Arbeiterkontingents. Das waren im Durchschnitt fünfzehn Jahre. An ihrem freien Wochentag hatten die Arbeiter mit alten Zeitungen und Ölrückständen die Wände isoliert. Das machte jeder irgendwann, man brauchte sich nicht zu organisieren. Es musste einfach nur kalt werden. Aber nach einigen Jahren ließ die Nässe das Papier modern. Zuerst wurden die Ecken des Raumes dunkel, fast schwarz, dann breitete sich das Zeug über alle Wände aus. Der Schimmel, der alsbald in kleinen Blüten zu sprießen begann, hatte etwas beinahe Schönes an sich. Die zarten Pelzfasern waren das Einzige, was in Bezirk 73 imstande war, zu wachsen. Aber Yan ahnte, wie gefährlich sie waren. Er fühlte sie, wenn er Luft holte: die lauernde Präsenz unsichtbarer Sporen, die in ihn drang, tief hineinkletterte in seinen so verletzlichen Organismus. Faber, der bucklige Koloss, den alle nur den Berg nannten, hatte oft über Lungenkrankheiten gesprochen. Er behauptete gern, dass er eine Frau in der Arbeiterkneipe kennengelernt hatte, die angesehene Ärztin war. Natürlich glaubte ihm niemand. Kein Mensch der gehobenen Stände, erst recht keine Ärztin, bandelte mit einem wie ihnen an. Manchmal lachten sie über Faber, es gab ja sonst nicht viel, worüber man hätte lachen können. Wie Fabers Frau wohl auszusehen hatte, wenn sie unter seinem Gewicht nicht kollabieren wollte. Sie grölten, grunzten, scherzten über ihre schlechten Zähne oder die Größe ihrer Titten.
Yan lachte mit, grinste dümmlich, aber eigentlich lachte er über sich selbst. Es spielte keine Rolle, was Faber behauptete. Yan hatte die Hälfte dessen, was er einst über Frauen gewusst hatte, schon wieder vergessen. Die zerknitterten Bilder, die die Kumpels untereinander austauschten, waren eines der wenigen Vergnügen inmitten von Dreck und Lärm. Mit ihnen versuchte Yan die Gewissheit aufrechtzuhalten, dass er irgendwann einmal vor langer Zeit ein anderes Leben geführt hatte. Vor allem in der Nacht, wenn er wach lag und die Wand anstarrte, überrollte ihn das Verlangen nach Wärme und Geborgenheit so heftig, dass es schlimmer schmerzte als all die Schürfwunden, Rückenschmerzen, überanstrengten Muskeln. Er flüchtete sich in Fantasien, träumte jugendliche Abenteuer und erotische Gedanken, auch wenn er nicht mehr wusste, wie sich das anfühlte.
Doch bald verwandelten sich nächtliche Imaginationen in Albträume, die er auch dann noch sah, wenn er die Augen aufschlug. Plötzlich glaubte er, die Wand würde sich bewegen. Aber nur, wenn er nicht direkt hinsah. Kleine Tierchen, scheu, heimtückisch; sie krabbelten über das fleckige Holz und vermehrten sich raschelnd. Ekel ergriff ihn. Er verfluchte sie alle, presste die Handflächen auf die Augen, weil er das Gewimmel ringsum nicht ertrug. Oft fragte er sich in diesen dunklen Stunden, ob er den Verstand verlor. Er begann alles zu hassen, sich selbst ebenso wie das Ungeziefer, das sich wie er verzweifelt an die Existenz klammerte, getrieben von dem müden Drang, nicht abzukratzen.
Aber was, wenn das Ungeziefer gar nicht da ist?, fragte er sich. Alles nur die Einbildung seines maroden Verstandes, er selbst – verrückt geworden durch die Einsamkeit in den Stollen? Ein Trick seiner Netzhaut. Er musste die Augen öffnen. Musste hinsehen. Musste wissen, ob er verrückt war oder erst auf dem Weg in den Wahnsinn.
Sieh hin!
Yan schrak hoch, Schweiß auf der Stirn. Er stöhnte vor Schmerzen, holte noch einmal Luft.
»Wo sind wir?« Er versuchte draußen etwas zu erkennen, doch es war zu dunkel. Es mussten Stunden vergangen sein.
Der Mann neben ihm blickte ihn besorgt an. Erst als die Berge so nah waren, dass sie wie eine Gewitterfront vor ihnen aufragten, erkannte Yan, wohin ihre Straße sie führte. Schubweise überkam ihn Angst.
»Das ist … das Gebirge!«
»Das ist unser Weg«, erklärte der Professor.
»Aber wir fahren da doch nicht hinein?« Wer den Schutzbereich verließ, wurde nie mehr gesehen.
»Wir hätten ihn rauswerfen sollen«, murmelte Marfried. Der Professor antwortete nicht.
Da endete die Straße. Vor ihnen ragte eine turmhohe Mauer empor. Sie erstreckte sich von einem Horizont zum anderen, streng den Ausläufern des Gebirges folgend. Eine düstere Wehranlage für einen Feind, den man nicht kannte.
Teile eines vorgelagerten Grabens waren mit Stahlsperren und gedrungenen Betontürmen ausgestattet. Kanonenläufe ragten daraus hervor wie Beine aus einem fetten Spinnenkörper. Stacheldraht wand sich über Zinnen und Senken der Befestigung und in einem ewiggleichen Rhythmus huschte Flutlicht durch die Nacht und erhellte die martialische Konstruktion.
Nicht! Wir dürfen da nicht durch! Yans Herz hämmerte gegen seine Rippen. Jenseits der Mauer gibt es nichts. Nur die Anderen.
Sie hielten vor der Toranlage, zwei Eisenschleusen, von denen nur eine geöffnet war. Scheinwerferlicht glitt über den Tarton und streifte grau uniformierte Gestalten mit Gewehren. Marfried öffnete das Fenster.
»Es ist Nacht«, sagte die ranghöchste Uniform. »Was haben Sie hier draußen zu suchen?«
»Wir wollten übernachten, aber die Hauptstadt wurde angegriffen, und unsere Dokumente müssen schnellstmöglich in Sicherheit gebracht werden, falls der Feind in Reveron einfällt.«
Ruppig nickte der Offizier. »Wir haben vor wenigen Stunden das Telegramm erhalten. Wir werden Ihnen eine Eskorte mitschicken, damit Sie Ihr Ziel unbeschadet erreichen.«
»Professor Richmuth-Tristmon wünscht, alleine zu reisen. Wir sind ausreichend bewaffnet.«
»Ich bestehe darauf. Alles andere ist unverantwortlich.«
Yan zuckte zusammen, als der Professor neben ihm leise schnaubte. Dann beugte sich dieser vor und sagte eindringlich: »Es ist mein Wunsch.«
Der Offizier schluckte. »Also schön. Auf Ihre Verantwortung.«
Marfried kurbelte das Fenster hoch. Yan sah den Befehlshaber einige Sekunden ratlos herumstehen, ehe er seinen Männern ein Zeichen gab.
Das Tor glitt ratternd beiseite. Langsam fuhr der Tarton ins Innere der Schleuse. Vor ihnen sah Yan das zweite Tor, eine dunkle Wand. Er drehte sich um. Die Flügel des ersten Tores schlossen sich wieder.
»Wenn wir zuhause sind, bekommt er Medizin und einen Verband, dann wird es ihm bessergehen«, teilte der Professor dem Rückspiegel mit. Der Fahrer reagierte nicht.
Yan brachte keinen Ton heraus. Voll Schrecken beobachtete er, wie die Flügel der zweiten Schleuse zur Seite glitten. Der Weg in die Welt hinter dem Schutzwall lag frei.
»Geben Sie Gas«, sagte der Professor. »Es ist schon spät.«
Yan schielte zu seinem Retter hinüber und wusste in diesem Moment, dass er neben einem besonderen Mann saß. Einem wichtigen Mann, der eine bedeutende Rolle im Krieg spielen musste.
»Wer sind Sie?«, fragte er.
»Professor Dimon Richmuth-Tristmon«, sagte der Mann im blauen Anzug. Dieses Mal hatte der Name Gewicht. Mit seiner Hilfe hatten sie das Tor in die Dämonenwelt passiert.
Die Straße führte in vielen Schlangenlinien steil bergauf. Ein düsterer Wald klammerte sich an die Bergflanken. Der Tarton überquerte mit dem schwachen Licht der Scheinwerfer einige Brücken, unter denen Gletscherwasser donnerte. Grob aus dem Felsen geschlagene Tunnel wechselten mit engen Kurven. Schotterstein und Dreck lösten den aufgerissenen Straßenbelag ab.
»Dieser Weg stammt aus alter Zeit, als der Pass noch begehbar war«, erläuterte der Professor knapp, ehe sie erneut schwiegen.
Yan konnte seine Unruhe nicht unterdrücken. Unentwegt huschte sein Blick aus dem Fenster. Er suchte nach ihnen, ohne zu wissen, wonach er Ausschau halten musste. Nach schwarzem Nebel, der zwischen den Bäumen hing? Oder einer wahrhaftigen Geistererscheinung? Dass der Professor im Angesicht der Gefahr derart ruhig blieb, verblüffte ihn. Aber vielleicht glaubte er an die Verschwörungstheorien, laut denen die Angst vor den Dämonen ein Mittel des Kaisers war, um Deserteuren und Flüchtlingen das Handwerk zu legen. Dabei waren die Geschichten alt – zu alt, um ein Produkt vom Schreibtisch des Kaisers zu sein. Überall tauchten sie auf. In Abenteuerromanen, Liedern oder Opern, in welchen der heldenhafte reveronische Soldat die Berge überschritt und der heimliche Traum der Menschen Wirklichkeit wurde. Auch Yan träumte von der Flucht. Die Sehnsucht nach der Welt auf der anderen Seite des Gebirges war in jedem tief verankert. Und doch blieb sie kaum mehr als der Silberstreifen am Horizont, ein Ort, an dem Kinderlieder oder Gedichte entstanden. Ein solcher Ort hatte in einer feuerfauchenden Welt wie dieser keinen Platz.
»Was ist passiert?«
Yan wandte sich Richmuth-Tristmon zu.
»Grubenunglück.«
Der Professor wirkte betroffen. Aber irgendwie schienen ihm die Worte zu fehlen und er beugte sich nach vorne, legte die Fingerspitzen aufeinander und betrachtete den Vordersitz.
Yan rang eine Weile mit sich. Dann fragte er: »Sie sind doch Professor und kennen sich demnach mit allerlei aus … Werde ich meinen Arm verlieren?«
Er kannte viele Grubenarbeiter, die nach Unfällen Gliedmaßen verloren hatten. Er hatte sie gesehen und mit ihnen gesprochen. Ein paar hatten es geschafft, dennoch zu überleben und in ein halbwegs würdevolles Leben zurückzukehren. Allerdings nur, weil sie jemanden hatten, der für sie noch etwas Geld zusammenkratzen konnte. Die meisten Verunglückten verschwanden einfach und Yan konnte sich nur zu leicht denken, welches erbärmliche Ende sie genommen hatten.
Richmuth-Tristmon schwieg beharrlich und nach einer Weile wachsender Sorge fragte Yan erneut.
»Ich bin kein Arzt«, meinte er nur und Yan presste die Lippen aufeinander.
Nach einiger Zeit konnten sie in der Ferne einen Lichtschimmer erkennen. Aus der Dunkelheit des Waldes schälte sich ein massives Steintor. Der Torbogen war zur Hälfte eingestürzt, aber in den Rahmen war nachträglich ein Metallgitter gesetzt worden. Aus dem Wachhaus neben dem Tor trat ein Soldat, in der einen Hand die Schlüssel, in der anderen eine Öllampe. Er öffnete und salutierte, als der Wagen an ihm vorbeirollte.
»Ist es das, sind wir da?«, fragte Yan. Seine Stimme klang schwach. Er fühlte sich schwindelig und müde.
»Ja, das ist mein Anwesen.«
»Aber die Dämonen. Was, wenn sie kommen?«
»Wir haben unsere Mittel und Wege, um sicher zu sein.« Der Professor hielt das Thema damit offenbar für erledigt. »Denken Sie nicht mehr darüber nach.«
Die Bäume lichteten sich und sie fuhren auf eine große natürliche Plattform hinaus. In der Nacht konnte man kaum etwas erkennen. Hier und da standen niedrige Gebäude. Sie fuhren an etwas vorbei, das wie eine Scheune aussah.
Am Ende der Straße wuchs ein schlossgleiches Gebäude empor. Die Fassade war breit und hoch und aus den zahlreichen Fenstern strömte Licht. Yan lehnte den Kopf an die Scheibe und betrachtete das Dach, das von Erkern, Türmen und Giebeln durchbrochen wurde. Der Tarton umrundete einen Teich auf dem Vorplatz und hielt vor dem Eingangsportal.
Es war der Augenblick, in dem Yans Geist beschloss, vorläufig in Sicherheit zu sein. Und plötzlich war alles da: der sengende Schmerz der Verbrennungen, der Hunger, die fiebrige Hitze in seinem Körper. Jemand öffnete die Fahrzeugtür und Yan taumelte ins Freie. Kühle Nachtluft umfing ihn. Er strauchelte und brach beim nächsten Schritt ohnmächtig zusammen.
Die Agentin
»Bringen Sie der gnädigen Frau das Abendmahl aufs Zimmer, sie wartet schon seit einer halben Stunde!«
»Jawohl, Fräulein Traudhild.«
»Und sorgen Sie dafür, dass die Betten der Kinder hergerichtet sind.«
»Fräulein Traudhild.« Das Hausmädchen nickte, nahm Traudhild das Tablett mit Speisen ab und hastete die Treppe hinauf in den ersten Stock.
Traudhild zwang eine Strähne, die sich aus dem Dutt gewunden hatte, in ihre Frisur zurück und eilte durch das große Haus der Familie Germont. Die Holzvertäfelung wirkte heute dunkler als sonst und unaufhörlich schlug Regen gegen die farbigen Doppelglasfenster. Obwohl Traudhild wie immer geschäftig über die makellos gewienerten Dielen trippelte, waren ihre Schritte weniger energisch. Sie hatte kaum geschlafen. Ihr Rücken schmerzte und die Arthritis in ihren Finger plagte sie heute besonders heftig.
»Wie weit sind sie?«, fragte sie, kaum dass sie die Küche betreten hatte.
Der Koch und seine Küchenmagd sahen von ihrer Arbeit auf. Es duftete bereits nach Schmorbraten und Zwiebeln.
»Noch beim Aperitif«, sagte der Koch, ein kahlköpfiger Mittfünfziger, der sich nie anmerken ließ, dass seine Familie knapp über die Runden kam, während er für eine der reichsten Herrschaften Tormars kochte. »Der Gewürzschaum kommt gut an. Die Herrschaften haben nachbestellt.«
Traudhild beugte sich über eine Schüssel mit hellbeigem Schaum. Sie nahm einen Löffel und kostete. Der Koch und die Küchenmagd warteten. Traudhild drückte den Schaum gegen ihr Gaumendach, schob ihn im Mund umher, während sie darauf wartete, etwas zu schmecken. Nichts.
»Ausgezeichnet«, sagte sie und der Koch lächelte.
Es erstaunte Traudhild nicht, dass sie ihr Geschmackssinn wieder einmal im Stich ließ. Dieser Umstand bestätigte nur, wie tief der Schock saß. Der Schock darüber, dass Monate der Vorbereitung umsonst gewesen waren. Dass über zweitausend Averoner bei dem missglückten Sturm auf Tormar ihr Leben verloren hatten. Und ausgerechnet der Mann, der am Ende des Flurs im Großen Salon seine Gäste bewirtete, war dafür verantwortlich. Er hatte getan, was sich das averonische Oberkommando nicht hatte vorstellen können, weil es schlicht wahnsinnig war.
Traudhild legte den Löffel beiseite. Wie einfach wäre es, unbemerkt einen Tropfen Mondschatten in den Schaum zu mischen. Ein Tropfen würde genügen, um Generalfeldmarschall Tillev Germont und seine gesamte verfluchte Gesellschaft aus der Welt zu schaffen.
»Machen Sie dieses Tablett noch fertig«, wies sie die Magd an, die fortfuhr, den Gewürzschaum in Porzellanschälchen zu füllen und mit einem Veilchenblatt zu garnieren. »Herr Kell, wie weit sind Sie mit dem Hauptgang?«
»Noch eine halbe Stunde.«
»Bis dahin wollen wir die gute Gesellschaft nicht auf dem Trockenen sitzen lassen. Bereiten Sie mehr Getränke vor, etwas Ausgefallenes. Fräulein Schmyder, sind Sie wohl bald fertig?«, herrschte Traudhild die Küchenmagd an, die hastig das letzte Veilchen drapierte. »Geben Sie mir das!«





























