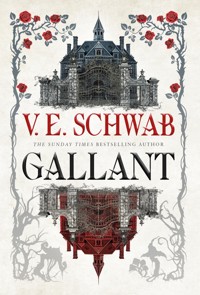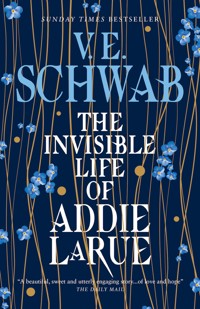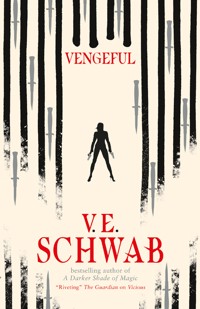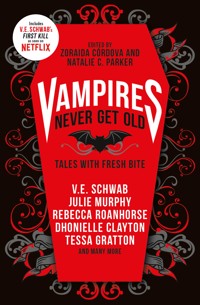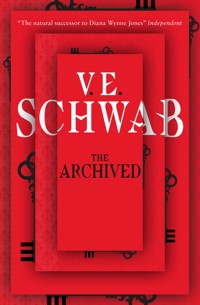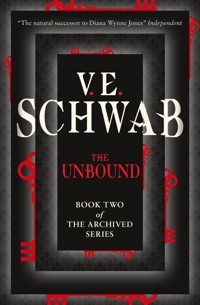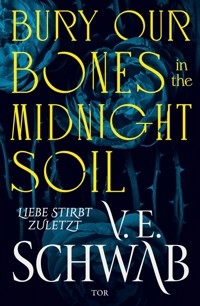9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
»Das unsichtbare Leben der Addie LaRue« ist ein großer historischer Fantasy-Roman, eine bittersüße Liebesgeschichte – und eine Hommage an die Kunst und die Inspiration. Addie LaRue ist die Frau, an die sich niemand erinnert. Die unbekannte Muse auf den Bildern Alter Meister. Die namenlose Schönheit in den Sonetten der Dichter. Dreihundert Jahre lang reist sie durch die europäische Kulturgeschichte – und bleibt dabei doch stets allein. Seit sie im Jahre 1714 einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hat, ist sie dazu verdammt, ein ruheloses Leben ohne Freunde oder Familie zu führen und als anonyme Frau die Großstädte zu durchstreifen. Bis sie dreihundert Jahre später in einem alten, versteckten Antiquariat in New York einen jungen Mann trifft, der sie wiedererkennt. Und sich in sie verliebt. Für Leser*innen von Erin Morgenstern, Neil Gaiman, Audrey Niffenegger, Leigh Bardugo und Diana Gabaldon
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
V.E. Schwab
Das unsichtbare Leben der Addie LaRue
Roman
Aus dem Amerikanischen von Petra Huber und Sara Riffel
FISCHER E-Books
Für Patricia,
die mich nie vergessen hat
Die alten Götter mögen groß sein, aber sie sind weder freundlich noch barmherzig, sondern launisch und unbeständig wie Mondlicht auf Wasser oder wie Schatten in einem Sturm. Wenn du sie anrufen willst, gib acht: Überlege genau, worum du bittest, und sei bereit, den Preis zu zahlen. Und ganz gleich, wie verzweifelt du bist, bete niemals zu den Göttern, die nach Einbruch der Nacht antworten.
Estele Magritte
1642–1719
Villon-sur-Sarthe, Frankreich
29. Juli 1714
Ein Mädchen rennt um ihr Leben.
Die Sommerluft brennt auf ihrem Rücken, aber da sind keine Fackeln, keine wütende Meute, nur die fernen Laternen der Hochzeitsfeier, das rötliche Glühen der Sonne, die gegen den Horizont stößt, aufbricht und sich über die Hügel ergießt. Das Mädchen rennt und ihre Röcke verfangen sich im Gras, während sie auf den Wald zustürmt, im Wettlauf mit dem sterbenden Licht.
Der Wind trägt Stimmen heran, die ihren Namen rufen.
Adeline? Adeline? Adeline!
Ihr Schatten erstreckt sich vor ihr – zu lang, die Ränder verschwimmen bereits –, und kleine weiße Blüten purzeln aus ihrem Haar, sprenkeln den Boden wie Sterne. Ein Sternbild, das sie hinter sich lässt, fast wie das auf ihren Wangen.
Sieben Sommersprossen. Eine für jeden Geliebten, den sie einmal haben wird, so hat Estele geweissagt, als das Mädchen noch klein war.
Eine für jedes Leben, das sie führen wird.
Eine für jeden Gott, der über sie wacht.
Jetzt verspotten sie sie, diese sieben Male. Versprechungen. Lügen. Sie hatte keine Geliebten, sie hat kein Leben geführt, sie ist keinen Göttern begegnet, und nun ist ihre Zeit abgelaufen.
Aber das Mädchen wird nicht langsamer, schaut nicht zurück; das Leben, das sie dort erwartet – statisch wie ein Gemälde, massiv wie eine Grabstätte –, will sie nicht sehen.
Stattdessen rennt sie.
Teil einsDie Götter, die nach Einbruch der Nacht antworten
Titel: Revenir
Künstler: Arlo Miret
Entstehungsdatum: 1721–22 n. Chr.
Material: Eschenholz, Marmor
Standort: Leihgabe des Museé d’Orsay
Beschreibung: Skulpturenserie aus fünf hölzernen Vögeln in verschiedenen Haltungen und Stadien kurz vor dem Abflug, auf einer schmalen Marmor-Plinthe montiert.
Hintergrund: Als gewissenhafter Autobiograph führte Miret Tagebücher, die einen Einblick in seine Denk- und Arbeitsweise geben. Betreffs der Inspiration für Revenir schreibt der Künstler die Idee einer beschädigten Figurine zu, die er im Winter 1715 auf den Straßen von Paris fand. Der hölzerne Vogel mit dem abgebrochenen Flügel wurde von ihm (wenngleich intakt) als Vierter in der Serie nachgestaltet – bereit, sich in die Lüfte zu erheben.
Geschätzter Wert: $ 175000
New York City
10. März 2014
I
Das Mädchen erwacht im Bett eines anderen.
Sie liegt da, vollkommen still, will die Zeit wie einen Atemzug in der Brust festhalten; als könnte sie die Uhr daran hindern weiterzuticken, den Jungen neben ihr daran aufzuwachen und die Erinnerung an ihre Nacht mit purer Willenskraft am Leben halten.
Natürlich weiß sie, dass sie das nicht kann. Dass er vergessen wird. So ist es immer.
Es ist nicht seine Schuld – es ist niemals ihre Schuld.
Der Junge schläft noch, und sie sieht zu, wie seine Schultern sich langsam heben und senken, betrachtet die Stelle, an der sein dunkles Haar sich im Nacken kräuselt, die Narbe entlang seiner Rippen. Details, die sich längst ins Gedächtnis eingeprägt haben.
Sein Name ist Toby.
Letzte Nacht hat sie ihm gesagt, ihrer sei Jess. Sie hat gelogen, aber nur, weil sie ihren wahren Namen nicht aussprechen kann – eines der kleinen, gemeinen Details, die sich wie Nesseln im Gras verbergen. Versteckte Dornen, die ihr einen Stich versetzen sollen. Was ist ein Mensch, wenn nicht die Gesamtheit der Spuren, die er hinterlässt? Sie hat gelernt, zwischen die Dornen zu treten, aber manche Verletzungen lassen sich nicht vermeiden – eine Erinnerung, ein Foto, ein Name.
Letzten Monat war sie Claire, Zoe, Michelle – aber vor zwei Nächten, als sie Elle war und sie nach einem von Tobys Gigs gemeinsam eine Bar verließen, sagte Toby, er sei in ein Mädchen namens Jess verliebt – er hätte sie nur noch nicht getroffen.
Also ist sie jetzt Jess.
Toby beginnt, sich zu regen, und sie spürt den vertrauten Schmerz in der Brust, als er sich streckt und zu ihr hin dreht – aber nicht aufwacht, noch nicht. Sein Gesicht ist jetzt wenige Zentimeter von ihrem entfernt, seine Lippen sind im Schlaf geöffnet, schwarze Locken beschatten seine Augen, dunkle Wimpern vor hellen Wangen.
Einmal hat der Schatten das Mädchen aufgezogen, bei einem Spaziergang an der Seine, und ihr gesagt, sie hätte einen »Typ«. Sähen nicht die meisten der Männer, die das Mädchen auswählte, ihm furchtbar ähnlich?
Dasselbe dunkle Haar, der stechende Blick, dieselben klar geschnittenen Gesichtszüge.
Aber das war nicht fair.
Schließlich sah der Schatten nur wegen ihr so aus. Sie hat ihm diese Gestalt gegeben, entschieden, was sie aus ihm machen, was sie in ihm sehen wollte.
Weißt du nicht mehr?, hat sie ihm damals gesagt. Dass du vorher nur Dunkelheit und Rauch warst?
Liebling, hat er mit seiner weichen, vollen Stimme geantwortet, ich war die Nacht selbst.
Jetzt ist es Morgen, in einer anderen Stadt, einem anderen Jahrhundert, das helle Sonnenlicht schneidet durch die Vorhänge, und Toby regt sich erneut, taucht durch die Oberfläche des Schlafes auf. Und das Mädchen, das Jess ist oder war, hält wieder den Atem an und versucht, sich vorzustellen, wie es wäre, wenn er aufwacht und sie sieht und sich erinnert.
Wie er lächelt und ihre Wange streichelt und sagt: »Guten Morgen«.
Aber das wird nicht passieren, und sie will die vertraute leere Miene nicht sehen, will nicht zuschauen, wie der Junge die Lücken zu füllen versucht, wo Erinnerungen an sie sein sollten, wie er die Fassung zurückgewinnt und sich routiniert lässig gibt. Dieses Schauspiel hat das Mädchen oft genug gesehen, sie kennt es in- und auswendig, deshalb gleitet sie stattdessen aus dem Bett und tapst barfüßig ins Wohnzimmer.
Sie sieht ihr Abbild im Spiegel der Diele und betrachtet die sieben Sommersprossen, die wie ein Band aus Sternen über ihre Nase und ihre Wangen verteilt sind.
Ihr eigenes Sternbild.
Sie beugt sich vor und haucht das Glas an. Zieht die Fingerspitze durch die Wolke und versucht, ihren Namen zu schreiben. A-d-
Weiter kommt sie nicht, bevor sich die Buchstaben auflösen. Es liegt nicht am Medium. Egal, wie sie versucht, ihren Namen zu sagen oder ihre Geschichte zu erzählen. Und sie hat es versucht, mit Bleistift, Tinte, Farbe, Blut.
Adeline.
Addie.
LaRue.
Es hat keinen Zweck.
Die Buchstaben bröckeln oder verblassen. Die Laute ersterben in ihrer Kehle.
Sie lässt die Finger sinken und dreht sich um, betrachtet das Wohnzimmer.
Toby ist Musiker, und die Zeichen seiner Kunst sind allgegenwärtig.
Die Instrumente, die an den Wänden lehnen. Die gekritzelten Zeilen und Noten auf den Tischen – halb erinnerte Melodien zwischen Einkaufszetteln und To-do-Listen. Aber hier und da zeigt sich ein anderer Einfluss – die Blumen, die überraschend auf dem Fensterbrett in der Küche aufgetaucht sind. Das Buch über Rilke, an dessen Kauf er sich nicht erinnert. Die Dinge, die bleiben, auch wenn die Erinnerungen vergehen.
Toby ist ein Spätaufsteher, also macht Addie sich einen Tee – er trinkt keinen, aber der Tee ist trotzdem da, in seinem Schrank, eine Dose loser Ceylon und ein Karton mit Seidenbeutelchen. Das Überbleibsel eines späten Ausflugs in den Supermarkt, ein Junge und ein Mädchen, die Hand in Hand durch die Gänge schlendern, weil sie nicht schlafen konnten. Weil sie die Nacht nicht enden lassen wollte. Nicht loslassen wollte.
Sie hebt die Tasse und inhaliert den Duft, während Erinnerungen aufsteigen.
Ein Park in London. Ein Innenhof in Prag. Ein Besprechungsraum in Edinburgh.
Die Vergangenheit wie ein Seidentuch über die Gegenwart gezogen.
Es ist ein kalter Morgen in New York, die Fenster sind vom Frost beschlagen, deshalb nimmt sie sich eine Decke von der Sofalehne und wickelt sie sich um die Schultern. An einem Ende des Sofas liegt ein Gitarrenkoffer, und Tobys Kater nimmt das andere in Beschlag, deshalb lässt sie sich auf der Klavierbank nieder.
Der Kater, der ebenfalls Toby heißt (»Damit ich mit mir selbst reden kann, ohne wie ein Irrer zu klingen …«), schaut sie an, während sie auf ihren Tee pustet.
Ob der Kater sich an sie erinnert?
Ihre Hände sind jetzt wärmer, und sie stellt die Tasse auf dem Piano ab und klappt den Deckel hoch, dehnt ihre Finger und fängt möglichst leise an zu spielen. Im Schlafzimmer hört sie, wie Toby-der-Mensch sich bewegt, und jeder Zentimeter an ihr, vom Skelett bis zur Haut, spannt sich vor düsterer Vorahnung an.
Das ist der schwierigste Teil.
Addie hätte gehen können – gehen sollen –, solange er noch schlief, als ihr Morgen noch zur Nacht gehörte, ein Moment in Bernstein eingeschlossen. Aber jetzt ist es zu spät, also macht sie die Augen zu und spielt weiter, hält den Kopf gesenkt, während sie seine Schritte hört, bewegt weiter die Finger, als sie ihn in der Tür spürt. Er wird dort stehen und die Szenerie in sich aufnehmen, versuchen, den Ablauf des gestrigen Abends zu rekonstruieren, wie alles so schieflaufen konnte, wann er ein Mädchen getroffen und mit nach Hause genommen hat, ob er zu viel getrunken hat, warum er sich an nichts mehr erinnert.
Aber sie weiß, dass Toby sie nicht unterbrechen wird, solange sie spielt, deshalb genießt sie noch ein paar Sekunden lang die Musik, bevor sie sich zwingt aufzuhören, hochzuschauen und so zu tun, als fiele ihr die Verwirrung in seinem Gesicht gar nicht auf.
»Morgen«, sagt sie fröhlich, und ihr Akzent, einst ländliches Französisch, ist jetzt so schwach, dass sie ihn kaum noch hört.
»Äh, guten Morgen«, sagt er und fährt sich mit der Hand durch die losen schwarzen Locken. Man muss ihm zugutehalten, dass er aussieht wie immer – ein wenig benommen, und überrascht, weil ein hübsches Mädchen in seinem Wohnzimmer sitzt, mit nichts als einem Slip und einem T-Shirt von seiner Lieblingsband unter der Decke.
»Jess«, sagt sie und liefert ihm den Namen, den er nicht finden kann, weil es ihn nicht gibt. »Schon okay«, sagt sie, »falls du dich nicht erinnerst.«
Toby wird rot und schubst Toby-den-Kater beiseite, um sich in die Sofakissen sinken zu lassen. »Tut mir leid … so bin ich eigentlich nicht. Ich bin nicht so ein Typ.«
Sie lächelt. »Ich bin nicht so ein Mädchen.«
Da lächelt auch er, und es ist wie ein Lichtstrahl, der die Schatten in seinem Gesicht durchbricht. Er nickt zum Klavier, und sie will, dass er so etwas sagt wie: »Ich wusste gar nicht, dass du spielen kannst.« Aber stattdessen sagt Toby: »Du bist wirklich gut.« Und das ist sie auch – erstaunlich, wie viel man lernen kann, wenn man die Zeit dazu hat.
»Danke«, sagt sie und fährt mit den Fingerspitzen über die Tasten.
Toby ist jetzt nervös und flüchtet sich in die Küche. »Kaffee?«, fragt er und durchsucht die Schränke.
»Ich hab Tee gefunden.«
Sie beginnt ein anderes Lied. Nichts Kompliziertes, nur eine Abfolge von Tönen. Den Anfang von etwas. Sie findet die Melodie, nimmt sie auf, lässt sie zwischen ihren Fingern hindurchgleiten, bis Toby mit einer dampfenden Tasse wiederauftaucht.
»Was war das?«, fragt er, seine Augen leuchten auf eine Weise, die typisch für Künstler ist – Schriftsteller, Maler, Musiker, alle, die für Momente der Inspiration anfällig sind. »Es klang vertraut …«
Ein Schulterzucken. »Du hast es mir letzte Nacht vorgespielt.«
Es ist keine Lüge, nicht ganz. Er hat es tatsächlich für sie gespielt. Nachdem sie es ihm gezeigt hatte.
»Ach ja?«, sagt er und runzelt die Stirn. Schon stellt er den Kaffee beiseite, greift nach Bleistift und Notizblock auf einem Tisch in der Nähe. »Gott – ich muss betrunken gewesen sein.«
Er schüttelt den Kopf, während er das sagt; Toby ist kein Songwriter, der seine Lieder unter Alkoholeinfluss schreibt.
»Erinnerst du dich an mehr davon?«, fragt er und blättert den Notizblock um. Sie beginnt wieder zu spielen, führt ihn durch die Noten. Er weiß es nicht, aber er arbeitet schon seit Wochen an diesem Lied. Sie beide tun das.
Zusammen.
Sie lächelt ein wenig, während sie weiterspielt. Das ist das Gras zwischen den Nesseln. Ein sicherer Ort, an den man den Fuß setzen kann. Sie selbst kann zwar keine Spuren hinterlassen, aber wenn sie es richtig anstellt, kann sie andere dazu bringen, es für sie zu tun. Nichts Konkretes, natürlich, aber wann ist die Inspiration schon konkret?
Toby hat sich jetzt die Gitarre gegriffen, balanciert sie auf einem Knie und spielt die Melodie nach, wobei er vor sich hin murmelt. Das ist gut, das ist anders, das ist etwas. Sie hört auf zu spielen und steht auf.
»Ich sollte gehen.«
Die Melodie zerfällt auf den Saiten, als Toby hochschaut. »Was? Aber ich kenne dich gar nicht.«
»Genau«, sagt sie und geht ins Schlafzimmer, um ihre Sachen zu holen.
»Aber ich würde dich gern kennenlernen«, sagt Toby, legt die Gitarre weg und folgt ihr durchs Apartment, und das ist der Moment, in dem ihr alles unfair vorkommt, der einzige Zeitpunkt, an dem die Welle der Frustration zu brechen droht. Weil sie schon seit Wochen versucht, ihn näher kennenzulernen. Und er sie innerhalb weniger Stunden vergisst. »Mach langsam.«
Sie hasst diesen Teil. Sie hätte nicht bleiben sollen. Aus den Augen, aus dem Sinn, so hätte sie es halten sollen, aber da ist immer die nagende Hoffnung, dass es diesmal anders sein könnte, dass er sich diesmal erinnern wird.
Ich erinnere mich, sagt der Schatten in ihrem Ohr.
Sie schüttelt den Kopf, zwingt die Stimme weg.
»Wozu die Eile?«, fragt Toby. »Ich möchte dir zumindest noch Frühstück machen.«
Aber sie ist zu müde, um das Spiel so schnell schon wieder aufzunehmen, deshalb lügt sie lieber und sagt, sie habe noch zu tun, und lässt sich nicht aufhalten, denn wenn sie das tut, weiß sie, dass sie nicht die Kraft hätte, noch einmal anzufangen, und der Kreis würde sich weiterdrehen, die Affäre am Morgen anfangen und nicht am Abend. Aber am Ende wäre es trotzdem nicht einfacher, und wenn sie schon wieder von vorn anfangen muss, dann will sie lieber die unbekannte Schönheit in der Bar sein als das Nachspiel eines vergessenen One-Night-Stands.
Es wird keinen Unterschied machen, jedenfalls gleich nicht mehr.
»Jess, warte«, sagt Toby und ergreift ihre Hand. Er sucht nach den richtigen Worten und gibt auf, um es gleich noch einmal zu probieren. »Ich hab heute Abend einen Gig, im Alloway. Du kannst gerne hinkommen. Das ist drüben, an der …«
Sie weiß natürlich, wo das ist. Dort sind sie sich zum ersten Mal begegnet, und zum fünften und zum neunten Mal. Und als sie zusagt, ist sein Lächeln strahlend. So wie immer.
»Versprochen?«, fragt er.
»Versprochen.«
»Wir sehen uns«, sagt er, die Worte voller Hoffnung, während sie sich umdreht und durch die Tür geht. Sie schaut zurück und sagt: »Vergiss mich nicht in der Zwischenzeit.«
Eine alte Gewohnheit. Ein Aberglaube. Eine Bitte.
Toby schüttelt den Kopf. »Wie könnte ich?«
Sie lächelt, als sei es nur ein Witz.
Aber während Addie sich zwingt, die Stufen hinunterzugehen, weiß sie, dass es bereits geschieht – sobald er die Tür geschlossen hat, wird sie aus seinem Gedächtnis verschwunden sein.
II
Der März ist solch ein wechselhafter Monat.
Er ist die Naht zwischen Winter und Frühling – auch wenn Naht einen gleichmäßigen Saum suggeriert, und der März mit seinem wilden Schwanken zwischen Januarstürmen und Junigrün ist eher wie eine Reihe holpriger Stiche, ausgeführt von unbeholfener Hand. Man weiß nie, was einen erwartet, bis man vor die Tür tritt.
Estele nannte dies immer die rastlosen Tage, wenn die Götter mit wärmerem Blut sich zu regen beginnen und die kalten sich zur Ruhe begeben. Wenn Träumer am anfälligsten für schlechte Ideen sind und Wanderer sich am leichtesten verirren.
Addie war immer schon für beides empfänglich. Sie ist am zehnten März geboren worden, doch es ist lange her, dass ihr an diesem Tag nach Feiern zumute war.
Dreiundzwanzig Jahre lang hat sie diese Zäsur in der Zeit und ihre Bedeutung – dass sie erwachsen wird, alt wird – gefürchtet. Und dann kam ihr der Geburtstag jahrhundertelang bedeutungslos vor, weit weniger wichtig als die Nacht, in der sie ihre Seele verkaufte.
Dieses Datum war Tod und Wiedergeburt in einem.
Dennoch hat sie heute Geburtstag, und ein Geburtstag verdient ein Geschenk.
Sie bleibt vor einer Boutique stehen, ihr Spiegelbild geisterhaft auf dem Glas.
Im breiten Schaufenster posiert eine Puppe mit vorgesetztem Fuß, den Kopf leicht zur Seite geneigt, als lausche sie einem Lied, das nur sie hören kann. Ihr langer Oberkörper ist in einen Pullover mit breiten Streifen gehüllt, ein Paar ölglatter Leggings verschwinden in kniehohen Stiefeln. Eine Hand ist angehoben, die Finger sind in den Kragen der Jacke eingehakt, die über ihrer Schulter hängt. Während Addie die Puppe betrachtet, ahmt sie unwillkürlich ihre Pose nach, setzt ihren Fuß vor, neigt den Kopf. Und vielleicht liegt es an ihrem Geburtstag oder an der Frühlingsluft, jedenfalls steht ihr der Sinn nach etwas Neuem.
Im Inneren der Boutique riecht es nach unangezündeten Kerzen und ungetragenen Kleidern, und Addie streicht mit den Fingern über Baumwolle und Seide, bevor sie den gestreiften Strickpullover findet, der aus Kaschmir ist. Sie legt ihn sich über einen Arm, zusammen mit den Leggings aus dem Schaufenster. Sie kennt ihre Größen.
Sie haben sich nicht verändert.
»Hallo!« Die fröhliche Verkäuferin ist ein Mädchen Anfang zwanzig, wie Addie selbst, nur dass die eine echt ist und altert und die andere ein Bild ist, eingeschlossen in Bernstein. »Kann ich Ihnen helfen?«
»Ach, schon okay«, sagt sie und nimmt ein Paar Stiefel von einer Auslage. »Ich habe alles, was ich brauche.« Sie folgt dem Mädchen zu den drei Umkleidekabinen mit den Vorhängen im hinteren Bereich des Ladens.
»Rufen Sie einfach, wenn Sie etwas brauchen«, sagt das Mädchen und wendet sich ab, bevor der Vorhang zuschwingt und Addie mit einer gepolsterten Bank und einem deckenhohen Spiegel und sich selbst allein ist.
Sie schüttelt ihre Stiefel ab, zieht ihre Jacke aus und wirft sie auf die Bank. Kleingeld klimpert in der Tasche und etwas fällt heraus. Mit einem dumpfen Klacken kommt es auf dem Boden auf, rollt durch die schmale Umkleidekabine und hält erst an, als es auf die Fußleiste trifft.
Ein Ring.
Ein kleines Rund aus aschgrauem Holz. Ein vertrautes Schmuckstück, einst geliebt, jetzt verhasst.
Einen Moment lang starrt Addie das Ding an. Ihre Finger zucken verräterisch, aber sie greift nicht danach, hebt ihn nicht auf, kehrt dem Ring einfach den Rücken zu und zieht sich weiter aus. Sie streift den Pullover über, zwängt sich in die Leggings, zieht den Reißverschluss der Stiefel hoch. Die Schaufensterpuppe war dünner, größer, aber Addie gefällt der Sitz des Outfits, die Wärme des Kaschmirs, das Gewicht der Leggings, die weiche Umarmung der gefütterten Stiefel.
Sie reißt nach und nach die Preisschilder ab, ohne auf die Nullen zu achten.
Joyeux anniversaire, denkt sie und betrachtet ihr Spiegelbild. Sie neigt den Kopf, als lausche sie einem Lied, das nur sie hören kann. Das Bild einer modernen New Yorkerin, auch wenn sie das Gesicht im Spiegel schon seit Jahrhunderten trägt.
Addie lässt ihre alten Kleider über den Boden der Kabine verstreut liegen. Auch den Ring ignoriert sie. Das Einzige, was sie mitnimmt, ist die abgelegte Jacke.
Sie ist weich und besteht aus schwarzem Leder, das vom langen Tragen wie Seide geworden ist. Heutzutage würde man sie Vintage nennen und ein Vermögen dafür bezahlen. Die Jacke ist das Einzige, was Addie damals nicht in New Orleans zurückgelassen und den Flammen überantwortet hat, obwohl sein Geruch wie Rauch daran haftet. Es ist ihr egal. Sie liebt die Jacke.
Damals war sie neu, aber inzwischen ist sie gut eingetragen und zeigt – anders als Addie selbst – ihr Alter. Es erinnert sie an Dorian Gray, nur dass sich hier die verflossene Zeit nicht auf menschlicher Haut, sondern auf Kuhhaut spiegelt.
Addie tritt aus der kleinen Kabine mit dem Vorhang.
Am anderen Ende der Boutique fährt die Verkäuferin hoch, überrascht von ihrem Anblick. »Passt alles?«, fragt sie, zu höflich, um zuzugeben, dass sie sich nicht erinnert, jemanden zu den Kabinen geführt zu haben. Fünf Sterne für den Kundenservice.
Addie schüttelt bedauernd den Kopf. »An manchen Tagen bleibt einem nur, was man bereits hat«, sagt sie und geht auf die Tür zu.
Wenn die Verkäuferin die Kleider findet, der abgestreifte Schatten eines Mädchens auf dem Boden der Umkleidekabine, wird sie sich nicht mehr erinnern, wem sie gehören, und Addie wird fort sein, aus den Augen, aus dem Sinn, und aus der Erinnerung.
Sie wirft sich die Jacke über die Schulter, hakt einen Finger in den Kragen ein und tritt hinaus in die Sonne.
Villon-sur-Sarthe, Frankreich
Sommer 1698
III
Adeline sitzt auf der Bank neben ihrem Vater.
Ihr Vater, der für sie ein Rätsel ist, ein ernster Riese, der sich nur in seiner Werkstatt wirklich zu Hause fühlt.
Zu ihren Füßen liegen Holzwaren unter einem Laken wie kleine Körper, und die Karrenräder rattern, während Maxime, die kräftige Stute, sie die Straße entlangzieht, in die Ferne.
Ferne, ein Wort, das ihr kleines Herz rasen lässt.
Adeline ist sieben, was genau der Anzahl der Sommersprossen in ihrem Gesicht entspricht. Sie ist klug und klein und flink wie ein Spatz und hat schon seit Monaten darum gebettelt, ihren Vater zum Markt begleiten zu dürfen. Bis ihre Mutter geflucht und nachgegeben, bis ihr Vater endlich Ja gesagt hat. Er ist Holzarbeiter, ihr Vater, und dreimal im Jahr unternimmt er die Fahrt entlang der Sarthe bis nach Le Mans.
Und heute begleitet sie ihn.
Heute verlässt Adeline zum ersten Mal Villon.
Sie schaut zu ihrer Mutter zurück, die mit verschränkten Armen neben der alten Eibe am Ende der Straße steht, und dann biegen sie um eine Ecke, und ihre Mutter ist fort. Das Dorf rollt vorbei, hier die Häuser und dort die Felder, hier die Kirche und dort die Bäume, hier Monsieur Berger, der den Garten umgräbt, und dort Madame Therault, die Wäsche aufhängt, ihre Tochter Isabelle sitzt in der Nähe im Gras, flicht Blumen zu Kronen, die Zunge konzentriert zwischen die Zähne geklemmt.
Als Adeline dem Mädchen von ihrer Reise erzählt hat, zuckte Isabelle nur mit den Schultern und sagte: »Mir gefällt’s hier.«
Ganz als könnte man nicht einen Ort mögen und gleichzeitig einen anderen sehen wollen.
Jetzt schaut sie zu Adeline hoch und winkt dem vorbeifahrenden Karren zu. Sie erreichen den Dorfrand, weiter ist sie bislang nie gekommen, und der Karren fährt durch ein Schlagloch und erzittert, als überwinde auch er eine Schwelle. Adeline hält den Atem an, in der Erwartung, dass sich gleich ein Seil hinter ihr spannt, das sie ans Dorf fesselt.
Aber es gibt keine Fessel, keinen Ruck. Der Karren fährt weiter, und Adeline fühlt sich wild und ein wenig verängstigt, während sie zum schrumpfenden Villon zurückschaut, das bis zum heutigen Tag ihre ganze Welt ausgemacht hat und jetzt nur noch ein Teil davon ist, mit jedem Schritt der Stute kleiner wird, bis ihr das Dorf wie eine der Figurinen ihres Vaters erscheint, so winzig, dass sie in eine schwielige Handfläche passen.
Nach Le Mans ist es eine Tagesreise. Die Fahrt angenehmer gemacht durch den Korb ihrer Mutter, Brot und Käse, um ihren Magen zu füllen, und das unbeschwerte Lachen und die breiten Schultern ihres Vaters, deren Schatten Adeline vor der Sommersonne schützt.
Zu Hause ist er ein stiller Mann, der ganz in seiner Arbeit aufgeht, aber auf Reisen beginnt er, sich zu öffnen, zu entfalten, zu sprechen.
Und wenn er spricht, dann, um ihr Geschichten zu erzählen.
Die Geschichten, die er gesammelt hat, so wie man Holz sammelt.
»Il était une fois«, sagt er dann und gleitet in Geschichten über Paläste und Könige hinein, über Gold und Glamour, über Maskenbälle und prachtvolle Städte. Es war einmal. So fängt die Geschichte an.
Die Geschichten selbst prägen sich ihr nicht ins Gedächtnis ein, aber die Art, wie er sie erzählt; die Worte fühlen sich glatt an wie Flusskiesel, und sie fragt sich, ob er diese Geschichten auch erzählt, wenn er allein ist, ob er einfach weitermacht und auf diese leichte, sanfte Art mit Maxime spricht. Oder mit dem Holz, das er bearbeitet. Oder ob die Geschichten nur für sie sind.
Adeline wünscht sich, sie könne sie niederschreiben.
Später wird ihr Vater ihr die Buchstaben beibringen. Ihre Mutter bekommt einen Anfall, als sie davon erfährt, und beschuldigt ihn, ihr damit eine weitere Möglichkeit zu eröffnen, faul zu sein und die Stunden des Tages zu verschwenden, aber Adeline stiehlt sich trotzdem in seine Werkstatt, und er gestattet ihr, sich hinzusetzen und in dem feinen Staub, der ständig den Boden der Werkstatt zu bedecken scheint, ihren Namen zu schreiben.
Aber heute kann sie nur lauschen.
Die Landschaft rollt an ihnen vorbei, das schaukelnde Porträt einer Welt, die sie schon kennt. Die Felder sind Felder, genau wie ihre eigenen, die Bäume ungefähr auf dieselbe Weise angeordnet, und als sie ein Dorf erreichen, ist es ein wässriges Abbild von Villon, und Adeline fragt sich schon, ob die Welt draußen genauso langweilig ist wie ihre eigene.
Und dann kommen die Mauern von Le Mans in Sicht.
Steinerne Firste in der Ferne, ein vielfach gezacktes Rückgrat entlang der Hügel. Es ist hundertmal größer als Villon – zumindest in ihrer Erinnerung –, und Adeline hält den Atem an, als sie durch das Tor in die mauerumwehrte Stadt fahren.
Dahinter ein Labyrinth aus überfüllten Straßen. Ihr Vater lenkt den Karren zwischen Häusern hindurch, die dichtgedrängt wie Steine nebeneinander stehen, bis die schmale Straße sich zu einem Platz hin öffnet.
In Villon gibt es natürlich auch einen Platz, aber der ist kaum größer als ihr Hof. Das hier ist das Reich eines Riesen, der Boden ist unter so vielen Füßen und Karren und Ständen kaum zu erkennen. Und während ihr Vater Maxime anhalten lässt, stellt sich Adeline auf die Bank und bewundert den Marktplatz, den berauschenden Duft von Brot und Zucker in der Luft, und Menschen über Menschen, wohin man auch schaut. Noch nie hat sie so viele auf einmal gesehen, geschweige denn welche, die sie nicht kennt. Sie sind ein Meer aus Fremden, unvertraute Gesichter in unvertrauten Kleidern, mit unvertrauten Stimmen, die unvertraute Worte rufen. Sie fühlt sich, als seien die Türen ihrer Welt weit aufgerissen worden, als hätte ein Haus, das sie zu kennen glaubte, mit einem Mal viele neue Zimmer bekommen.
Ihr Vater lehnt am Karren und redet mit den Vorbeigehenden, derweil lässt er seine Hand, in der ein kleines Messer liegt, über einen Holzklotz fahren. Er schabt die Oberfläche mit der steten Leichtigkeit von jemandem ab, der einen Apfel schält, zwischen seinen Fingern fallen Girlanden hinab. Adeline hat ihm schon immer gern bei der Arbeit zugesehen, beobachtet, wie die Figuren Gestalt annehmen, als seien sie von Anfang an da, nur verborgen, wie der Kern im Innern eines Pfirsichs.
Das Werk ihres Vaters ist wunderschön, das Holz glatt, wo seine Hände rau sind, zart, wo er groß ist.
Und inmitten der Schüsseln und Tassen, zwischen seinen Werkzeugen, liegen Spielzeuge zum Verkauf aus und Holzfigürchen, so klein wie Brötchen – ein Pferd, ein Junge, ein Haus, ein Vogel.
Adeline ist inmitten solcher Kinkerlitzchen aufgewachsen, aber ihr Lieblingsstück ist weder Tier noch Mensch.
Es ist ein Ring.
Sie trägt ihn an einem Lederband um den Hals, ein zartes Schmuckstück, das Holz aschgrau und glatt wie polierter Stein. Er hat ihn bei ihrer Geburt geschnitzt, für das Mädchen, das sie einmal sein würde, und Adeline trägt ihn wie einen Talisman, ein Amulett, einen Schlüssel. Hin und wieder geht ihre Hand dorthin, ihr Daumen fährt über die Oberfläche wie der ihrer Mutter über einen Rosenkranz.
Jetzt hält sie sich daran fest, ein Anker im Sturm, während sie hinten auf der Ladefläche steht und alles in sich aufnimmt. So ist sie fast groß genug, um die Gebäude hinter dem Markt zu sehen. Sie stellt sich auf die Zehenspitzen und fragt sich, wie weit sie wohl reichen, bis ein Pferd in der Nähe ihren Karren anstößt und sie beinahe hinunterfällt. Die Hand ihres Vaters schließt sich um ihren Arm und zieht sie zurück in Sicherheit.
Bei Tagesende sind die Holzwaren weg, und Adelines Vater gibt ihr einen Kupfer-Sol, damit sie sich kaufen kann, was immer sie möchte. Sie geht von Stand zu Stand, beäugt die Gebäckstückchen und die Kuchen, die Hüte und die Kleider und die Puppen, aber am Ende entscheidet sie sich für ein Tagebuch aus Pergament, mit Wachsfaden gebunden. Es ist das leere Papier, das sie reizt, die Vorstellung, dass sie die Fläche füllen kann, mit was immer sie will.
Die Bleistifte dazu konnte sie sich nicht leisten, aber ihr Vater kauft mit einer zweiten Münze ein Bündel kleiner schwarzer Stangen, und erklärt ihr, dass dies Holzkohle sei, zeigt ihr, wie man die dunkle Kreide auf das Papier drückt und die Linie verwischt, um harte Kanten in Schatten zu verwandeln. Mit ein paar schnellen Strichen zeichnet er einen Vogel in die Ecke der Seite, und sie verbringt die nächste Stunde damit, die Linien nachzuahmen, die noch viel interessanter sind als die Buchstaben, die er darunter geschrieben hat.
Als der Tag in die Abenddämmerung übergeht, packt ihr Vater den Karren zusammen.
Sie bleiben über Nacht in einem Gasthof vor Ort, und zum ersten Mal in ihrem Leben schläft Adeline in einem fremden Bett und erwacht zu fremden Geräuschen und Gerüchen, und für einen Moment, so kurz wie ein Gähnen, weiß sie nicht, wo sie ist, und ihr Herz schlägt schneller – erst vor Furcht und dann wegen etwas anderem. Etwas, das sie noch nicht benennen kann.
Und als sie nach Villon zurückkehren, ist sie bereits nicht mehr dieselbe. Ein Zimmer mit weit aufgerissenen Fenstern, begierig, die frische Luft hereinzulassen, das Sonnenlicht, den Frühling.
Villon-sur-Sarthe, Frankreich
Herbst 1703
IV
Es ist ein katholischer Ort, Villon. Jedenfalls nach außen hin.
In der Mitte der Ortschaft gibt es eine Kirche, ein ernstes, steinernes Ding, wo alle hingehen, um ihre Seelen zu retten. Adelines Mutter und Vater knien dort zweimal die Woche, bekreuzigen sich und sprechen ihre Gebete und reden von Gott.
Adeline ist jetzt zwölf, also tut sie es auch. Aber sie betet so beiläufig, wie ihr Vater Baguettebrote aufrecht hinstellt, wie ihre Mutter ihren Daumen anleckt, um verstreute Salzkörnchen aufzusammeln.
Es ist eine Sache der Gewohnheit, eher mechanisch als dem Glauben geschuldet.
Die Kirche im Städtchen ist nicht neu und Gott ebenso wenig, aber Adeline denkt inzwischen so über ihn, dank Estele, die sagt, die größte Gefahr der Veränderung sei es, dem Neuen zu gestatten, das Alte zu ersetzen.
Estele, die zur Dorfgemeinde gehört und dann auch wieder nicht.
Estele, die wie ein Baum im Herzen des Dorfes am Fluss herangewachsen ist und sicherlich niemals jung war, die dem Boden selbst entsprang, mit knorrigen Händen und hölzerner Haut und Wurzeln tief genug, um ihren eigenen verborgenen Brunnen anzuzapfen.
Estele, die glaubt, der neue Gott sei ein filigranes Ding. Sie denkt, er gehört zu Städten und Königen und sitzt auf einem goldenen Kissen über Paris und hat keine Zeit für Bauern, keinen Platz inmitten von Wald und Stein und Flusswasser.
Adelines Vater hält Estele für verrückt.
Ihre Mutter sagt, die alte Frau sei auf dem besten Weg in die Hölle, und als Adeline einmal Estele davon erzählte, lachte sie ihr Lachen, das wie trockene Blätter raschelt, und sagte, einen solchen Ort gäbe es nicht, nur die kühle, dunkle Erde und das Versprechen auf Schlaf.
»Und was ist mit dem Himmel?«, fragte Adeline.
»Der Himmel ist ein schöner Fleck im Schatten, ein breiter Baum über meinen Knochen.«
Mit zwölf fragt Adeline sich, zu welchem Gott sie jetzt beten soll, damit ihr Vater seine Meinung ändert. Er hat seinen Karren mit Waren für die Fahrt nach Le Mans beladen, hat Maxime angeschirrt, aber zum ersten Mal seit sechs Jahren fährt sie nicht mit ihm.
Er hat versprochen, ihr einen frischen Pergamentblock und neue Zeichenwerkzeuge mitzubringen. Aber sie wissen beide, dass sie lieber auf Geschenke verzichten und ihn begleiten würde, lieber die Welt draußen sehen will, als einen neuen Zeichenblock zu haben. Ihr gehen die Motive aus, sie hat sich längst jede müde Linie des Dorfes eingeprägt und all die vertrauten Gesichter darin.
Aber dieses Jahr hat ihre Mutter entschieden, dass es nicht richtig wäre, wenn sie zum Markt fährt, nicht passend, obwohl Adeline weiß, dass sie immer noch auf die Holzbank neben ihren Vater passt.
Ihre Mutter wünscht sich, sie wäre mehr wie Isabelle Therault, süß und freundlich und überhaupt nicht neugierig, zufrieden damit, den Blick auf ihre Strickarbeit zu senken, anstatt zu den Wolken hochzuschauen, anstatt sich zu fragen, was wohl um die nächste Ecke liegt oder hinter den Hügeln.
Aber Adeline weiß nicht, wie sie wie Isabelle sein kann.
Sie will nicht wie Isabelle sein.
Sie will nur nach Le Mans fahren und sich dort die Menschen anschauen und die Kunst, und das Essen kosten und Dinge entdecken, von denen sie noch nie gehört hat.
»Bitte«, sagt sie, als ihr Vater auf den Karren steigt. Sie hätte sich zwischen den Holzarbeiten verstecken sollen, sicher verborgen unter der Plane. Aber jetzt ist es zu spät, und als Adeline nach dem Rad greift, packt ihre Mutter sie am Handgelenk und zieht sie weg.
»Genug«, sagt sie.
Ihr Vater schaut zu ihnen hin und gleich wieder weg. Der Karren fährt los, und als Adeline versucht, sich loszureißen und ihm nachzurennen, zuckt die Hand ihrer Mutter wieder vor, und diesmal findet sie ihre Wange.
Tränen schießen ihr in die Augen, ein sichtbares Erröten, bevor der Bluterguss entsteht, und als die Stimme ihrer Mutter erklingt, ist es wie eine zweite Ohrfeige.
»Du bist kein Kind mehr.«
Und Adeline versteht – auch wenn sie es zugleich nicht versteht –, sie hat das Gefühl, einfach nur dafür bestraft zu werden, dass sie erwachsen wird. Die Wut weckt in ihr den Wunsch wegzulaufen. Die Näharbeit ihrer Mutter in den Ofen zu werfen und sämtliche unfertigen Skulpturen in der Werkstatt ihres Vaters zu zerbrechen.
Stattdessen schaut sie zu, wie der Karren um die Kurve biegt und zwischen den Bäumen verschwindet, eine Hand umklammert den Ring ihres Vaters. Adeline wartet, bis ihre Mutter sie loslässt und sie zu ihren Hausarbeiten zurückschickt.
Und dann geht sie zu Estele.
Estele, die noch die alten Götter verehrt.
Adeline muss fünf oder sechs gewesen sein, als sie zum ersten Mal beobachtete, wie Estele ihre Steingut-Tasse in den Fluss fallen ließ. Es war ein hübsches Ding, mit einem Muster, das wie eine Spitzenborte in die Seiten geprägt war, und die alte Frau ließ sie einfach fallen und lauschte auf das Platschen. Ihre Augen waren geschlossen, und die Lippen bewegten sich, und als Adeline der Alten – sie war damals schon alt, ist immer schon alt gewesen – auf dem Nachhauseweg auflauerte, sagte Estele, sie hätte zu den Göttern gebetet.
»Wozu?«
»Maries Kind kommt nicht so, wie es sollte«, sagte sie. »Ich habe die Flussgötter gebeten, alles glatter fließen zu lassen. Sie sind gut darin.«
»Aber warum hast du ihnen deine Tasse gegeben?«
»Weil die Götter gierig sind, Addie.«
Addie. Ein Spitzname, den ihre Mutter als zu jungenhaft verspottet. Ein Name, den ihr Vater bevorzugt, aber nur wenn sie allein sind. Ein Name, der wie eine Glocke in ihren Knochen widerhallt. Ein Name, der viel besser zu ihr passt als Adeline.
Jetzt findet sie Estele in ihrem Garten, eingehüllt von den wilden Ranken eines Kürbisses, dem dornigen Fortsatz eines Brombeergestrüpps, niedergebeugt wie ein herunterhängender Ast.
»Addie.« Die Alte sagt ihren Namen, ohne aufzublicken.
Es ist Herbst, und der Boden ist übersät mit den steinharten Früchten, die nicht so gereift sind, wie sie sollten. Addie stupst sie mit der Fußspitze an. »Wie sprichst du mit ihnen?«, fragt sie. »Den alten Göttern? Nennst du sie beim Namen?«
Estele richtet sich auf, Gelenke knacken wie trockene Stöcke. Wenn die Frage sie überrascht, so lässt sie es sich nicht anmerken. »Sie haben keine Namen.«
»Gibt es einen Zauberspruch?«
Estele schaut sie bedeutungsvoll an. »Zaubersprüche sind für Hexen, und Hexen werden zu oft verbrannt.«
»Wie betest du dann?«
»Mit Geschenken und Lobpreisungen, und selbst dann sind die alten Götter launisch. Sie antworten nicht immer.«
»Was macht man dann?«
»Dann macht man weiter.«
Sie kaut auf der Innenseite ihrer Wange. »Wie viele Götter gibt es, Estele?«
»So viele Götter, wie du Fragen hast«, antwortet die Alte, aber in ihrer Stimme liegt kein Spott, und Addie weiß, dass sie sie nur ausreden lassen muss, nur den Atem anhalten muss, bis sie das verräterische Anzeichen dafür sieht, dass Estele nachgibt. Es ist so, als warte man, nachdem man geklopft hat, an der Tür eines Nachbarn, von dem man weiß, dass er zu Hause ist. Sie hört die Schritte, das leise Kratzen des Schlosses und weiß, dass es nachgeben wird.
Estele seufzt unverhohlen.
»Die alten Götter sind überall«, sagt sie. »Sie schwimmen im Fluss und wachsen auf dem Feld und singen im Wald. Sie sind im Sonnenlicht auf dem Weizen und unter den Schößlingen im Frühling und in den Ranken, die an der Seite der steinernen Kirche hochwachsen. Sie sammeln sich an den Rändern des Tages, beim Morgengrauen und in der Abenddämmerung.«
Adelines Augen verengen sich. »Wirst du es mir beibringen? Wie man sie ruft?«
Die Alte seufzt, sie weiß, Adeline LaRue ist nicht nur schlau, sondern auch dickköpfig. Sie watet durch den Garten zum Haus zurück, und das Mädchen folgt ihr, in der Befürchtung, Estele könne das Gespräch beenden, wenn sie die Haustür erreicht, bevor sie geantwortet hat. Aber Estele schaut zu ihr zurück, die Augen in ihrem faltigen Gesicht leuchten wach.
»Es gibt Regeln.«
Adeline hasst Regeln, aber sie weiß, dass sie manchmal notwendig sind.
»Wie zum Beispiel?«
»Du musst dich demütig vor ihnen verneigen. Du musst ihnen ein Geschenk bringen. Etwas, das einen Wert für dich hat. Und du musst achtgeben, worum du bittest.«
Adeline denkt nach. »Ist das alles?«
Esteles Gesicht verfinstert sich. »Die alten Götter mögen groß sein, aber sie sind weder freundlich noch barmherzig, sondern launisch und unbeständig wie Mondlicht auf Wasser oder wie Schatten in einem Sturm. Wenn du sie anrufen willst, gib acht: Überlege genau, worum du bittest, und sei bereit, den Preis zu zahlen.« Sie beugt sich über Adeline und taucht sie in Schatten. »Und ganz gleich, wie verzweifelt du bist, bete niemals zu den Göttern, die nach Einbruch der Nacht antworten.«
Zwei Tage später, als Adelines Vater zurückkehrt, bringt er ihr einen frischen Pergamentblock und ein Bündel schwarzer Bleistifte, die mit Schnur zusammengebunden sind. Als Allererstes sucht sie sich den besten davon aus und vergräbt ihn hinter ihrem Garten in der Erde und betet darum, dass sie ihren Vater bei der nächsten Fahrt begleiten darf.
Aber wenn die Götter sie hören, dann antworten sie nicht.
Sie fährt nie wieder zum Markt.
Villon-sur-Sarthe, Frankreich
Frühling 1707
V
Ein Blinzeln, und die Jahre ziehen dahin wie Blätter im Wind.
Adeline ist jetzt sechzehn, und alle sprechen von ihr wie von einer Sommerblume, die man pflückt und in eine Vase stellt, deren einziger Zweck es ist, zu blühen und dann zu verrotten. Wie Isabelle, die von einer Familie statt von Freiheit träumt.
Adeline hat beschlossen, lieber ein Baum zu sein, so wie Estele. Wenn sie schon Wurzeln schlagen muss, will sie wild wuchern, statt sich zurechtstutzen zu lassen, will allein stehen und unter freiem Himmel wachsen. Und nicht als Feuerholz enden, gefällt und zerhackt, in jemandes Kamin.
Sie hebt sich die Wäsche auf die Hüfte und steigt die Anhöhe hoch und dann den verwilderten Abhang zum Fluss hinunter. Am Ufer angekommen, dreht sie den Korb um, schüttet die schmutzige Wäsche aufs Gras, und dort, wie ein Geheimnis zwischen Röcken und Schürzen und Unterwäsche verborgen, ist ihr Skizzenbuch. Nicht das erste – sie sammelt sie Jahr um Jahr, sorgsam darauf bedacht, jeden Zentimeter Platz zu füllen und jede leere Seite bestmöglich auszunutzen.
Aber sie sind wie brennende Wachskerzen in einer mondlosen Nacht, sie gehen immer zu schnell aus.
Dass sie ständig Teile davon weggibt, macht es auch nicht besser.
Sie schüttelt ihre Schuhe ab und lässt sich, die Röcke gerafft, auf den Abhang sinken. Mit den Fingern fährt sie durch Unkraut und Gras, bis sie die zerfranste Papierkante gefunden hat, eine ihrer liebsten Zeichnungen, zu einem Viereck gefaltet und letzte Woche, kurz nach Tagesanbruch, in den Uferboden gesteckt. Ein Unterpfand, eingegraben wie ein Samen oder ein Versprechen. Eine Opfergabe.
Adeline betet noch immer zum neuen Gott, wenn es sein muss, aber wenn ihre Eltern nicht hinschauen, betet sie außerdem zu den alten. Sie kann beides: den einen wie einen Kirschkern in der Backe behalten, während sie dem anderen etwas zuflüstert.
Bislang hat noch keiner von ihnen geantwortet.
Und trotzdem ist Adeline sich sicher, dass sie zuhören.
Als George Caron sie letztes Frühjahr auf eine bestimmte Weise anzuschauen begann, betete sie darum, er möge seinen Blick abwenden, und er fing an, Isabelle wahrzunehmen. Isabelle ist seitdem seine Frau geworden, und ist jetzt reif mit ihrem ersten Kind und erschöpft von all der Mühsal, die damit einhergeht.
Als Arnaud Tulle letzten Herbst seine Absichten erklärte, betete Adeline darum, er möge ein anderes Mädchen finden. Das geschah zwar nicht, aber im Winter wurde er krank und starb, und Adeline fühlte sich furchtbar wegen ihrer Erleichterung, wenngleich sie den Bach weiter mit kleinen Gaben fütterte.
Sie hat gebetet, und jemand muss sie erhört haben, denn sie ist immer noch frei. Frei von Brautwerbung, frei von einer Hochzeit, frei von allem, außer von Villon. In Ruhe gelassen, um zu wachsen.
Und zu träumen.
Adeline lehnt sich auf dem Abhang zurück und balanciert den Skizzenblock auf den Knien. Sie holt das Säckchen mit der Kordel aus der Tasche, ein paar Stückchen Holzkohle und einige abgenutzte Bleistifte klappern darin wie Münzen am Markttag.
Früher hat sie ein Stück Stoff um die Enden gebunden, damit ihre Finger sauber bleiben, bis ihr Vater schmale Holzhüllen angefertigt hat, in die sie die schwarzen Stangen stecken kann, und ihr zeigte, wie sie das kleine Messer halten muss, um die Ränder anzuspitzen. Und jetzt sind die Bilder schärfer, die Ränder konturierter, die Details feiner. Die Bilder blühen wie Flecken auf dem Papier auf, Landschaften von Villon, und von allen, die darin leben – die Linien des Haars ihrer Mutter, die Augen ihres Vaters und Esteles Hände, und dann dort, an den Kanten und Rändern jeder Seite …
Adelines Geheimnis.
Ihr Fremder.
Jeden kleinen ungenutzten Flecken füllt sie mit ihm, ein Gesicht, so oft schon gezeichnet, dass die Bewegungen mühelos sind, die Linien sich ganz von selbst entfalten. Sie kann ihn aus der Erinnerung heraus zeichnen, obwohl sie sich nie begegnet sind.
Schließlich ist er nur ein Produkt ihrer Fantasie. Ein Gefährte, erst aus Langeweile und dann aus Sehnsucht geschaffen.
Ein Traum, der ihr Gesellschaft leistet.
Sie erinnert sich nicht, wann es angefangen hat, bloß dass sie sich eines Tages die Männer im Dorf angeschaut hat und sie in vielerlei Hinsicht ungenügend fand.
Arnauds Augen waren hübsch, aber er hatte kein Kinn.
Jacques war groß, aber sterbenslangweilig.
George war stark, aber seine Hände waren rau und seine Launen noch rauer.
Also stibitzte sie alles, was ihr gefiel, und setzte sich daraus jemand Neues zusammen.
Einen Fremden.
Es begann als Spiel – aber je öfter Adeline ihn zeichnet, desto stärker werden die Linien, desto sicherer der Schwung der Holzkohle.
Schwarze Locken. Blasse Augen. Kräftiges Kinn. Runde Schultern, und ein Mund wie Amors Bogen. Ein Mann, dem sie nie begegnen wird, ein Leben, das sie nie kennenlernen wird, eine Welt, von der sie nur träumen kann.
Wenn sie ruhelos ist, kehrt sie zu den Zeichnungen zurück und fährt die inzwischen vertrauten Linien nach. Und wenn sie nicht schlafen kann, denkt sie an ihn. Nicht an die Wölbung seiner Wange oder den Grünton, den sie sich für seine Augen ausgedacht hat, sondern an seine Stimme, seine Berührung. Sie liegt wach und sieht ihn neben sich, seine langen Finger folgen unsichtbaren Mustern auf ihrer Haut. Und dabei erzählt er ihr Geschichten.
Nicht solche, wie ihr Vater sie erzählt hat, von Rittern und Königreichen, Prinzessinnen und Dieben. Keine Märchen und Warnungen davor, Grenzen zu übertreten, sondern Geschichten, die ihr wie Wahrheiten vorkommen, Eindrücke von unterwegs, von funkelnden Städten, von der Welt jenseits von Villon. Und obwohl die Worte, die sie ihm in den Mund legt, sicherlich voller Übertreibungen und Lügen sind, lässt die Stimme ihres ausgedachten Fremden sie so wunderbar, so wirklich erscheinen.
Wenn du das nur sehen könntest, sagt er.
Ich würde alles dafür geben, antwortet sie.
Eines Tages, verspricht er ihr. Eines Tages zeige ich es dir. Du wirst es alles sehen.
Die Worte tun weh, denn aus dem Spiel wird Verlangen, echtes, gefährliches Verlangen. Und deshalb lenkt sie selbst in ihrer Fantasie die Unterhaltung zurück auf sicherere Pfade.
Erzähl mir von Tigern, sagt Adeline; von diesen riesigen Katzen hat sie über Estele erfahren, die wiederum über den Maurer davon weiß, der einmal Teil einer Reisegesellschaft war, wo eine Frau behauptet hatte, sie hätte einen gesehen.
Ihr Fremder lächelt und gestikuliert mit den langgliedrigen Fingern und erzählt ihr von ihrem seidigen Fell, ihren Zähnen, ihrem wütenden Brüllen.
Auf dem Abhang, die Wäsche vergessen neben sich, dreht Adeline gedankenverloren mit einer Hand den Ring, während sie mit der anderen zeichnet, seine Augen skizziert, seinen Mund, die Kontur seiner nackten Schultern. Mit jeder Linie haucht sie ihm Leben ein. Und lockt mit jedem Strich eine neue Geschichte aus ihm hervor.
Erzähl mir vom Tanzen in Paris.
Erzähl mir vom Segeln auf dem Meer.
Erzähl mir alles.
Darin lag keine Gefahr, keine Schande, nicht, als sie noch jung war. Alle Mädchen neigen zum Träumen. Das wächst sich aus, sagen ihre Eltern – aber stattdessen hat Adeline das Gefühl, immer mehr hineinzuwachsen, sich immer fester an die hartnäckige Hoffnung zu klammern, es könne noch mehr geben.
Eigentlich sollte die Welt größer werden. Stattdessen schrumpft sie für Adeline, zieht sich wie Ketten um ihre Glieder fest, derweil sich die flachen Linien ihres Körpers immer stärker dagegen wölben, und plötzlich ist die Holzkohle unter ihren Nägeln unschicklich, und genauso die Vorstellung, dass sie das Alleinsein Arnauds oder Georges Gesellschaft vorzieht, oder der eines anderen Mannes, der Interesse an ihr hat.
Sie hadert mit allem, sie gehört nicht dazu, eine Beleidigung für ihr Geschlecht, ein dickköpfiges Kind in Gestalt einer Frau, ihr Kopf geneigt und die Arme fest um ihren Zeichenblock geschlungen, als sei er eine Tür.
Und wenn sie hochschaut, geht ihr Blick stets zum Dorfrand.
»Eine Träumerin«, spottet ihre Mutter.
»Eine Träumerin«, klagt ihr Vater.
»Eine Träumerin«, warnt Estele.
Aber es scheint ihr dennoch kein schlechtes Wort zu sein.
Bis Adeline aufwacht.
New York City
10. März 2014
VI
Es gibt einen besonderen Rhythmus, wenn man sich allein durch die Welt bewegt.
Man entdeckt, dass man ohne bestimmte Notwendigkeiten und kleine Freuden einfach nicht auskommt. Damit sind nicht Essen oder Unterkunft gemeint – für Addie sind sie bloßer Luxus –, sondern das, was einen bei Verstand hält. Was einem Freude bringt. Was das Leben erträglich macht.
Addie denkt an ihren Vater und seine Schnitzereien, wie er die Rinde abschälte, das Holz darunter weghobelte, um die Formen zu finden, die ihm innewohnten. Michelangelo nannte es den Engel im Marmor – was sie als Kind allerdings nicht wusste. Für ihren Vater war es das Geheimnis im Holz. Er wusste, wie er ein Ding Span um Span, Stück um Stück, reduzieren musste, bis er seine Essenz gefunden hatte; wusste auch, wenn er zu weit gegangen war. Ein Streich zu viel, und das Holz in seinen Händen wurde zerbrechlich statt zart.
Dreihundert Jahre lang hatte Addie Zeit, die Kunst ihres Vaters zu üben, sich selbst auf ein paar grundlegende Wahrheiten hinunterzuschnitzen, herauszufinden, worauf sie auf keinen Fall verzichten kann.
Und das ist es, was sie für sich entschieden hat: Sie kommt ohne Essen aus (sie magert nicht ab). Sie kommt ohne Wärme aus (die Kälte bringt sie nicht um). Aber ein Leben ohne Kunst, ohne Wunder, ohne schöne Dinge – das würde sie wahnsinnig machen. Sie ist schon einmal wahnsinnig geworden.
Was sie braucht, sind Geschichten.
Geschichten sind eine Form der Selbstbewahrung. Um in Erinnerung zu bleiben. Oder sich selbst zu vergessen.
Geschichten besitzen viele Gestalten: in Holzkohle, und in Liedern, in Gemälden, Gedichten, Filmen. Und Büchern.
Bücher sind, wie sie erfahren hat, eine Möglichkeit, tausend Leben zu führen – oder in einem sehr langen Leben Kraft zu finden.
Nach zwei Häuserblöcken in der Flatbush sieht sie den vertrauten grünen Klapptisch auf dem Bürgersteig, voll mit Taschenbüchern, und dahinter Fred, zusammengekauert auf seinem klapprigen Stuhl, die rote Nase in M wie Missgunst gesteckt. Der alte Mann hat ihr einmal erklärt, als er noch bei K wie Killer war, dass er vor seinem Tod unbedingt die komplette Alphabet-Serie von Grafton gelesen haben will. Sie hofft, dass er es schafft. Er hat einen hartnäckigen Husten, und das Herumsitzen in der Kälte macht es nicht besser, aber er ist da, wann immer Addie vorbeikommt.
Fred lächelt nicht und macht keinen Smalltalk. Was Addie über ihn weiß, hat sie ihm in den letzten zwei Jahren Wort für Wort aus der Nase gezogen, langsam und stockend. Sie weiß, dass er Witwer ist und dass er in dem Haus wohnt, vor dem er steht, dass die Bücher seiner Frau Candace gehörten und dass er nach ihrem Tod all ihre Bücher zusammenpackte und nach unten brachte, um sie zu verkaufen. Als würde er sie damit Stück für Stück loslassen. Seine Trauer verkaufen. Addie weiß, dass er hier unten sitzt, weil er Angst hat, in seinem Apartment zu sterben und nicht gefunden zu werden – von niemandem vermisst.
»Wenn ich hier umkippe«, sagt er, »kriegt es zumindest jemand mit.«
Er ist ein barscher alter Mann, aber Addie mag ihn. Sieht die Schwermut in seiner Wut, die Zurückhaltung der Trauer.
Addie hat den Verdacht, dass er eigentlich gar nicht will, dass die Bücher sich verkaufen.
Er gibt ihnen keine Preisschilder, hat kaum welche davon gelesen, und manchmal ist seine Laune so mies, sein Tonfall so kalt, dass er die Kunden verjagt. Sie kommen und kaufen trotzdem, und jedes Mal, wenn die Auswahl dünner zu werden scheint, taucht ein neuer Karton auf. Der Inhalt wird ausgepackt, um die Lücken zu füllen, und in den letzten paar Wochen sind Addie wieder Neuerscheinungen unter den alten Titeln aufgefallen, frische Cover und ungebrochene Rücken zwischen den ramponierten Taschenbüchern. Sie fragt sich, ob er sie extra kauft oder ob andere Leute angefangen haben, ihm Exemplare für seine merkwürdige Sammlung zu spenden.
Jetzt wird Addie langsamer, ihre Finger tanzen über die Buchrücken.
Die Auswahl ist stets ein Konzert aus disharmonischen Klängen. Thriller, Biographien, Liebesromane, hauptsächlich zerlesene Taschenbücher, unterbrochen von ein paar glänzenden Hardcovern. Hundertmal ist sie schon stehen geblieben, um sie zu betrachten, aber heute lässt sie einfach das Buch am Ende des Tisches in ihre Hand kippen, die Geste leicht und schnell wie die eines Zauberers. Ein Taschenspielertrick. Lange geübt und längst perfektioniert. Addie klemmt sich das Buch unter den Arm und geht weiter.
Der alte Mann schaut nicht einmal auf.
New York City
10. März 2014
VII
Die Marktstände kauern wie eine Gruppe alter Weiber am Rand des Parks.
Vom Winter lange Zeit ausgedünnt, nimmt die Zahl der weißen Planen endlich wieder zu, Farbtupfer sprenkeln den Platz, wo neue Waren zwischen dem Wurzelgemüse, dem Fleisch und dem Brot aufgetaucht sind.
Addie schlängelt sich zwischen den Leuten hindurch, hält auf das kleine weiße Zelt zu, das sich an das vordere Tor bei der Prospect schmiegt. Rise and Shine ist ein Kaffee-und-Kuchen-Stand, der von zwei Schwestern geführt wird, die Addie an Estele erinnern, wenn sie freundlicher, weicher gewesen wäre und ein anderes Leben zu einer anderen Zeit geführt hätte.
Die Schwestern sind das ganze Jahr über hier, ob es schneit oder die Sonne scheint, eine kleine Konstante in einer sich ständig wandelnden Stadt.
»Hallo, Liebes«, sagt Mel, mit den breiten Schultern und wilden Locken und der Freundlichkeit, die Fremden das Gefühl gibt, zur Familie zu gehören. Addie gefällt das, die ungezwungene Wärme, sie will sich am liebsten darin einkuscheln wie in einen oft getragenen Pullover.
»Was können wir dir bringen?«, fragt Maggie, älter, dünner, mit Lachfältchen um die Augen.
Addie bestellt einen großen Kaffee und zwei Muffins, eins mit Blaubeeren und das andere mit Schokosplittern, und reicht dann einen zerknüllten Zehner über die Theke, den sie auf Tobys Wohnzimmertisch gefunden hat. Natürlich könnte sie auf dem Markt auch stehlen, aber sie mag diesen kleinen Stand und die beiden Frauen, die ihn betreiben.
»Hast du zehn Cent?«, fragt Maggie.
Addie kramt das Kleingeld aus der Tasche und entdeckt ein paar Quarter-Münzen, ein Fünf-Cent-Stück – und da ist er wieder, warm inmitten des kalten Metalls. Ihre Finger streifen den Holzring, und bei dem Gefühl beißt sie die Zähne zusammen. Wie ein Gedanke, der an einem nagt, den man nicht abschütteln kann. Während sie die Münzen durchwühlt, gibt Addie acht, den Holzring nicht noch einmal zu berühren, widersteht dem Drang, ihn ins Unkraut zu werfen, weiß, dass es nichts nützen würde, wenn sie es täte. Er findet stets wieder seinen Weg zu ihr zurück.
Der Schatten flüstert in ihr Ohr, die Arme wie einen Schal um ihren Hals gewickelt.
Ich bin immer bei dir.
Addie nimmt eine Zehn-Cent-Münze und steckt den Rest wieder ein.
Maggie reicht ihr vier Dollar zurück.
»Woher kommst du, Herzchen?«, fragt Mel, der die kaum merkliche Kante eines Akzents an den Rändern von Addies Stimme aufgefallen ist; inzwischen besteht er nur noch aus einem schwach gesprochenen s und einem etwas weicheren t. Es ist so lange her, aber anscheinend kann sie ihn immer noch nicht loslassen.
»Von hier und da«, sagt sie, »aber geboren wurde ich in Frankreich.«
»Oh, là, là«, sagt Mel in ihrem flachen Brooklyner Akzent.
»Bitte schön, Sonnenschein«, sagt Maggie und reicht ihr eine Tüte mit dem Gebäck und einen hohen Becher. Addie schließt die Finger um die Pappe, genießt die Wärme an ihren kalten Handflächen. Der Kaffee ist stark und dunkel, und als sie einen Schluck davon nimmt, spürt sie die Wärme bis tief im Innern, und sie ist wieder zurück in Paris, in Istanbul, in Neapel.
Ein Schluck Erinnerungen.
Sie geht auf das Parktor zu.
»Au revoir!«, ruft Mel und landet dabei hart auf jedem Buchstaben, und Addie lächelt in den Dampf.
Die Luft im Park ist frisch. Die Sonne gibt sich kämpferisch, aber der Schatten gehört noch dem Winter, deshalb folgt Addie dem Licht, lässt sich auf einem grasbewachsenen Abhang unter dem wolkenlosen Himmel nieder.
Sie setzt das Blaubeermuffin auf der Papiertüte ab und nippt an ihrem Kaffee, betrachtet das Buch, das sie sich von Freds Tisch geborgt hat. Sie hat sich nicht die Mühe gemacht, genauer hinzuschauen, als sie es nahm, aber jetzt ist sie beim Anblick des Taschenbuchs mit dem weichen, abgegriffenen Cover und dem deutschen Titel etwas enttäuscht.
Kinder- und Hausmärchen, steht da, von den Brüdern Grimm.
Ihr Deutsch ist eingerostet, irgendwo in einer hinteren Ecke ihres Kopfes verborgen, die sie seit dem Krieg nicht mehr oft besucht hat. Jetzt staubt sie sie ab, in dem Wissen, dass sie unter der Schmutzschicht intakt und unberührt ist. Die Gabe des Gedächtnisses. Sie blättert durch die brüchigen, alten Seiten, ihr Blick stolpert über die Wörter.
Es war einmal – früher hat sie solche Geschichten geliebt.
Als sie noch ein Kind war und die Welt klein, und sie von offenen Türen träumte.
Aber inzwischen weiß Addie Bescheid, weiß, dass die Märchen voller dummer Menschen sind, die dumme Dinge tun, Warngeschichten von Göttern und Monstern und gierigen Sterblichen, die zu viel wollen und dann nicht begreifen, was sie verloren haben. Bis der Preis bezahlt wurde und es zu spät ist, ihn zurückzufordern.
Eine Stimme steigt wie Rauch in ihrer Brust auf.
Bete niemals zu den Göttern, die nach Einbruch der Nacht antworten.
Addie wirft das Buch beiseite und lässt sich ins Gras zurücksinken, schließt die Augen, während sie versucht, die Sonne zu genießen.
Villon-sur-Sarthe, Frankreich
29. Juli 1714
VIII
Adeline hatte ein Baum sein wollen.
Wild und tief wachsen, niemandem gehören außer der Erde unter ihr und dem Himmel über ihr, genau wie Estele. Es wäre ein unkonventionelles Leben, vielleicht ein wenig einsam, aber zumindest wäre es ihres. Sie würde niemandem gehören außer sich selbst.
Aber hierin liegt die Gefahr eines Ortes wie Villon.
Einmal blinzeln – und ein Jahr ist vorbei.
Nochmal blinzeln – und fünf weitere folgen.
Es ist wie eine Lücke zwischen Steinen, dieses Dorf, gerade breit genug, dass Dinge verlorengehen können. Ein Ort, an dem die Zeit weggleitet und verschwimmt, an dem ein Monat, ein Jahr, ein Leben verschwinden können.
Adeline wollte ein Baum werden.
Aber dann kamen Roger und seine Frau Pauline. Zusammen aufgewachsen und dann verheiratet und dann gestorben, in der Zeit, die Adeline braucht, um ein Paar Stiefel zuzuschnüren.
Eine schwierige Schwangerschaft, eine schwere Geburt, zwei Tote statt einem neuen Leben.
Drei kleine Kinder zurückgelassen, wo es vier hätten sein sollen. Die Erde noch frisch auf einem Grab, und Roger, der nach einer Mutter für seine Kinder sucht, nach einem zweiten Leben auf Kosten von Adelines einzigem.
Natürlich sagte sie nein.
Adeline ist dreiundzwanzig, bereits zu alt zum Heiraten.
Dreiundzwanzig, ein Drittel des Lebens schon verstrichen.
Dreiundzwanzig – und dann wie eine preisgekrönte Sau an einen Mann vergeben, den sie nicht liebt oder will oder auch nur kennt.
Sie sagte nein und erfuhr, wie wenig ihr Wort wert war. Erfuhr, dass sie sich wie Estele dem Dorf versprochen hatte, und das Dorf verlangte nach ihr.
Ihre Mutter sagte, es sei ihre Pflicht.
Ihr Vater sagte, es sei eine Gnade, obwohl Adeline nicht weiß, für wen.
Estele sagte nichts, weil sie wusste, dass es ungerecht war. Dass dies das Risiko einer Frau war, wenn sie sich an einen Ort band statt an eine Person.
Adeline wollte ein Baum sein, und stattdessen kamen nun die Leute mit der Axt.
Sie gaben sie weg.
In der Nacht vor der Hochzeit liegt sie wach und denkt an Freiheit. Ans Weglaufen. Daran, sich auf dem Pferd ihres Vaters davonzustehlen, auch wenn sie weiß, dass der Gedanke Wahnsinn ist.
Sie fühlt sich wahnsinnig genug, um es zu tun.
Stattdessen betet sie.
Natürlich betet sie schon seit dem Tag ihrer Verlobung, übergab die Hälfte ihres Besitzes dem Fluss und vergrub die andere Hälfte auf dem Feld oder in dem verwilderten Abhang, wo das Dorf in den Wald übergeht, und jetzt hat sie kaum noch Zeit und Gaben übrig.
Sie liegt im Dunkeln, dreht den alten Holzring an seinem Lederband und überlegt, jetzt noch einmal zum Beten hinauszugehen, mitten in der Nacht, aber sie erinnert sich an Esteles furchteinflößende Warnung vor den Mächten, die antworten könnten. Also krampft sie stattdessen die Hände zusammen und betet zum Gott ihrer Mutter. Betet um Hilfe, um ein Wunder, um einen Ausweg. Und dann im dunkelsten Teil der Nacht betet sie um Rogers Tod – alles, damit sie entkommen kann.
Sie fühlt sich sofort schuldig, saugt das Gebet wieder in ihre Brust ein wie ausgestoßenen Atem, und wartet.
Der Tag bricht an und schüttet falbes Licht über dem Feld aus.
Adeline schlüpft noch vor dem Morgengrauen aus dem Haus, nach einer schlaflosen Nacht. Jetzt bahnt sie sich einen Weg durch das wilde Gras hinter dem Gemüsegarten, ihre Röcke saugen den Tau auf. Sie geht in die Knie, ihren liebsten Zeichenstift in der Hand. Sie will ihn nicht hergeben, aber ihr bleibt nicht mehr viel.
Mit der Spitze voran drückt sie den Bleistift in die feuchte Erde des Feldes.
»Helft mir«, flüstert sie dem Gras zu, dessen Ränder im Licht erstrahlen. »Ich weiß, dass ihr da seid. Ich weiß, dass ihr zuhört. Bitte. Bitte.«
Aber das Gras ist nur Gras, und der Wind ist nur Wind, und keiner antwortet, selbst als sie die Stirn auf den Boden drückt und schluchzt.
An Roger ist nichts falsch.
Aber es ist auch nichts richtig. Seine Haut ist wächsern, sein blondes Haar schütter, seine Stimme wie ein Windhauch. Wenn er die Hand auf ihren Arm legt, ist sein Griff schwach, und wenn er ihr den Kopf zudreht, riecht sein Atem schal.
Und Adeline? Sie ist ein Gemüse, das sich schon zu lange im Garten verbirgt, die Haut hart, das Innere holzig, nun soll es ausgegraben und in eine Mahlzeit verwandelt werden.
»Ich will ihn nicht heiraten«, sagt sie, die Finger in die überwucherte Erde gekrallt.
»Adeline!«, ruft ihre Mutter, als sei sie ein Hoftier, das sich verirrt hat.