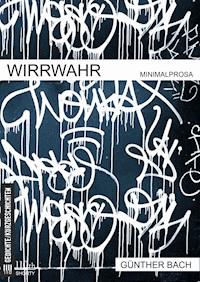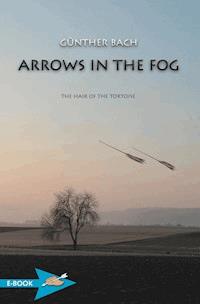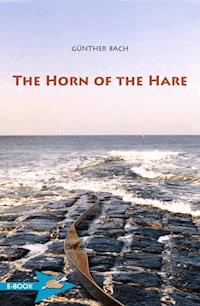Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hörnig, A
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieser vierte Roman von Günther Bach knüpft direkt an die Handlung von "Gegen den Strom" an. Wie auch bei den drei vorangegangenen Romanen steht das Bogenschießen im Mittelpunkt der äußeren und inneren Handlung. Mit atmosphärisch dichten Schilderungen und einer detaillreichen und ausführlichen Sprache, versteht es der Autor, das Augenmerk auf einfache Alltagshandlungen zu richten, und aus diesen kleine Kostbarkeiten zu machen. Und ganz nebenbei werden dem Leser Basisbegriffe des Bogenschießens erklärt und nahegebracht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table of Contents
Titelseite
Impressum
Dictum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Der Autor
Die Romane als e-book
e-books in englisch
Printausgaben
Traditionell Bogenschießen
Buchrückseite
GÜNTHER BACH
DAS UNSICHTBARE ZIEL
ROMAN
VERLAG ANGELIKA HÖRNIG
©2011 Verlag Angelika Hörnig
Alle Rechte vorbehalten.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftiche Genehmigung des Verlags reproduziert oder elektronisch vervielfältigt oder verbreitet werden.
Illustrationen & Coverfoto: Günther Bach
© 2012 ebook ISBN 978-3-938921-22-4
Verlag Angelika Hörnig Siebenpfeifferstraße 18 D-67071 Ludwigshafenwww.bogenschiessen.de
Wenn die Spannung erfüllt ist, muss der Schuss fallen; er muss vom Schützen abfallen wie die Schneelast vom Bambusblatt, noch ehe er es gedacht hat.
Eugen Herrigel
1
Alles hatte gestimmt.
Er hatte einen guten, sicheren Stand. Die Sonne war vor ihm, aber sie blendete ihn nicht, abgeschirmt durch die dichte Krone einer riesigen Esche. Das Tier unten in der Senke, ein Stück oberhalb des schlammigen Bachbettes, dagegen hell beleuchtet und in guter, in sicherer Schussentfernung.
Ein schöner Schuss, der nicht fehlgehen konnte.
Der Pfeil war in Ordnung; alle seine Pfeile waren in Ordnung. Vor jedem Schuss hatte er Nocke und Befiederung geprüft, er machte es nie anders. Daran konnte es nicht gelegen haben. Noch nie war er mit besseren Pfeilen zu einem Wettkampf angetreten. Er wusste, dass er sauber geankert hatte, den Bogen voll ausgezogen, und er hatte die richtige Spannung in den Schultern gespürt. Der Bogen war der beste, den er je hatte. Und doch hatte er das Tier verfehlt.
Nicht etwa ein schlechter Schuss – nein, er hatte es übel verfehlt, um fast zwei Meter. Auf diese Entfernung. Was war das?
Bärger trat einen Schritt zurück, drehte sich um. Die anderen drei Schützen seiner Gruppe schienen nichts bemerkt zu haben; sie unterhielten sich leise.
Es war der zweite Tag der Meisterschaft. Gestern war alles perfekt gelaufen; nun ja, er lag nicht an der Spitze mit seinem Ergebnis, aber in seiner Altersklasse hatte er Aussicht auf einen der vorderen Plätze und das fand er eigentlich völlig normal.
Bärger trat zurück an den Abschusspflock, zog Pfeil Nummer zwei aus dem Köcher, spürte dem leichten Widerstand nach, mit dem er die Nocke auf die Sehne schob und atmete langsam ein. Während er das Ziel ins Auge fasste, hob er langsam den Bogen. Mit dem nächsten Einatmen spannte er den Bogen, bis die Spitze des Mittelfingers der Pfeilhand den Mundwinkel berührte.
Er wusste, dass alles stimmte, gestimmt hatte, bis zu diesem Moment, als er den Pfeil fliegen ließ.
Mit einem lauten Knall schlug der Schaft auf einen Stein; die Stahlspitze erzeugte einen Funken und er sah, wie der Pfeil in mehrere Teile zersplitterte. Wieder hatte er das Ziel um fast zwei Meter rechts verfehlt. Bärger spürte, wie ratlose Verzweiflung seinen Hals zuzuschnüren begann. Als er den dritten, den letzten Pfeil nockte, war seine Sicherheit dahin. Er wusste, dass etwas eingetreten war, das er nicht beeinflussen konnte, eine neue, unbekannte Störung, keiner von den alten Fehlern, wie sie immer wieder einmal auftraten und überwunden werden konnten, weil man ihre Ursache kannte. Etwas wie Resignation stieg bleiern in ihm auf, mechanisch vollzog er den Aufbau des dritten Schusses und auch diesmal schlug der Pfeil rechts neben dem Ziel in den sumpfigen Boden; etwas näher als die beiden ersten, aber dennoch beschämend weit daneben.
Wortlos trat Bärger vom Pflock zurück. Er wusste, dass er diesmal beim Ablassen des Pfeils etwas gespürt hatte; etwas, das nicht dazu gehörte und das vorher noch nie da gewesen war. Die Sehne. Er hatte gefühlt, wie die Sehne über die Spitze seines Mittelfingers geglitten war, ein Gefühl, das es nicht geben durfte. Die drei Finger der Pfeilhand mussten die Sehne freigeben ohne den geringsten Widerstand in dieser letzten, alles entscheidenden Phase des Schusses. Und genau das war nicht geschehen. Die Bogensehne war an seinem Finger hängen geblieben, daher die Rechtsschüsse.
Sie gingen hinunter zum Bachbett, um die Pfeile zu holen. Niemand aus der Gruppe kommentierte Bärgers Fehlschüsse und so sammelte er schweigend die Bruchstücke des Schaftes ein und schob sie in seinen Köcher. Alle hatten gesehen, dass er keinen Treffer erzielt hatte und so war es eigentlich überflüssig, dass der Schreiber ihn nach seinem Ergebnis fragte.
»M«, sagte Bärger, das übliche Kürzel für mistake – einen Fehlschuss – und der Schreiber nickte und trug das Zeichen für die null Punkte seiner Serie in die Scorekarte ein.
Die Gruppe zog weiter, zum nächsten Ziel. Der Parcours war weitläufig angelegt und ohne die farbigen Bändsel, die in Augenhöhe an den Ästen der Bäume hingen, hätten sie Schwierigkeiten gehabt, sich in dem unbekannten Gelände zurechtzufinden.
Das Ziel war diesmal ein Nahschuss, etwa fünf Meter weit, auf die Figur eines Eichhörnchens, das vor dem Stamm einer Eiche aufgebaut war. Auf dem Weg dorthin hatte Bärger versucht, die Finger seiner Pfeilhand zu massieren, in der Hoffnung auf die Einmaligkeit dieses Versagens. Als Erster trat er an den Pflock, schloss einen Moment lang die Augen und schaltete alles aus, was geschehen war.
Klang der Sehne und Einschlag des Pfeils waren fast wie ein einziges Geräusch und er sah den weißen Punkt der Nocke seines Pfeils vor der Mitte des Ziels stehen. Als er vom Pflock zurücktrat, um dem nächsten Schützen seiner Gruppe Platz zu machen, spürte er ein Gefühl von Erleichterung, doch der Flow des gestrigen Tages, diese Empfindung von Leichtigkeit und Sicherheit, wollte sich nicht wieder einstellen.
Das nächste Ziel war ein Timberwolf, ein großes graues Tier, das vor einer dichten Brombeerhecke aufgebaut war. Die Distanz entsprach dem, was unter Bogenschützen als »jagdliche Entfernung« bezeichnet wurde, eine Strecke von etwa 20 Yards oder sechzehn Metern. Es war seine Lieblingsentfernung, auf der er bisher seiner Treffer sicher sein konnte.
Diesmal schoss er als Letzter. Als er an den Pflock trat und den Pfeil auf die Sehne schob, hörte er über sich den heiseren Schrei eines Kolkraben und als er nach oben sah, hörte er das Rauschen der schwarzen Schwingen dicht über den Kronen der alten Rotbuchen. Er sah ihm nach, bis er verschwunden war. Dann hob er den Bogen und wieder stimmte alles in der Gewissheit des Treffens, doch als der Schuss fiel, fühlte er, wie die Sehne an seinem Finger zog und er wusste, dass er von nun an seines Pfeils nicht mehr sicher sein konnte. Es war vorbei.
Nachdem er seinen Pfeil aus dem Gestrüpp der Brombeerhecke gefischt hatte, sagte er dem Schreiber, dass er nicht mehr weiterschießen werde. Auf die erstaunte Frage, warum, erklärte er, dass er Schmerzen in der rechten Hand habe und seinen Ablass nicht mehr kontrollieren könne.
Er müsse aufgeben, sagte Bärger, es habe keinen Sinn mehr. Er bat noch darum, seine Scorekarte nicht abzugeben, wünschte den Dreien »Alle ins Kill« und als sie den nächsten Forstweg erreicht hatten, hob er noch einmal grüßend die Hand und ging den Weg zurück bis zum Einschießplatz, wo am Morgen der Wettkampf begonnen hatte.
2
Es stimmte nicht, er hatte keine Schmerzen.
Aber wie hätte er erklären sollen, was er selbst nicht verstand, dass plötzlich und ohne jede Vorwarnung ein Teil seines Körpers nicht mehr funktionieren wollte, dass eine so einfache Bewegung wie das Strecken der Finger nicht mehr möglich zu sein schien und das mit dieser winzigen Bewegung auf einmal alles zusammenbrach, woran er jahrelang gearbeitet hatte, an dem optimalen Ablauf der einzelnen Schritte in Vorbereitung des Schusses. Es kam ihm vor wie Hohn, dass ausgerechnet jetzt, nachdem er meinte, auf dem Höhepunkt seiner Leistungen zu sein, durch so eine winzige Schwäche, ganz am Ende der Kette von allen im Unterbewusstsein verankerten Abläufen, alles zerbrechen sollte. Eine Kette, fiel ihm ein, ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Kein Zweifel, das stimmte.
Bärger nahm kaum wahr, dass ihm eine warme Herbstsonne auf die Schultern schien, als er langsam auf dem schmalen Schotterstreifen neben der Landstraße zurück zum Hotel lief. Am Morgen hatte ihn ein befreundeter Bogenschütze im Wagen zum außerhalb der Stadt liegenden Gelände mitgenommen. Erst jetzt merkte er, wie weit der Rückweg war. Es war eine schöne Landschaft; sanft abfallende Hügel nach Westen zu, Koppeln mit Weidezäunen, hinter denen braunbunte Kühe weideten. Nach Osten, in seinem Rücken, zog sich der bewaldete Bergrücken hin, unter dessen altem Baumbestand aus Eschen, Rotbuchen und Eichen, unterbrochen von Kiefernbeständen, der Parcours aufgebaut war. Bei jedem Schritt klapperten die Pfeile in seinem Köcher, aber er hörte es nicht und auch die wenigen Wagen, die an ihm vorbei fuhren, bemerkte er kaum.
Endlich tauchte das rote Ziegeldach des Hotels vor ihm auf, das sich als Sport- und Kongresszentrum bezeichnete; eine zweigeschossige Anlage mit großer angeschlossener Tennishalle, in die man vom Restaurant aus durch große Glasscheiben hineinblicken konnte. An der Rezeption ließ sich Bärger den Schlüssel geben, baute in seinem Zimmer den Bogen auseinander und verstaute Köcher und Pfeile in seinem Rucksack. Er duschte ausgiebig und zog sich um. Obwohl es auf Mittag zuging, verspürte er keinen Hunger. Was er sich unbedingt ersparen wollte, war die Ankunft der Bogenschützen, die gleich ihm ihre Zimmer hier im Haus gebucht hatten. Es würde bis zum späten Nachmittag dauern, bis die ersten nach Auswertung der Scorekarten, Ausfüllen der Urkunden und anschließender Siegerehrung hier eintrafen, aber er wollte niemanden von ihnen sehen und Fragen beantworten müssen, auf die er selbst keine Antwort wusste.
So griff er nach seiner Reisetasche, hing sich den Rucksack mit Bogen und Pfeilen über die Schulter und stand eine halbe Stunde später ein zweites Mal vor der Rezeption, um seine Rechnung zu bezahlen.
»Sie reisen schon ab, Herr Bärger?«, fragte die elegante Frau mit der blonden Kurzhaarfrisur, die hinter dem Tresen ein paar Zahlen in die Tastatur ihres Rechners hämmerte. Sie hatte dabei ein unbeteiligtes Lächeln auf dem schmalen Gesicht, dessen Bräune mit Sicherheit dem hoteleigenen Solarium zu verdanken war. Vermutlich Teil der Dienstkleidung, dachte er.
»Termine«, sagte Bärger, und er wusste nicht genau, warum er das sagte, denn er hatte überhaupt keine Termine, sondern noch zwei Tage Urlaub, und er hatte auch keinen Grund, dieser fremden Frau irgendeinen Grund für seine Abreise zu nennen, aber schließlich hatte sie auch keinen Grund gehabt, ihn danach zu fragen und so war denn alles, Frage wie Antwort, nichts weiter als eine Restform höflichen Umgangs miteinander.
Er zahlte, grüßte, warf sich erneut den Rucksack über die Schulter und lief davon in Richtung Bahnhof, dem Richtungspfeil folgend, der neben dem riesigen Werbeschild an der Hoteleinfahrt einen Fußweg von fünfzehn Minuten versprach.
Die Zeitangabe stimmte in etwa, doch als er endlich vor dem Fahrplan in der kleinen Schalterhalle stand, musste er feststellen, dass der nächste Zug in Richtung Hamburg, wo er in den ICE nach Kopenhagen umsteigen wollte, erst in zwei Stunden fahren würde. Er schob Reisetasche und Rucksack in ein Schließfach und stand gleich darauf wieder auf dem Bahnhofsvorplatz. Nach einem kurzen Blick schlenderte er an den wartenden Linienbussen vorbei in Richtung des Kirchturmes, dessen grüne Turmspitze er unweit über den Dächern der zweigeschossigen Häuser gegenüber schimmern sah.
Wie vermutet stand er gleich darauf auf dem Marktplatz der kleinen Stadt, die ihm sauber und aufgeräumt erschien. Er warf einen Blick auf die Brunnenanlage neben der Kirche, die wohl das Modell eines Perpetuum Mobile darstellen sollte; in einer gläsernen Röhre stieg das Wasser, bis es einen Punkt erreichte, an dem es überlief und ein kompliziertes Werk von Rädern und Hebeln in Bewegung setzte. Gleich gegenüber standen Tische und Stühle unter bunten Sonnenschirmen auf der Straße. Bärger fand einen freien Tisch, setzte sich und bestellte bei einer freundlichen Kellnerin ein Stück des Apfelkuchens nach Art des Hauses, den sie ihm empfohlen hatte. Der Cappuccino, den er dazu trank, war gut und auch der Kuchen, der reichlich mit Mandelsplittern bestreut war, schmeckte ihm. Aber trotz des beschaulichen Treibens um ihn herum wollte ihn das Gefühl von Unruhe nicht verlassen und immer wieder ertappte er sich dabei, dass er den Mittelfinger der rechten Hand beugte und streckte, als wolle er seine Beweglichkeit prüfen.
Die Sonne warf schon lange Schatten in den engen Straßen, als er endlich zahlte, aufstand und zurück zum Bahnhof ging, wo er gleich darauf seinen Regionalzug bestieg, sich in die Fensterecke eines leeren Abteils setzte und hoffte, den größten Teil der Fahrt verschlafen zu können.
3
Aus dem Schlafen war nicht viel geworden.
In kurzen Abständen hielt der Zug an kleinen Stationen, deren Namen ihm nichts sagten. Schweigende Menschen mit müden Gesichtern stiegen ein und bald wieder aus; eine Gruppe lärmender Schüler war bemüht, die Fahrgäste zu verärgern, aber niemand schien Lust zu haben, sich mit ihnen anzulegen.
Als Bärger nach zwei Stunden Fahrt in Hamburg ankam, blieb ihm reichlich Zeit zum Umsteigen. Den größten Teil der dreistündigen Fahrt nach Nykoebing schlief er nun aber wirklich. Es war weit nach elf Uhr abends, als er sein Gepäck in den Kofferraum seines Wagens laden konnte, den er vor dem Bahnhof geparkt hatte. Er fühlte sich müde und zerschlagen.
Eine ganze Weile saß er noch unbeweglich hinter dem Lenker, den Zündschlüssel in der Hand und atmete tief die frische Seeluft, die durch die offene Seitenscheibe zu ihm hereinströmte.
Dann fuhr er los, die letzte Strecke nach Falkerslev, wo er die Ereignisse der letzten beiden Tage schnell zu vergessen hoffte.
Es war eine helle Mondnacht, und als er von der Landstraße in den Feldweg einbog, der zu Maybritts Haus führte, sah er unter sich in der Senke auf den weiten Wiesenflächen den Silberschein der flachen Nebelbänke, die sich wie die Wellen eines Sees im schwachen Wind auf und ab bewegten. Er stellte den Motor ab und ließ den Wagen langsam den flachen Hang hinunterrollen, bis er vor dem Hoftor zum Stehen kam. Er beschloss, das Gepäck im Wagen zu lassen und trat durch die offene Gartenpforte. Als er die Haustür leise aufschloss, kam ihm seine Katze Candy entgegen, die sich schnurrend an seinen Beinen rieb.
»Ist ja gut, Candy«, sagte Bärger und strich ihr über den Rücken, »jetzt bin ich wieder da.«
Leise ging er durch den Flur und ins Wohnzimmer, in dem es nach reifen Äpfeln duftete. Durch das offene Fenster warf er noch einen Blick in den kleinen Hof. Feucht glänzten die in der Dunkelheit schwarzen Blätter des alten Nussbaums und auf den runden Steinen des alten Kopfsteinpflasters schimmerte der Mondschein.
Welch eine Stille, dachte Bärger.
Er zog sich aus, legte sich auf die Couch, zog sich die Flauschdecke bis zum Hals und schon in der nächsten Sekunde sprang ihm seine Katze mit allen vier Pfoten zugleich auf die Brust, um schnurrend ihren Kopf an seinem Kinn zu reiben. Er streichelte ihren Rücken, und sie streckte sich langsam aus, um für eine Weile still liegen zu bleiben, bis sie unvermittelt aufsprang, lautlos auf die Dielen sprang und in der Dunkelheit verschwand. Gleich darauf war er eingeschlafen.
Es waren vertraute Geräusche aus der Küche, die ihn am Morgen weckten; das Klappern der Teller und Tassen, die Maybritt aus dem Schrank nahm und auf den Tisch am Fenster stellte, auf den zu dieser Zeit wohl schon die Sonne scheinen mochte. Noch einen Moment lang genoss er das Gefühl von Geborgenheit und Wärme, bevor er aufstand, um Maybritt zu begrüßen. Als er in der Küchentür stand, stellte sie die Teekanne auf den Tisch, aus der sie schon in beide Tassen eingeschenkt hatte, verschränkte die Arme vor der Brust und lächelte ein wenig spöttisch.
»Ich habe dich erst heute Nachmittag erwartet«, sagte sie, »hast du solche Sehnsucht nach mir gehabt? Dann hättest du doch auch zu mir ins Schlafzimmer kommen können.« Sie rückte ihren Stuhl in die Sonne, blieb aber stehen.
Bärger sagte nichts, sondern nahm sie schweigend in den Arm, küsste sie auf den Hals und genoss dabei den Geruch ihres Haares, das sie zu einem losen Knoten gebunden hatte.
Dann saßen sie einander gegenüber und während er den bernsteinfarbenen Honig in einer Schleife auf sein Brot fließen ließ, begann er zu erzählen.
Er rechnete es ihr hoch an, dass sie Geduld hatte, wenn er vom Bogenschießen sprach, denn er wusste, dass sie es nicht aus eigenem Interesse tat, sondern wohl eher aus dem Wissen darum, was es ihm selbst bedeutete.
»Es ist etwas Merkwürdiges passiert«, sagte Bärger und sah nachdenklich aus dem Fenster, »ich musste mittendrin aufhören, am zweiten Tag. Bis dahin war alles gut gelaufen.«
»Hattest du einen Unfall?«, wollte Maybritt wissen. Ihre Stimme klang besorgt.
»Das ist ja das Verrückte«, sagte Bärger, »es kam wie aus heiterem Himmel. Meine rechte Hand spielte auf einmal nicht mehr mit. Mit einem Mal gingen meine Pfeile alle daneben und ich wusste nicht, warum. Es dauerte eine ganze Weile, bis ich merkte, dass die Bogensehne am rechten Mittelfinger hängen blieb, wenn ich den Pfeil lösen wollte. Es hatte keinen Zweck mehr, ich musste aufhören.«
»Hast du Schmerzen?«, wollte Maybritt wissen. Er schüttelte den Kopf.
»Überhaupt nicht«, sagte er »das ist ja das Komische.« Er ballte die Hand zur Faust und streckte sie wieder, mehrmals hintereinander.
»Es spannt nur ein wenig, hier am Mittelfinger, wenn ich eine Faust mache.« Bärger sah sie fragend an, als könne sie ihm eine Erklärung geben.
»Es wird am besten sein, wenn du deine Hand eine Weile in Ruhe lässt und vielleicht auch beim Bogenschießen erst mal eine kleine Pause einlegst. Sollte es nicht besser werden, können wir immer noch zum Arzt gehen. In Nykoebing gibt es einen guten Orthopäden«.
Dabei blieb es fürs Erste, aber auch Wochen danach vermied es Bärger, über das Thema zu reden, zumal diese merkwürdige kleine Behinderung sich ausschließlich beim Bogenschießen bemerkbar machte. Es war zu einer Angewohnheit geworden, dass er gelegentlich seinen rechten Mittelfinger massierte, aber auch das wurde seltener. Den Rucksack mit Bogen, Köcher und Pfeilen hatte er in einer Bodenkammer abgestellt, um nicht ständig daran erinnert zu werden. Allen anderen Tätigkeiten in Zusammenhang mit seiner Arbeit im Mittelalterzentrum konnte er problemlos nachgehen und so sah er auch keine Veranlassung, anderen von dieser Macke, wie er es bei sich selbst nannte, zu berichten.
Nur bei den Vorführungen auf der Wiese hinter seinem Blockhaus am Hafen des Mittelalterzentrums, bei denen er vorwiegend Schulklassen von der Geschichte des Bogenschießens erzählte, nahm er für einige wenige Male den leichtesten von Erhards Eschenbogen in die Hand, um den Gebrauch zu demonstrieren. Auf den Schuss mit dem starken Wikingerbogen, mit dem er sonst vorgeführt hatte, wie man mit einem Pfeil mit einer schweren Bodkinspitze ein Brett spalten konnte, verzichtete er völlig. Ohnehin nahm die Zahl der Besuchergruppen jahreszeitlich bedingt immer mehr ab und die Veranstaltungen verlegten sich mehr und mehr in den Bereich der Innenräume der immer noch wachsenden kleinen Stadtanlage.
Eines Tages fand Bärger beim Heimkommen in Falkerslev ein Schreiben der Berliner Speditionsfirma, bei der er vor vier Jahren seine Möbel abgestellt hatte, als er nach Falkerslev gezogen war. In dem Brief wurde ihm mitgeteilt, dass der Besitzer der Firma gewechselt habe und zur Verlängerung des Mietvertrages sein persönlicher Besuch erwünscht sei.
Er hatte keine besondere Lust, nach Berlin zu fahren, am wenigsten zu dieser Jahreszeit, einem nasskalten und nebligen November, aber tatsächlich war zu dieser Zeit wenig zu tun im Centret und Herr Pedersen, sein Chef, würde kaum Einwände gegen einen Kurzurlaub von zwei oder drei Tagen haben.
Auch Maybritt meinte nach kurzem Überlegen, dass er besser allein fahren solle; schon der Katzen wegen, die in Falkerslev versorgt werden mussten. Sie kamen überein, dass er so schnell wie möglich zurückkommen sollte, aber das war ohnehin seine Absicht gewesen. Seitdem sie einmal mit dem ICE in wenig mehr als fünf Stunden Berlin bequem und ohne den ewigen Stau auf der Autobahn erreicht hatten, kam etwas anderes als eine Bahnfahrt für ihn nicht in Frage.
In der Woche darauf fuhr er also mit leichten Gepäck im Intercity Express, der im Abstand weniger Stunden mehrmals am Tag zwischen Kopenhagen und Berlin verkehrte, in Richtung seiner nur noch selten vermissten Heimat. Auf dem Bahnhof in Nykoebing hatte er sich wieder einmal die neueste Ausgabe des deutschen Nachrichtenmagazins gekauft, das er in Berlin regelmäßig gelesen hatte, weil es ihm Hintergrundinformationen zu Ereignissen verschaffte, die in den knappen Darstellungen der Rundfunksendungen für ihn oft unverständlich blieben. So hatte er eine ganze Weile gebraucht, um zu begreifen, auf welche Weise die sogenannte Immobilienblase in den USA zustande gekommen war, in deren Gefolge reihenweise Banken weltweit zusammenbrachen. Aber selten nur hatte er darin Erfreuliches zu lesen gefunden und momentan hatte er keine Lust, über die Enthüllungen der neuesten Skandale zu lesen.
Er sah aus dem Fenster des leeren Abteils, bis in Hamburg Reisende zustiegen, die ihm empört ihre Platzkarten vorwiesen, mit denen sie ihren Anspruch auf den Fensterplatz nachwiesen. Die Aussicht auf ein sinnloses Streitgespräch mit der gereizten Familie schien Bärger wenig verlockend. Er hob wortlos seine Reisetasche aus dem Gepäcknetz und zog die Abteiltür hinter sich zu. Im nächsten Wagen fand er einen anderen Fensterplatz, auf den bis Berlin niemand weiter Anspruch erhob.
An der Verspätung von mehr als zwanzig Minuten schien niemand Anstoß zu nehmen, als der Zug endlich auf dem Hauptbahnhof hielt. Bärger erinnerte sich an den Schalter der Autovermietung, deren Logo er schließlich zwischen den Leuchtwerbungen der endlosen Shoppingangebote rechts und links der Gleise entdeckte. Am Schalter erfuhr er, dass der bestellte Wagen auf dem Vorplatz seit einer Stunde für ihn abgestellt war. Sogar den genauen Standort auf dem Bahnhofsvorplatz konnte ihm der junge Mann auf dem Display seines Rechners zeigen. Er nahm die Schlüssel entgegen und dankte höflich für den Wunsch nach einem angenehmen Aufenthalt.
Draußen empfingen ihn Verkehrslärm vermischt mit Möwenschreien, der Geruch von Rauch und Autoabgasen und ein chaotisches Gewimmel von Fahrzeugen auf der Suche nach Park- oder Haltemöglichkeiten. Es ist jedes Mal ein bisschen schlimmer, wenn ich wieder hier herkomme, dachte Bärger. Als er seine Reisetasche auf den Rücksitz schob, begann es zu nieseln. Es ging jetzt auf zwei Uhr nachmittags; man hatte ihm gesagt, dass er sich möglichst bis drei Uhr bei der Speditionsfirma melden solle, um die Formalitäten zu erledigen. So schob er sich seufzend hinter den Lenker, ließ den Motor an und als sich vor ihm die erste Lücke in der Kolonne von Fahrzeugen zeigte, ließ er den Wagen auf die Straße rollen.
Bis zur Landsberger Allee im Osten Berlins war es kaum eine halbe Stunde Fahrt und als er vor dem Lagerhaus hielt, ahnte er nichts Gutes. Die Fassade hatte einen neuen ziegelroten Anstrich erhalten und warb nun mit einem geschosshohen Schild als SELFSTORAGE DISCOUNT BERLIN für seine Dienstleistungen. Seine Befürchtungen wurden kurze Zeit darauf bestätigt, als ihm die schmale Mappe mit seinen Vertragsunterlagen vorgelegt wurde. Der Preis seines Lagerraums war von monatlich 120 auf 140 Euro gestiegen und man gab sich nicht viel Mühe, ihn von den Ursachen dieser Preissteigerung zu überzeugen.
Bärger überschlug schnell, dass ihn die zwölf Quadratmeter, auf denen er seine wenigen Holzmöbel abgestellt hatte, jährlich fast 1700 Euro kosten würden und er hatte erhebliche Zweifel, ob diese Summe durch den Zeitwert seiner Möbel noch abgedeckt wurden. Es war an der Zeit, sich Gedanken um seine Zukunft zu machen und gegenwärtig schien nur wenig darauf hinzuweisen, dass er sie in Berlin finden könnte.
Ich muss mit Maybritt darüber sprechen, dachte er; sie hätte doch mitkommen sollen. So blieb ihm nur, sich nach der Kündigungsfrist zu erkundigen, die bei drei Monaten lag. Man händigte ihm den Schlüssel zu seiner Kammer aus und er fuhr mit dem geräumigen Lastenaufzug in die vierte Etage. Die Luft im Raum war kühl, aber trocken und roch nach Papier und Kiefernholz. Er hatte selbst alles gestapelt; ganz hinten die Kleiderschränke, davor Sideboards, Regale, vier Stühle und den Lesesessel und zuletzt die Kisten mit den Büchern. Die zumindest, dachte Bärger, sollte ich mitnehmen, wenn ich in Falkerslev bleibe. Auch die Regale würde er dann brauchen, aber die waren zerlegbar und im Grunde alles mit einer Fahrt im Lieferwagen zu erledigen.
Neben den Bücherkisten lehnte seine große schwarze Zeichenmappe, die ihn seit seiner Studentenzeit in Dresden begleitet hatte. Einem spontanen Einfall folgend, griff er danach, ohne konkrete Erinnerung an ihren Inhalt und schloss die Tür sorgfältig ab. Er nahm die Kopie seines neuen Vertrags entgegen und fragte, ob man ihm bei der Entsorgung seiner Möbel behilflich sein könne, wenn er keine weitere Verwendung dafür habe. Wie nicht anders erwartet, bestand das einzige Angebot in der Zusammenarbeit mit der Sperrmüllabteilung der Stadtreinigung.
Man würde ihm den Preis übermitteln. Bärger bedankte sich, wünschte einen guten Tag und ging mit seiner Mappe unter dem Arm zurück zum Wagen.
4
Der Regen hatte aufgehört. Immerhin.
Er stellte die Mappe vor die Rücksitze und sah auf die Uhr. Es war doch inzwischen schon kurz vor vier Uhr geworden. Die beginnende Rush Hour füllte bereits wieder die Straßen, jedoch eher in Richtung stadtauswärts und weil er plötzlich Hunger spürte, beschloss er, in der kleinen Kneipe in der Nähe des Bahnhofs Friedrichstraße endlich wieder einmal nach dem Chili con Carne zu fragen, das dort seit vielen Jahren in einer bemerkenswert gleichbleibenden Qualität angeboten wurde. Er fand unerwartet einen Parkplatz unmittelbar daneben unter dem S-Bahnbogen und trat gleich darauf in den kleinen Gastraum mit dem abgewinkelten Tresen vor der winzigen Küche, in der man dem Koch bei seinen Hantierungen zuschauen konnte.
Zumindest der Name TEX MEX war noch der alte; die junge Kellnerin kannte er nicht, meinte aber dafür den Koch wiederzuerkennen und auch die Speisekarte zeigte anscheinend ein unverändertes Angebot. Bärger war froh, etwas Vertrautes wiedergefunden zu haben; ein eher seltenes Ereignis in einer Stadt wie Berlin, die in immer kürzeren Abständen bemüht schien, ihr Gesicht zu verändern. Gleich am Alexanderplatz hatte er zwei neue Gebäude von seltener Scheußlichkeit entdeckt; ein Elektronikkaufhaus und etwas, das man jetzt wohl Shoppingcenter nannte. Er grinste, als er entdeckte, dass dessen seltsame Fassade aus himbeerfarbenen Betonfertigteilen mit einer aufwändigen Spitzbogenornamentik hergestellt worden war. Wie hatte man sich vor Jahren über die Fertigteilbauweisen der DDR lustig gemacht – nun ja, unter der Prämisse der Massenproduktion war Qualität nur schwer machbar. Aber was man hier daraus gemacht hatte, war auch als Unikat kaum zu ertragen. Ob man dem Ding wohl schon einen Namen gegeben hatte, wie das früher in Berlin schnell passieren konnte?
Für den Brunnen auf dem Alexanderplatz, den es immer noch gab, hatte der Berliner damals schnell den Namen ›Nuttenbrosche‹ gefunden. Seltsam, dass hier, an so exponierter Stelle in der Stadtmitte, solche offensichtlichen Fehlentscheidungen möglich waren.
Die junge Kellnerin brachte ihm den bestellten spanischen Landwein – das Weinangebot war nur klein, dafür aber preiswert – und gleich darauf das Chili, das er zur Feier des Tages mit gebratenem Choriso bestellt hatte. Dazu gab es frische Baguettescheiben in einem Brotkorb und als Bärger den ersten Löffel voll gekostet hatte, wusste er, dass sich hier nichts geändert hatte.
»Ist alles in Ordnung?«, fragte die Kellnerin im Vorbeigehen. »Perfekt«, sagte Bärger, »wenigstens etwas, auf das man sich in Berlin noch verlassen kann.«
Sie schien nicht recht zu verstehen, was er meinte, und wie sollte sie das wohl auch, jedenfalls nickte sie ihm freundlich zu und er brach das knusprige Brot in kleine Stücke, die er mit Genuss kaute und trank dazu in kleinen Schlucken von dem trockenen sauberen Wein.
Bärger ließ sich Zeit mit seiner Mahlzeit.
Es herrschte reger Verkehr in der kleinen Kneipe; ständig kamen und gingen Gäste, die meist sehr jugendlich aussahen, wahrscheinlich Studenten der nahe gelegenen Humboldt-Universität. Neu war für ihn war das Gewirr der Sprachen. Die Gruppe am Nebentisch schien sich hier verabredet zu haben und sprach unbekümmert deutsch und englisch durcheinander; Verständigungsprobleme schien es nicht zu geben. In seinem ersten Semester in Dresden hatte es für kurze Zeit einen koreanischen Kommilitonen gegeben, was er damals sehr exotisch fand. Dazwischen schienen Ewigkeiten zu liegen.
Neben der Tür las ein langhaariger Mann in der ›El Pais‹, einer spanischen Tageszeitung und er stellte überrascht fest, dass auch die junge Kellnerin keine Schwierigkeiten hatte, einer amerikanischen Familie den Weg zum Brandenburger Tor zu erklären.
»Noch ein Glas Wein?«, fragte sie im Vorbeigehen und griff nach dem leeren Glas.
»Leider nein«, meinte Bärger bedauernd, »ich muss noch ein bisschen fahren. Bringen Sie mir bitte die Rechnung«.
Er zahlte, war überrascht von dem geringen Betrag, und bedankte sich mit reichlich Trinkgeld. Sie wünschte ihm noch einen angenehmen Aufenthalt in der Stadt, was ihn feststellen ließ, dass er sich darüber noch keine Gedanken gemacht hatte. Inzwischen war es draußen dunkel geworden. Der Blick auf die Uhr zeigte ihm, dass es kurz nach fünf war. Was tun mit dem Rest des Tages?
Seine alten Freunde in Berlin hatte er in der viel zu lang ertragenen Ehe mit einer dominanten Dolmetscherin fast alle verloren. Nach der Trennung hatte er dann auf erneute Kontaktaufnahmen verzichtet, weil er niemandem Anlass geben mochte, sich für ihn oder sie zu entscheiden. Zu den wenigen, die ihm treu geblieben waren, zählte mit Sicherheit Jürgen, der Statiker; Arbeitskollege und Freund zugleich, dessen Humor und geradlinige Denkungsart ihm in der Vergangenheit oft über schwierige Wegstrecken hinweggeholfen hatten.
Ich hätte ihn anrufen sollen, dachte Bärger. Aber vielleicht hatte er auch ohne Anmeldung heute Abend Zeit?
Er griff nach dem Handy, wählte die gespeicherte Adresse und tippte auf die Ruftaste. Er hörte das Rufzeichen, einmal, zweimal, dann meldete sich die bekannte Stimme: »Ingenieurbüro Glöckner«.
»Hallo, Jürgen«, sagte Bärger, »sitzt du immer noch an deinem Rechner?«
»Hallo Rolf«, sagte die Stimme in seinem Hörer und er konnte die Überraschung hören, »es bleibt mir doch gar nichts anderes übrig – aber was verschafft mir das seltene Vergnügen deines Anrufs?«
»Ich hatte in Berlin zu tun«, sagte Bärger, »im Moment hänge ich hier in meiner alten Kneipe rum und überlege, was ich mit dem Rest des Tages noch anfangen könnte. Hast du vielleicht eine Idee?«
Es gab eine kleine Pause.
»Warte mal«, sagte Jürgens Stimme im Handy, »die Bewehrungslisten müssen heute noch fertig werden, die schicke ich dann weg zum Plotten. Dafür brauche ich noch eine reichliche halbe Stunde. Dann wollte ich eigentlich aufhören. Bist du mit dem Wagen da?«
»Ich habe mir bis morgen einen Mietwagen genommen«, sagte Bärger, »dann fahre ich zurück nach Falkerslev, aber mit der Bahn. Ich habe keine Lust mehr, lange Strecken mit dem Wagen zu fahren.«
»Geht mir genau so«, sagte Jürgen, »aber beruflich lässt es sich leider meistens nicht vermeiden. Hast du Lust, zu mir rauszukommen?«
Jürgen wohnte mit seiner zweiten Frau im Norden Berlins, wo er in einem ruhigen Ortsteil ein Haus nach eigenem Entwurf gebaut hatte; so eigenwillig wie er selber war, mit einer großen Dattelpalme im Wohnzimmer, die direkt in einer Pflanzgrube im Fußboden des Erdgeschosses wurzelte und einem Kamin aus Natursteinen, den er selbst gemauert hatte. Die Wand darüber war statt eines Bildes mit den verwitterten silbergrauen Brettern eines alten Scheunentores verkleidet. Das alles wiederzusehen, am Kamin sitzend ein Glas Rotwein zu trinken und von alten Zeiten zu erzählen, schien ihm verlockend.
»Na klar habe ich Lust«, sagte Bärger, »und von hier aus bin ich bis zu dir mindestens eine Dreiviertelstunde unterwegs. Du kannst also in Ruhe deine Arbeit fertig machen.«
»Na dann, bis gleich«, sagte Jürgen, und als hätte er das Stichwort hören können, »was war doch gleich der Vorteil vom Rotwein?«
Bärger lachte: »Man braucht ihn nicht kalt zu stellen. Bis gleich.«
Je weiter er sich bald darauf vom Stadtzentrum entfernte, um so bekannter kamen ihm die Straßenbilder wieder vor. Der Verkehr stadtauswärts hatte nachgelassen und nur wenige Baustellen hinderten ihn am Vorankommen. Als rechts vor ihm neben der Straße ein riesengroßer mit blauem Blech verkleideter Kasten auftauchte, hatte er keine Mühe, ihn als IKEA-Filiale zu erkennen.
Die übliche Stadtrandarchitektur, dachte Bärger. Ganz egal, wohin man kommt, es sieht überall gleich aus. Die Neubauten im Stadtzentrum, die ihm unterwegs ins Auge gefallen waren, schienen überwiegend Hotels gewesen zu sein. Es muss der Tourismus sein, der seit einigen Jahren die gesamten überkommenen alten Stadtstrukturen auf den Kopf stellt. Er war sich nicht sicher, welchen Einfluss die Grundstückspreise in der City darauf haben mochten, aber wenn er von Lage und Erscheinungsformen der neueren Bausubstanz ausging, dann waren die Interessen des Tourismus in Berlin gegenüber denen der Bürger wesentlich besser vertreten.
Dem mochte auch die falsche Monumentalität der Regierungsbauten geschuldet sein, deren Maßstabslosigkeit ihn immer wieder erschreckte. Wenn Jahre zuvor in der DDR noch der ein wenig schwammige Begriff einer ›repräsentativen Architektur‹ für die staatlichen Bauvorhaben in Umlauf war – niemand konnte ihm damals so recht erklären, wen oder was diese Architektur denn repräsentieren solle – so schien ihm in letzter Zeit der Begriff des vorsätzlich Spektakulären für das aktuelle Baugeschehen der einzig zutreffende.
Das Ortsschild am linken Straßenrand zeigte ihm an, dass er nun die Hauptstraße verlassen musste. Er bog ab in die rechts und links mit alten Linden bestandene Landstraße und musste nun doch ein wenig suchen, bis er endlich in die unbefestigte Querstraße einbiegen konnte, an deren Ende das Grundstück mit Jürgens Haus lag.
Er parkte neben dem Gartentor und konnte schon von der Straße aus sehen, dass Jürgen die Zeit bis zu seiner Ankunft ausgereicht hatte, um im Kamin Feuer zu machen.
»Schön, dich mal wieder zu sehen«, sagte Jürgen, als er ihm die Tür öffnete. Eine kleine grau getigerte Katze saß zwei Schritte hinter ihm auf den hellen Dielen und schaute ihn aufmerksam einen Moment lang an, bevor sie lautlos durch die offene Tür verschwand.
»Ist wohl schon eine ganze Weile her seit dem letzten Mal«, meinte Bärger, »weißt du noch, wann das war?«
»Ein bisschen mehr als zwei Jahre müssen es wohl sein«, meinte Jürgen, »solange bist du nämlich schon in Dänemark.«
Sie gingen gemeinsam in das große Wohnzimmer, das nur schwach beleuchtet war. Wie bei Maybritt gab es auch bei Jürgen keine Gardinen an den Fenstern, doch der dichte Heckenbewuchs und die dahinter stehenden Bäume im Garten mochten die Sicht von der Straße her versperren.
Jürgens Frau begrüßte ihn mit herzlichem Lächeln, als er sich für die späte, unangemeldete Störung entschuldigen wollte.
»Das ist überhaupt kein Problem«, sagte sie, »ich freue mich, wenn sich ab und zu mal jemand zu uns verirrt.«
Sie hatte einen Teller mit belegten Broten vorbereitet und obwohl Bärger erklärte, dass er eben erst eine Riesenportion Chili gegessen habe, blieb die Platte auf dem Nebentisch stehen, als sie sich bald darauf verabschiedete und die Treppe hinauf nach oben ging.
»Sie muss bis morgen Mittag noch einen Artikel redigieren«, sagte Jürgen erklärend, »eigentlich verdiene ich genug für uns beide, aber sie hat Spaß daran und ich habe keinen Grund, ihr das auszureden.«
Er goss in die beiden Gläser, die vor ihm standen, ein wenig von dem tiefroten Wein aus einer bauchigen Flasche, gab Bärger eines davon in die Hand und meinte dann, während er sein Glas in einer winzigen kreisförmigen Bewegung schwenkte: »Was hältst du von der Sorte?«
Bärger roch einen fruchtigen Duft, doch der Geschmack war anders; er erinnerte ihn an Dörrpflaumen und Eichenholz und er kam ihm sehr schwer vor.
»Ich habe nicht viel Ahnung davon«, gab er zu, » aber ich glaube, es ist ein Spanier. Und zwar einer, vor dem man sich in Acht nehmen muss.«
Jürgen lachte.
»Wenn du meinst, dass es keiner von der Sorte ist, die man gegen den Durst trinkt, dann muss ich dir Recht geben. Er hat’s wirklich ganz schön in sich. Und mit dem Spanier hast du auch recht gehabt, es ist ein sehr ordentlicher Rioja.«
Sie tranken sich zu, Jürgen legte einen neuen Birkenkloben auf die zusammensinkende Glut im Kamin und dann saßen sie sich in den bequemen Sesseln gegenüber und schauten beide eine Weile den züngelnden Flammen zu, die schnell größer wurden, bis das Holz in der ganzen Länge hell brannte.
»Was machst du eigentlich jetzt in« – Jürgen machte eine Pause – »wie heißt das gleich, wo du jetzt wohnst?«
»Falkerslev«, sagte Bärger, »oder besser Nykoebing, denn Falkerslev ist bloß ein kleines Dorf in der Nähe der Stadt und der Hof, auf dem wir wohnen, liegt auch noch außerhalb des Ortes. Im Vergleich zu dir wohne ich wirklich auf dem Land. Und was ich mache? Das ist nicht so ganz einfach zu beschreiben. Ich bin angestellt bei einem Mittelalterzentrum; das musst du dir vorstellen als ein großes Gelände, das am Stadtrand von Nykoebing liegt, direkt am Guldborgsund, also am Wasser, und wo auf wissenschaftlicher Basis so etwas wie experimentelle Archäologie betrieben wird. Inzwischen gibt es dort so etwas wie eine kleine mittelalterliche Stadtanlage mit allem Drum und Dran – alle möglichen Handwerker: Schmied, Töpfer, Bäcker, Weber, Färber, einen Kaufmannsladen, eine Schänke und was weiß ich sonst noch alles. Das ist absolut authentisch; dort wohnen ganze Familien mit ihren Kindern, es gibt Hühner, Ziegen und Schafe und das Ganze ist zu einem zunehmend beliebten Touristenziel geworden.«
»Hört sich ganz interessant an«, meinte Jürgen, »aber was machst du denn dort?«
»Na ja«, sagte Bärger ein wenig verlegen, »eigentlich bin ich als Konservator angestellt, oder – wie es in meinem Arbeitsvertrag heißt – als ›Kurator‹. Das heißt, die ganze Anlage ist so konzipiert, dass auch wertvolle alte Gebäude aus dem Umland, die entweder baufällig sind oder aus anderen Gründen abgerissen werden sollen, dort abgebaut, rekonstruiert und hier wieder aufgebaut werden können – vorausgesetzt, dass sie historisch hierher passen. Dafür hatten sie lange Zeit einen Architekten aus Kopenhagen. Der hatte irgendwann keine Lust mehr und da habe ich jetzt diesen Job in Festanstellung übernommen.
Das fängt beim Aufmaß an, dann die Aufsicht beim Demontieren meistens sind es ja Fachwerkbauten – über den Abtransport bis zum Wiederaufbau im Centret. Aber die haben dort richtig gute Fachleute, die mit Liebe bei ihrer Arbeit sind. Ja, und weil nicht immer eine Baumaßnahme zu betreuen ist, mache ich in der Sommersaison auch Vorführungen im mittelalterlichen Bogenschießen für Touristengruppen und Schulklassen und ab und zu einen Kurs im Bogenbauen.«