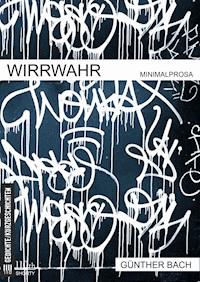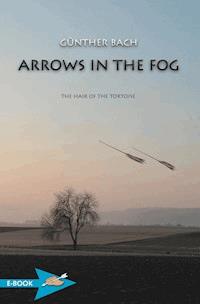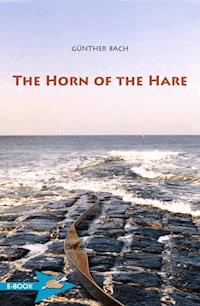Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hörnig, A
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nach seinem ersten Roman „Das Horn des Hasen“ erzählt uns Günther Bach nun den zweiten Teil der Geschichte um Rolf und Erhard. Auch in diesem Roman geht es wieder um die Faszination Bogenschießen, und um das Leben natürlich, das sich ständig verändert. Vor allem dann, wenn noch dazu eine Frau ins Spiel kommt. Die Fortsetzungen dieser Geschichte heißen: "Gegen den Strom" (2008) und "Das unsichtbare Ziel" (2011).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 373
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
GÜNTHER BACH
PFEILE IM NEBEL
ODER DAS HAAR DER SCHILDKRÖTE
ROMAN
VERLAG ANGELIKA HÖRNIG
Pfeile im Nebel
oder Das Haar der Schildkröte
von Günther Bach
© 2004 Verlag Angelika HörnigAlle Rechte vorbehalten.Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Formohne Genehmigung des Verlags reproduziertoder vervielfältigt werden.
Illustrationen: Günther BachZitat Seite 5: Hans Magnus Enzensberger,Vom Blätterteig der Zeit, aus:Die Elixiere der Wissenschaft © Suhrkamp VerlagFrankfurt am Main 2002Gedicht auf Seite 192: Hans Magnus Enzensberger,Das Einfache, das schwer zu erfinden ist, aus:Die Elixiere der Wissenschaft ©Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 2002Wir danken für die freundliche Genehmigung.
Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text- und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Umschlaggestaltung: AHA-Designnach einem Foto von Silke Lübbert
© 2012 eBookISBN: 978-3-938921-21-0
Verlag Angelika HörnigSiebenpfeifferstraße 18D-67071 Ludwigshafenwww.bogenschiessen.de
Offenbar sind die Zeiten vorbei, zu denen man glauben konnte, ein Leben auf der Höhe der Zeit ließe sich leben.
Hans Magnus Enzensberger
Denn das Leben gewährt keine Probeläufe, es findet statt – jetzt und hier.
James Ogilvy
1
Bärger packte ein.
Es war nicht viel, was er nach vier Jahren in der Firma in die beiden Bananenkisten zu stapeln hatte. Eigentlich, dachte Bärger, hätte ich das Alles gar nicht mehr mit mir herumschleppen müssen. Wann habe ich schon mal nachgesehen, na ja, Haustechnik war nie meine Stärke. Auch so eine Fehlinformation im Studium. Wie bei der Statik. Wie hatte der Professor gesagt – »Sie brauchen als Architekt von Statik nur soviel zu verstehen, dass Sie einem Statiker klarmachen können, was Sie von ihm wollen.«
Jawohl, Herr Professor, deine Klausuren sahen dann aber ganz anders aus!
War das lange her. Wie lange war das her?
Bärger hob den letzten Bücherstapel aus dem Wandschrank. Hochbaukonstruktionen, Bauentwurfslehre, der gute alte Neufert. 33. Auflage seit 1936 – seit er sein Studium in Dresden begann, war das Buch dreimal so dick geworden. Neufert, der Mitarbeiter von Gropius, Maßordnung, Standards und Normen, aber eben auch Bauhaus und Beginn des industriellen Bauens.
Wie verquer war doch all das verlaufen, wie sehr konnten blendende Ideen sich in ihr Gegenteil verkehren: Das Gropius-Konzept für die Siedlung in Dessau und der Plattenbau in Berlin, Hauptstadt der Tätärä. Und jetzt – die Tischleuchte von Wagenfeld, die Stahlrohrsessel von Breuer, Mies van der Rohe und Mart Stam, vor mehr als achtzig Jahren erdacht für den preiswerten Erwerb durch den normal verbrauchenden Bürger, heute die Nachbauten als exquisite Einzelstücke zu horrenden Preisen in den Ausstattungsläden der Schickeria. Bärger entfaltete den mehrseitigen auf Hochglanzpapier gedruckten Prospekt. Nicht einmal die Namen der Erfinder waren genannt. Da stand nur etwas von Top-Kreationen internationaler Designer – als ob sich der übrige Schrott mit den Leistungen von Mies und Mart Stam vergleichen ließe. Wie schön zeitgemäß dieser Nachsatz der Werbung: Ideal, um Ihre Liquidität zu erhöhen und Ihre Aufwendungen innerhalb kürzester Zeit steuerlich geltend zumachen! Hört sich doch viel besser an, als die These von Wagenfeld, dass die beste Eigenschaft der Dinge um uns her das Anspruchslose sein soll.
Durch die offene Tür hörte Bärger die Fahrgeräusche des Aufzugs, der nach unten fuhr. Erst jetzt bemerkte er die Stille in dem alten Eckhaus, in dem zu DDR-Zeiten die Handwerkskammer ihren Sitz hatte. Er sah auf die Uhr, es war spät geworden. Beim Blick aus dem Fenster bemerkte er die kleine Espressomaschine auf der Fensterbank, die er fast vergessen hätte. Es war noch genug von dem schwarzen Pulver in der Blechdose und als er die kleine dickwandige Tasse unter den Auslauf schob und dem gurgelnden Geräusch beim Einlaufen des Kaffees lauschte, überkam ihn denn doch so etwas wie Bedauern, dass es wieder einmal zu Ende war.
Es war eigentlich doch eine ganz schöne Zeit hier gewesen. Er mochte die großen Räume, die so hoch waren wie in den italienischen Renaissancepalästen.
Neben der Zeichenlampe stand die Schachtel mit seinen Visitenkarten. Er nahm sie, hielt sie einen Moment in der Hand. Dann ließ er langsam den ganzen Stapel in den Papierkorb rutschen. Eine einzelne Karte mit dem roten Firmenlogo und der Aufschrift »Chefarchitekt« flatterte auf den Boden. Er hob sie auf, zögerte und steckte sie dann die Hemdtasche.
Das war’s dann wohl, sagte Bärger laut.
Er war schon an der Tür, als das Telefon klingelte.
Bärger sah auf die Uhr, es war kurz vor zehn. Er schaltete die Zeichenlampe ein und griff nach dem Hörer.
»Bärger«, sagte er, »ich bin überhaupt nicht mehr da.«
Aber der Anrufer wollte es nicht zur Kenntnis nehmen.
»Bist du immer noch da? Ich habe es schon bei dir zu Hause versucht – was machst du eigentlich um diese Zeit noch im Büro?«
Es war Lothar, der Vorsitzende des Bauausschusses, gründlich und gewissenhaft wie immer. Hatte er schon wieder etwas vergessen? Bärger zog den Terminkalender unter den Lichtkegel der Lampe. Richtig, da stand es: Dienstag Besichtigung AKW, Termin 8 Uhr.
»Hallo, Lothar«, sagte er »ich mache, was alle im Büro machen, ich trinke Kaffee. Nein, ohne Mist, ich habe hier meinen letzten Kram eingepackt und wollte gerade nach Hause fahren. Alles klar, morgen um acht auf dem Parkplatz. Also dann – bis morgen.«
Er legte auf. Letztes Telefonat, dachte Bärger, hätte doch auch ein Wink des Schicksals sein können, ein Blick in die Zukunft. Dann schob er die beiden Kisten vor die Tür, schaltete die Lampe aus und verschloss die Tür.
Wie hieß es doch in dem spanischen Sprichwort: Wenn die eine Tür sich schließt, öffnet sich eine andere.
2
Noch war Sommer.
Aber schon begann das Laub der Sommerlinden gelb zu werden, färbten sich die Dolden der Ebereschen korallenrot und fielen die Äpfel am Morgen mit dumpfem Schlag in den taunassen Rasen.
Warum hänge ich mich hier schon wieder rein, dachte Bärger, als er auf den parkenden Wagen zuging. Ich habe noch nicht mal meinen Tee ausgetrunken und überhaupt ist das Ganze ziemlich sinnlos - als könnte ich ein stillgelegtes AKW begutachten.
Er hatte um Material gebeten, um Baupläne, aber außer einem Lageplan, den der künftige Investor beschafft hatte, war nichts zu erhalten gewesen. Es ist immer noch so, dachte Bärger, über Gebautes kann ich nur mit Papier und Bleistift in der Hand nachdenken.
Die Wagentür schwang auf und Bärger hob grüßend die Hand, als Lothar ihm zuwinkte. Korrekt wie immer, im hellgrauen Anzug und frischgebügeltem Hemd, die Krawatte etwas zu bunt, aber präzise gebunden. Bärger sah an sich herunter. Wenigstens sauber waren die Jeans ja, aber zu dem leichten Blazer trug er nur ein offenes dunkelblaues Hemd.
»Für wen hast du dich denn heute so fein gemacht,« wollte er wissen.
Lothar grunzte verärgert und fuhr den Wagen aus der Parklücke, bog auf die Straße ein und fädelte sich geschickt in den dichten Verkehr in Richtung Außenring ein.
Sie kannten sich lange genug, um eine Weile miteinander schweigen zu können.
Der Wagen fuhr über eine Brücke und eine mannshohe Brüstung reflektierte die Fahrgeräusche durchs offene Seitenfenster. Danach begann eine lange Steigung. Bärger schob sich im Sitz hoch, als ihm die Sonne ins Gesicht zu scheinen begann. Er blinzelte, schob den Sicherheitsgurt zur Seite und sah auf die Straße, die nun schnurgerade auf die Kuppe des Höhenzuges führte.
»Wie weit ist es eigentlich noch?«, wollte er wissen.
»Halbe Stunde oder so«, knurrte Lothar und schaltete in den niedrigeren Gang, ohne zu kuppeln. Nie würde ich das machen, dachte Bärger. Früher habe ich sogar noch Zwischengas gegeben beim Runterschalten, so wie ich es beim LKW-Fahren mal gelernt hatte.
Auf halber Höhe der Steigung wurde sichtbar, dass die Straße in weitem Bogen nach Westen schwenkte und eine Weile der Kammlinie folgte. Von oben fiel der Blick auf eine grüne Hügellandschaft mit einzelnen Baumgruppen. Am Horizont zeichnete sich das dunkle Band eines Nadelwaldes ab, hinter dem sich in gestuften Blautönen eine Reihe sanft gerundeter Berge staffelten.
Er sah nach vorn, als Lothar unvermittelt in einen Abzweig hineinfuhr und kurz darauf der Wagen in den Schatten eines Kiefernwaldes tauchte.
»Jetzt sind wir gleich da«, sagte Lothar, und als der Blick wieder frei wurde, sah Bärger in der Ferne hinter einem langgestreckten Flachbau die Kuppel des Kernreaktors.
Seitlich davon, auf einer kleinen Anhöhe, stand eine Gruppe von vier Kühltürmen, strahlend weiß gegen das tiefe Blau des Himmels.
»Was wirst du jetzt eigentlich machen?«
Bärger ließ sich tiefer in den Sitz rutschen und blickte zu Lothar, der konzentriert auf die Straße schaute. Licht und Schatten wechselten in rascher Folge im Rhythmus der großen Eschenbäume auf beiden Seiten der Fahrbahn.
Noch bevor der Geschäftsführer ihm die Kündigung auf den Tisch gelegt hatte, war ihm wiederholt das Angebot gemacht worden, weiterhin als freier Mitarbeiter bei der Firma zu verbleiben. Er wusste, warum. Sie brauchten ihn wegen der Zulassungsnummern in vier Bundesländern. Es ging um seinen Stempel, um die Vorlageberechtigung bei den Bauämtern, weil von seinen Mitarbeitern noch niemand die Zulassung der Architektenkammer besaß. Auch als sie ihm Geld anboten für Unterschrift und Stempel hatte er nur gegrinst und den Kopf geschüttelt. Sie werden schon noch jemand anderen dafür finden, hatte er gesagt, und war gegangen.
Was würde er jetzt machen?
»Ich habe mich erst mal als freier Architekt bei der Kammer eintragen lassen. Mal sehen, wie ich so zurecht komme. Für ein halbes Jahr habe ich noch mit einem Umbau zu tun und danach kann ich zumindest Bauüberwachung machen. Das ist zwar nicht mein Traumziel, aber man kann davon leben. Ich bin mit einem Statiker befreundet, der froh ist, wenn ich ihm etwas abnehmen kann.«
Am Rande einer Neubausiedlung standen auf einer von hohen Pappeln gesäumten Wiese die bunten Scheiben einer Bogenschießanlage.
»Hast du gesehen?« Lothar wies mit der Hand auf die ein wenig verwildert aussehende Anlage, deren Scheibenauflagen aber noch neu und wenig benutzt schienen.
»Ja doch«, sagte Bärger.
»Warst du nicht selber mal Bogenschütze?«, wollte Lothar wissen.
»Oh ja«, sagte Bärger und nickte mehrmals mit dem Kopf,
»oh ja, das war ich.«
»Und warum hast du damit aufgehört?«
Bärger schwieg eine Weile.
»Das ist keine gute Frage«, sagte er dann, »darüber müsste ich erst mal nachdenken.«
Wieder bog der Wagen ab auf eine betonierte Fahrbahn, es war die Zufahrtstraße zum AKW:
Obwohl seit Jahren stillgelegt, sah die ganze Anlage von Weitem erstaunlich gut erhalten aus. Ein dreigeschossiger Verwaltungsbau, dahinter die große Turbinenhalle, gleich daneben die Kuppel des Reaktors. Aber alles wurde überragt von der Vierergruppe der riesigen Kühltürme, die auf einer faltbandartigen und fast ornamental anmutenden Stützenreihe zu schweben schienen. Als ob sie mehr festgehalten als getragen werden müssten, dachte Bärger. Er spürte eine intensive Anziehung, einen förmlichen Sog beim Anblick der völlig maßstablosen geschwungenen Flächen, ein Gefühl, wie er es ähnlich beim ersten Anblick der Kapelle von La Ronchamp empfunden hatte.
Lautlos rollte der Wagen aus, hielt im Schatten einer Birke, während Bärger sich nicht von diesem Anblick lösen konnte. Die Stimme der Stadträtin riss ihn aus einem Zustand versunkener Betrachtung.
»Die stehen überhaupt nicht auf unserem Programm!«
Sie kam auf ihn zu, elegant wie immer, strahlte Frische aus und Energie. Ihre brandroten Haare waren in sorgfältiger Unordnung und ihre roten Pumps klapperten auf dem unpassend groben Beton. Hatte sich Lothar ihretwegen so in Schale geschmissen? Halt jetzt bloß das Maul, dachte Bärger, grinste freundlich und griff nach der dargebotenen Hand. Hinter ihr kam mit grämlichem Gesicht der ‘schwarze Robert’, wie Bärger den Mann von der PDS-Fraktion wegen seiner Vorliebe für schwarze Klamotten und seines ebenso schwarzen Vollbartes nannte.
Erst jetzt sah er ihren Wagen hinter dem verwilderten Gebüsch, das den ehemaligen Firmenparkplatz umgab.
Müssen mal eine Menge Leute hier gearbeitet haben, dachte Bärger. Er hatte sich immer vorgestellt, ein Atomkraftwerk würde mehr oder weniger automatisch oder doch nur mit einem Minimum an Personal betrieben. Auch das schien wieder mal ein Irrtum zu sein, denn offenbar war ein weit höherer Arbeitsaufwand für den Betrieb erforderlich, als aus überwiegender Wartung und Überwachung zu erwarten gewesen wäre.
Jetzt jedenfalls war alles menschenleer und still. Über den Dächern des Verwaltungsgebäudes begann die Luft in der zunehmenden Hitze bereits zu flimmern.
Hallend fiel eine Tür ins Schloss. Aus dem Verwaltungsbau kamen zwei Männer auf sie zu. Durch das offenstehende Tor neben dem unbesetzten Pförtnerhaus gingen sie den beiden entgegen. Halblaut sagte die Stadträtin die Namen der Männer, Investor und Makler, wie sich bei der Vorstellung zeigte. Ihre beiden Daimler standen im Schatten der Turbinenhalle, natürlich, sie trugen Krawatten zu weißen Hemden, natürlich, und die goldenen Uhren, die unter den weißen Manschetten sichtbar wurden, als sie die schwarzledernen Pilotenkoffer anhoben, waren Rolex, natürlich.
Wieso finde ich das eigentlich natürlich, dachte Bärger, es ist durch und durch unnatürlich. Allein, dass ich selber schon diese Statussymbole wahrnehme, dass ich weiß, wie eine Rolex aussieht, ist der Anfang einer Akzeptanz dieser absurden Gesellschaftsspiele.
Er sah einem Sperber nach, der über die Wiese nahe den Kühltürmen strich, rüttelnd verharrte und sich dann mit angelegten Schwingen fallen ließ. Kurz über dem hohen Gras breitete er die Flügel aus, fing den Sturzflug ab und stieß, die gespreizten Fänge voran, zwischen die dichten Halme.
Als Lothar nach ihm rief, war die Gruppe schon fast an der Tür.Bärger warf einen letzten Blick auf den Sperber, der inzwischen in Richtung des Waldes abstrich. Dann drehte er sich um und ging ihnen nach.
Es war verabredet, dass er an der Beratung nicht teilnehmen, sondern in dieser Zeit auf einem Rundgang durch Turbinenhalle und Verwaltungsgebäude eine Einschätzung des Bauzustandes vornehmen sollte. Er hatte erklärt, dass durch eine bloße Inaugenscheinnahme – keiner hatte an dem Begriff Anstoß genommen – nur eine sehr vorläufige Bewertung vorgenommen werden könne. Es waren aber alle darin übereingekommen, dass in dieser Phase der Verhandlung eine Übersicht über mögliche vorhandene Schäden völlig ausreichend sei. So hatte Bärger denn Kamera und Lasermessgerät an den Gürtel gehängt, das Notizbuch in die Hemdtasche geschoben und sich für anderthalb Stunden, wie er meinte, auf den Weg gemacht.
Da er bereits in dem Verwaltungsbau war, beschloss er, dort zu beginnen.
Zweibündige Anlage, trug er ein, Geschosshöhe 2,80 m, Abmessungen etwa 15 x 60 m, Flachdach – ich muss mir unbedingt die Dachdeckung ansehen. Bärger machte eine flüchtige Skizze, suchte und fand Messpunkte für den Entfernungsmesser und trug schließlich, zufrieden mit seiner Schätzung, die genauen Außenmaße ein. Am Giebel der Nordseite fand er eine Kellertreppe mit verschlossener Stahltür; den Lichtschächten nach zu urteilen war etwa ein Viertel des Baus unterkellert. TGA – Räume, dachte Bärger, Hausanschluss, Heizung, Elektro mit Stark- und Schwachstrom. Na ja, dachte er beim Blick auf den riesigen Reaktor, Energie müsste wohl immer ausreichend vorhanden gewesen sein.
Er sah sich den Sockelbereich an und fand auch hier keine Schäden aus aufsteigender Feuchtigkeit; der Putz war trocken und rissfrei. In der Kiesschüttung rings um das Gebäude wucherten dicke Polster von gelbem Mauerpfeffer.
An der Wetterseite war die Farbe der ehemals weißen Fassade ein wenig vergraut, Rotznasen hatten sich vom herablaufenden Wasser zu beiden Seiten der Sohlänke gebildet, aber das war alles normal und im Rahmen des üblichen Verschleißes. Rinne und Fallrohre waren intakt, nur in der Nähe des Südgiebels stand reglos in der Spätsommersonne ein kleine Birke auf dem Dach. Bei ihrem Anblick fiel Bärger die Dachdeckung ein und er stieg in dem halligen Treppenhaus hinauf in die dritte Etage, um nach einem Dachausstieg zu suchen. Als er gedankenlos nach dem Handlauf griff, wirbelte er eine Wolke grauen Staubes auf
Er fand den Ausstieg am Ende des Flures in Form in der Wand eingelassener Steigeisen, die zu einer Luke in der Decke führten.
Es war nicht schwer, den Deckel anzuheben, der durch eine Kette gesichert wurde und einen Moment später stand Bärger auf dem Dach. Er sah sich um. Die Deckschicht war eine hellbunte Kiesschüttung und trug erstaunlich wenig Bewuchs, wenn man von vereinzelten Polstern des Mauerpfeffers und der kleinen Birke am Giebel absah.
Die Anschlüsse an die Außenwände waren fehlerfrei, ebenso die Verkleidungen der Abluftrohre und Schächte – soweit erkennbar, notierte er einschränkend in sein Notizbuch. Dann schob er das Notizbuch zurück in die Tasche, setzte sich auf die blechverkleidete Haube des Abluftschachtes und schaute sich um.
Der Sperber war längst verschwunden, aber hinten am Waldrand schien ein großer Raubvogel zu kreisen.
Wie still es hier ist, dachte Bärger.
Er sah hinüber zu den Kühltürmen, die auch aus dieser Höhe noch als gestaltgewordene Mathematik seinen Standort weit überragten. Er würde hinübergehen, war Bärger sich sicher, auch wenn er nicht genau sagen konnte, warum. Aber vorher musste er sich wohl noch die Turbinenhalle ansehen.
Nach einem letzten Blick in die Runde stieg Bärger zurück in den Schacht, sicherte die Luke hinter sich und machte sich auf den Weg.
Wie erwartet, war auch die Schlupftür in dem riesigen Schiebetor unverschlossen. Er zog die schwer gängige Tür hinter sich zu. In der leeren Halle war das Geräusch wie ein lauter Schuss. Mit klatschendem Flügelschlag flatterten zwei Tauben von einem der stählernen Dachbinder auf und flogen nebeneinander aus einem der offenstehenden Fenster unterhalb des Kranbahnträgers. Staub flimmerte in den Lichtbalken, die durch die Oberlichtbänder in die Halle fielen.
Nichts erinnerte mehr an die Maschinen, die hier gestanden haben mussten. Vielleicht war zwischenzeitig schon eine andere Nutzung geplant worden und nicht zur Ausführung gekommen, denn nicht nur die Wände sahen wie frisch geweißt aus, sondern auch der mit Steinzeugfliesen belegte Boden zeigte keine merklichen Schäden. Bärger suchte nach Spuren der Maschinenfundamente, konnte aber außer einigen Unregelmäßigkeiten im Fugenbild der Platten nichts entdecken. Selbst die Kranbahn im östlichen Hallenschiff schien noch vorhanden. Aber soweit, auch deren Zustand zu untersuchen, ging seine Neugierde nicht.
Bärger notierte seinen Befund und auch die Vermutung, dass hier bereits vorbereitende Maßnahmen einer neuen Nutzung vorgenommen wurden. Das Dach werde ich mir schenken, dachte er, nachdem er einen Blick auf die Uhr geworfen hatte. Es zog ihn zu den Kühltürmen.
3
Wenig später verließ er die Halle, trat blinzelnd in den gleißenden Sonnenschein zurück, ging über den Werkhof und dann durch das hohe Gras den Türmen entgegen, als seien sie das eigentliche Ziel der Fahrt gewesen. Sie standen, wie sich beim Näherkommen zeigte, auf einer kleinen Anhöhe innerhalb des Firmengeländes, das von einem hohen Drahtzaun noch immer lückenlos umschlossen wurde. Reste eines von tiefen Radspuren zerfurchten Weges wurden unter dem Gras sichtbar.
Bärger folgte ihm bis auf ein Plateau, das scheinbar für den Bau der Türme planiert worden war.
Die Einbauten schienen auch hier längst entfernt zu sein. Jedenfalls konnte er zwischen den Stützenbändern hindurch, deren Höhe er auf ungefähr drei Geschosse schätzte, auf der anderen Seite das Gras der sonnenbeschienenen Wiese erkennen. Der Neigungswinkel der Stützen schien die Hyperbelkurve der Turmwände bis auf den Boden zu verlängern. Er sah hinauf zum oberen Rand des Turmes und ihn befiel ein Schwindel, weil sein Auge keinen Halt fand an der riesigen gewölbten Fläche, die sich vor ihm erhob.
Bärger ging näher heran, stieg auf den Rand des Ringfundamentes und trat dann zwischen den Stützen hindurch ins Innere des Kühlturms.
Trotz der immensen Größe des Raumes, innerhalb dessen er plötzlich stand, empfand er Beklemmung und Unsicherheit. Nein, nicht trotz, sondern wegen dieser enormen Ausmaße, wurde ihm schlagartig klar. Das Unmenschliche dieses riesigen Schlotes bestand ja wirklich im Fehlen jeden menschlichen Maßstabs. Er blickte nach oben, wo der glockenförmige Schacht sich in den blauen Sommerhimmel öffnete. Die Sonne schien in einem steilen Winkel durch die kreisrunde Öffnung, zeichnete einen scharf begrenzten Lichtschein auf die gegenüberliegende Innenwand und bis auf den Boden. Bärger versuchte, die Grenzlinie dieses leuchtenden Flecks, der aus der Deformation eines Kreises aus Licht bestand, dessen Strahlen auf die Innenseite einer Glocke aus Beton fielen, als geometrische Konstruktion nachzuvollziehen, aber es wollte ihm nicht gelingen. Es überstieg sein Vorstellungsvermögen.
Er griff nach der Kamera, um diese Figur wenigstens zweidimensional zu erfassen, aber der Weitwinkel reichte nicht aus für die Wiedergabe des gesamten Bildes. Der Gedanke, dass sich dieser Raum seiner messenden Wahrnehmung entziehen wollte, brachte ihn dazu, nach dem Lasermessgerät zu greifen. Da die gegenüberliegende Seite in hellem Sonnenschein lag, ging Bärger einige Schritt zur Seite, bis er meinte, gegenüber den roten Messpunkt im Bereich des Eigenschattens der Turmwand erkennen zu können. Er pfiff durch die Zähne. Das Display zeigte, was sein Auge verweigert hatte – ein genaues Maß von 42,53 m. Er versuchte mehrfach, den oberen Rand anzupeilen und glaubte schließlich der dritten Messung, die genau 53 m auswies.
Die Höhe am unteren Rand des Glockenmantels, den das schrägstehende Stützenband abfing, lag bei vier Metern, war also weit mehr als ein normales Geschoss hoch. Er stellte verwundert fest, dass es nichts mehr zu messen gab und gleichzeitig, dass diese Maße ihm nicht weiterhelfen konnten bei dem Versuch, diesen Raum zu erfassen.
Auch wenn er nicht recht wusste, warum, schrieb er die Maße in sein Notizbuch, schob die Hände in die Taschen der Jeans und begann, mit gleichmäßigen Schritten das Rund des Kühlturms abzuschreiten. Am Ausgangspunkt angekommen hatte er 220 Schritte gezählt, was mit der Messung übereinstimmen konnte. Auf einer begrenzten Teilfläche des glatten Betons, der sich innerhalb des Ringfundaments als ein flaches Becken absenkte, lagen kleine Haufen blauschwarz glänzender Schlacken, Reste von Schweiß- oder vielmehr Schneidarbeiten an Stahlteilen. Auch die Stellen, an denen beim Abtransport von sperrigen Teilen der eigentlichen Kühlanlage die Kanten der Stützen beschädigt wurden, waren unübersehbar. Aber außer einer zerbrochenen Holzpalette und dem mumifizierten Balg einer Saatkrähe war der riesige Raum leer.
Langsam ging Bärger bis in die Mitte, sah sich im Kreis um, dann nach oben und hatte plötzlich das Gefühl, dies runde Loch da oben, das in den Himmel zu führen schien, sei der eigentliche Ausgang. Eine Wolke schob sich über den Turmrand und wieder empfand er leichten Schwindel, weil seine Augen nicht unterscheiden konnten, ob Wolke oder Turm sich bewegte. Er setzte sich, wo er stand, an einem Punkt, den er für das Zentrum hielt, legte sich dann auf den Rücken und starrte in die Höhe, bis ihn die Augen schmerzten.
Als er die Augen schloss, hörte er das Geräusch des Windes. Er blieb eine Weile so liegen, bis er sich einer neuen Empfindung bewusst wurde: Ihm war, als würde er leichter und leichter, biser zu schweben begann. Unendlich langsam begann sein Körper zu kreisen, während er ebenso langsam höher und höher stieg, der Öffnung ins Licht entgegen.
Bärger fuhr auf, schüttelte heftig den Kopf und stellte sich breitbeinig aufrecht, bis das Gefühl des Taumelns sich verlor. Als er den Klang der Autohupe hörte, der sich mit kurzen Pausen wiederholte, wurde ihm klar, was ihn aus diesem seltsamen Wachtraum gerissen hatte. Er empfand ein Gefühl der Erleichterung, als er nicht allzu eilig zurückging zu den Anderen, die schon wartend bei den Wagen standen. Kurz vor dem Parkplatz aber drehte er sich noch einmal um. Wie ein abstraktes Zeichen und von seinem Standpunkt aus so genau diagonal, dass der nächststehende Turm den dahinterliegenden völlig verdeckte, stand die Gruppe der Betonriesen gegen den noch immer tiefblauen Himmel. Zeichen für was?
Ich finde es heraus, sagte Bärger zu sich selbst, hob die Kamera ein letztes Mal an diesem Tag und konnte nun wirklich im Sucher alles erfassen, was er sah. Dann ging er aber doch schnell auf die Runde der Vier zu, die ihn ungeduldig erwartete.
»Wie war doch gleich Ihr Name?«, fragte der Investor mit der Rolex, als er endlich verschwitzt und schmutzig bei der Gruppe angelangt war.
»Bärger«, sagte er freundlich »Rolf Bärger.«
»Wie der Berg?«, wollte der Investor wissen.
»Nein«, sagte er, und die ihn kannten, wussten, was nun kam, »mit ä; vorne B und hinten Ärger.«
Der Investor behauptete, von sich hören zu lassen und dann fuhren die beiden Daimler nacheinander davon. Aber auch Lothar meinte, sie hätten noch mehr zu tun und die Stadträtin wiederholte, dass sich niemand, aber auch wirklich niemand, für die Kühltürme interessiere. Was ja so denn auch nicht ganz stimmte, fand Bärger. Aber er behielt es lieber für sich.
Er sah hinüber zu Lothar, der unzufrieden den Kopf schüttelte, um sich dann mit einem entschlossenen »Na, komm schon!« hinter den Lenker fallen zu lassen und den Motor zu starten.
So richtig erfolgreich schien das Gespräch nicht verlaufen zu sein, aber Bärger war sich nicht sicher, ob Lothars schlechte Laune auf seinen ungeplanten Abstecher zu den Kühltürmen oder auf den Verlauf der Verhandlungen zurückzuführen war. Er hielt es für besser, nicht nachzufragen und wartete, bis Lothar von selbst zu reden begann.
»Was hältst du denn eigentlich von dem Typ?«, war nach einiger Zeit dessen erste Frage. Es konnte wohl nur der Investor gemeint sein.
»Was soll ich von einem Mann halten, den ich heute zum ersten Mal und im ganzen vielleicht fünf Minuten gesehen habe?« fragte Bärger zurück.
»Aber eigentlich hast du Recht – irgendwie sind die sich alle ähnlich, Makler wie Investoren. Man wird nie das Gefühl los, dass sie pokern und sich alle Mühe geben, ihre wirklichen Absichten nicht erkennen zu lassen. Das wirklich Merkwürdige an ihnen ist, dass die Klischees, die man schließlich von ihnen entwickelt hat, meistens zutreffen. Was ist es denn diesmal?«
»Er interessiert sich für die Halle und den Geschossbau, sagt aber natürlich nicht, wofür und will auch nur einen kleinen Teil des Geländes und außerdem ein neues Gutachten über mögliche Kontaminierungen im Reaktorbereich. Daran wird's wohl scheitern. Ich würde gerne wissen, was das kostet, wenn der mal abgerissen wird.«
»Also wieder ein Windei.«
Bärger sah aus dem Wagenfenster; schon war wieder die Ausfahrt zur Autobahn angezeigt. Speckgürtel war das hier nicht mehr, nach üblicher Maklerlesart, aber immerhin Autobahnnähe – ein starkes Plus.
Wie war doch gleich dieser Spruch, den sie so gern zum Besten gaben? Für eine Immobilie seien drei Dinge wichtig:
Erstens – die Lage, zweitens – die Lage und drittens – die Lage. Was mochte der wohl hier vorhaben?
Bärger fiel sein erster Job nach der Wende ein; eine Firma, die sich aus einem Institut der Bauakademie gegründet hatte und einen leitenden Architekten suchte. Eine merkwürdig unsichere und verunsichernde Zeit war das gewesen, in der man fremd war und sich fremd fühlte auch in ehemals vertrauter Umgebung. Damals begann, was er bis heute widerstrebend als Prämisse seines beruflichen Handelns übernommen hatte: Das Misstrauen. Und dazu gehörte auch die Akzeptanz eines gegenseitigen Misstrauens, das ihn zum Anfang schmerzlich getroffen hatte. Seit seiner Studentenzeit hatte er das Vertrauensverhältnis zwischen Bauherrn und Architekt für eine selbstverständliche und unabdingbare Basis der Zusammenarbeit gehalten. Nur auf dieser Grundlage, so hatte er geglaubt, könne eine Bauaufgabe erfolgreich gelöst werden. Aber es war so sehr anders geworden, dass es ihm manchmal die Sprache verschlug im Umgang mit seinen Bauherren.
Die Rolle, in die er sich als Architekt gedrängt sah, war die eines überflüssigen und in jedem Fall viel zu teuren Fachidioten, dessen Unterschrift und Stempel unter Zeichnungen und Formulare man aber benötigte, um die Baugenehmigung zu erlangen. Er hatte noch keinen erlebt, der nicht bis zur Farbe der glasierten Ziegel und der Form der Fenstersprossen gewusst hätte, wie sein Haus auszusehen habe.
Nach anfänglichen Versuchen einer sach – und lagebezogenen Einflussnahme hatte Bärger es aufgegeben, die aus Wohnmagazinen und Katalogen übernommenen Vorstellungen zu beeinflussen.
Es war mühsam genug, die gültigen Vorschriften der Bauordnung als Voraussetzung einer Baugenehmigung zu erklären und in die Planung einzuarbeiten. Besonders aufwändig war es dann, wenn die Rolle des Bauherren zwischen Ehepaaren zum Streitobjekt wurde. Er erinnerte sich an den Umbau eines kleinen Einfamilienhauses – eingeschossig, mit ausgebautem Dach – für das er schließlich acht verschiedene Entwürfe geliefert hatte, die sich tatsächlich substantiell voneinander unterschieden. Aber abgesehen von dieser Erkenntnis der Verwandlungsmöglichkeiten eines so kleinen Hauses war der Aufwand in Relation zum Honorar unangemessen hoch ausgefallen. Selbst nach der Einigung seiner beiden Bauherren auf die letzte Variante hatten sie nachträglich doch wieder verändert, obwohl er sie darauf hingewiesen hatte, dass dadurch der bereits abgeschlossene Werkvertrag und der damit verknüpfte Bauablaufplan ausgehebelt wurden. Bärger vermutete allerdings, dass der Chef des Baubetriebes selbst die Situation erkannt und geschickt ausgenutzt hatte.
Nein, es kränkte ihn nicht mehr, wenn man ihm die Absicht der – wie hieß das doch so schön – Vorteilsnahme unterstellte. Zu einem Mitarbeiter des Hochbauamtes hatte Bärger am Rande einer Beratung im Scherz einmal erklärt, er sei hochgradig bestechlich – nur hätte bis heute leider nie jemand davon Gebrauch gemacht. Aber der Mitarbeiter war sehr befremdet und hielt die Bemerkung scheinbar nicht für ein geeignetes Gesprächsthema.
Misstrauen also, gegenseitiges Misstrauen, war die Basis seines Handelns geworden. Eine Basis, der man selbst misstrauen sollte, fand Bärger. Vielleicht so: Man sollte nicht von vornherein ausschließen, dass jemand auch ehrlich meinen könnte, was er sagt.
Inzwischen rollte der Wagen längst wieder auf der Autobahn in Richtung Berlin.
»Hast du schon darüber nachgedacht?«, wollte Lothar wissen.
»Noch nicht«, sagte Bärger, und wusste, was gemeint war. Aber es bestand ein Zusammenhang zwischen dem, was ihm gerade durch den Kopf ging und der Frage, warum er das Bogenschießen aufgegeben habe.
»Es war einfach so, dass ich es noch einmal packen wollte. Ich hatte ja in den letzten Jahren nur noch als Designer gearbeitet, weil ich die Schnauze vom Bauen voll hatte. Oder nein, nicht vom Bauen, – von der Bauplanung als Mitarbeiter eines ›staatlichen Leiters‹, der immer ein Genosse war und deshalb immer unfehlbar wusste, was richtig und was falsch war, gleich, worum es ging. Aber wem erzähle ich das!«
Lothar hockte entspannt hinter dem Lenker und hörte zu. Jetzt nickte er zustimmend, hakte aber beharrlich noch einmal nach. »Hattest du denn überhaupt keine Zeit mehr?«
Wieder dachte Bärger eine Weile nach.
»Na ja«, gab er schließlich zu, »ich habe eine ganze Weile gebraucht, bis ich die neuen Spielregeln kapiert hatte. Täglich mit einer Krawatte zur Arbeit zu gehen war ja noch das Wenigste. Immer die Bürotür zum Flur offen zu lassen, mich auf dem Flur nur im Laufschritt zu bewegen und prinzipiell Überstunden zu schieben, gehörte auch dazu. Was ich mir nicht angewöhnen konnte, waren diese Sprüche, die ich bald nicht mehr hören konnte: ›Es rechnet sich nicht!‹ oder ›Wir arbeiten daran!‹ – das war die kapitalistische Variante zu unserem ›Es geht seinen sozialistischen Gang!‹, was ich genau so beschissen fand.«
Plötzlich fiel es ihm ein.
»Weißt du, was es war?«, sagte Bärger, »ich habe einfach keinen mehr wiedergesehen. Ich habe seit mehr als zehn Jahren keinen von denen mehr wiedergesehen, mit denen ich damals trainiert habe.«
Nach einer Weile fügte er hinzu: »Und der, von dem ich am meisten gelernt habe, war schon lange vorher nicht mehr da.« Erhard, dachte Bärger, und die Erinnerung an eine Insel in der Ostsee, die sich für ihn untrennbar mit Pfeil und Bogen verband, überfiel ihn mit schmerzlicher Klarheit. Aber hergegeben hatte er ihn nicht, seinen Bogen, obwohl einige scharf darauf waren. Er hatte ihn mitgenommen auf zwei Umzügen, sorgfältig aufbewahrt und sicher verstaut. Warum eigentlich?
Ob er ihn wohl noch spannen konnte bis zum Ankerpunkt? Was geschah mit einem Bogen, der nicht mehr geschossen wurde? Würde er brechen oder könnte er wieder eins werden mit diesem Stück verzauberten Holzes, das in seiner Hand Leben bekam?
Es drängte ihn nach Hause, und er sah auf die Uhr, um die verbleibende Fahrzeit einzuschätzen.
»Hast du heute noch was vor?«, wollte Lothar wissen.
»Oh ja«, meinte Bärger, »ich muss mich noch vorbereiten. Heute Abend ist wieder Japanisch-Kurs in der Volkshochschule.«
Lothar pfiff durch die Zähne.
»Alles wegen der Reise?«
Bärger nickte.
»Wann geht es denn los?«
»Übermorgen«, sagte Bärger.
4
Es war Zeit genug nach dem Duschen, nicht nur für eine Kanne grünen Tees in aller Ruhe.
Gleich nach der Rückkehr war Bärger in den Keller gegangen, wo im Regal unter einem Stapel alter Fachzeitschriften der schwarze Koffer mit seinem Bogen lag. Nach kurzem Suchen hatte er auch in einer Ecke die Zeichenrolle mit den Pfeilen gefunden. Mit einem feuchten Lappen hatte er den Staub abgewischt und Bogenkoffer und Rolle vor sich auf den Tisch gelegt.
Er hielt die flache Teeschale in beiden Händen, starrte auf den schwarzen Koffer und konnte sich nicht entschließen, ihn zu öffnen.
Was soll das, dachte Bärger, ich habe Wichtigeres zu tun. Das alles ist längst vorbei und wahrscheinlich kann ich ihn gar nicht mehr spannen. Aber je mehr er sich dagegen sträubte, umso mehr wurde ihm bewusst, dass er sich gegen etwas zur Wehr setzte, das eindeutig von diesem Ding in dem schwarzen Koffer da vor ihm ausging, das in guten Stunden fast so etwas wie ein Teil von ihm selbst geworden war.
Er setzte die Teeschale ab, zog mit beiden Händen die Reißverschlüsse auf und schlug den Deckel des Koffers zurück. Mattglänzend lag das rotbraune Bogenholz zwischen den grünen Schaumstoffpolstern, die in den Jahren vergilbt und brüchig geworden waren. Sehne und Wurfarme waren dabei, sogar ein abgeschabter Felltab lag in einer der Aussparungen der Polsterung.
Zögernd griff Bärger nach dem Mittelteil, schloss die linke Hand um den Pistolengriff und hob sie langsam in Augenhöhe. Er peilte über das Bogenfenster einen Punkt an der Wand an und versuchte, sich an das Bild einer bunten FITA-Scheibe zu erinnern. Aber es stimmte nicht, nicht einmal mit dem Torso von einem Bogen in der Hand, im Sitzen über das Shelf zu peilen. Bärger stand auf, setzte die Wurfarme ein und zog die Verschraubung fest. Als er nach der Sehne griff, wurde ihm bewusst, dass er vergessen hatte, wie sie einzulegen war. Er versuchte sich zu erinnern, aber es wollte ihm nicht einfallen. Erst als ihm im Bogenkoffer der Spanngurt ins Auge fiel, begann sein Gedächtnis wieder zu arbeiten. Er legte den Gurt um den linken Fuß, hakte den unteren Wurfarm mit der eingelegten Sehne ein und zog den oberen Wurfarm über die Schulter nach vorn, bis er die Sehne einhängen konnte.
Jetzt war es wieder ein Bogen, was er in der Hand hielt. Langsam und vorsichtig begann er, die Sehne Stück um Stück zu ziehen, nachzulassen, zu ziehen, bis er es endlich wagte, den Bogen voll zu spannen und für zwei, drei Sekunden am Kinn zu ankern. Es ist nicht mein Kopf, der sich erinnert, dachte Bärger. Es ist mein Körper, der den Bogen wiedererkennt.
Er legte den Bogen vor sich auf den Tisch, setzte sich und sah verwundert auf seine Hände, als hätte er es ihnen nicht zugetraut. Es war wie das Schließen eines Kreises gewesen, wie das Vollenden zu etwas Ganzem, als er den Bogen ganz gespannt hatte und die Kraft spürte, die von der Bogenhand über Arme und Schultern zur Pfeilhand floss.
Spannung? Ja, natürlich Spannung – Spannung, die sich lösen wollte im Schuss, die den Impuls auf den Pfeil geben wollte, um ihn auf den Punkt zu schicken, wo sich zeigen musste, ob alles richtig war.
Kein Zweifel, der Bogen war intakt. Kein Zweifel auch, dass er ihn noch spannen konnte. Und seit eben auch kein Zweifel mehr daran, das er ihn wieder spannen wollte. Es steckt noch alles drin, dachte Bärger.
Er berührte die Rolle mit den Pfeilen, lauschte auf das leise Klappern. Es hat nicht aufgehört, es hat auf mich gewartet. Aber ich hätte es fast vergessen.
Bärger ging in die Küche, schaltete den Wasserkocher an und wartete, bis das Wasser zu summen begann. Dann schaltete er ab, wartete wieder, bis das Wasser im Kessel still wurde. Langsam goss er es in das winzige Kännchen, das Form und Größe eines kleinen Apfels hatte, bis das Wasser über den Rand der Kanne lief. Er warf einen Blick auf die Armbanduhr und wartete genau achtzig Sekunden, während er gedankenlos die schlichte rotbraune Kanne betrachtete, die vom langen Gebrauch einen matten Glanz angenommen hatte. Dann goss er eben so langsam und vorsichtig den Tee durch ein Bambussieb in die flache weiße Schale. Erst darin schien der Tee seine Farbe anzunehmen; ein leichtes duftiges Grün, das sich zum Rand der Schale hin gelblich aufhellte.
Mit beiden Händen nahm Bärger die volle Schale, hob sie gegen das Fenster, um die edle spannungsvolle Silhouette zu betrachten, und trank sie dann langsam mit geschlossenen Augen in einem Zuge leer.
Es war Zeit geworden, seine Bücher und das Übungsheft einzupacken. Bärger spülte die Teeschale aus und stellte sie behutsam auf ein zusammengefaltetes Küchentuch. Dann ging er zurück ins Zimmer, entspannte den Bogen, nahm die Wurfarme ab und legte die Teile in den Koffer zurück. Nicht für lange, so nahm er sich vor.
Nach einem Blick auf die Uhr setzte er sich noch einmal an seinen Arbeitstisch, um auf die Tabelle mit den Schriftzeichen der japanischen Silbenschrift zu schauen. Er hatte sie in Augenhöhe vor sich an die Wand gepinnt, um sie immer im Blickfeld zu haben. Aber es schien nichts zu nützen. Es ist zum Verzweifeln, dachte Bärger, warum bin ich nur außerstande, mir das einzuprägen. Die Japanerin, die den Kurs leitete, hatte erzählt, dass die Kinder in Japan mit fünf Jahren anfingen, Hiragana zu lesen. Ihm fiel ein, dass er selbst in der Schulzeit an nur einem Tag das Alphabet der phönizischen Keilschrift erlernt hatte, gemeinsam mit einem Klassenkameraden. Er konnte es heute noch. Damals hatten sie sich während des Unterrichts Zettel geschrieben und sich beim Austausch erwischen lassen, um sich über die hilflosen Gesichter der Lehrer zu freuen, die mit den rätselhaften Zeichen nichts anzufangen wussten.
Lange vorbei, dachte Bärger. Jetzt beneidete er die drei Gymnasiastinnen, die die vorderen Bänke im Klassenraum der Volkshochschule belegt hatten und mit spielerischer Leichtigkeit die komplizierten Zeichen reproduzierten. Ihm selbst half sein gutes Gehör, mit dem er auch Feinheiten der Aussprache aufnahm, das Gehörte korrekt wiederzugeben. Aber an der Schrift verzweifelte er fast. Wieder und wieder hatte er versucht, die komplizierten zusammengesetzten Zeichen in irgendein System zu bringen, eine einprägsame Ordnung, aber es war ihm nicht gelungen. Hiragana blieb für ihn ein visuelles Chaos. Muss was dran sein, dachte Bärger, dass die Europäer, die perfekt japanisch können, von den Japanern für verrückt gehalten werden.
Jetzt war es aber wirklich Zeit geworden. Er schob die Bücher, das Vokabelheft und die Übungskladde in seine alte rindlederne Schultertasche, die, wie er fand, in jedem Jahr schöner geworden war, schloss die Wohnungstür hinter sich und machte sich auf den Weg zur Haltestelle der Straßenbahn.
Es war eine sehr gemischte Truppe, die sich da allwöchentlich in den Räumen des alten Gymnasiums traf, um gemeinsam japanisch zu lernen. Zu Beginn hatten sich alle vorgestellt, Namen und Beruf genannt und ihren Sprachwunsch begründet.
Ein Polizist war dabei, der seine Sprachkenntnisse dienstlich einsetzen wollte oder sollte und ein Feuerwehrmann, der sich für die Geschichte der Samurai und insbesondere für Schwerter interessierte. Neben Bärger saß ein Ehepaar, das gemeinsam eine Kampfkunstschule betrieb. Ein Rentner, der nach der dritten Lektion aufgegeben hatte, konnte nicht so recht begründen, warum er gekommen war. Außer den drei Schülerinnen, die die erste Bankreihe belegt hatten, nahmen noch zwei Gymnasiasten aus anderen Schulen teil, die erklärten, sich auf ein Sprachstudium vorbereiten zu wollen. Er war der Einzige, der als Begründung eine bevorstehende Japanreise nannte und deswegen lebhaft beneidet wurde.
Es war ihm ziemlich schnell klar geworden, dass er in der kurzen Zeit seiner Kursteilnahme keine ausreichenden Sprachkenntnisse erwerben würde, um sich damit auch nur ansatzweise in der Landessprache verständigen zu können. In den Städten, so hatte die Lehrerin erzählt, sei es unproblematisch, sich auf englisch zu unterhalten; die Leute auf dem Lande würden aber in der Regel nur japanisch sprechen. Nur eins half ihm ein wenig über seine Enttäuschung, als sie nämlich erklärte, dass die Japaner es zu schätzen wüssten, wenn ein Ausländer – ein Gai-Jin – nicht nur die üblichen Umgangsformen beherrschte, sondern darüber hinaus auch die wichtigsten Höflichkeitsformen in Worten ausdrücken konnte.
So konzentrierte sich Bärger weiterhin auf eine korrekte Aussprache und die komplizierten Rituale von Vorstellung, Begrüßung und Verabschiedung in Verbindung mit den dazugehörigen und je nach Anlass zu variierenden Verbeugungen.
Die heutige Lektion befasste sich mit Shopping in Japan, wurde aber wie jede vorangegangene mit einer Leistungskontrolle eingeleitet, deren Tempo und Konsequenz ihn unangenehm an die an die längst vergangene eigene Schulzeit erinnerte. Nach alldem, was er darüber gehört und gelesen hatte, musste es in Japan genauso zugehen. War er einfach schon zu alt für diese Art des Paukens? Er hatte ja dafür bezahlt, sich hier wie ein Schuljunge behandeln zulassen und vermutlich war die Methode auch wirklich effizient. Aber er mochte es einfach nicht und er mochte auch den überlegenen Spott der Gymnasiasten nicht, die sich offen über die unbeholfenen Ausspracheschwierigkeiten der älteren Kursteilnehmer lustig machten.
Was ihm aber ernstlich zu denken gab, war seine offensichtliche Unfähigkeit, sich die dreiundzwanzig Schriftzeichen des Hiragana, der japanischen Silbenschrift, einzuprägen. Es traf ihn besonders deshalb, weil er immer geglaubt hatte, ein besonders gutes visuelles Gedächtnis zu haben. Aber vor dieser Aufgabe versagte es schlicht und einfach. Bärger spürte, dass er bereits so etwas wie eine Abneigung gegen die Zeichen zu entwickeln begann. Allein die Tatsache, dass ein Volk drei verschiedene Schriften neben- und auch untereinander verwendete, schien ihm absurd bei dem gleichzeitigen bedingungslosen Bekenntnis zur modernen, technologisch orientierten und auf äußerste Rationalität bedachten Arbeitsumwelt.
Yoshiko-San, die Lehrerin, hatte auf seine entsprechende Frage hin erklärt, dass der Ursprung der Hiraganazeichen in einer Weiterentwicklung der chinesischen Schriftzeichen als eine phonetische Schrift in Form von Silben liege. Das mochte die ihm oft bizarr erscheinenden Formen der Zeichen erklären, machte ihr Erfassen aber keineswegs leichter.
Merkwürdig schien ihm dagegen, dass er zu den eigentlichen chinesischen Schriftzeichen – dem Kanji – eine bessere Beziehung gefunden hatte. Da er nie den Ehrgeiz entwickeln wollte, einige Tausend dieser ursprünglich aus Bildzeichen entstandenen grafischen Gebilde zu erlernen, war ihm zu einzelnen dieser als Radikale bezeichneten Formen ein zwangloser Zugang möglich geworden. Das war aber schon lange vor seinem Bemühen um die japanische Sprache und mochte daran gelegen haben, dass er zu diesem Zeitpunkt bereits so intensiv mit Geist und Technik der chinesischen Tuschmalerei vertraut war, dass ihm das Einfügen der Schriftzeichen in seine Tuschbilder wie auch kalligrafische Übungen zum entspannenden Vergnügen geworden war. Nein, die klassischen Formen der Kanji mochte er, aber mit der daraus abgeleiteten Schnellschrift konnte er nun einmal nichts anfangen.
»Bärger-San«
Die Stimme der Lehrerin holte ihn zurück in die Gegenwart. Nach einem letzten Blick in sein Übungsheft stand er auf, ging zur Tafel und schrieb ohne zu zögern den verlangten Satz an die grüne Fläche. Aber schon als er, den Kreidestaub von den Händen reibend, an seinen Platz zurückging, wusste er, dass er morgen alles wieder vergessen haben würde.
Die Lektion ging weiter, in dem zügigen Tempo, das Yoshiko-San für angemessen hielt. Bärger gestand sich ein, nur deshalb noch nicht aufgegeben zu haben, weil er vor den Gymnasiasten nicht zugeben wollte, dass er mit dieser Art des Lernens an seine Grenzen gestoßen war.
Präzise mit dem Pausenzeichen war die Lektion beendet. Die Hausaufgaben notierte er in die Kladde, mit dem Vorsatz, sie am nächsten Morgen zu erledigen.
»Keine Schularbeiten mehr, Bärger-San!«
Vor ihm stand lächelnd Yoshiko und streckte ihm die Hand entgegen. Bärger stutzte einen Moment, bevor er begriff. Dann stand er auf, verneigte sich und griff nach ihrer Hand.
»Ich wünsche eine schöne Reise nach Japan«, sagte Yoshiko förmlich, »Sie werden das Herbstlaub in den Wäldern von Kyoto sehen.« Es klang ein wenig sehnsüchtig. Aber dann sagte sie, wieder lächelnd: »Ihre Verbeugung war zu tief für eine einfache Lehrerin, Bärger-San. Kommen Sie gesund wieder!« Damit ging sie schnell aus dem Klassenzimmer.
Auf dem Weg zur Haltestelle der Tram dachte Bärger an seine bevorstehende Reise. Er hatte den Reiseführer ausführlich studiert, hatte herausgefunden, dass die geplante Route alle kulturell bedeutenden Orte Mittel- und Südjapans berührte und war ein wenig in Sorge, ob die Zeit für eine gründliche Besichtigung reichen würde.
Er erinnerte sich an eine Cypernreise im November vor zwei Jahren, an die leerstehenden Hotelburgen am Strand, an die verdorrte Vegetation und an den Geruch der brennenden Abfallhaufen am Rande der Stadt. Besonders aber erinnerte er sich an das Desaster eines Abstechers von Cypern nach Kairo. Es war das Angebot einer örtlichen Reederei, eine Zweitagestour mit dem Schiff nach Alexandria. Hin- und Rückfahrt fanden während der Nachtstunden statt. Der Luxusliner legte am Morgen in Alexandria an; von dort ging es ohne Aufenthalt in den bereitstehenden Bussen auf einer Autobahn sechs Stunden lang durch eine trostlose Landschaft bis nach Kairo. Der größte Teil der Trasse verlief parallel zum Suezkanal, gelegentlich kamen über dem Uferschilf die Aufbauten oder auch nur die Schornsteine eines vorbeifahrenden Schiffes in Sicht.
Kairo erwies sich als eine Großstadt mit endlosen Vorstädten, es ging quer hindurch bis nach Gizeh.