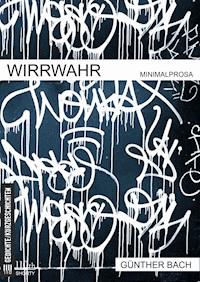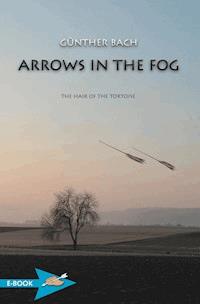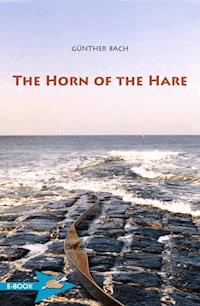Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hörnig, A
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein verregnetes Wochenende auf einer Insel, ein Mann ist verschwunden, ein Einbruch in ein Haus, Rätsel und versteckte Hinweise. Ruhig erzählt und doch spannend wie ein Krimi. Der Roman über die Faszination des Bogenschießens und wie es die Menschen verändern kann. Die Fortsetzungen dieser Geschichte heißen: "Pfeile im Nebel" (2004), "Gegen den Strom" (2008) und "Das unsichtbare Ziel" (2011).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 210
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Günther Bach
Das Horn des Hasen
Roman
© 2000 Verlag Angelika Hörnig
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne Genehmigung des Verlages reproduziert oder elektronisch vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlaggestaltung: Angelika Hörnig Illustrationen: Günther Bach
© 2012 eBook ISBN: 978-3-938921-20-3
Verlag Angelika Hörnig Siebenpfeifferstr. 18
„Vielleicht sind Gefühle etwas Unsicheres, aber es hilft nichts, man muss sich schon auf sie verlassen.“
Johannes Bobrowski
Vorwort
Als dieses Buch geschrieben wurde, gab es in dem Teil Deutschlands, in dem ich damals lebte, keine Möglichkeit, es drucken zu lassen. Das Manuskript lag fast zwanzig Jahre lang in einer Schublade, und nur gelegentlich warf ich einen Blick auf die mit der Zeit brüchig werdenden Seiten. Aus heutiger Sicht erscheint es mir schwierig, die Umstände begreiflich zu machen, unter denen die Menschen in jenem Teil Deutschlands lebten, der sich wie zum Hohn als demokratisch bezeichnete.
Als der zweite Weltkrieg zu Ende ging, war ich zehn Jahre alt. Ich war aufgewachsen in einer kleinen, 900 Jahre alten, durch viele mittelalterliche Bauten geprägten Stadt, mit vielen gotischen Backsteinkirchen, die im Krieg von den Bomben verschont worden waren. Das Ende dieser trotz des Krieges ruhigen Kindheit kam zusammen mit dem Ende des Krieges, mit den weißen Fahnen an den Fenstern und mit den leeren Straßen, durch die Jeeps und amerikanische Panzer rollten.
Die Amerikaner zogen bald ab. Ihnen folgten die Russen, denen für viele in der Stadt Angst und Schrecken vorausgingen. Schon damals begannen die ersten, sich aus Furcht vor dem Kommenden in den Westen Deutschlands zu flüchten. Wir verblieben in der sowjetisch besetzten Zone, aus der vier Jahre später die sogenannte Deutsche Demokratische Republik wurde.
Meine Heimatstadt lag nur hundert Kilometer von Berlin entfernt. Berlin wurde damals für viele zum letzten offenen Ausweg, wenn es nicht mehr weiterzugehen schien. Es war gut, zu wissen: Wenn man es nicht mehr aushalten konnte, wenn man sich nicht mehr zufrieden geben wollte mit der Enge und Verlogenheit dieses Überwachungsstaates, in dem ein Fortkommen nur möglich war durch Mitgliedschaft in der Staatspartei, wenn man diese dumpfe Selbstzufriedenheit des regierenden Mittelmaßes nicht mehr zu ertragen bereit war, dann konnte man immer noch in das mitten in diesem Staat liegende Berlin fahren, sich in die Stadtbahn Richtung Westen setzen und war gleich darauf in der Freiheit.
Dann aber kam der 13. August 1961, der Tag des Mauerbaus in Berlin. Zu dieser Zeit strömten täglich viele tausend Menschen aus der DDR über Westberlin in die Bundesrepublik Deutschland, und es waren oft die Besten, die gingen.
Zur gleichen Zeit hatte ich mein Studium der Architektur an der technischen Universität Dresden beendet und saß über meiner Diplomarbeit. Als ich bald danach mit dem Diplom in der Tasche nach Berlin kam, war die Grenze bereits dicht. Fremd in dieser Stadt und ohne Freunde und Menschen, denen ich vertrauen konnte, fand ich nirgendwo mehr ein Loch in der Mauer. Der Weg in die Freiheit schien endgültig versperrt. Je perfekter jedoch die Grenzsicherungen um diesen Staat wurden, umso einfallsreichere Formen nahmen die Fluchtversuche der Menschen an. All diese verzweifelten Aktionen galten als Verbrechen und wurden mit vielen Jahren Zuchthaus bestraft. Später erteilte das Regime den Grenztruppen den Befehl, auf Flüchtlinge zu schießen. Es ist nie genau festgestellt worden, wie viele Menschen dabei den Tod fanden. Aber immer wieder fanden Einzelne den Weg in die Freiheit.
Nachdem ich viel später begriffen hatte, dass auch meiner beruflichen Entwicklung enge Grenzen gesetzt waren, weil ich die Mitgliedschaft in der staatlichen Einheitspartei ablehnte, begann ich wie viele in diesem Land nach einer Sache zu suchen, die mein vorbehaltloses Engagement wert war. Ich fand sie in der chinesischen Tuschmalerei und im Bogenschießen.
Es ist diese Zeit, über die ich in meiner Erzählung berichte. Ich sehe sie heute auch als ein Zeichen dafür, dass ein Mensch nicht leben kann in der ausschließlichen Ablehnung seiner äußeren Lebensumstände. Vielleicht kann man es so sagen: Es ist besser, für eine Sache zu sein, als sich gegen alles aufzulehnen. Wichtig ist nur, eine Sache zu finden, für die zu leben sich lohnt.
Günther Bach
1
Hinter den letzten Häusern verlor sich der Weg im Schnee. Den Hang hinauf hatte der Wind die Böschung des steilen Einschnittes verweht und auch die Weinrosenhecken übergangslos unter einer hohen Schneewehe vergraben. Blaue Schatten lagen in der einzelnen Spur, die auf den Hügel führte. Sie lief bis vor das einzeln stehende Haus auf der Hügelkuppe und von dort weiter in einem flachen Bogen in Richtung zum Walde. Auf der Schwelle lag hochgeweht lockerer Schnee. Rings um das Haus war die weiße Fläche unberührt. Kalt und schwarz sahen die Fenster in den klaren Tag. Ein Windstoß ließ eine kreiselnde Fahne Pulverschnee glitzernd von der Dachkante stäuben. Die kahlen Zweige der Birke schlugen raschelnd gegeneinander. Über den schmalen Waldstreifen am Steilufer flog mit taumelndem Flügelschlag eine Krähe. Der Blick zurück über das Dorf zeigte senkrecht aufsteigende weiße Rauchfahnen über den Dächern, die in Höhe der verstreuten Baumgruppen zerflossen. Weit hinten auf dem Bodden zog das Mittagsschiff nach Stralsund einen weißen Streifen Kielwasser hinter sich her. Kalt war auch das Licht, das auf den flachen Wellen des Boddens spielte.
Ende März schien der Winter noch einmal zurückgekommen zu sein.
Es war ohnehin schwierig, zu dieser Zeit im Dorf nicht aufzufallen. Im Sommer kamen die Besucher zu Hunderten täglich, um über die Hügel zu wandern, die wenigen Gaststätten zu belagern, in den Baracken und Andenkenbuden billige Souvenirs zu kaufen und am Strand zu baden. In der Menge war man unbeobachtet.
Aber jetzt?
Die freie Lage des Hauses ließ niemanden ungesehen in seine Nähe gelangen. Es unbemerkt zu betreten, war unmöglich. Vorher schien alles klar und einfach: Bei Dunkelheit an der alten Schmiede vorbei hinter dem Dorf den Weg zwischen Wald und Hügeln zu nehmen und von der Rückseite her zwischen Ginster- und Sanddornhecken bis zum Schuppen zurückzugehen.
Vom Dorf her konnte man nicht gesehen werden.
Aber nun war da der Schnee, der jede Fußspur sichtbar machte. Wenn der Schnee liegen blieb, war die Fahrt vergeblich. Vier Tage – ein verlängertes Wochenende – mehr Zeit war es nicht, um zu erfahren, was geschehen war.
2
Er war etwa seit Ende September verschwunden. Wahrscheinlich war es gar nicht gleich bemerkt worden.
Er verbrachte regelmäßig vier Wochen Urlaub im Ausland, meist allerdings in der Hauptsaison, um den Besuchern aus dem Weg zu gehen, die ihn – teils aus Neugierde, teils als Quartiersuchende – sogar auf seinem Grundstück störten. Der niedrige Drahtzaun, der, an den Weg grenzend , das Grundstück auf der Kuppe umschloss, wurde von vielen ignoriert, der Plattenweg zum Haus als Aufforderung zum Betreten missverstanden. So schloss er sich oft ein und reagierte selten auf Klopfen und Rufen. Man musste angemeldet sein, wenn man ihn treffen wollte.
Nach Süden zu neigte sich der Hang in eine flache Senke, stieg dann wieder an und fiel erneut in einer sanften Neigung in Richtung zum Dorfe. Am Gegenhang standen im tiefen Schnee die hölzernen Pfosten des Scheibenständers. Das untere Querholz, auf das die Scheibe abgesetzt wurde, ragte kaum aus der weißen Fläche. Von der oberen Latte flatterte ein Fetzen Plastikfolie, die die Scheibe gegen Regen geschützt hatte. Auch der durch eine Bodenwelle gekrümmte Schatten erschien in den Strahlen der flach scheinenden Nachmittagssonne leuchtend blau.
Wie lange war es her? Drei – nein, vier Jahre. Es war eine warme Juninacht, hell und windstill; eine von diesen Nächten, in denen es auf der Insel nicht dunkel werden will, in denen man meint, eine Vorstellung schwedischer Mittsommernächte zu haben.
Ich konnte nicht schlafen. So war ich die Hügel hinauf gelaufen. Neben dem Haus stand auf dem Weg eine Gruppe Urlauber und sah auf den dunklen Hang gegenüber. Eine quadratische Scheibe mit bunten Ringen wurde von zwei im Gras steckenden Lampen angestrahlt. Merkwürdig schwebend stand die Fläche gegen den schwarz erscheinenden Hintergrund des Rasens. Auf der Terrasse neben dem Haus saßen unter der Birke zwei Männer.
Ein dritter stand seitlich daneben, unbewegt, in der linken Hand einen Bogen haltend, an dessen klobig erscheinendem Mittelteil Metallteile glänzten. Der Mann hatte den Bogen auf den linken Fuß gestellt und sah auf die angeleuchtete Scheibe, die sich in gleicher Höhe mit seinem Standort zu befinden schien. Als er sich bückte, sah ich vor ihm im Gras einige Pfeile stecken. Er legte einen Pfeil auf, hob den Bogen in Richtung zur Scheibe und spannte in einer zügigen Bewegung den Bogen. Dem leisen schnappenden Geräusch der Bogensehne beim Abschuss folgte fast sofort das trockene Aufschlagen des Pfeiles auf der Scheibe. Im gelben Fleck in der Mitte der Scheibe stand plötzlich ein schwarzer V-förmiger Schatten. Bevor ich begriffen hatte, dass die zwei Lampen am Fuß des Scheibenständers genau im gleichen Winkel die Schatten des Pfeilschaftes auf die Scheibe warfen, wiederholten sich die Geräusche von Abschuss und Einschlag. Wieder im Gelb, etwas tiefer, zeichneten nun die sich kreuzenden Schatten ein großes W, dessen obere Schenkel über den Scheibenrand ins Dunkel wiesen.
Der Mann legte den dritten Pfeil auf. Es schien ein gleiches Zeitmaß zu sein, in dem die Bewegungen abliefen. Auch der dritte Pfeil landete in dem leuchtenden gelben Fleck, in dem sich nun ein filigranes Gitter spitzwinklig kreuzender Schatten gebildet hatte.
Der Mann legte den Bogen ins Gras und ging den Hang hinunter zur Scheibe. Im Licht der Lampen schien er eher klein als mittelgroß. Barfuss, in Jeans und einem dunklen T-Shirt, zog er, scheinbar nicht ohne Mühe, die Pfeile aus der Scheibe. Er bückte sich zu den Lampen, die gleich darauf erloschen und kam langsam zum Haus zurück. Die Pfeile trug er in der Hand. Er setzte sich zu den beiden Männern auf der Terrasse, die sich nun über den Bogen beugten, den er quer über den Knien hielt. Ich stand etwa zwanzig Meter neben dem Haus und sah auf die Männer, die leise miteinander sprachen. Es war kein Wort zu verstehen.
Die Gruppe neben mir, die gleich mir schweigend zugesehen hatte, schien weitergehen zu wollen. Als sie bei mir vorbeikamen fragte ich: „Sie entschuldigen – kennen Sie den Mann?“ „Den da mit dem Bogen?“ Ich nickte. Sie schienen das schon öfter gesehen zu haben. „Der baut hier solche Dinger. Aber bezahlen kann man die nicht.“
Sie gingen weiter. Ich sah zurück zur Scheibe. Meine Augen hatten sich wieder der diffusen Helligkeit angepasst, in der die nun hellgraue Scheibe vor dem gleichmäßig dunklen Rasenhang stand. Ich hatte den Eindruck eines Show-Effektes, als ich mir die Szene wiederholte, die ich eben gesehen hatte. Aber die war von eigenartiger Faszination gewesen.
Ich interessierte mich nicht für Bogenschießen. Im Fernsehen hatte ich Männer in Rollstühlen gesehen, die in Turnhallen auf Scheiben schossen. Ich hielt es für eine Sportart für Versehrte oder für Kinder und konnte mir nicht vorstellen, dass man sich ernsthaft damit beschäftigen könnte. Es schien mir eine Marotte zu sein, aber sie passte zu meinem Bild von der Insel.
Und ich hätte den Mann gern kennengelernt, der in der Nacht auf die bunte Scheibe schoss. So fing es an, damals, vor vier Jahren.
3
Der Wind nahm zu. Er kam in Stößen über den Bodden und wehte glitzernde Wolken von den Rosenhecken, deren Zweige braunstachlig aus dem Schnee auftauchten. Ich drehte mich um und schlug den Kragen der Jacke hoch. Mich fror.
Langsam ging ich den Weg zurück, den ich gekommen war. Im Gasthaus am Hafen trank ich einen Grog, dann noch einen. Draußen war es dunkel geworden. Wenn ich den Kopf dicht vor die schwarze Fensterscheibe beugte, sah ich im Hafen die Masten der Fischerboote schwanken. Die Leine des Fahnenmastes vor dem Gasthaus klatschte in wechselnden Rhythmen gegen das Holz. An zwei Tischen neben dem Schanktisch saßen die Fischer, die Bier und Korn tranken.
Als ich hereingekommen war, hatten sie kurz aufgesehen. Dann sprachen sie weiter. Am Stammtisch spielte ein Gruppe Skat. Ihre schwarzen Schiffermützen lagen neben ihnen auf den Stühlen. Die einzige Frau im Raum war die Kellnerin, die mit müdem Gesicht am Büfett hinter dem Schanktisch lehnte. Im halbdunklen Raum war nur leises Sprechen und das Klatschen der Karten auf dem Holztisch zu hören.
Mit der Wärme kam die Müdigkeit. Ich zahlte und ging hinauf in mein Zimmer. An die Tür gelehnt stand ich in dem dunklen Raum. Das Licht der Hoflampe warf krause Schatten eines Baumes gegen die Decke oberhalb des Fensters. In dem scharf begrenzten hellen Rechteck tanzten die wirren Muster der Zweige in rüttelnden Stößen. Die Wellen klatschten in schweren Schlägen gegen die Spundwände des Hafenbeckens.
Das Bett war klamm und schwer; das Zimmer wohl erst am Nachmittag geheizt worden. Ich stand noch einmal auf, um die Wollsocken anzuziehen, die ich aus der Reisetasche neben dem Bett nahm. Dann schlief ich ein.
In der Nacht schlug das Wetter um. Ich wurde wach, als Regen an die Scheiben sprühte und dachte an das Haus auf dem Hügel, bevor ich wieder einschlief. Der Morgen war trübe. Der Wind hatte sich gelegt und es regnete. Der Blick aus dem Fenster reichte bis zur Hafenmeisterei, dann versank alles in fahlem Grau, Regen und Wasser im Hafen verschwammen im dichten Fallen der Tropfen. Ich legte mich wieder ins Bett und schlief bis gegen Mittag.
Die Gaststube war leer, als ich das Haus verließ. Der Schnee war verschwunden und in den Gräben sammelte sich schwarzes Wasser, das gurgelnd aus den Rinnen der Häuser schoss und durch die Gärten und über die ausgewaschenen Wege lief. Ich ging den Weg zur Schmiede und bog dann in den schmalen Pfad neben der Siedlung ein, der zum Leuchtturm führt. In der Senke, wo er die Betonplatten der Straße zum Klausner kreuzte, ging ich durch das triefende Gras in Richtung zum Hügel zurück. Kein Mensch war zu sehen.
Vom Mantel lief mir das kalte Wasser in die Kniekehlen, drang durch die Hose und füllte mir die Schuhe, bis beim Laufen jeder Schritt ein schmatzendes Geräusch verursachte. Ich fror noch mehr als gestern und wäre am liebsten umgekehrt. Allein die Tatsache, dass niemand nach mir sah, ließ mich weitergehen. Im Haus würde ich eine Gelegenheit finden, mir die Füße zu trocknen. Die Reservesocken bauschten die eine Manteltasche, in der anderen steckte die Taschenlampe.
Die Zeit schien mir lang, bis das Dach über dem Hügel auftauchte. Ich stieg den Hang empor und erreichte ungesehen die Hecke hinter dem Hof. Ich konnte nicht glauben, dass gestern noch Schnee gelegen hatte, wo jetzt das gelbe Vorjahresgras in welken Büscheln zwischen erstem Grün des neuen Jahres lag. Ich schob mich zwischen den sperrigen Zweigen hindurch, die mir die kalte Nässe ins Gesicht sprühten und trat unter das Dach des Schuppens.
Jetzt war der Grund meines Herkommens unwichtig. Ich wollte ins Trockene, bevor meine Finger zu klamm und steif von der Kälte waren, um das Schloss zu öffnen. Ich griff nach dem Dachsparren über der Tür und fand den Schlüssel im Astloch der zweiten Dachlatte, wo er immer gelegen hatte.
Das Vorhängeschloss zeigte hellbraunen Flugrost; als ich den Schlüssel hineinsteckte und umdrehte, blieb der Rost fleckig in meiner Hand. Ich wischte das Schloss ab und öffnete die Tür.
Die Luft im Schuppen schien kälter als draußen zu sein. Ich ließ das offene Vorhängeschloss in die Krampe fallen und zog die Tür hinter mir zu, bis der Überwurf sich über die Krampe legte. Von weitem konnte es aussehen, als hinge das Schloss vor der Tür. Mehr konnte ich nicht tun.
Es war stockdunkel. Als ich die Taschenlampe einschaltete, fiel ihr Schein auf eine graukörnige stumpfglänzende Eisscholle, die ein rechteckiges Wasserbecken nahezu ausfüllte.
Eine Fläche von etwa zwei mal drei Metern war ausgeschachtet und die Erde zu einem Wall um die Grube herum aufgeschüttet worden. Das Becken war mit Plastikfolie ausgelegt und mit Wasser gefüllt, das zwischen Scholle und Beckenrand einen schwarzen Streifen ausfüllte, und in dem sich der Schein der Taschenlampe spiegelte.
Im Hintergrund des leeren Schuppens lag eine gewölbte Schale, die wie eine große Badewanne aussah. Vier Plastikkanister, Ölpapier und eine Rolle Glasvliesgewebe lagen in einer Ecke. Ich begriff nichts.
Ich hob den Lattenrost von dem Lichtschacht des Kellerfensters, das vor dem Bau des Schuppens dem Keller ein wenig Licht gegeben hatte.
Nachdem ich den Mantel an einen Nagel neben der Tür gehängt hatte, ließ ich mich in den Lichtschacht hinab. Wie erwartet, war der Fensterflügel noch immer vor Nässe verquollen und nicht verriegelt. Mit Mühe drückte ich ihn auf und leuchtete hinein. Auf dem Regal unter dem Fenster standen staubige Flaschen, die ich mit dem Fuß beiseite schob.
Ich legte die Lampe auf das Regal und sprang steifbeinig ins Dunkel. Eine Flasche rollte vom Regal und zersprang mit dumpfem Knall.
Ich verfluchte meine Neugierde und hatte für einen Moment das Gefühl, in eine Falle geraten zu sein. Dann nahm ich die Lampe und ging zur Tür. Sie war angelehnt und der Schein der Taschenlampe führte mich bis zur Kellertreppe.
Die Sicherungen im elektrischen Zähler waren herausgeschraubt und standen auf dem schwarzen Gehäuse. Ohne mich weiter umzusehen, stieg ich die Treppe hinauf und trat in den Flur.
Kein Raum war verschlossen, bis auf die Haustür. Alle Schlüssel hingen am Brettchen neben dem Lichtschalter zur Kellertreppe; an der Tür zur Werkstatt steckte der Schlüssel im Schloss. Ich drehte nacheinander alle Glühbirnen in den Lampen aus: Im Wohnzimmer die Deckenlampe, in der Küche die Wandlampe über dem Herd, in der Werkstatt und schließlich im Raum unter dem Dach. Dann ging ich zurück in den Keller und schraubte die Sicherungen ein. Als ich den Lichtschalter im Keller drehte, flammte die Lampe auf.
Ich legte die Hand vor die Augen und setzte mich auf die Kellertreppe. Meine Füße brannten. Ich zog die Schuhe aus, streifte die nassen Socken von den Füßen und zog die trockenen an, nachdem ich die Füße mit einem Fetzen Stoff, der unter der Treppe lag, trockengerieben hatte. Mit Widerwillen zwängte ich die Füße wieder in die nassen Schuhe.
In der Werkstatt unter der Hobelbank entdeckte ich den elektrischen Heizofen. Meine Stimmung stieg. Ich trug ihn ins Dachzimmer und steckte die Verlängerungsschnur in die Steckdose. Der Geruch von verbranntem Staub erinnerte mich an die Zigaretten. Die Schachtel war zerdrückt, aber trocken geblieben. Ich setzte mich mit dem Rücken gegen die Wand und schob mir den Heizofen vor die Füße. Als die Zigarette brannte, spürte ich erstmals die nun bereits wieder nachlassende Spannung.
Es hatte bisher alles geklappt, genau wie geplant. Ich war im Haus und hier verlor sich das vage Gefühl der Unsicherheit, des Unerlaubten. Ich war mir von vornherein klar über die Tatsache, dass ich einen Einbruch verübt hatte. Dass ich nichts weiter wollte, als Gewissheit über seinen Verbleib, würde mir niemand glauben, falls man mich erwischte. Aber ich glaubte, dass er mich verstanden hätte.
Die Reflexe der glühenden Heizdrähte schimmerten im Lack des Holzfußbodens und mit der langsamen Erwärmung im Raum erkannte ich die vertraute Umgebung wieder. Auf dem Fensterbrett fand ich eine leere Blechdose für die Zigarettenasche. Das Wasser lief an der blinden Scheibe herunter. Auf dem dicken Rieddach war das Geräusch der fallenden Tropfen gedämpft und gleichmäßig zu hören.
Ich fühlte mich sicher und geborgen. Das Tageslicht war noch ausreichend, um eine Suche zu beginnen.
Aber wonach wollte ich eigentlich suchen?
4
Ich wollte Hinweise auf sein Verschwinden finden. Dabei interessierten mich weniger das Ziel seiner von niemandem bemerkten Abreise, als vielmehr die Ursachen und die Umstände – obgleich sie vermutlich in unmittelbarem Zusammenhang miteinander standen. Warum ich einen Unfall oder ein Verbrechen ausschloss, konnte ich nicht erklären. Es hätte einfach nicht in das Bild meiner Vorstellung gepasst. Es musste etwas anderes sein, und ich war überzeugt, dass sein Verlassen der Insel einen Schlusspunkt in einer Reihe von Ereignissen darstellte.
Seit ich ihn kannte, war mir jeder Vorwand recht gewesen, auch nur für ein langes Wochenende auf die Insel zu kommen. Aber später als zu Anfang Oktober und früher als Ende Mai war ich nie hier gewesen. Er hatte mich mehrfach eingeladen, im Winter zu kommen. Ich hatte Farbdias gesehen von Dünen aus Schnee, von eisverkrusteten Granitbrocken, die in der Sonne funkelten wie Kristall, von aufeinander getürmten Eisschollen, zwischen denen schwarzgrünes Wasser stand und die an den Rändern gesäumt waren von stachligem Raureif. Ich fand es herrlich; aber ich wollte im Sommer im Sand liegen, wenn die Sonne hoch stand und auf das Kollern und Rollen der Steine hören, die die Brandung an den schmalen Strandstreifen unterhalb der Steilküste spülte.
Vielleicht hätte ich mehr über ihn erfahren, wenn ich damals gekommen wäre, aber ich glaubte, dass ich jedes Jahr auf die Insel kommen könnte.
Mir war klar, dass ich wenig von ihm wusste. Aber als ich darüber nachdachte, warum, schien es mir einleuchtend. Er hatte nie von seiner Vergangenheit gesprochen, weil sie für ihn abgeschlossen war. Sie beschäftigte ihn nicht mehr.
Ich entsann mich einer Handvoll ungeöffneter Briefe auf dem Regal neben dem Zeichentisch. Er zuckte die Achseln, als ich ihn danach fragte. Am anderen Tag lagen die Aschereste im Kamin und ich war überzeugt, dass er sie ungelesen verbrannt hatte.
Die Hitze des Heizkörpers drang durch die Sohlen meiner Schuhe. Ich stand auf und ging zu dem niedrigen Fenster in der gewölbten Nische der Dachgaube. Vor dem flachen Kreisbogen der Scheiben begann es bereits wieder dunkler zu werden, obgleich der Regen nachgelassen hatte.
Ich sah auf die Uhr, sie zeigte wenige Minuten vor vier und ich zögerte, was als Nächstes zu tun sei. Hinter dem Vorhang des eingebauten Regals fand ich eine Steppdecke, zwei Wolldecken und das blaue Samtkissen. In der Nische hinter dem Schornstein, dessen quadratischer Mauerpfeiler mitten im Raum durch das Dach führte, lehnte zusammengelegt das Klappbett, auf dem ich zwei Sommer lang geschlafen hatte. In dem Moment hatte ich mich entschieden. Es war fünf nach vier, als ich den Heizkörper ausschaltete, den Stecker aus der Leitung zog und die Treppe hinunter in die Werkstatt ging. Ich öffnete die Tür zum Wohnzimmer und trat seitlich neben die Scheibe des großen Terrassenfensters, um vorsichtig nach draußen zu sehen.
Die Vorsicht war überflüssig. Ich musste zweimal hinsehen, um zu begreifen. Er hatte die Steinplatten unmittelbar vor dem Fenster entfernt und Malven gepflanzt – vor die gesamte Fensterbreite. Sie waren aufgeschossen zu dichten übermannshohen Büschen, die nun mit einem Gewirr dürrer Stengel die Sicht nach außen versperrten.
Wie so oft in vergangenen Jahren öffnete ich den linken Fensterflügel und stieg über die niedrige Fensterbank zwischen die nässetriefenden Malvenbüsche. Kein Mensch war zu sehen. Ich klemmte einen Pappstreifen zwischen Rahmen und Flügel und zog das Fenster hinter mir zu, so fest es ging. Der Wind kam von Nordwest, aber selbst wenn die Bö das Fenster aufdrückte, wäre es kaum zu sehen. Ich konnte nur hoffen, dass es hielt und mehr zu tun war keine Zeit.
Ich trat auf die Terrasse und ging über die Steinplatten zum Weg. Im letzten Moment fiel mir der Mantel ein. Ich ging zurück über den Hof, auf dem sich schwarze Pfützen gesammelt hatten, öffnete die Tür zum Schuppen und nahm den Mantel vom Nagel. Das Schloss schnappte ein und ich legte den Schlüssel zurück auf den Platz über dem Dachsparren. Im Laufen zog ich den Mantel an, den mir der Wind um die Beine flattern ließ.
Die Dunkelheit hatte zugenommen. Vom Westen her schoben sich schwere Regenwolken über den Wald und ich lief den Weg hinunter ins Dorf. Im Gasthaus bezahlte ich die Rechnung, holte die Tasche und ging hinüber zum Hafen.
Zwei Leute, die ich nicht kannte, saßen im Fahrgastraum des Schiffes. Der Hafenmeister kam, um die Leinen loszumachen und ich rief ihm eine Bemerkung über das Wetter zu. Er knurrte Unverständliches und ging in sein Büro zurück, als das Schiff ablegte und in weitem Bogen in die Fahrrinne einschwenkte. Ich zahlte und steckte den Fahrschein in die Manteltasche.
Als das Schiff nach einer halben Stunde Fahrt im Nachbarort der Insel anlegte, verließ ich das Schiff. Inzwischen war es bereits dunkel geworden.
Neben der Kaufhalle stand mit hängendem Kopf ein Pferd vor einem Wagen, der mit leeren Fischkisten beladen war. In der Kaufhalle nahm ich ein Brot, zwei Päckchen Schnittkäse und eine harte Wurst aus den Regalen, fand noch eine Dose gezuckerte Kondensmilch und legte zur Sicherheit eine Packung Tee dazu.
Ich zahlte an der einzigen besetzten Kasse neben dem Ausgang und schob am Packtisch alles in meine große Reisetasche. Dann überquerte ich die Straße und ging an der alten Mühle vorbei in Richtung Strand.
Der Wind trieb mir in scharfen Schlägen den Regen ins Gesicht, als ich im festen, nassen Sand den Weg zurückging. Ich folgte der geschwungenen Strandlinie, bis im Dunkel vor mir die bewaldete Steilküste als Schatten wieder auftauchte, während zu meiner Linken die weißen Gischtfetzen über die Granitbrocken der Uferbefestigung jagten.
Ich lief weiter bis zu der schmalen Treppe, die auf die Steilküste führte. Neben den halbierten Eisenbahnschwellen, aus denen die Stufen gebildet waren, lief das Regenwasser in tief ausgespülten Rinnen hinunter zum Strand. Der Weg durch den Wald, den ich im Sommer nur als grünleuchtenden Tunnel im Dickicht des wuchernden Unterholzes kannte, schien mir fremd und lang.
Dann sah ich wieder die Silhouette des Hauses auf dem Hügel. Ich hätte gerne eine Zigarette geraucht, aber ich ging weiter durch die Senke, den Weg hinauf bis hinter das Haus. Ich hatte genug von Regen, Kälte und Wind.