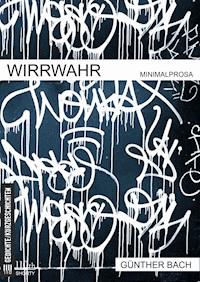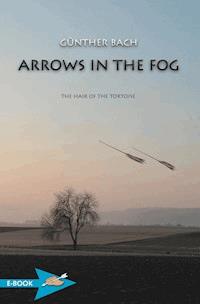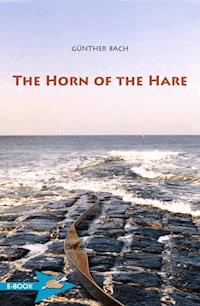Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hörnig, A
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Wege von Rolf und Erhard, die sich zum zweiten Mal getrennt hatten, laufen in den kanadischen Wäldern wieder zusammen. Mehr denn ja sind Pfeil und Bogen ihre Begleiter. Nach "Horn des Hasen" und "Pfeile im Nebel" der dritte Bogenschützen-Roman von Günther Bach. Wer zur Quelle will, muss gegen den Strom schwimmen, so sagt es das chinesische Sprichwort. Doch auch die erreichte Quelle ist noch nicht der Anfang des Weges.Ihre klaren Wasser kommen aus tiefem Grund, der für immer im Dunkel bleiben wird. Nur wer das Unergründliche ihres Ursprungs bejaht, kann sich ihrer Reinheit erfreuen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 326
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table of Contents
Titelseite
Impressum
Dictum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Bücher für Bogenschützen
Der Autor
Die Romane als e-book
e-books in englisch
Printausgaben
Traditionell Bogenschießen
Buchrückseite
GÜNTHER BACH
GEGEN DEN STROM
ROMAN
© 2008 by Verlag Angelika Hörnig
Alle Rechte vorbehalten.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne Genehmigung des Verlages reproduziert oder elektronisch vervielfältigt oder verbreitet werden.
Cover-Foto und Illustrationen: Günther Bach
© 2012 ebook ISBN 978-3-938921-22-7
Verlag Angelika Hörnig Siebenpfeifferstr. 18 D-67071 Ludwigshafenwww.bogenschiessen.de
Wer zur Quelle will, muss gegen den Strom schwimmen.
Chinesisches Sprichwort
1
„Es ist Post gekommen.“
Nur dieser eine Satz.
Nun ja, Post war selten geworden, seit Bärger Berlin verlassen hatte und auf Falster lebte, der Deutschland am nächsten gelegenen dänischen Insel. Aber manchmal kam doch neben Werbung und Behördenpost einer dieser handgeschriebenen Briefe eines alten Freundes.
Gelegentlich fand er selbst Freude daran, mit sattschwarzer Tinte auf elfenbeinfarbenem Papier Nachricht von sich zu geben, obwohl auch hier Computer und E-Mail den Hauptteil dessen besorgten, was jetzt als Kommunikation galt.
Zeit ist Geld? Bärger schüttelte den Kopf. Zeit ist die uns zugemessene Frist zu leben. Man kann mehr daraus machen als Geld.
Zwei schmale Briefe lagen auf einem flachen Päckchen aus starkem braunen Packpapier. Bärger schob sie beiseite und wog den mit Paket- band verklebten Umschlag in der Hand. Er war unerwartet schwer.
Ein Gefühl von Unruhe ergriff ihn, als er die Adresse las.
Es war nicht die bekannte Handschrift – er wusste sofort, von wem die Sendung kam. Er glaubte zu spüren, dass in diesem Päckchen etwas verborgen war, das er nicht wissen wollte. Nicht jetzt.
Er ließ es auf den Tisch fallen, verschränkte die Hände im Nacken und sah nachdenklich in den blassblauen wolkenlosen Himmel.
Wie lange war es her, dass er ein ähnliches Päckchen erhalten hatte? Nicht mehr als ein halbes Jahr.
Seltsam. Er hätte nicht sagen können, ob ihm die Zeit seither schnell oder langsam vergangen war – Herbst, Winter und nun schon wieder ein beginnender Frühling. Obwohl der alte Nussbaum im Hof noch keine Blätter hatte, wehte der laue Wind den Geruch der feuchten Erde aus dem Garten herüber.
Er spielte mit der langen Haarsträhne, die sich aus dem losen Knoten in Maybrits Nacken gelöst hatte.
Sie stand reglos, den Rücken an den Stamm des Nussbaums gelehnt und schien mit geschlossenen Augen die wärmenden Sonnenstrahlen zu genießen. Das hier ist meine Welt, dachte Bärger. Und gleich danach: Ist das hier wirklich meine Welt?
„Willst Du den Brief nicht aufmachen?“ Sie sah ihn nicht an bei ihrer Frage, aber Bärger wusste, dass auch sie den Zwiespalt empfand – Freude über die Nachricht von einem guten Freund, aber auch die Ahnung einer Störung, die von außen kam und von weit her.
Bärger sah auf den Poststempel – Vancouver. Nach dem letzten Kontakt war es unwahrscheinlich, dass Erhard ihn selbst dort aufgegeben hatte. Wo mochte er jetzt sein?
Auf dem Giebel des niedrigen Hauses begann eine Amsel ihr Abendlied zu flöten, mit gleichmäßigen Pausen, als lausche sie den eigenen melodischen Tonfolgen nach.
Nein, dachte Bärger, ich will ihn nicht aufmachen. Nicht jetzt.
Er stand auf und hielt ihr die Hand hin.
„Lass uns rausgehen, ich muss noch ein wenig laufen.“ Sie gingen schweigend durch den Garten, entlang an den blassrot blühenden Beerensträuchern, über das schneeige Weiß der herabgefallenen Kirschblüten und vorbei am leuchtend grünen Laub der riesigen Brombeerhecke.
„Habe ich dir eigentlich schon mal erzählt, dass Erhard seine Post früher auch wochenlang ungeöffnet liegen ließ und manchmal sogar ungelesen verbrannt hat?“
„Hast du nicht“, sagte Maybritt, „aber ich würde es ihm zutrauen. Willst du es jetzt genauso machen?“
Bärger sah sie schweigend an.
Sie hatte die braunen Ledersandalen ausgezogen, die sie an zwei Fingern der linken Hand schlenkern ließ und lief mit gleitenden Schritten über das dichte Gras, das zwischen dem Koppelzaun und dem sandigen Feldweg gewachsen war.
Sie war es, die ihm gezeigt hatte, wie man barfuß über Stoppelfelder lief, mit diesem schlurfenden Schritt, bei dem man die Halme niedertrat und scharfe Steine beiseite schob. Es funktionierte auch im Wald, auf Kiefernnadeln und Moos, und er hatte ein neues Gefühl dafür entwickelt, sich im Hautkontakt mit dem Erdboden zu bewegen. Wenn man es richtig machte, konnte man auf einem Stoppelfeld laufen wie auf einem Teppich.
„Ich würde Einiges gern so machen wie Erhard“, sagte Bärger, „aber das wohl nicht“.
Sie folgten dem Weg bis zum Waldrand und saßen eine Weile unter der dichten Krone einer alten Kiefer, die ihre Zweige bis tief hinunter zum Boden hängen ließ.
In der Stille des Abends lauschten sie dem leisen Knistern, mit dem die vorjährigen kegelförmigen Zapfen aufsprangen, die Samen freigaben und zu den offenen schuppig gegliederten Kugeln wurden, die der Herbstwind aus der Krone fallen lassen würde. Im Schein der tief stehenden Sonne schienen Maybrits Augen von tieferem Grün zu sein als sonst und Bärger spürte das vergängliche Glück dieser Stunde. Vielleicht, dachte er, bin ich deshalb so glücklich, weil ich weiß, dass es vergänglich ist. Es ist ein befristetes Glück, aber solange es dauert, bin ich außerhalb der Zeit.
Es wurde schon wieder kühl, als sie zurückgingen.
Seit einem Jahr erst lebte Bärger auf dem kleinen Bauernhof in der Nähe eines Dorfes mit dem Namen Falkerslev. Der Name hatte ihm gleich gefallen; seit er ihn zum ersten Mal auf dem Ortsschild gelesen hatte, verband er ihn mit dem Bild eines schlafenden Falken. Wahrscheinlich hatte er eine völlig andere Bedeutung, aber die hätte er gar nicht wissen wollen.
Es war ein kleines Anwesen, das einen ebenso kleinen und fast quadratischen Innenhof umschloss. Im Sommer warf das dichte Laub eines großen Walnussbaumes seinen Schatten über einen runden steinernen Tisch, in dessen Mitte ein quadratisches Loch seine Herkunft als einen Mühlstein verriet. Ein eingeschossiges Wohnhaus aus roten Ziegeln mit einem fast ebenso großen Seitenflügel, ein umgebauter Stall und ein zu silbernem Grau verwitterter Holzschuppen, dessen große Fenster sich zum Garten hin öffneten, schlossen den Raum um einen Ort der Stille. Kaum einmal drangen Geräusche von außen herein. Die nächste Straße war weit entfernt; manchmal hörte er fernes Hundegebell aus dem Dorf; wenn der Wind von Osten kam, auch das Läuten der Abendglocken. Aber all das verstärkte nur das Gefühl von Stille an diesem Ort.
Maybritt war ihm vorausgegangen.
Ihr ausgeblichener langer Rock aus hellgrauem Leinen hatte vom Abendtau einen nassen Saum bekommen. Bärger sah zu, wie ihre nackten Füße scheinbar schwerelos durch das dichte Gras glitten.
Wie klein sie sind, dachte Bärger, es sind die Füße eines Kindes. Und gleich danach: Wie schön, dass nur ihre Füße so klein sind. An Maybritt hatte Bärger alles gefunden, was er an einer Frau liebte. Er dachte daran, dass er jeden Teil dieses schlanken Körpers da vor ihm kannte und wie glücklich es ihn machte, bei ihr zu sein.
Sie schien seine Gedanken gespürt zu haben. Plötzlich drehte sie sich um und schüttelte lächelnd den Kopf: „Es gehört sich nicht, harmlose dänische Mädchen in der freien Natur mit den Augen auszuziehen!“ Sie drohte ihm mit erhobenem Zeigefinger.
„Hast Du harmlos gesagt?“, fragte Bärger.
Aber sie hatte sich schon wieder umgedreht; wie in einem amerikanischen Historienfilm hob sie den Rocksaum mit beiden Händen über die Knie und lief mit schnellen Schritten voraus. Gleich darauf hörte er das Geräusch der zufallenden Pforte im Gartenzaun und dann war der weiße Fleck ihres T-Shirts hinter der Brombeerhecke verschwunden. Langsam ging er ihr nach.
2
Seit Stunden saß Bärger an dem alten Tisch mit der weiß gescheuerten Ahornplatte in der Küche und las.
Der Tee, den Maybritt ihm am späten Abend hingestellt hatte, war längst kalt geworden, als er endlich die beiden dicken Notizbücher von sich schob und auf die Uhr sah. Inzwischen war es fast zwei Uhr nachts.
Nach dem Abendessen hatte er vorsichtig mit der Klinge seines Jagdmessers, das er nun ständig am Gürtel trug, die feste Verpackung des Päckchens aufgeschnitten.
Es enthielt zwei gleichartige dicke Schreibhefte mit Ringbindung und eine kleine Schachtel, die mit einem Lederband verschlossen war.
Er hatte sie Maybritt hingeschoben und seine Vermutung war richtig gewesen: Darin lag eine silberne Anstecknadel, so etwas wie eine Brosche. Es war die Silhouette eines indianischen Kanus, etwa so groß wie sein kleiner Finger, an dem die winzigen Nachbildungen der wichtigsten traditionellen Ausrüstungsgegenstände eines Trappers beweglich befestigt waren – ein Beil, ein Kompass, ein Paddel, eine Laterne und eine Pfanne.
„Die Pfanne“, hatte Erhard auf einen kleinen Zettel geschrieben, „braucht man hier nicht nur für Rührei, sondern auch zum Goldwaschen.“ Wie zum Beweis hatte in der Watte der Verpackung ein erbsengroßes kantiges Stückchen Gold gelegen. Fast hätten sie es übersehen.
Maybritt hatte das Geschenk originell gefunden und sofort an das T-Shirt gesteckt. Besonders gefiel ihr, dass die zierlichen Werkzeuge sich ständig bewegten.
Die Notizbücher sahen eher schäbig aus.
Die orangefarbenen Umschläge waren fleckig, wie es schien, von Tee und Fett. Die Ecken bogen sich fächerförmig nach oben, als wären sie wieder und wieder umgeblättert worden. Zu Beginn waren die Seiten sorgfältig mit Kugelschreiber beschrieben, auf den hinteren Blättern fand sich ein zum Teil fast unleserliches Bleistiftgekritzel. Das zweite Heft war nur zur Hälfte beschrieben.
Obenauf hatten zwei Seiten weißen Papiers mit dem Werbeaufdruck eines Hotels in Vancouver gelegen. Erhard hatte wohl in dem Haus mit dem Namen „Abercorn Inn“ übernachtet. Die Grafik sah aus wie ein alter Stich von einem englischen Landhaus.
„Du musst“, hatte Erhard auf die Bogen geschrieben, „nicht alles lesen, was ich da aufgeschrieben habe. Manches ist weder wichtig noch interessant. Einiges ist nicht zu Ende gedacht und wurde nur notiert, damit ich es nicht vergesse. Und schließlich ist einiges nur für mich bestimmt.
Die Stellen, die für Dich interessant sein könnten, findest du leicht. Ich habe an den Stellen ein paar Federn zwischen die Seiten gelegt. Es sind – weil du das sicher wissen willst – Schwanzfedern vom Waldhuhn, das hier grouse heißt und sehr lecker schmeckt, wenn man nicht gerade eins mit zehntausend Flugstunden erwischt hat. Was du aber unbedingt lesen solltest, findest du in dem zweiten Heft – ich meine den Bericht über den Winter am West Road River.“
So war es denn auch gewesen.
Danach hatte Bärger ein etwas anderes Bild von Blockhausromantik bekommen, als er es bisher aus Büchern kannte. Er selbst hatte schon vor langer Zeit im Bücherschrank seines Vaters, dessen lebenslanger vergeblicher Traum eine Kanadareise gewesen war, einiges über kanadische Winter gefunden und mit Spannung gelesen.
Selbstverständlich waren alle Verfasser in der Lage gewesen, allein mit Werkzeugen, wie sie an Maybrits Brosche baumelten, ihre eigenen Blockhäuser zu bauen, was in den früheren Zeiten wohl auch noch erlaubt gewesen sein mochte. Er hatte alles geglaubt. Es schien nicht sehr problematisch gewesen zu sein und meist waren die Berichte über die anheimelnde Wohnlichkeit dieser mit Moos und Lehm abgedichteten Hütten fast überschwänglich gewesen.
In Erhards hölzerner Bohlenhütte am kleinen Bootshafen des Mittelalterzentrums von Nykoebing, das seit einem halben Jahr auch zu seinem Arbeitsplatz geworden war, hatte er mehrere Bücher gefunden, die in sachlicher Form Auskunft über den Bau von Blockhäusern gaben. Er hatte gelegentlich darin geblättert; besonders interessant waren ihm die Beschreibungen der historischen Entwicklung des Blockhausbaus in Skandinavien erschienen. Das begann bei den Eckverbindungen in Form einfacher gerader Überblattungen unterschiedlich dicker Rundstämme und endete schließlich bei komplizierten sogenannten Sattelnocken mit doppelten Dichtungsnuten an Rundstämmen, die über die gesamte Länge von Fräsmaschinen auf gleichmäßige kreisförmige Querschnitte abgearbeitet worden waren.
Das Ergebnis war ein Blockhaus de luxe – eine künstliche Primitivität, hergestellt mit computergesteuerten Werkzeugen.
Aber das war es nicht, wovon Erhard berichtet hatte.
Er hatte nichts weiter getan, als mit Erlaubnis des Eigentümers in einer alten cabin – es war das in Kanada übliche Wort für Blockhaus – einen Winter zu verbringen.
Und das musste nach seinem Bericht alles andere als ein romantisches Abenteuer gewesen sein.
Wenn Bärger darüber nachdachte, war sein Tagesablauf im „Middelaldercentret“ schon einigermaßen lebensecht – abgesehen von den Tagen, an denen er im Auftrag des Museumsleiters auf der Suche nach alten Häusern durch das Land fuhr.
Aus Erhards Truhe hatte er sich mit ein paar weiten Leinenhemden eingedeckt. Er hatte auch den Wert einer Gugel aus Lodenstoff zu schätzen gelernt, die bei kaltem Wetter Schultern und Nacken warm hielt, ohne beim Bogenschießen zu hindern. Auch an die Bundschuhe, die aus dem dicken weich gegerbten Nackenleder eines Ochsen gemacht waren, hatte er sich schnell gewöhnt. Dies alles waren Dinge – seine alte Lederhose, die Griffe seiner Bogen und Messer, die Gefäße aus Holz und die Beutel aus Leder – die mit zunehmendem Alter, mit den Spuren des Gebrauchs in seinen Augen immer schöner wurden.
Aber er konnte – zumindest immer, wenn er es wollte – sich abends unter die Dusche stellen und in einem sauberen Bett schlafen. Und heißes Wasser für einen Tee zu machen, war eine Sache von Minuten.
So echt es schien, war es doch immer ein wenig Spiel; eben weil es immer den möglichen Rückzug in die Bequemlichkeiten des 21. Jahrhunderts gab. Es war niemals vergleichbar mit einem Winter in der Wildnis, einem Winter, der ein halbes Jahr dauerte und in dem Temperaturen um minus 40 Grad der Normalfall waren.
Ihm war kalt geworden.
Schwarz stand die Nacht vor den spiegelnden Scheiben des kleinen Küchenfensters.
Bärger schaltete die Deckenlampe über dem Tisch aus und wartete, bis das undurchdringliche Schwarz sich zu einem dunklen Blau aufhellte und nur noch die Blätter des Fliederstrauches draußen im Garten ein schwarzes Scherenschnittmuster bildeten. Dann ging er langsam die Treppe hinauf, zog sich im Dunkeln aus und legte sich leise ins Bett.
Bis zum Einschlafen lauschte er den ruhigen Atemzügen Maybrits, die sich nicht gerührt hatte. Er träumte von Schnee und davon, dass er das Geräusch des Fallens der Flocken hören konnte und dass es ein Geräusch war, das er nicht mit Worten beschreiben konnte.
Am nächsten Morgen ließ böiger Wind dichte Regenschauer an die Scheiben prasseln.
Sie saßen länger als sonst beim Frühstück.
Auch heute war nichts anders, als er es bei Maybritt von Anfang an kannte: Die blaue Leinendecke auf dem Tisch, darauf das im Farbton passende Keramikgeschirr, das Maybrits Hände geformt hatten, der strohgeflochtene Brotkorb und die Holzschale mit dem frischen Obst.
Der intensive Duft einer blühenden Hyazinthe erfüllte den Raum.
Und doch schien es ihm, als habe er all das schon gar nicht mehr bewusst wahrgenommen, als habe er es nur noch als selbstverständlich registriert.
Ich musste erst Erhards Bericht lesen, bevor ich es wieder bemerkt habe, dachte Bärger. Es wäre mir nur dann aufgefallen, wenn etwas anders gewesen wäre.
Er sah zu Maybritt, die gedankenverloren aus dem Fenster sah und zwischen den Fingern ein Kügelchen aus Brotteig formte. Große Tropfen rannen an den Scheiben herab.
„Ich danke dir“, sagte Bärger leise.
Sie sah ihn überrascht an.
„Wofür?“, wollte sie wissen.
„Für alles“, sagte Bärger, „oder einfach dafür, dass du da bist.“
Maybritt lachte.
„Das ist nicht mein Verdienst.“
„Wem sonst soll ich es sagen?“, wollte Bärger wissen.
Sie sah ihn eine Weile an. Dann sagte sie anstelle einer Antwort: „Du siehst müde aus.“
„Ich sehe nicht nur so aus“, sagte Bärger.
Er griff nach den Heften mit den orangefarbenen Umschlägen, die neben ihm auf dem Fensterbrett lagen. Aber dann zögerte er, schob sie zurück und sagte zu Maybritt, die ihn erwartungsvoll ansah: „Was weißt du eigentlich über Kanada?“
Maybritt schüttelte den Kopf.
„Habe ich hier etwa einen deutschen Schulmeister im Haus oder was?“
Sie stützte das Kinn auf die Hand und lächelte ihn an.
„Na schön. Ziemlich weit weg, ziemlich groß und im Winter ziemlich kalt. Bären Wölfe, Trapper und Indianer. Ach ja – Kanus und Blockhäuser habe ich vergessen. Weißt du übrigens, dass wir hier auf Falster weiter nördlich wohnen, als die Leute in Vancouver?“
Er wusste es nicht.
„Ja ja“, sagte Maybritt, „und so einer will nun kleine dänische Mädchen beeindrucken.“
„’tschuldigung“, sagte Bärger und grinste.
Aber dann schlug er das vor ihm liegende Heft auf, überflog noch einmal die ersten Zeilen und begann zu erzählen.
„Wie du siehst, weiß ich selber nicht viel mehr über Kanada. Und ich habe nach dem Lesen den Eindruck, dass unser Freund Erhard bei seiner Ankunft auch nicht viel mehr gewusst haben kann. Die Zeiten, in denen jeder dort in den Wäldern tun und lassen konnte, was er wollte, sind offensichtlich lange vorbei. Und wahrscheinlich ist das auch richtig und gut so.
Es muss ihm aber besonders wichtig gewesen sein, allein einen Winter in der kanadischen Wildnis zu erleben. Und wenn das der Hauptgrund seiner Reise gewesen ist, dann scheint sie ihm trotz aller theoretischen Vorbereitung eine Menge Überraschungen bereitet zu haben. Aber von Anfang an.
Erhard schreibt hier, dass er ein paar Monate lang in einem Sägewerk gearbeitet hat, in dem vor allem Bauholz hergestellt wurde. Aber nicht nur das. Diese Firma hat auch nach eigenen und fremden Entwürfen das Bauholz für komplette Häuser zugeschnitten, in Containern verpackt und nicht nur nach Kanada und Nordamerika, sondern eigentlich in alle Welt verschickt. Sie haben diese Häuser sogar mit eigenen Montagetrupps aufgestellt. Erhard schreibt hier, dass überall in Kanada diese Kataloge in den Supermärkten rumliegen.
Anscheinend hat er nicht viel länger als ein Vierteljahr dort gearbeitet und dabei wohl auch eine Menge über maschinelle Holzbearbeitung gelernt. Einer der Leute, mit denen er zusammengearbeitet hat, war sozusagen im Nebenberuf Trapper. Dem gehört ein kleines Blockhaus und eine Trapline an einem Fluss mit dem Namen West Road River.“
„Was ist eine Trapline?“, wollte Maybritt wissen.
„Soviel ich weiß, ist das ein bestimmtes Gelände, für das ein Trapper gegen eine Gebühr das Recht erwirbt, dort seine Fallen aufzustellen,“ sagte Bärger.
„Vielleicht war er auch im Nebenberuf Sägewerksarbeiter und im Hauptberuf Trapper, aber das ist wohl nicht entscheidend. Wichtig war für Erhard, dass der Mann sich bei einem Unfall das Kniegelenk so schwer verletzt hatte, dass er für dieses – also für das vergangene Jahr auf das Trappen verzichten musste und aus diesem Grunde Erhard seine cabin überließ.“
Aber Maybritt unterbrach ihn schon wieder.
„Und wo hat nun das Blockhaus gestanden?“
„Habe ich das nicht gesagt?“ Bärger schüttelte den Kopf.
„Das muss in Britisch Kolumbien sein. Sie sind zusammen nach …“
Er schlug erneut das Heft auf und fuhr suchend mit dem Finger über die Seiten.
„… Nimpo Lake gefahren, auf dem Provincial Highway 20, wenn du es genau wissen willst, und von dort sind sie mit einem Buschpiloten in einem kleinen Wasserflugzeug zu einem See geflogen, der Tsacha Lake heißt. Frag mich jetzt bitte nicht, wie das ausgesprochen wird; wahrscheinlich ist es ein Indianerwort. Von dort aus sind sie dann zusammen ein Stück weit mit dem Kanu den Fluss hinunter gepaddelt. Der Abfluss dieses Sees ist der West Road River.“
Bärger schwieg eine Weile. Dann fuhr er fort.
„Das Verrückteste ist für mich, dass Erhard kaum etwas von dem beschreibt, was uns als halbwegs normale Mitteleuropäer an kanadischen Reiseberichten so fasziniert. Nichts von Urwaldromantik und Zauber der Wildnis. Das will sicher nicht heißen, dass er nicht auch solche Tage dort erlebt hat. Aber beschrieben hat er eigentlich nur das Gegenteil – die Probleme, die ein Leben in der Natur unter diesen Umständen mit sich bringt.“
Wieder machte Bärger eine Pause. Dann sah er Maybritt an und sagte: „Genau das ist es: Er hat hier nur all das aufgelistet, was ihm problematisch erschien. Aber so, wie er es als Designer zu sehen gewohnt ist – nämlich als eine zu lösende Aufgabe! Jetzt wird mir auch klar, warum ich besonders diese Kapitel in seinem Bericht lesen sollte, die er mit den zwischen die Seiten gelegten Federn gekennzeichnet hat.“
Bärger zeigte Maybritt die Schwanzfedern des Waldhuhns, die Erhard als Lesezeichen verwendet hatte.
„Wenn ich die Kernpunkte dieser einzelnen Kapitel auf eine Liste schreiben würde, dann hätte ich als Ergebnis eine Aufgabenstellung, die etwa so heißen könnte: Wie mache ich aus einen Winter in den kanadischen Wäldern anstelle eines primitiven und gefährlichen Überlebenstrips ein angenehmes Erlebnis! Obwohl wahrscheinlich auch dann noch genügend Risiko verbleibt, wenn man nicht vorsätzlich irgendwelche Gefahren sucht.“
Maybritt sah ihm gerade in die Augen. Dann faltete sie demonstrativ die Hände, legte sie vor sich auf den Tisch und sagte: „Unser Freund scheint also noch nicht alle seine Probleme alleine gelöst zu haben – oder?“
Bärger zögerte.
„Ich verstehe dich nicht – wie meinst du das jetzt?“
„Warum?“, sagte Maybritt, „Warum hätte er dir denn sonst seine ganze Problemliste mitsamt kanadischen Lesezeichen schicken sollen?“
„Du meinst …“
Bärger sprach den Satz nicht zu Ende.
„Na klar! Dein Freund weiß ganz genau, wie er dich wieder an seine Angel bekommt.“
Bärger schwieg. Hatte sie Recht?
Mit keinem Wort hatte Erhard erwähnt, dass er irgendwelche Hilfe brauchte. Aber das hatte er noch nie getan. Nein, eine Aufforderung war das nicht; aber vielleicht war es in Erhards Augen ein Angebot? Maybritt irrte sich selten in der Einschätzung von Menschen und ihren Absichten. Schließlich hatte sie Erhard in den letzten Jahren wahrscheinlich besser kennen lernen können als er selbst.
„Lass uns heute Abend noch einmal in Ruhe darüber reden,“ sagte Maybritt, „es ist Zeit, dass du nach Nykoebing kommst.“
Bärger sah auf die Uhr.
Draußen hatte es aufgeklart. Ein kühler Wind fegte graues und weißes Gewölk über einen leuchtend blauen Himmel.
Der Regen hatte aufgehört.
3
Während der Fahrt nach Nykoebing – einen Weg, den er inzwischen im Schlaf gefunden hätte – dachte Bärger an seinen Freund.
Sie hatten sich über Jahre nicht mehr gesehen, nachdem Erhard bei einem Fluchtversuch aus der DDR über die Ostsee in einem selbstgebauten Tauchboot spurlos verschwunden war. Es war ein Zufall, dass sie sich wieder begegnet waren. Das war in dem nahe der Stadt errichteten experimentellen Mittelalterzentrum, das Bärger auf der Reise nach Südschweden, einem spontanen Einfall folgend, besucht hatte. Hier war ein originalgetreues Stadtbild des vierzehnten Jahrhunderts wieder aufgebaut worden, das auch jetzt noch ständig erweitert wurde.
Er hatte Erhard erst in letzter Minute gesehen, als er schon auf dem Rückweg zum Parkplatz war, um seine Reise fortzusetzen. Danach war er geblieben; zunächst für ein paar Tage, dann aber im nächsten Jahr zurückgekommen, um zu bleiben.
Es war ein neues Leben, das er begonnen hatte; ein gänzlich verändertes. Hier auf der Insel Falster hatte Bärger, der im letzten Jahr in Berlin seinen Job als Chefarchitekt einer bayerischen Baufirma verloren hatte, eine interessante neue Aufgabe gefunden. Gemeinsam mit Archäologen arbeitete er an der Rekonstruktion mittelalterlicher Hausfunde, in deren Ergebnis einzelne Gebäude mit originalen Werkzeugen und Verfahren auf dem Gelände des Mittelalterzentrums neu entstanden.
Es war eine Arbeit ohne den Stress drängender Termine und finanzieller Vorgaben. Er war dankbar dafür, während seines Studiums noch eine gründliche Ausbildung historischer Baumethoden kennengelernt zu haben. Die Bewerbungsschreiben junger Architekten, die in Berlin bei ihm auf dem Schreibtisch gelegen hatten, zählten anstelle erworbener Kenntnisse nur noch die Namen verschiedener CAD-Programme auf, mit deren Hilfe man am Computer vorproduzierte Versatzstücke von Bauteilen zusammensetzen konnte. Er hatte selbst mit einigen dieser Programme gearbeitet und wusste, wie gefährlich es sein konnte, wenn man der scheinbaren Präzision der perfekten grafischen Darstellung allzu schnell vertraute. Trotz immer neuer Baustoffe und Verfahren war die Zahl von Baufehlern und -schäden eher größer geworden.
Kurz vor der Brücke, die in die Stadt führte, bog Bärger links ab und fuhr nun langsam am Ufer des Guldborgsunds entlang. In der Nähe der großen Wurfmaschinen, der Bliden, stellte er den Wagen ab und schlenderte nachdenklich den Weg zum kleinen Bootshafen hinunter. Hier hatte er in einem kleinen schindelgedeckten Haus aus handbebeilten Eichenbohlen seinen zweiten Arbeitsplatz. Hier stand eine Schnitzbank, mit der er die Langbogen aus Eschenholz bearbeitete, hier fertigte er die Sehnen für die Bogen und baute auf Vorrat Pfeile aus Fichtenholz, wie es sein Freund Erhard vor ihm getan hatte. Bündel von Rohschäften standen in Weidenkörben neben der offenen Feuerstelle.
Anfang Mai würde die Saison wieder beginnen und Scharen von Touristen aus aller Welt würden durch die Gassen ziehen, den Handwerkern beim Arbeiten, den Rittern beim Turnier und den Händlern beim Feilschen zusehen wollen. Und so wie Erhard es vor ihm getan hatte, würde er den Besuchern zeigen, wie man mit Pfeil und Bogen umging, und wenn er Glück hatte, dann war ab und zu jemand dabei, der danach wiederkam und mehr darüber wissen wollte.
Jetzt aber löste Bärger die versteckte Arretierung des innen liegenden Schubriegels und schob die schwere Bohlentür auf.
Es war eine uralte Konstruktion: Zwei massive Zapfen waren anstelle von Beschlägen in Bohrungen in Sturz und Schwelle eingelassen. Der untere Zapfen ruhte auf einem kleinen kugelförmigen Stein und war von Erhard mit irgendeinem Fett so reichlich geschmiert worden, dass das dicke Türblatt langsam und lautlos wie der Flügel eines Banktresors aufschwang.
Drinnen gab es nichts, das einen solchen Sicherheitsaufwand gerechtfertigt hätte.
Ein offener Herd – mit Lehm aus Mauerziegeln auf Tischhöhe aufgemauert – stand an der rechten Giebelwand des kleinen Hauses. Der Rauchfang darüber war aus Weidenruten geflochten, die von innen und außen mit Lehm verstrichen waren. In der gewölbten Öffnung unterhalb der Herdplatte trockneten dicke Scheiter aus Kiefernholz. Rechts neben der Tür, direkt unter der großen Luke – sie war doppelt so breit wie hoch – stand eine alte Hobelbank. Erhard hatte sie oft benutzt und immer gut gepflegt. Sie hatte eine Platte aus Weißbuche und er hatte sie von Zeit zu Zeit mit einer Ziehklinge abgezogen und geölt. Bärger machte es Freude, an ihr zu arbeiten.
Neben dem Herd stand die Schnitzbank. Wenn es notwendig wurde, einen neuen Langbogen zu bauen, trug er sie vor das Haus in die Sonne. Aber noch waren vor Saisonbeginn ausreichend Bogen einsatzbereit. Auf hölzernen Zapfen, die an der Rückwand in zwei senkrechten Reihen in gleichmäßigem Abstand eingelassen waren, lagen acht Langbögen aus Esche, der Größe nach übereinander aufgereiht. Zwei der unteren Zapfen waren nicht belegt. Hier hatte Erhards großer Langbogen gehangen und gelegentlich auch sein schwerer Recurve, den er wohl mitgenommen hatte auf seine Reise nach Kanada.
Schließlich stand auch noch ein breites Bettgestell an der gegenüberliegenden Giebelwand. Bärger hatte zur eigenen Bequemlichkeit eine Schaumstoffmatratze auf das straffe Gurtgeflecht gelegt. Darauf lagen aber wieder die weich gegerbten Rentierfelle, die Erhard aus Schweden mitgebracht hatte. Eine Truhe aus Eichenholz mit schmiedeeisernen Beschlägen, und ein paar Wandregale aus gehobelten Brettern waren das ganze Mobiliar. Bärger konnte sich nicht erinnern, in dieser Hütte jemals etwas vermisst zu haben.
Aber heute war anderes zu tun.
Er schob die Riegel von der Luke zurück. Es kostete Kraft, den schweren Klappflügel anzuheben. Bärger ließ die beiden Stützen an den Seiten der Luke einrasten, die sie wie ein Vordach in der Schräge hielten. Heller Sonnenschein flutete herein, fiel auf die glänzende Fläche der Hobelbank und ließen ihn für kurze Zeit blinzeln. Dann sah er hinaus.
Immer noch wehte ein kräftiger Wind aus Osten.
Aus den alten Pappelbäumen am Ufer des Sunds schwebten wie Schneeflocken die Wattegespinste mit den winzigen Samenkörnern daran durch die Luft, fielen zu Boden, wo sie sich zu flauschigen Kissen verdichteten und lautlos weiterglitten, bis sie irgendwo im Windschatten liegen blieben. Zum Bild des schneeigen Gestöbers fügte sich das Geräusch des Laubes der großen Bäume, das der Wind in flatternde Bewegung versetzte. Es war wie das Rauschen des Regens.
Es ist seltsam, dachte Bärger.
Ich sehe, was es ist, ich weiß, wie es entsteht und trotzdem sehe und höre ich gleichzeitig immer noch mehr und höre noch anderes, so, als wäre es darüber oder dahinter – den Schnee in den Samenbüscheln, den Regen im Blätterrauschen. Ist das die Arbeitsweise meines Gedächtnisses, das Neues immer mit Bekanntem vergleicht?
Es war Zeit zu beginnen.
Er griff in den neben ihm stehenden Korb und holte ein Bündel Pfeilschäfte heraus. Erhard hatte eingeführt, dass sie im Mittelalterzentrum alle Pfeile auf die Länge von dreißig Zoll zuschnitten. Das machte es möglich, bis zu zwei Mal abgebrochene Pfeilspitzen zu ersetzen, wenn sie denn, was häufig der Fall war, unmittelbar hinter der Spitze abgebrochen waren. Aber die meisten Pfeile gingen im hohen Gras hinter dem Schießplatz verloren.
Zu Erhards eigener Ausrüstung für den Pfeilbau gehörte auch ein echter „Zollstock“, eine Eschenleiste, auf der er Kerben im Abstand von einem Zoll eingeschnitten hatte. Er hatte Wert auf die Feststellung gelegt, dass sein Messgerät drei Fuß lang war. Bärger hatte ihn in Verdacht, dass seine archaischen Messmethoden ein wenig Schau waren, aber Erhard war jedenfalls in der Lage gewesen, mit seinem, wie er es nannte, „anthropometrischen“ System recht genau zu arbeiten. Immerhin hatte Bärger in der Zwischenzeit selbst die kleinen Maße im Kopf: Eine Handbreit waren vier Zoll, eine Spanne acht und ein Fuß zwölf Zoll.
Wichtiger als der Zollstock war für seine Arbeit aber eine Vorrichtung, die Erhard als Klemmlade bezeichnet hatte. Es waren zwei gleich große – ein Fuß lange, hätte Erhard gesagt – Bretter aus Fichtenholz, in die in gleichmäßigem Abstand und deckungsgleich sechs v-förmige Nuten eingeschnitten waren. Zwischen den beiden Brettern konnte man sechs Pfeilschäfte so stabil fixieren, dass sie für die meisten Arbeitsschritte sicher festgehalten wurden.
Bärger löste die Schnur von dem Bündel, zählte zwölf Schäfte ab und ließ sie auf der Hobelbank unter seiner Handfläche leicht vor- und zurückrollen, um sie auf ihre Geradheit zu überprüfen. Nachdem er zwei der Schäfte ausgetauscht hatte, schnürte er das Bündel wieder zusammen und stellte es in den Korb zurück.
Als Nächstes riss er ein handbreites Stück Schleifleinen von einem der Bogen ab, die unter der Hobelbank lagen und zog die Schäfte nacheinander mit drehenden Bewegungen durch das in der linken Hand zusammengelegte Leinenstück. Auch den nachfolgenden Arbeitsschritt hatte er von Erhard übernommen: Mit einem feuchten Lappen wischte er flüchtig über die Schäfte und legte sie zum Trocknen kurz auf die breite Fensterbank in die Sonne. Nach kurzer Zeit hatten sich lose Fasern pelzig aufgestellt und waren nach dem zweiten Schliff endgültig verschwunden. Glatt und leicht nach Harz duftend lagen die Schäfte in Bärgers Hand.
Sechs davon legte er so nebeneinander in die Nuten der Klemmlade, dass das eine Ende etwa einen Zoll weit über die Brettkante ragte, legte das andere Brett darauf und schob das ganze Paket hinter die Vorderzange der Hobelbank, die er vorsichtig anzog. Auf gleiche Höhe gebracht zeigten die Schnittflächen der senkrecht stehenden Schäfte die Schichtung der Jahresringe. Bärger drehte nacheinander alle Schäfte, bis die Ringe parallel zur Klemmlade lagen. Dann nahm er eine Fliesensäge – es war das Werkzeug, das auch Erhard für diese Arbeit bevorzugt hatte – und schnitt damit vorsichtig die Sehnenkerben in die Schäfte. Im Prinzip war die Fliesensäge eher so etwas wie eine feine Rundfeile, mit der man mühelos glatte und ausgerundete Schlitze als Sehnenkerben herstellen konnte. Das war schnell getan.
Bärger löste die Vorderzange, drehte die Klemmlade um und schob die Schäfte so weit zurück, dass nun die anderen Enden für die Aufnahme der Pfeilspitzen bearbeitet werden konnten.
Im Mittelalterzentrum bevorzugten sie die Messingspitzen in Geschossform – sie hießen auch hier in Dänemark „Bulletpoints“. Es war üblich, die Schäfte mit einem Anspitzer anzukegeln und die Spitzen mit Epoxidharz einzukleben. Für beide Arbeiten war die Klemmlade eine gute Hilfe.
Bis zur Mittagszeit lagen zwölf Pfeile mit Sehnenkerben und Spitzen vor ihm auf der Hobelbank.
Für die Anbringung der Befiederung legte Bärger die Klemmlade so auf die Hobelbank, dass die Schäfte mit der Sehnenkerbseite sechs Zoll weit über die Kante herausstanden. Mit einer dünnen Sperrholzleiste, die er in die Sehnenkerben schob, richtete er die Schäfte so aus, dass sie alle in eine Richtung zeigten. Dann klemmte er die Lade mit einer Schraubzwinge auf der Hobelbank fest.
Die Schachtel mit den fertig zugeschnittenen Federn lag auf dem Wandregal über der Hobelbank. Es waren naturfarbene Truthahnfedern, fünf Zoll lang und keilförmig zugeschnitten. Freihändig trug Bärger den Kleber aus der Tube auf und setzte die Leitfedern eine nach der anderen auf die Schäfte, gerade und nur nach Augenmaß, aber mit einer Genauigkeit, die auch Erhard zufriedengestellt hätte.
Er hatte es so übernommen.
Nicht nur das Gerät, auch die Art und Weise des Umgangs damit, die Sorgfalt und Genauigkeit. Wenn er dann draußen auf dem Schießplatz den Besuchern Pfeile und Bogen übergab, die so etwas meist zum ersten Mal in die Hand nahmen, dann fand er die Nachlässigkeit, mit der das Gerät oft behandelt wurde, schon recht ärgerlich. Aber auch daran war er inzwischen gewöhnt. Nur diejenigen, die manchmal danach zu seinen Pfeilbaukursen kamen und so selbst gelernt hatten, was dazu gehörte, einen guten Pfeil zu bauen, wussten dessen Wert zu schätzen. Schließlich war auch das getan. Bärger legte die befiederten Pfeile zum Aushärten des Klebers in die Sonne.
Der Wind hatte nachgelassen.
Als Bärger vor die Hütte trat, war das Rauschen in den Bäumen verstummt. Der Mast des kleinen Segelbootes im Hafen schwankte nur leicht und die flachen Wellen verursachten von Zeit zu Zeit ein hohles Glucksen, wenn sie unter die Bohlen des Steges liefen. Er setzte sich auf die Bank, den Rücken an die sonnenwarmen Eichenbohlen gelehnt und blinzelte in den blassblauen Frühlingshimmel.
Was Erhard da von seinem Blockhauswinter geschrieben hatte, war dann doch sehr überraschend für ihn gewesen. Hatte er wirklich nicht bedacht, worauf er sich eingelassen hatte – ein reichliches halbes Jahr in Eis und Schnee zu leben, möglicherweise wochenlang keinen anderen Menschen zu sehen und mehr oder weniger von dem zu leben, was er zuvor selbst in einem Kanu mitgebracht hatte?
Wie er Erhard kannte, waren die letzten Punkte wohl das geringere Problem gewesen: schon auf Hiddensee war Erhard oft und gern allein gewesen oder hatte doch zumindest diesen Anschein vermittelt. Gutes Essen und Trinken wusste er bei Gelegenheit durchaus zu schätzen, aber er legte keinen besonderen Wert darauf.
Nein, es musste wohl dieses Blockhaus selbst gewesen sein, das ihm von Anfang an nicht gefallen hatte. Verglichen mit seinem Bohlenhaus hier am Guldborgsund musste es ziemlich enttäuschend gewesen sein, vor allem mit der Aussicht, einen ganzen Winter darin verbringen zu müssen. Aber Bärger glaubte Erhard genug zu kennen, der von einmal gefassten Entschlüssen nicht zurücktrat. Immerhin hatte er auf diese Weise Zeit genug gehabt, über Alternativen nachzudenken.
Und er hatte auch gewusst, wem er sie beschreiben konnte, oh ja.
Je länger Bärger darüber nachdachte, umso mehr musste er Maybritt recht geben: Erhard erwartete von ihm eine Antwort, den Lösungsvorschlag für ein Problem.
Die Liste war nicht lang, und Lösungsvorschläge für alle Fragen gab es reichlich.
Die eigentlichen Probleme waren nicht technischer Natur, sondern lagebedingt.
Bärger grinste beim Gedanken an die Binsenweisheit aller Makler: Drei Dinge sind entscheidend für den Wert einer Immobilie – erstens die Lage, zweitens die Lage und drittens die Lage. Das traf unbedingt auch für den kanadischen Urwald zu, wenn auch in einem völlig anderen Sinn. Selbst ein minimales Wohnprogramm war unter solchen Voraussetzungen wohl nur bedingt zu realisieren.
Dass das Blockhaus klein sein würde, hatte er sicher vorher gewusst. Das Regelmaß für eine cabin schien bei dreieinhalb mal vier Metern zu liegen, begrenzt schon durch das Gewicht der Stämme, die ein Mann allein bewegen konnte. Dabei war das Bewegen in der Ebene ja noch das geringste Problem. Je höher die Balkenlagen der Wände wuchsen, umso schwieriger wurde es, die Stämme nach oben zu bringen. So waren wohl manches Mal zwei oder drei Lagen von Rundhölzern mehr geplant gewesen, wenn ein Trapper beim Nahen des Winters aufgab und schließlich froh war, vor dem ersten Schnee das Dach über dem Kopf noch rechtzeitig dicht zu bekommen.
Also: die Blockhäuser waren in erster Linie so klein, weil ein Mann allein in einem Sommer aus massiven Baumstämmen auch mit Hilfe von Seilwinde und Kettensäge nicht mehr zustande bringt als ein Haus mit der Grundfläche eines kleinen Wohnzimmers bei einer Höhe von nicht viel mehr als zwei Metern. Im Vergleich dazu war die Hütte hier hinter ihm geradezu geräumig und von beträchtlicher Höhe, wozu der offene Dachraum unter dem Steildach natürlich beitrug. Aber auch die laut deutscher Bauordnung vorgeschriebene Mindesthöhe von zweieinhalb Metern bei Aufenthaltsräumen waren Bärger schon immer zu wenig erschienen. Wenn es ihm möglich war, hatte er das Maß überschritten.
Zu klein, zu niedrig. Was war gleich der dritte Mangel gewesen? Richtig, zu dunkel.
Kunststück – was sollten wohl zwei kleine Fensterluken von je einem halben Quadratmeter an Tageslicht in eine Hütte lassen, wenn noch dazu an der Sonnenseite ein Vordach über dem Freisitz, der porch, einen zusätzlichen Schatten warf.
Aber Erhard hatte weniger das Tageslicht gemeint. Den mitgebrachten Vorrat an Kerzen hatte er wohl ziemlich schnell verbraucht, danach war ihm nur die Petroleumlampe geblieben. An den Geruch der ewig blakenden Laterne hatte er sich wohl oder übel gewöhnt, aber das schwache Licht, so hatte er geschrieben, habe die Empfindung der ihn umgebenden Dunkelheit eigentlich noch verstärkt.
Problem Nummer vier war das outhouse gewesen.
So nennt man in Kanada das stille Örtchen, auf das sich auch ein Trapper in der Wildnis von Zeit zu Zeit begeben muss. Im Sommer schien es, wenn man von den Mücken einmal absah, keiner Erwähnung wert, aber die Verdauung, so Erhard, nehme keine Rücksicht auf das Wetter und gewisse Probleme ließen sich eben nur bedingt aufschieben.
Bärger versuchte sich vorzustellen, bei fünfzig Grad Kälte im Tiefschnee oder während eines Schneesturms zu einem Plumpsklo ohne Tür am Waldrand zu stolpern. Na ja, vielleicht konnte man sich auch daran gewöhnen, aber er hatte Fantasie genug, dass es ihm bei solchen Bildern kalt den Rücken hinunterlief.
Dazu eine brauchbare Alternative zu finden, schien nicht ganz einfach zu sein.
Seltsamerweise hatte Erhard ein anderes Problem nur am Rande erwähnt, obwohl es Bärger gravierend erschien. Es ging um das Heizen, oder besser: um die Temperaturverteilung in der cabin.
Erhard konnte mit Feuer umgehen. Den kleinen Kamin in seinem Haus auf Hiddensee hatten sie nur selten angeheizt; meist war es im Sommer eher zu warm gewesen. Aber an den nebligen Tagen im Herbst konnte es manchmal empfindlich kühl werden und dann hatte er Erhard zugesehen, wie der einen sorgsam – wie auch anders denkbar – geschichteten Stapel von Kienholzspänen, darüber gelegten dünnen Scheitern und schließlich zwei dicken Kloben obenauf mit nur einem Streichholz und ohne die Hilfe von Papier oder irgendwelchen Zündhilfen im Nu zum Brennen brachte.
Es war auch nicht nur einer von diesen legendären Yukon-Öfchen aus Blech, sondern ein alter gusseiserner Herdofen gewesen, von dem Erhard geschrieben hatte.
Es leuchtete ein, dass die kleine Hütte in kürzester Zeit warm geworden war, aber Erhard hatte geschrieben, dass er oft schwitzend und in Hemdsärmeln am Tisch saß, während gleichzeitig in der Ecke versehentlich vergossenes Wasser auf dem Boden gefror. Das bedeutete also, dass auch in der gut geheizten cabin in Fußbodenhöhe Minustemperaturen herrschen mussten. Und nicht nur das: wenn da öfter mal Wasser vergossen wurde – und Bärger war sich sicher, dass das von Zeit zu Zeit geschehen musste – dann lag inzwischen unter dem Hüttenfußboden im Winter eine massive Eisplatte. Vielleicht taute die nicht einmal im Sommer richtig auf.
Aber selbst wenn Erhard die Ursache dieses Problems erkennen konnte, hätte er nichts dagegen tun können – er war nur Gast in einem fremden Blockhaus, und auch wenn er es gewollt hätte, wäre mitten im Winter eine bauliche Veränderung nicht mehr möglich gewesen.
Ich wüsste schon, was zu tun wäre, dachte Bärger. Dann horchte er auf.
Der lose Kies auf dem Hafenweg knirschte unter dem gleichmäßigen langsamen Schritt eines näherkommenden Mannes.
Pedersen, dachte Bärger, den Schritt kenne ich.