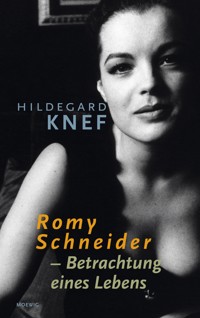Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edel Books - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit "Das Urteil", fünf Jahre nach "Der geschenkte Gaul" erstmals erschienen, knüpfte Hildegard Knef an ihren Erstlingserfolg an. Das Buch handelt von ihrer Brustkrebserkrankung und setzt mit seiner schockierenden Offenheit und schonungslosen Herangehensweise stilistisch und inhaltlich Maßstäbe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 569
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hildegard Knef
Das Urteil oder
Der Gegenmensch
Roman
Die in diesem Buch geschilderten Ereignisse beruhen auf eigenem Erleben, die Personen, deren Handlungen und Äußerungen sind im Sinne einer allgemeingültigen Aussage frei gestaltet und in keinem Fall als Abbilder lebender Personen gedacht; etwaige Ähnlichkeiten sind daher rein zufällig.
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
1
Die Fenster meiner Krankenzimmer, vom Bett aus gesehen fast immer rechts gelegen, scheinen zur verbotenen, meist unmöglichen Seitenlage aufzufordern. Also drehe ich meinen Kopf dem verglasten, selten geöffneten Viereck entgegen, messe Verzweiflung und Hoffnung am eintönigen Bild, das, wetterbedingt und den Jahreszeiten entsprechend, magere Abwechslung bietet. Da war, vor kaum drei Monaten, im Schweizer Spital ein Kastanienbaum, ich hatte seine Kerzen weißlich blühen und gelblichgrau schrumpfen sehen, hatte den täglichen, ihm gezollten Jubel aller Tag-, Nacht- und Mittagsstundenersatzschwestern hingenommen, bis er, mir verleidet, zum teilnahms- und erbarmungslos beobachtenden Kritikaster geworden, bis ich ihn des schadenfrohen Spionierens für schuldig befand und in ihm den saft-, kraft-, gesundheitsstrotzenden Feistling sah, der seine Vielästigkeit benutzte, um sich an Leben, an heftigem und langsamem Sterben in sämtlichen Krebs-, Intensiv- und septischen Stationen zu weiden und selbst seine Wurzeln nach Thermographie-, Mammographie-, Kobalt- und Röntgenkellern auszustrecken, bis ich nach Wochen seine Hoffnungslosigkeit zu meiner werden ließ: nie mehr herauszukommen, ich aus dem weißen Quadrat meines Raumes, er aus dem grauen seines Hofes.
Damals hatte ich nichts vom Urteil geahnt. Das Leben scheint sich einzurichten auf ein Vor, auf ein Nach. Seit gestern werde ich Vor-Urteil und Nach-Urteil denken.
Und vor dem Kastanienbaum war es eine Palme und das Dach einer Garage gewesen. Es war eine lahme Palme, mit ölverschmierten, auberginfarbenen Blättern, die sich nur einmal im subtropischen Sturm verärgert hin und her warfen, um dann wieder gleichgültig-reglos, oberhalb eines Stammes, der die Haut einer vertrockneten Ananas hatte, herabzuhängen.
Davor ein Berliner Hinterhof, abgeblätterte Mauern mit verblaßten Einschüssen und einer zum Trocknen ans rostige, jugendstilverschnörkelte Eisenbalkongitter geklammerten Schürze neben unbewohntem Vogelbauer und Schnittlauchtopf; ein Mann, der sich um sechs Uhr zehn in grauweißem Unterhemd zwischen Stores streckte, seinen Altmännerbusen kratzte und angewidert auf die Fensterreihen des Krankenhauses sah, sich gähnend umdrehte und bis zum nächsten Morgen entschwand. Dann ein Fenster in London, und vielrohrige Schornsteine neben gelbgrünem Himmel; der gepflegte, penible Rasen vor schalldichtem Glas einer Züricher Klinik, ein glattes, fleckenloses Grün, wie schamponiert, wie staubgesaugt, gebürstet, rundrum makellos, dann in Hamburg ein Garten mit engbrüstigen, ängstlich eingezäunten Beeten. Da waren New Yorks Lichtschachte und Feuerleitern, Samedans schneeverwehte Flugpiste, dann bei München eine Birke, eine Trauerweide und Maifrisches an Rändern des Vierecks – dort, wo das Urteil seine ersten Möglichkeiten erahnte, erforschte und nutzte. Jetzt Salzburg. Hinter grünen Jalousieblättern ein dunstig weißblauer Himmel. Hitzehimmel. Zwei Klappfenster der Gynäkologischen, daumenbreite Ecke der Fischer-von-Erlach-Kirche, zerfranste Krone eines Nußbaums. Die Blumenbeete unterm Fenster, den Parkplatz mit Autonummernschildern der Ärzte sehe ich nicht. Ich weiß, daß sie da sind. Am Abend vor der Operation hatte ich am Fenster gestanden, während zwei Schwestern das Laken glattzogen, die Kissen aufklopften, Waschbecken blankrieben. Vorgestern war das. Vor-Urteil. Das sind die Fenster der letzten Jahre.
Die Gesichter meiner Bäckerbekittelten waren zerknirscht gewesen. Ehrlich zerknirscht, beinahe empört. Dennoch gemahnten sie an jene Schauspieler, die, kurzfristig auftretend, die handlungstreibende tragische Meldung überbringen. »Es ist ...«, sprach einer, brach ab, als hätte er nach durchwartetem ersten und zweiten Akt das alptraumhafte Textloch entdeckt, aus dem es kein Entweichen gibt. »Es ist ...«, begann er von neuem, tapfer und mitleiderregend. Doch ich, als herrisch-verängstigte Hauptrollenträgerin, ließ hören: »Sagen Sie die Wahrheit, ich verlange die Wahrheit.« Das »Verlange« stümperhaft betont. Nun nickten sie, als hätte ich die rettende Arbeit der versagenden Souffleuse übernommen, als hätte ich das Signal gegeben, die Weichen des Gedächtnisses gestellt. »Der Gefrierschnitt war verdächtig«, kam flüssig, der Sache sicher. Und der zweite: »Ich war im Labor, der letzte Test hat es bestätigt.«
Nun ein Hüsteln, ein langgezogenes »Ja«, verhaspelt folgt: »Es ist ein Carcinom, kirschgroß.« Das »Kirschgroß« wird größer und größer – hat es nicht einen heiteren, einen hoffnungsfrohen Klang, sommerwarm tiefrot lebendig? –, »Herrgottnochmal«, sagte der erste, doch es war lahm, ohne Auflehnung, aus der Rolle fallend. Der Ausflug in eine mangelhaft inszenierte Hauptprobe schien beendet.
Das Urteil war gesprochen. »Jetzt wird’s albern«, hatte ich gesagt. Und waren ihre besorgten, verschlossenen Gesichter nicht aufgeklappt? Hatten sie sich nicht geglättet, entfaltet, verjüngt und Spuren der Überraschung und Dankbarkeit gezeigt? Sie trugen knackig gestärkte, durch Heißmangeln gezerrte Kittel. Bäckerkittel. Wie sie da standen, lose aufgereiht, hätten sie vom Adamsapfel bis zur Schuhsohle gesehen eben jener Innung angehören können, zum Jubiläumsfoto angetreten. Nichts da vom nachgiebigen Sexygrün der Schweizer Frauenspitäler: Stehkragenhemdchen, im Nacken verhakt, den Eindruck vermittelnd, lässig umgeworfen zu sein, OP-Masken und Hauben im Haute-Couture-Chic liefen mich vor vierundfünfzigster – oder war es fünfundfünfzigster? – Operation sekundenlang den Strandgutzustand vergessen, den angeschnallten, angespülten, atropinversengten.
Der nun sprach oder durch Räuspern bekanntgab, daß er augenblicklich sprechen wollte, jener Wiener, derzeit Salzburg, stand in seinem Bäckerkittel und sah mich aus erstaunten Augen an, und das war wiederum erstaunlich, da die Augen Stehender, auf Liegende gerichtet, fast immer den Ausdruck des Hochmuts, der Anmaßung und Eitelkeit annehmen. Als Kind muß er rote Haare gehabt haben, ein paar Flusen hängen da und dort um seinen runden Schädel, auch die Handrücken sind voller ziegelroter Fusseln, als hätte er sich mit nassen Händen auf einem Schafwollteppich gewälzt. Ich hoffte auf einen verniedlichenden, nach Mutterart geflüsterten Du-machst-schon-Sachen-Satz. »Haben wir freie Hand?« fragte er, und, als könne Französisches zur Klärung beitragen, fügte er ein »Carte blanche?« hinzu. Ich nickte rasch, der Mitbestimmung entwöhnt, klinikgeeicht, Andeutungen misstrauend und in direkter Frage-Antwort ungeübt. Die Fusselhand näherte sich meiner, deckte sie zu, ließ sie frei. Und schon beginnen vier Wände UNHEILBAR zu brüllen. »Würde«, raschelt es hinter steinschwerer Stirn. »Warum ich?« Jammert es freischwebend. »Warum nicht ich?« echot’s hämisch. Wie schob sich das ungebräuchliche Würde-Wort ein? Wörter, Bilder wittern freie Bahn, schrankenlosen Zutritt. Es ist der 7. August 1973. Gestern, am 6., haben sie mich operiert. Gestern gehört zum Vor-Urteil. Sicher waren sie. Sicher war ich. Keine Rede von Urteil. In zwei Stunden werden sie mich wieder holen zur sechsundfünfzigsten Operation. Zuvor wird der Anästhesist mit einem wohlwollenden »Das wird Sie müde machen« die Ampulle Dolantin injizieren, dann das speichelbremsende Atropin, eventuell fürs narkosemürbe Herz ein Strophantin; der Oberarzt wird kommen, der gleiche, der gestern sagte: »Mit noch drei Semestern könnte aus Ihnen ein schlechter Landarzt werden.« Krauses, dichtes Haar hat er, ein heiteres junges Gesicht mit sanften, sehr blauen Augen.
»Was sind Sie für ein Sternzeichen?« hatte ich gefragt.
»Ich weiß nicht.«
»Wann sind Sie geboren?«
»Sechsundvierzig.«
»Welcher Tag?«
Da scheut er zurück, zögernd kommt: »Vierter Juli.«
»Dann sind Sie Krebs.«
Er wird rot, sieht auf die Fischer-von-Erlach-Kirche, als warte er auf das Einsetzen des Geläuts, als könne der schrille Klang das Wort mit sich nehmen. Sie blieb stumm, nur die Jalousie knarzte gleichmäßig leise, wie das lose sitzende Gebiß eines Greises.
In eineinhalb Stunden werden sie ihre Jacken ausziehen, Hosen Hemden Schuhe wechseln, sie werden in ihren schwedischen Holzlatschen einherklappern, werden sich fünf Minuten lang die Hände mit Septical scheuem, mit Hilfe der OP-Schwester die dünnen, sterilen Handschuhe überstreifen. Ein Mann in weißer Schürze wird mich ins weißgekachelte Nebenzimmer schieben, ich werde zusehen, wie eine breite Kanüle die Vene findet, das Pentothal einläuft. Ich werde zusehen, bis ich nichts mehr weiß, nichts mehr spüre. Sie werden über die Wimpern streichen, die Lidreflexe prüfen, dann Kurare spritzen – nein, das werden sie nicht, das tun sie bei Bauchoperationen, damit ihnen der Darm nicht wie zehn hungrige Nattern entgegenspringt. Der Operateur wird sein zum Anästhesisten gewendetes »Kann ich anfangen?« murmeln, und der wird nicken oder auch »Ja« sagen. Sie werden die Haut steril waschen. Fett und Muskeln lanzettförmig umschneiden, Gewebe durchtrennen, Blutungen stillen, Drüsen plus Fett bis zum großen Muskel präparieren und dann im ganzen in seiner Facie ablösen. Irgendwann wird der Operateur »Ich muß mal wieder mit Laien operieren« sagen, oder: »Wäre schön, wenn wenigstens einer aufwachte«, und natürlich: »Wenn ich Schere sage, meine ich immer Klemme, das wissen Sie doch.« Und wenn die Nadel zu groß, wird ein zu operierendes Rhinozeros ins mundverbundene Gespräch geworfen, das man mit derselben vernähen sollte. Der Dialog für fette Weiber entfällt, Kuhvergleiche, Wirtschaftswunderscherze bleiben aus, vielleicht berichtet auch einer von nächtlichen Taten, ob mittelmäßig, ob bravourös. Seufzend werden sie funktions-wichtige Nerven schonen, Lymphknoten abführen, Hauptarterien beachten, kleine Blutungen mit elektrisch aufgeladenen Messerchen verkochen, sich vor Hämatomen, sprich: Blutergüssen, hüten, mit Catgut vernähen, Saugdrainage einlegen; Nachsickerblutungen nach außen ableiten. Der erste Assistent wird mit zwei chirurgischen Pinzetten herantreten, die Haut mit Seide vernähen, den Wundbereich mit Spray abdecken, mit steriler Gaze verbinden, die Saugflasche an Unterdruckflasche hängen. Dann werden sie im Vorraum Kaffee trinken, eine Zigarette rauchen, den nächsten erwarten.
Noch verharren sie am Platz, alle drei, Chirurg, Gynäkologe, Anästhesist. Der eine schniebt ungeduldig-verärgert, doch teilt nicht mit, ob Hitze, ob Urteil ihn zum Schnieben veranlassen. Er war U-Boot-Kapitän und irgendwann in englischer Gefangenschaft bei Singapur. Soviel weiß ich schon. Soweit bin ich einbezogen. Das Abschweifen vom hilfsbedürftigen Körper, der meiner ist, gab Auftrieb. In den Schweizer Spitälern gebot es der Anstand, ihn unerwähnt zu lassen, den Weltkrieg Nummer zwei. Da schien es eingefrorene Aggression, Frustration, Unausgelebtes, Unausgestorbenes und deshalb der Vergangenheit, wie der Gegenwart, unzugehörig. Selbst manche Krankenschwester deutschen Geblüts bemühte sich, ihre Herkunft zu verleugnen, gemahnte sogleich an Emigranten im Amerika des Jahres 47. Nur der einen, die mit Handtasche nach West-Berlin getürmt war, blieb’s »schnuppe«. Doch in der Kantine hatte angeblich eine helvetische Schwester auf sie niedergebläkt, als sie Fett plus Pelle von der mittäglichen Brühwurst bedächtig entfernte: »Das hätten sie doch gern gegessen, als Sie noch drüben waren.« – »Was so allens Drüben is«, sagte sie im reinsten, zermürbendsten Sächsisch, dem soeben erlernter badischer Singsang einen originellen, wenn auch keinesfalls erfreulicheren Neuklang beigab. Weiche Hände hatte sie, Hände, für die man dankbar ist, wenn der Körper gewalttätig wird, wenn er, gefoltert, seine Schmerzfähigkeit offenbart. Selbst ihr hochtoupiertes Haar, ansonsten unerträglich, hatte ich liebgewonnen. Es thronte auf ihrem ohnehin großen Kopf gleich einem japanischen Lampenschirm, zerbrechlich und gefährdet bei unbedachter Bewegung, bei leisestem Windzug, zu stürzen und Kopf, auch Hals mit sich zu reißen. Die Haube trug sie in der Kitteltasche, der Krach mit der Stationsschwester war bleibend.
Mein U-Boot-Kapitän sagt: »Wir haben Zeit, wir werden jetzt ganz in Ruhe vorbereiten.« Er zieht das »Ruhe«,als wolle er mich mit dem Klang seiner tiefen Stimme hypnotisieren, als wolle er mich an dieser wunderbaren Ruhe teilhaben lassen. Und prompt hoffe ich auf Begnadigung, Widerruf, Aufhebung des Urteils. Meine Lider scheinen sich selbständig zu machen, sie dehnen sich, so fürchte ich, bis zum Kieferknochen aus. Ein Kügelchen Hoffnung zerstiebt im Trockenschaum, der durch meine Venen, mein Rückenmark geistert, meinen Speichel schluckt, auf meiner Zunge hefeähnlich quillt.»Bis gleich«,sagen die drei und gehen etwas betreten, einer dem anderen den Vortritt lassend und dadurch den Abgang auf komisch-hilflose Art – ein Schritt vor, einer zurück, die Hand sinnlos wegweisend in Richtung Tür – verzögernd. »Bis gleich«, als würden wir uns zum Kaffee treffen, zum Spaziergang, zum Sonnenbad an der Salzach. Decken schlingern und schwimmen, als lägen sie im Wasserbad. Das Leinentuch klebt auf Schienbeinen, aus den Kniekehlen tropft es wie aus Gartenschläuchen; frische, nicht frische, ganz frische Narben pfeifen und kratzen wie weiland sämtliche Pullover einer Kindheit. Die Hitze hängt im Spinatgrün des Vorhangs, am Waschbecken, im Thermometerglas, am Sauerstoffgerät, im Elektrokardiograph, der an selbstgebasteltes Radio erinnert. Meine Haare gleichen Raststättenspaghetti, naß und säuerlich riechend; der Wunsch nach Deodorant wird manisch, brav hüpfen Werbespots durch femsehgelullte Zellen. Salzburgs Augusthimmel strahlt mich an. Wie sehne ich mich nach den tröstenden, gütigen, schmerztilgenden Drogen erster Operationen, als alle Krankenhäuser nach Lysol stanken und man nach den Ätherkurznarkosen kotzte. Wie sehne ich mich nach den paradiesischen Tagen und Nächten, als man Elend und Panik gegen ein violettes Kissen eintauschen durfte, auf dem man schmerzfrei davonflog, als Spasmo-Inalgon, als Fortral, als Valium plus Novalgin-Infusion noch ungegoren, ungeboren in makabren Hirnen ruhten, als die nervenzerreibenden, nackenzersägenden, allergiesäenden Bösartigkeiten uninjiziert blieben, als die Maßlosigkeit eines Schmerzes unausgekostet weichen mußte, als Eukodal und Klyradon, als Morphium noch nicht unter dem perfidimbezillen Banner der Suchtgefahr im Lächeln einer Oberschwester, im Besserwissen eines knackgesunden und allemal unoperierten Internisten eingefroren lagen, als der klappernde Schlüsselbund zum Giftschrank keine verspielten Süchte unterstellte, als adoleszente Herointräume noch keine Rechtfertigung lieferten.
Gallig grämlich das Erwachen. Drahtumwickelt wie Frachtgut liege ich. Strippen, bräunlich mit weißen Knöpfen, schaukeln zwischen mir und EKG-Überwacher. Eine Infusion kleckert schleppend beharrlich, als müsse sie sich zur Abgabe eines jeden Tropfens widerwillig entschließen. »Wie lange habe ich?« frage ich. Sie ist kugelrund, mit dunkelbraunen Knopfaugen im kugelrunden Gesicht. Die schwarzen, dünnen Haare sind zur Zwiebel zusammengedreht und ragen aus der brettharten Haube gleich einem Taubenei. Sie ist heiter, sie ist zufrieden. »Ausgefüllt«, sagt sie, und: »Mir geht’s immer gut, ich weiß nicht, warum, verdient hab’ ich’s nicht.« Seit zwanzig Jahren steht sie im Operationssaal und assistiert, verehrt ihren Professor, bemängelt die »ungelenken« Pfoten anderer, verklärt sich im Vergleich, der ihren Professor in beispiellose, unangetastete Höhen entschwinden läßt. Ludmilla heißt sie. Ludmilla sagt: »So dürfen Sie nicht denken«, und ihre Stimme, ansonsten hell und kärntnerisch markig, rasselt vor Aufregung, vor Furcht, die Pausen zwischen postnarkotisch dahinplätschernden Sätzen können kürzer werden, zum Gespräch ausarten. »Viele kenn’ ich, viele, die haben Jahre damit gelebt, uralt sind’s geworden damit«, sagt sie entschieden. Ich, quengelig/Streit suchend, Anästhesie- und Inalgon-gebeizt: »Was heißt „damit“, warum die Umschreibung?« Sie überhört, bleibt dabei: »Uralt sind die geworden, jawohl.« Sie setzt sich auf den Stuhl neben meinem Bett, schnellt sogleich wieder hoch, eilt zum Fenster, just als das scheppernde Gebell der Erler Kirchenglocken anhebt. Stimmen aus dem Krankenhauspark, bisher nölig einschläfernd, erwachen schnarrend-mißmutig. Da quäken und prasseln Rufe, werden Wagentüren nachdrücklich zugeschlagen, als verlange das Gedröhn eine Antwort, eine Stellungnahme, die Entladung. Ludmilla zerrt an den verbogenen Plastiksträngen der stets klappernden, nun lautlos gewordenen Jalousie. Dann eilt sie zum Waschbecken, kontrolliert Gläser und Tücher, reibt an Wasserhahn und Spiegel. Ihre raschen Bewegungen, vom langen Tag abgenützt, sind nachlässiger, friedlicher als morgens, da sie lautlos, doch heftig von eigenen, kugelrunden Energien gespeist ins Zimmer stürzt, so daß man meint, sie müsse, von nichts aufgehalten, zum Fenster hinausschießen, um unten angekommen die Treppe aufs neue zu erklimmen, bis ihr Tatendrang, zur Ordnung gerufen und im OP eingekreist, auf Selbstzerstörerisches verzichtet. »Gebrüllt hat der Professor heut’ früh, weil’s so heiß war im OP«, brüllt sie über das gurgelnde Geläut hinweg. »Hab’ ich den Herren gesagt: »Wenn Sie weniger frühstücken würden und weniger Kaffee trinken, würden S’ auch weniger schwitzen«, hab’ ich gesagt. Also angesehen haben die mich, die Herren.« – »Die Herren« knallt in das letzte, ausatmende dürre Klingeln einer einzige Glocke. »Ham S’ Schmerzen?« fragt sie unvermittelt und hat zwei dicke Tränen vor den dunkelbraunen Knöpfen sitzen. Sie hocken da, bewegungslos, laufen weder raus noch rein, sie bedecken die Knöpfe wie Gelatine. »Sterben tun immer andere«, sage ich, noch immer quengelig-renitent. »Du mußt Größe zeigen«, schießt durch einen Kopf, der offenbar meiner ist. Er scheint neben meiner Schulter zu liegen, mein enthauptetes Haupt, wie in der hirnrissig-lustigen Reklame, in der ein Herr in Urahnenwams sein lächelndes Gesicht unterm Arm trägt. Durch diesen meinen Kopf also schießt das von der »Größe«, unter der ich mir ebensowenig vorzustellen vermag wie unter dem präoperativen »Würde«. Es hilft dennoch. Lehrsatz der Eingewiesenen: Nicht weiter als sechzig Stunden denken. Die Minute ist entscheidend, sie könnte dich zur nächsten tragen. Was ist banaler: die Sucht zu leben oder die Sucht aufzugeben?
»Die Narbe macht Schmerzen so drei, vier Tag’ lang«, sagt Ludmilla. Wieder setzt sie sich. »Sie müssen’s glauben, weg ist’s, gut ist’s, gefunden ham ma’s.« Sie streicht über das Tuch, ist froh, einen Fleck zu finden, hastet zum Schrank, wechselt aus, bringt Franzbranntwein, massiert die blassen, die schauderhaft laschen, bleichen Waden, die geparkten, bettgelagerten, ungenutzten. »Und in der Lymphe war nichts«, sagt sie, über meine Beine gebeugt.
Der Himmel ist dunkelrot, als brenne eine Stadt, als brenne das Land, ein weißgrauer Streifen, von einem Flugzeug gezogen, läuft durch das Rot, sinkt zusammen, gruppiert sich zu Staubmäusen, wird verspeist, vom Rot geschluckt, als hätte es Flugzeug und Streifen nie gegeben. Noch planschen schwimmen segeln sie, rollen an Ufern, kauern im Gras, belagern Waller-, Mond-, Wolfgang-, Traun- und sämtliche anderen Seen. Ihre Haut wird heiß sein von der Sonne, beim ersten Glas Kalterer werden sie kichrig oder moros. Später werden sie, Theater-, Konzert- oder Opererschlafft, an die grüngedeckten Tische des »Goldenen Hirschen« stürzen, Tafelspitz Leberknödel Torten schlucken, zunächst gedämpft, dann lauthals Kritik üben, Kalorien zählen, das letzte Achtel bestellen.
»Geh’n Sie manchmal ins Konzert?« frage ich. Entgeistert sieht sie auf. »Ich?« ruft sie, als sei sie überzeugt, ich müsse jemand anderen meinen. »Nein«, sagt sie verwundert und setzt sich, Franzbranntweinflasche in der Hand. Sie schüttelt den Kopf, lächelt erschreckt, als versuche sie sich ein Leben außerhalb der Klinik vorzustellen. Sie hat den gleichen Ausdruck, den Menschen annehmen, wenn sie sich zum erstenmal in einem Film sehen oder ihre Stimme auf einem Tonband hören. »Spazieren geh’ ich manchmal, auf dem Mönchsberg, setz’ mich da hin, in meiner Freistund’.« Sie errötet, als bekenne sie eine Schuld, als sei die Unvereinbarkeit ihres Krankenhaus-Salzburg mit dem Festspielstadt-Salzburg einem Versagen zuzuschreiben. »Ich hol’ die Spritze, dann können S’ schlafen.« Sie schnellt hoch, entwischt.
Mein Salzburg war krankenhausfrei gewesen. Krankenhausfrei wie ein Reiseprospekt. Heißer »Jedermann«-Nachmittag, vor zwanzig Jahren, mit Mutter. Einmal Wilhelm Backhaus, der, gleich zornbebendem Adler, Köpfe anpeilte, Beute suchte, sich erhebende Frau mit Kind ausmachte, sie mit Blick an Sitz festnagelte und, noch immer Schnabel und Krallen angriffsbereit, zu Tasten und Beethoven zurückfand. – Und »Don Giovanni«, Erinnerungen an Albernes, an übereifrigen Komparsen, gewandet in napoleonisches Kostüm, ganz und gar fehl am Platze, unübersehbar von weißer ungeschminkter Inspizientenhand in die Kulisse beordert, den erschütternden Rückweg antretend, anfänglich souverän, dann kleiner werdend, schließlich rutschend. Und ich, geschüttelt und wiehernd, unterm Gezischel der Nachbarn das Weite suchend. Salzburg im November: Stadt mit hochgezogenen Schultern, an neblig-schwarzen Tagen Gassen wie in Venedig, der Kern zusammengeschmolzen, als wollten Hochhäuser und Außenbezirke überhandnehmen und hemdsärmelig das im Sommer Gelobte beiseite schieben. Vernieselte, glückliche Woche in St. Gilgen. Später die Hochzeitsreise und Fuschl, im Elektroboot um den See herumtuckern. – Wer sagte damals: »Hier sollte man leben«? Er oder ich? In Gmunden war das. Dann Mondsee, hochschwanger war ich, behäbig zufrieden, dick wie Flußpferd.
Und abends bei Tomaselli, Eis löffeln, durch die Getreidegasse schlurren, die Salzach begucken.
Vor drei Tagen im zugigen Festspielhaus, »Idomeneo« mit seinem Wahnsinnslibretto, mit einem alles vergessen lassenden Dirigenten. Salzburg, Festspielstadt, wie’s versprochen, wie sich’s gehört, und ich tat mit.
Was ist anders seit dem Urteil? Nichts ist anders. Alles ist anders. Nein. Nichts. Was würde ich tun, wenn sie jetzt kamen, sagten: »Wir haben uns geirrt«? Schreien vor Glück? Kaum. Dankbar weinen? Vielleicht. Mich in rosarote, katzenweiche Sicherheit kuscheln? Ja. Und dann? Anwesend, vorhanden, zugegen war es immer. Seit der Panzer über den Gefangenentrupp hinwegrollte, oder schon vorher? Seit der Panzer rollte und ich im Graben lag, den Schlag auf rechte Kieferseite spürte, die Zähne lose herumsprangen. Seit damals das Gefühl, auf Pump zu leben, eilig, hastig, Schultern angespannt, selbst im Schlaf hochgezogen, als erwarte ich einen Schlag, eine saftige Ohrfeige, Watschenmann Watschenfrau. Bei den Ärzten sage ich jedesmal meinen Vers auf, wie beim Verhör. Bin ihr Häftling, ihr Leibeigener, täusche kuhäugige Ergebenheit vor, denn irgendwo tickt die List: mit ihrer Hilfe werde ich ihn überlisten, meinen einzelligen, meinen vielzelligen Mörder. Mit was geht man ihm an den Hals, wie stellt man die Falle, wo ist die Kandare, wo das Schlafittchen? Mein Wärter wird zum Mittler, Mittler zwischen Nicht-Existieren, Doch-Existieren, Noch-Existieren. Sie sind sich uneins, die Mittler. Sie knirschen Zähne, gucken bedepscht, selbst das Skalpell hat Fragezeichen. Bevor sie kuschen, ein würdiger Vorschlag: Bestrahlung. Auch da werden sie debattieren, zu keinem Ergebnis kommen, der Platzälteste wird sich durchsetzen. Dazwischen Harmloses: Milch, viel Milch, spazieren, schlafen, nicht dran denken, ignorieren. Ignoriere, was dich beherrscht, denn der Mörder braucht Diener, der König den Höfling, der sich verneigt. Warum bibbere ich? Unfähig, mit der einzigen Sicherheit zu leben, dem Noch? Leben fürchten, weil Tod fürchten. Erfolg fürchten, weil Mißerfolg fürchten. Alter fürchten.- Aber nicht doch. Ich nicht. Wenn ich es erleben darf. Darf dürfen. Demut als Schlupfwinkel. Brav, setz dich, bring den Knochen, auch wenn wir Vegetarier sind. Unauffällig leben, unauffällig sterben. Brav brav, auf dein Lager. Hoffnungskekse. Mürbeteig. Die Dunkelheit bringt mich um. Nein, nicht die Dunkelheit, du Idiotin. Ich werde Notruf anrufen, sagen: Ich bin in Not. Ich werde sterben. Sagen Sie nicht, daß Sie auch sterben werden, denn Sie kennen Ihren Mörder nicht. Noch nicht. Meinen kenne ich. Wer will schon mit seinem Mörder im Dunkeln allein sein. Sich ansehen, sich begrapschen lassen von dem Einzelligen, Vielzelligen. Ich werde dem Notrufmenschen sagen: Ich habe ein Kind. Es geht nicht mal zur Schule, und ich fürchte, der Kaiserschnitt hat uns beide – versteh’n Sie? beide – ans Messer geliefert. Wo ist der Mit-Mensch? Warum heißt er nicht Gegen-Mensch? Eine Welt voll Gegen-Mensch; und ihre Verbesserer sehen bösartiger aus als ihre Komiker. Ich stehe auf einem Bahnhof – dabei hasse ich Züge –, doch ich stehe auf einem Bahnhof und winke nach. Sagen Sie mir, wie man anständig stirbt. Keiner sagt, wie man anständig lebt, vielleicht weiß einer, wie man anständig stirbt. Ich bin, laut Steuererklärung, eine natürliche Person und will wissen, wie man anständig stirbt. Peinlich, peinlich, werden Sie sagen und Turnstunden belegen, zur Kur fahren, Wasser treten, Rumpf beugen hinausschieben. Das Schicksal hat mit uns Hühner zu rupfen, gigantische, aufrührerische Hühner. Die sanfte, zittrige, valiumsüchtige Schwester im Schweizer Spital sagte: »Am liebsten arbeite ich auf der Krebsstation. Die Menschen sind so dankbar.«
Ludmilla befühlt den Hüftknochen, sticht in den Muskel, legt die Spritze beiseite. »Ich bleib’ da, bis Sie einschlafen.« Sie setzt sich, legt die Hände nebeneinander, betrachtet sie. »Rot sind die«, sagt sie verärgert, dann: »War’n S’ oft in Salzburg ?«
»Im Krieg zum erstenmal.«
»Meinem Vetter, dem Karli, dem hätt’s gefallen, die Musik, der spielte Klavier, herrlich spielte der.« Die Gelatine sitzt vor den Augäpfeln. »Grad’ verlobt war’n s’, meine Freundin und er. Gertie hieß sie. Krieg war und eingezog’n war er zu den Jagdfliegern oder so was. Und wir, die Gertie und ich, wir war’n im Ferienheim von der Schwesternschul’. Da kommt ein Telegramm, der Karli ist abg’stürzt.« Die Gelatine löst sich ab, sprüht übers Gesicht, rinnt wie Landregen. Mit einem Tuch reibt sie Kinn Hals Augen, heftig, grob; unaufhaltsam rinnt es weiter. Die Stimme klar und trocken: »In der Nacht bin ich mit der Gertie draußen g’sessen, vor der Schul’. Die Bank stand an einem Hang, unten war eine Betonfläche, das sollt’ Parkplatz werden, da fragt sie mich, ob ich glaub’, daß wir mit denen, die wir lieben, im Tod vereint werden. „Ja“, hab’ ich g’sagt, „Ja, das glaub’ ich.“ Da ist sie aufg’standen und hinunterg’sprungen. Ich weiß nix mehr, gar nix. Nur der Körper auf dem Beton, der verdrehte Hals und ihre langen Haar’. Ich hab’ g’schrien und g’schrien. – Ich hätt’ das nicht sagen dürfen.« Sie zerrt an ihrem Gürtel. »Fett bin ich. Wenn ich nur wüßt’, wovon ich so fett werd’.« Sie steht auf, schiebt den Stuhl in eine Ecke, stellt sich ans Bettende, pustet wie ein Kind, das Seifenblasen macht. »Ich hätt’s nicht sagen dürfen, und ich hätt’s Ihnen nicht erzählen dürfen. Schlaf’n S’jetzt, vergess’n S’ alles. Gefund’n ham ma’s. Gut is.« An der Tür sagt sie: »Ich bleib’ heut’ in der Klinik. Ich komm’ noch mal vorbei.«
Die Betäubung wuselt heran. Gedanken wie in Ei gewälzt, Ei und Mehl, glibbrig gleitend, panierfertig. Ein pfeifender Schmerz stellt sich auf, klaviersaitenstramm: Wo bleibt mein Protestmarsch? Marsch der Kriegs- und Arztversehrten? Wo? Kuschte mundtot, servil, machte mit bei werbegenehmer Gesundheit plus Jugend gleich Erfolgserlebnis. Wehe, es wird ihnen ein Zahn gezogen, sie vergreisen zerflusen verludern. Ich weine ihm nach, dem unter »Streß« und »psychosomatisch« versauerten Protest, dem von Internisten- und Spezialistenherden Ausgeweideten. Behende begab es sich auf den Weg, das Urteil, wohl wissend, daß viel Rasen viel Psychosomatisches deckt. Ich möchte Herbstrot sehen, Novembernebel, Schnee, den ich nicht mehr leiden kann, seit er mich drei Jahre lang in Schweizer Alpenhöhe fixiert und durchschaut; rammdösig machendes Kalkweiß, stur, wie das Blau des Tropenhimmels. Ich möchte Frühlingsgrün sehen, den nächsten quittegelben, semmelblonden Sommer. Die Leidenschaft verpustet nicht. Wenn es wahr ist, daß nur die Alten am Leben hängen, war ich mit achtzehn alt. »Während der ein, zwei Testjahre tun Sie nur das, was Ihnen Freude macht«, sagt der mit den roten Fusseln auf den Händen. Habe ich gelernt zu tun, was Freude macht? Ich habe gelernt zu tun. Punktum. Hat mich das Tun gefreut? Ich weiß es nicht, wahrhaftig, ich weiß es nicht. – Und: »Sie haben auf der Wahrheit bestanden. Sie sind die erste, der wir sie gesagt haben, seit sich eine Frau aus dem Fenster gestürzt hat. Dabei war’ sie zu retten gewesen.« Auf den ersten Teil unseres Lebens werden wir zu wenig vorbereitet, auf den zweiten gar nicht, auf den Tod überhaupt nicht. Worauf werden wir vorbereitet? – Und noch eins: »Regen Sie sich nie auf.« Ich werde Martin anrufen, Martin, meinen Freund: »Du bist Pfarrer. Sag etwas. Hilf.« Meine Auswege sind glitschig wie Seeton, wie Lehm nach Regen. In Amerika sagen sie’s dir. Knapp kühl erschreckend, ohne Fisimatenten. Und bei uns? Da drucksen sie herum. Wie dankbar tauchen wir ein in die Überlebensgeschichten, die atemberaubenden, als hätten wir dem Tod den Todesstoß versetzt. Inder kennen kein Wort für »morgen«. Ich bin morgenausgerichtet. Wie drehe ich den Spieß jetzt um? Sie ekelt mich an, die verblasene Lebensunlust, die Koketterie mit Tod und Terror. Zeigt sie vor, breitwandig stereophonisch, bildschirmig beschränkt, disneygleich verniedlicht, zeigt sie vor, auf daß die latenten Kriminellen Aktive werden und zwischen Bohnerwachs- und Silberputzreklame dem Blutrausch beitreten. Zeigt sie vor, auf daß sie in den Hirnen der Kranken kleben und sie das letzte, fürchterliche Fürchten vor den Menschen lehren. Und schon tapern sie, die Bilder satanischer Folter im Nachmittagsprogramm, von nöligem Kommentar erläutert. Wie stolz sind wir auf die Brutalisierung, auf den Hang zur Gesinnung, der so wahnwitzig ist wie der Hang zur Wahrheit. Da lobe ich den sanften Schmäh, tausche ihn dankbar ein für knochenbrechende Frisch-von-der-Leber-weg-Wahrheit, die nichts als wahnsinnige Unwahrheit. Von Barbarei zur Dekadenz und einmal retour, im Atemzug einer Generation. »Wir haben was erlebt«, sagen sie, wenn ihr Leben voll überlebtem Grauen war. Sprecht, sprecht, sprecht von unheiler Welt, sprecht von Underkill, von Overkill, von Luft-, Meer- und Flußverschmutzung, von unserer besudelten, von unserer mißbrauchten Erde, nur vom Sterben, vom Tod sprecht ihr nicht. Zuckt zusammen, wie weiland vor Pornographie. Der parate Wortschwall gerät ins Stocken, gibt sich indisponiert, verwundbar, murmelt enteilend: Schamlos. Selbst in den Krankenhäusern bekommt er einen Fachnamen: »Wir hatten einen Exitus«, sagen sie, runzeln die Stirn, sind für Exitus nicht zuständig. Zuvor ein verwirrter, gemeindeausgebooteter Pfarrer, schlurft von Bett zu Bett, wird aufgesogen von einsinkenden Augen und ihrer Einsamkeit, trifft allein auf den totgeschwiegenen Tod. – Wann hatte ich die Vision, daß wir nachher in plastikbestuhlter Flughafenhalle auf Abruf warten? Ich will kein Mitleid. Ich will Mitleid, doch nicht eures, vielleicht mein eigenes; denn selbst wenn wir einer Meinung wären, wären wir es aus verschiedenen Gründen. . . Nein, Hypochonder bin ich nicht. Nicht mehr. Von Krankenhaus zu Krankenhaus ging’s, immer hieß es: »Damals, nach Hamburg«, oder: »Zwischen Los Angeles und Zürich«, oder: »Das war vor München.« Gemeint waren Operationen, Ärzte, Rechnungen. So war das. So ist das. So ist das schluck’ ich nicht, noch nicht; ich randaliere. Immer waren es zwei, zwei Operationen hintereinander, immer die gleiche ermüdende Überraschung bei Ärzten, bei mir. Irgendetwas ging bei der ersten schief, oder irgend etwas kam hinzu, dazwischen Arbeit – gibt es eine Entschuldigung für Fleiß, Bienenfleiß? – und bestußte Fragen: »Was glauben Sie, ist der Sinn des Lebens?« Und das wissende Lächeln, aus dem die Dummheit tropft. . .
In vier Wochen Richtfest. Richtfest fürs erste Eigene, ungemietete, Gekaufte. Nach dreißigjähriger Flucht, nach zehnjähriger Suche, auf der ich mehr Plätze, Länder, Häuser gesehen als die Söldner Cäsars, die Kolonialtruppen Britannias.
»Warum schlafen S’ nicht?« fragte Ludmilla. Teils Vorwurf, teils Verzeihen. »Wann kann ich raus?«
Die Lippen werden rund wie die Augen; nach zwei Schnappern: »Hat man so was gehört? Denkt an raus.«
»An was sonst?«
»Gefällt’s Ihnen nicht bei uns?« Besorgt ist sie, als verwalte sie eine Pension. »Was Krankenhaus angeht, besser als irgendwo.«
»Wissen S’, daß wir die meisten rausschmeißen müssen? Denen fällt immer noch was ein. Also, Herr Professor, hier tut’s weh und da is’ noch was.« Sie klopft auf Bauch und Rücken, lacht glucksend, schlägt sich erschrocken auf den Mund, flüstert: »Also wirklich, krankenhausverrückt san die, klingeln allewei, wenn’s gar nix gibt.« Sie nimmt meine Hand, als wolle sie »Guten Tag« oder »Auf Wiedersehen« sagen, hält sie, als könne sie sich nicht entschließen, sie fortzuziehen. Fest, kindlich-knubblig ist die Hand. Schmerz, Zorn, Gezeter verlieren sich in ihr, gleiten ab, weichen Müdigkeit und Erschöpfung.»Ich werd’ Ihnen einen Fernseher besorgen, morgen läuft Ihre Sendung«, sagt sie. »Es ist so lange her«, höre ich mich sagen, glaube zwischen Bandagen, Schnüre, Kissen zu rutschen, unsichtbar zu werden, mich aufzulösen in klitzekleine Prismen, wie die in den Schüttelrohren der Kinder, die in immer neue Muster zusammenfallen. Der Morgen ist schlimm. Es sind die knusprigfrischen Geräusche, die Gebadete, Ausgeschlafene machen, das erwartungsfrohe Ungleichmaß ihrer Schritte, die mühsam gedämpften Begrüßungen, das Klicken der Linken, Klirren der Frühstücksgeschirre. Die Stationsschwester kommt herein. Das Weiß der Haube, des Kittels paßt gut zum dunkelblonden Haar, zu den weiten, grauen Augen. Ihre Bewegungen sind langsam, ausgeglichen. »Haben S’ a bisserl g’schlaf’n?« fragt sie. Ich weiß, daß ich nicht antworten darf, ich weiß, daß ich heulen werde, heulsusig heulen, aus Angst vor einem Tag, vor einer Nacht, vor dem Urteil, vor der Gewißheit. »Schmerzen?« – »Es geht.« – »Sie werden’s schaffen«, sagt sie, kaum hörbar. Ich angele meine Puderdose vom Nachttisch, werfe sie an die Wand. Splitternd fällt sie zu Boden, sprüht Puderstaub über blankes Linoleum. Erstaunt starren wir ihr nach, als sei sie selbsttätig dort angelangt. Sie beugt sich hinunter, sammelt die Splitter ein, legt sie vorsichtig auf den Rand des Waschbeckens, nimmt meinen Kopf, drückt ihn gegen ihre Schulter. »Sie dürf’n sich nicht aufreg’n«, sagt sie immer wieder, legt meinen Kopf zurück, setzt sich neben mich, blinzelt, versucht einem zitronengelben Sonnenstreifen auszuweichen.
Nachts kommt mein U-Boot-Kapitän. Er ist bleich, verschwitzt, auf dem Nasenrücken hat er einen roten Streifen, da, wo die OP-Maske festgebunden wird. »Bis jetzt ham ma operiert«, sagt er und knallt sich auf den Stuhl; »weiß nicht, ob ich die durchkrieg’. Wochenlang zum Arzt gerannt ist sie, der gibt ihr Morphium. Wos hat s’? An Dreck hat s’ im Bauch, daß einem graust. Wann kommt s’? Nachts kommt s’, wann sonst. Verruckt könnt’ ma werd’n. Anzeig’n müßt ma den Arzt, den bloßfüßigen, g’schert’n, an wem bleibt’s hängen, wenn s’abkratzen? An uns bleibt’s hängen, na kloar. An Whisky brauch’ ma jetzt.« Er geht zur Tür, als liefe er durch kniehohes Gras. Er watet, kommt zurück mit Flasche und Zahnputzglas, gießt ein, läßt mich nippen,nimmt einen großen Schluck,stöhnt genießerisch.»An der Salzach war ich für a halbe Stund’heut’nachmittag, also wälzen tun die sich da, der ganze Boden voll Sperma...« Ablehnend schüttelt er den Kopf, fügt hinzu: »Grün könnt’ ma werd’n vor Neid. In zehnTagen könn’ma Fäden zieh’n,dann können S’raus hier,aus der Hitzen.Tut’s weh?« – »Mäßig.« – »AWeanerin san S’ net.Wann ma dena sagt: „Guat schaun S’ aus, gnä’ Frau“ sag’n s’: „Oba die Füaß tun ma weh.“« Es ist Sonntag, Krankenhaussonntag, ledern, verdrießlich, beklemmend. In der Öde bricht mein Rotfussliger ein. »Ich war fliegen«, verkündet er und streicht sein kahles Haupt, als stünde eine windzerzauste Mähne zu Berge. »Kleiner Rundflug, hat mir gutgetan.« Seine Rechte wedelt in Richtung Himmel. Er hält inne, sieht sich um, als könne er sich nicht erinnern, was ihn hierhergebracht, dann setzt er zur Wanderung an; schusselig läuft er hin und her, beschreibt Bögen und Kreise, zwei Achten, ein Quadrat. »Ich fliege schon lang«, sagt er, dehnt »lang« zu einem Jahrhundert umfassenden Zeitraum. Der Versuch, ihn als Piloten einzuordnen, mißlingt, ich sehe ihn Hebel und Knöpfe verwechselnd, Anweisungen überhörend, bin überzeugt, daß die Fähigkeiten der Selbstdisziplinierung am OP-Tisch aufgebraucht. Meine Gedanken scheinen sich mitzuteilen. »Mein Hobby«, sagt er achselzuckend und so wienerisch, daß der englische Ursprung des Wortes in Frage gestellt; »jeder hat so seinen Tick.« Stolz reckt er sich, wie jemand, der, obwohl manuell unbedarft, eine knifflige Reparatur ausgeführt. »In Österreich wollen S’ leben?« fragt er unvermittelt und preßt die Lippen zusammen. »Hauptsächlich leben«, sage ich. Er rennt los, als hätte eine Alarmglocke angeschlagen. »Werden S’«, ruft er. »Österreich wird Ihnen guttun. Wir ham alles hinter uns, was die anderen noch vor sich ham. Auch a Trost. Ham ma Mut für die Fäd’n?« – »Pack ma’s«, sage ich dialektneidisch, rutsche plattfüßig ins Federbett österreichischen Schleppgesangs, mit Jammergedanken an »NujradeBerlinerisch«; selbst schlampig geschriebenes BLN wich buchstabentreuem, postleitgezähltem Berlin, als sei es Dorf, Kaff, Nest, Burgflecken. »Wenn S’ ka Freud’ ham, lass’n ma’s heut. Red’n ma a bisserl. Durchs Reden kommen die Leut’ z’samm.« – »Auf los jeht’s los«, sage ich donauabtrünnig, spreezugewendet. Er reißt die Tür auf, die Stationsschwester steht wie aus dem Boden gestampft assistierbereit neben Verbandswagen, auf dem Pinzetten Skalpelle Scheren Schläuche Gummihandschuhe liegen. »A bisserl hintennach san ma«, sagt er und wickelt mich aus wie vielfach geschnürte Bahnfracht, »aber vielleicht ist’s besser als vornweg, wenn s’ eh alle am Abgrund stehn.« Er nimmt Skalpell, Pinzette, beugt sich vor, murmelt: »Aus’m Verkehr müßt’ ma sie zieh’n, die Leut’, aus’m Verkehr.« Ein schwarzer Faden schaukelt vor meinen Augen, verschwindet; »den ersten hätt’n ma«, höre ich, und: »Viel versäumt ham S’ net bei die Festspül, a Durcheinander war des auf der Bühne bei dem Shakespeare, wenn’s so zuging bei unsereins in der Chirurgie, würd’ ma uns gegenseitig operier’n und die Patienten möcht’n dalieg’n und zuschau’n. Sechs ham ma, fehl’n noch an die dreißig. Mach ma weiter?« Ein gequetsches »Ja« läßt ihn abbrechen. »Also wenn’s weh tut, lassen ma’s.« – »Morgen tut’s nicht weniger weh.« Er dreht sich zur Schwester, reißt die Augen auf, sagt: »Notschlachten?« Sie starrt ihn an, verdutzt, entrüstet, ruft: »Aber, Herr Professor«, erschrickt ob des Tadels, schwächt ihn mit einem nervösen Kichern ab. »Ich kannte eine Ärztin«, sage ich, »Landärztin, die wurde nachts zum uralten Dorftyrannen gerufen. Der sagt: „Bitte, Frau Doktor, helfen Sie mir, ich will nicht sterben.“ – „Hör auf“, sagt sie, „ein Leben lang hast du die Leute geärgert, nun stirb schon.« Sein Lachen kommt prustend, stoßweise, wie das Wasser aus verstopftem Hahn; die behandschuhten Hände von sich gestreckt, steht er da, als würde er gekitzelt, dann klappt er nach vorn, beäugt gesammelt – aufmerksam Narben und Fäden, schnippelt weiter. Seinen von »Jetza« und »Au« unterbrochenen Ablenkungsmonolog beginnt er mit: »Heut’ san’s alle politisch, selbst wann’s lernen, wie’s an Fußpilz behandeln soll’n, müssn’s den politisch behandeln. Aber warten ma’s ab. Der Heraclitus sagt, daß sich alles verändert. Doch da kommt der Parmenides und sagt, daß sich gar nix verändert. Und daß kalt nicht nur heiß ist, wissen ma eh, und daß nichts so heiß ’gessen wird, wie’s ’kocht is, außer ’s Fädenziehen, wissen ma a, und wenn ma so weitermachen und der Gynäkologe nix dagegen hat, von mir aus können S’ heut’ gehn.« Er richtet sich auf, sieht auf mich herab, genießt Sprachlosigkeit, Freude, Dankbarkeit. Das Urteil zertrieselt, wird fadenscheinig, unglaubwürdig, zerbirst an wilder Glückseligkeit und Hoffnung, die hinter plötzlich unbegreiflicher Wende Amnestie wittert, Krankenhaus gleich Festung setzt, der wiedergewonnenen Freiheit unterstellt, gesundheitssicher krankheitsfremd urteilsfrei zu sein. Bevor er seine Meinung ändern könnte, stehe ich auf. »Nicht so rasch«, schreit die Stationsschwester und schwenkt Gazeverband und Pflasterrollen. Schwummelig taste ich an schwankendem Bett entlang. Die Narben scheinen Laute auszustoßen, sie kreischen wie ein Sägewerk bei Tagesanbruch, sie zerkleinern Freude, bedrohen Flucht, verstellen Ausweg. Eilig danke ich ihm, schüttle Hände, wieder und wieder, umarme die Schwester, die zwei Tränen zerdrückt und »Vorsicht, Vorsicht« und »Zu Haus’ habe ich Bescheid gesagt« und »Nicht in die Sonne legen, in zehn Tagen zum Professor«, ruft. Die Mahnungen reichen bis zum Tor. Da steht ein Wagen. Neben ihm mein Mann. Eine Sekunde lang sehe ich ihn, wie ich ihn vor fünfzehn Jahren sah. An einem Flugplatz war das. Da stand er, überlang aus dem Gewimmel ragend, unsicher lächelnd, unendlich mager, verletzbar jung, in schlottrigem Hemd und zerknitterter Hose. Es ist das Lächeln, das mich erinnert, das gleiche wie damals. Langsam fährt er an, umfährt einen aus der Seitenstraße schießenden Volksbus, umfährt ihn teilnahmslos sicher. Die Zärtlichkeit zerschellt am Profil, das jetzt forsch verwegen, hartgesotten erscheint. Ich sehe mich blindlings stürzen, sehe mich aufprallen, auf Furcht, unnachgiebige, blanke Furcht; Furcht vor Ausgestoßensein, Furcht vor Furchtlosen, Unachtsamen, Furcht vor der Zugbrücke, die gezogen, die mich trennt von ahnungslos Schmerzfreien. Es ist das Gift der Angst, die Hochmut der Angst. Seine rechte Hand berührt meine linke. Sie zieht mich in einen heiteren, schwebenden Tag, in tausenderlei Grün, in lauen, pendelnden Wind, vorbei an reglosen Buchen und Linden, an zapplig tänzelnden Pappeln. Die Schönheit trifft mich wie ein unvermuteter Schlag. Sie streichelt und schlägt zugleich. Das klebrig-heiße Krankenhauszimmer war schmerzgerecht. Die Schönheit ist Hohn, liebkosend grausam, belästigt vom Urteil, von mir.
Zehn Tage später senkt sich ein weißlackiertes Ungeheuer auf mich herab. Einmal heult es auf, gellend giftig, verstummt. Dann starrt es mich an, einäugig, rotumrandet. Ich liege auf schmaler Bank in großem Kellerraum, kaue an Ober- und Unterlippe, schlucke, wo es nichts zu schlucken gibt, sehe zwei Neonröhren, vier Klappfenster, von denen eins geöffnet ist, grauen Linoleumboden, Christuskreuz über leerem Metalltisch, unterteilte Wand, hinter der zwei Stahltüren liegen. Zuvor waren U-Boot-Kapitän, Rotfussliger und ich von wegen »öffentlichen« Berufs und Presseverfolgtheit auf Schleichwegen durch den Bauch des Krankenhauses gelaufen, über ungezählte Treppen, Gänge, Korridore, vorbei an gestapelten Bettgestellen, Aktendeckeln, Matratzen, zerrupften Teddybären, bis wir vor einem Schild, auf dem »Kobalt-Raum« stand, auf einen straffen blondgrauen Mann trafen, der als Primarius vorgestellt wurde. Augenblicklich hatte ich zu klappern begonnen, als stünde ich auf fehlerhaftem Laufband. »Die zwanzig Bestrahlungen bringen wir auch noch hinter uns«, hatte der Rotfusslige gesagt, und: »Wir arbeiten sozusagen mit Gürtel und Träger.« Dabei hatte er mit beiden Händen sämtliche Taschen abgefummelt, als suche er eine schriftliche Bestätigung. Mein U-Boot-Kapitän hatte seinen schweren Arm auf meine Schultern gelegt, als müsse er mich am Boden festhalten. Dann eilten sie hinaus, sahen durch den verglasten Panzerschlitz der Kontrollkabine; vier Augen hüpften auf und ab, nickten mir zu, wollten sagen: »Mut, Mut, nichts dabei, machen wir täglich.« Dann das Aufheulen. Meine Hochtoupierte im Schweizer Spital hatte von ihrem Vater erzählt: »Nu ja, een Prostatacarcinom, das hat er wech, lebt janz zufrieden, trinkt sein Bierchen, roocht sein Zigarrchen.« Ich würde mich umbringen, hätte ich gedacht.
Plötzlich ein Geruch, wie hinter der Bierbrauerei in Berlin-Schöneberg. Als Kind war ich die Hauptstraße entlanggerannt, bis der bitter-süßliche Geruch verflogen.
Mein Blick bleibt hängen beim gesenkten Christuskopf. Ein Knall, als würde eine Eisentür zugeschlagen, das Auge klappt zu, das Ungeheuer stellt ab. Sogleich wippt der Primar heran, gut erhalten, gut in Schuß, abgehärtet, sportlich, Diät einhaltend, das Ungeheuer fürchtend. Sein Lächeln ist festgefroren, eingebacken; tagaus, tagein lächelt er den Hoffnungslosen, den Hoffnungsvollen, den Eingeweihten, Uneingeweihten entgegen, gleichmütig distanziert – das Zahnarztlächeln an der Wartezimmertür: Bei mir tut’s nicht weh. »War’s schlimm?« fragt er und weiß schon die Antwort. »Nein«, sage ich, wie erwartet. Er dreht mich hin, er dreht mich her, verschiebt Ungeheuer und mich, sagt: »Drei Minuten sind lang, wenn man sich nicht bewegen darf«, und verschwindet hinter der Mauer. Wieder heult es, wieder schweigt es. Ich werde malen, mit dicken, leinöltriefenden Pinseln, rote, grüne, gelbe Liebeserklärungen malen, Liebeserklärungen ans Leben. Ich werde für einen Morgen danken, für einen Tag, für eine Nacht, für das Jetzt.
Nach dem vierten Heuler bin ich eingewöhnt, angepaßt, werde schläfrig, döse ein, schrecke auf, wenn des Ungeheuers Lid zuknallt, der Primär um die Strahlenschutzmauer wippt. »Bis übermorgen«, sagt er, zieht den Kittel aus, prüft die Kontrolluhr in der Brusttasche. »Wenn wir zu viel Strahlen abbekommen, müssen wir in Urlaub.« Sein Lächeln vertieft sich, sucht um Entschuldigung an.
2
Im Wagen wird mir mulmig, achterbahnmulmig. Überm Wolfgangsee hängt weißer Nebel, von den Blättern tropft es, als regnete es aus Zweigen und Ästen, wir fahren den aufgeweichten Weg zum furchterregenden Asyl, zum letzten gemieteten, bis zum Richtfest zu bewohnenden. Es hat ein Gespenst, dreißig unbewohnbare Zimmer, keine Heizung, rauchende Biedermeier- und Rokokoöfen, den säuerlich modrigen Geruch, der an Grüften, Champignonkeller, schimmliges Gemäuer erinnert. Die Wände sind rissig und trophäenbeladen, Hirsch- und Rehbockköpfe strecken dürftige oder wuchtige Geweihe in düstere Flure, werfen unter funzligen Geweihlampen garstige, sich kreuzende Schatten; auf unwohnlichen Wohnraum stieren um die Jahrhundertwende verendete Büffel herab, zwischen verschlissenen Ledersesseln, deren Sitze altersschräg und uneinnehmbar, ragen mannshohe Elefantenzähne hervor, dazwischen, sorgsam verteilt, stehen und hängen ausgestopfte Schwäne und Perlhühner, deren Federn im Zugwind aufflattern, als setzten sie zum Flug an. Auf sargschwarzer Truhe stapeln sich Zeitschriften der Jahre 1919–1930, auf mottenzerfressenem Kartentisch liegt ein grünspaniges Gästebuch, das den verschlungenen Dank des Kaisers Franz Joseph vorweist.
Andreas klurrt durch den Gang. Sein schwarzgefärbtes Haar wedelt um das faltige, griesgrämige Gesicht, die uralte dunkelgrüne Bedienstetenschürze schlabbert um seine Hosenbeine. Wie immer murmelt er vor sich hin, beendet Unverständliches mit lauthals Verständlichem: »Mir san a Sozialstaat. Ma darf net mehr arbeiten. In meinem Alter hab’ ich nix mehr nötig und scho goar nix, wenn s’ ka Durchlauchten san.«
Er gehört ins Furchterregende, wie die berstenden Schränke, die vollgestopft mit zerbröselndem Leinen, henkellosem Meißen und Weinlaubmuster, silbernen Bestecken, Armeen von Saucieren. Andreas lebt tagelang in verschimmeltem Loch, das er sein Zimmer nennt. Den Vorschlag, es gegen ein luftigeres, weniger verschimmeltes einzutauschen, nimmt er mit abschätzendem Blick entgegen, untersagt dem unblaublütigen Volk Verbesserungsvorschläge. Dann greift er zum Reisekorb, enteilt, taucht wieder auf, enteilt aufs neue.
Neben gewohntem Modergeruch stinkt es nach Verbranntem, Versengtem. Andreas hat seinen Ofen geheizt. Es schwelt. Die Klappe ist geschlossen. Andreas plant Mord. Selbst Juliane, auf oberster Stufe der steilen Treppe stehend, kann an der Freudlosigkeit des Hauses nicht rütteln. Juliane ist prall, vollbusig, hellblond, männerverrückt, sechzigjährig und strömt zeitweilig übermäßige Lebensfreude und Vitalität aus. Augenblicklich strömt sie. »Die Schlange!« brüllt sie, daß Schwanenfedern schweben, Geweihe knirschen, der morsche Boden gleich einer Hängematte zu schwingen beginnt. »Das göttliche Kind hat die gräßliche, grauenvolle Schlange gesehen.« Sie rollt die Augen, schüttelt das Haupt, schlägt mit breiter, derber Hand auf die Stirn, daß man meint, sie müsse zersplittern. »Das göttliche Kind« winkt, ruft »Mama«, wendet sich wieder dem Julianeschen Schauspiel zu. »Was soll man machen, was soll man machen?« röhrt jene wie von Sinnen und zerrt am dichten, im Nacken verknoteten Haar. Eine 30-Watt-Birne bescheint hohe Backenknochen und kurze, gerade Nase. Das Gesicht ist glatt, die Haut rosig. »Das Schlabberkram hab’ ich operieren lassen, ritsch ratsch, futsch war’s«, hatte sie, kaum bei uns eingetroffen, gesagt und stolz die Narben hinter den Ohren vorgezeigt. Sie steht schnaufend, einer Wagnerheroine bei Aktschluß nicht unähnlich, und hält eine Schaufel. »Mit diesem Ding hier bin ich auf sie los.« Morsch wie alles, so auch die Schaufel, löst sich selbe vom Stiel, poltert lärmend die Treppe hinunter. Gelähmt stehe ich, biete ihr mein Schienbein dar. »O Gott, o Gott«, schreit Juliane, »was für ein Leben, was für ein Haus.« Als sei es das Startzeichen für den Auftritt, nähern sich zwei orientierungslose Fledermäuse, beginnen über ihrem Blondhaar zu kreisen. Der markerschütternde Schrei befördert mich die Treppe hinauf, da liegen wir, Kind und Köpfe notdürftig mit Händen bedeckend, als wichen wir Tieffliegern aus. »Frau Gräfin haben gerufen«, quietscht es aus der Tiefe. Andreas steht greisenhaft kichernd, den Blick auf Juliane gerichtet, die als einziges Mitglied der Mietfamilie dem Adel zugehört und also seines Interesses würdig. Sie wedelt mit der Hand, als vertreibe sie Fliegen, flüstert in mein Ohr: »Er säuft. Ich rieche das sofort. Mir kann man da nichts vormachen.« Keuchend erhebt sie sich, schlägt die Jacke übers Haar, dreht erfolglos an ausgeleiertem Lichtschalter, verschwindet ins Schlafzimmer. Ich höre manches am Boden zerschellen, vernehme Kreischen, dann hilflos schluchzendes Gelächter; prustend erscheint sie, meldet die Vertreibung eines Fledermauspulks.
Vor einem Vierteljahr war sie zu uns gestoßen. »Ich heiße Juliane«, hatte sie gesagt, »ich bin Alkoholikerin. Seit fünf Jahren trocken.« Sie hatte mich angestrahlt, als hätte ich zur Heilung beigetragen. »Warum sagen Sie „ich bin“, wenn Sie seit fünf Jahren nicht getrunken haben?« hatte ich ahnungslos gefragt. »Weil es so ist«, rief sie und rang in altmodischer Theatergebärde die Hände; »Alkoholiker bleibt Alkoholiker, ob er trinkt oder nicht. Ich bin Mitglied der AA. Sie hat mich gerettet.« Abkürzungen durchforschend, war ich auf fremdländische Fluglinien, Automobilclubs, auch Sportvereine gestoßen. Angesichts meiner Ratlosigkeit hatte sie drei Hefte, auf denen »Alcoholics Anonymous« zu lesen stand, aus einem Lacklederbeutel gezogen und, mit dem Zeigefinger auf den Boden weisend, »Sie haben mich aus der Gosse gezogen« gerufen. »Aus der Gosse«, hatte sie wiederholt und die Augen geschlossen, als sähe sie noch immer unratumspülte Rinnsteine und Gullygitter vor sich. Doch dann hatte sie kurz aufgelacht und das Gesicht mit einem Spitzentaschentuch, das sich in ihrer großen Hand lächerlich ausnahm, betupft. »Geld brauche ich nicht«, hatte sie, den Kopf in den Nacken werfend, gesagt, »was ich brauche, ist Arbeit und ein ausgefüllter Tag.« So blieb sie. Wir unterliegen ihrer Zeiteinteilung, die sie um vier Uhr früh aufstehen und um acht zusammenbrechen läßt; ihrer frenetischen Häkelei, die uns mit Schals und Decken für Jahrzehnte versieht; ihren Perioden wilder Lebenslust, die sie mit »Ich bin ab heute wüst« einleitet und die unversehens in taumelige Depression umschlagen; ihrem unbeirrbaren Zwang, in dürftigen Kammern zu hausen, als müsse sie Buße tun; der panischen Suche, bei Ankunft in jedweder Stadt, nach dem Sitz der ortseigenen »AA« und deren abendlichen Treffen der Geheilten und Nicht-Geheilten sowie dem manischen Bedürfnis, einen Motorroller zu besitzen und auf ihm täglich mehrmals wilde, lärmende Runden zu drehen. Ihre nur selten und stockend vorgetragene Lebensgeschichte beginnt: »Ich war reich, ich war schön, ich hatte alles. Mann, Kind, Gesundheit. Dann kam der Krieg, der elende Krieg, und nahm mir alles. Nach acht Jahren Gefangenschaft, nach Polen und Sibirien fing ich an zu trinken.« Der Morgen bricht an mit einem AA-Satz: »Ich muß jeden Tag etwas Gutes tun. Ich bitte Gott um die Gnade, mir Kraft zu geben. Ich darf nicht sagen, daß ich nie wieder trinke. Ich darf nur sagen, daß ich heute nicht trinke.« Berichte über »die Zeiten der Gosse« bleiben beharrlich distanziert, als spräche sie von einer ihr flüchtig bekannten Person; nur an Tagen, da sie »wüst«, identifiziert sie sich mit jener Juliane, die der Trunksucht ergeben. Dann zerrt sie an imaginären Ringen, schleudert sie hohnlachend und mit weitausholender Geste unsichtbaren Kumpanen vor die Füße, schreit: »Nehmt sie. Nehmt alles.« Alsbald stimmt sie, ungeachtet des ständig plärrenden Transistorradios, eine vielstrophige Hymne an, die entweder larmoyant oder gleich einem Schrei der Verzweiflung durch Küche und umliegende Räumlichkeiten hallt. So sitzt sie inbrünstig singend, die geschwollenen Beine auf Kissen gelagert, bis das begrenzte Repertoire aufgebraucht. Den letzten Versen versagt sie den anfänglichen Einsatz, wendet sich bereits dem zellophangeschützten, peinlich fleckenlosen Kochbuch zu, dessen nur einen Teelöffel Alkohol erfordernde Rezepte dick durchgestrichen und unleserlich gemacht sind. »Ein Tropfen und ich bin im Hades«, sagt sie. »Der Alkoholiker« – nie »die Alkoholikerin«, als sei die Sucht maskulinen Genen anzukreiden –, »der Alkoholiker kann nicht aufhören, bis er in der Gosse liegt.« »Die Gosse« wiederum mittels des zu Boden gestreckten Zeigefingers anschaulich gemacht. Verfehlt das Absingen der Hymnen, eine beschwichtigende Wirkung auszuüben, springt sie, die Kissen gleich Bällen von sich stoßend, auf und ruft, ans Fenster eilend, das schmerzdurchdrungene: »Ich brauche Achmed!« Doch vor Achmed ist zu warnen, von Achmed gilt es abzulenken, denn Achmed löst bestürzende, langanhaltende Depressionen aus. Achmed, ein Araber, in Pittsburgh ansässig, ist, so sieht man auf vergilbten, runzligen Fotos, ein sanft blickender Herr unbestimmten Alters. »Ich habe ihn geliebt«, flüstert Juliane, die Bilder an den mächtigen Busen pressend, »fünf Jahre lang habe ich ihn geliebt. Gekocht habe ich für ihn, Tag und Nacht. Er wurde fett.« Der Griff lockert sich, dumpfes Schweigen befällt sie, der Ausdruck wird untröstlich und reuig, Achmed wandert ins Seitenfach des stets paraten Lackbeutels. »Fett«, sagt sie, entrüstet auf den Beutel starrend, und beginnt den Kopf erst langsam, dann schneller und schneller hin und her zu werfen, bis sie, bleich und schwankend am Fensterbrett Halt suchend, das erste einer zahllosen Kette von »Achmeds« haucht.
Doch jetzt steht Juliane beherrscht und die Lage überblickend vor der Schlafzimmertür und spricht gebieterisch: »Das Fenster ist geschlossen, die Fledermäuse entfernt, Sie müssen ins Bett.« Willenlos folgen Mutter und Tochter, obwohl uns vor knochenharten Matratzen und deren festgefügten Kuhlen, die zur starren, unverrückbaren S-Haltung zwingen, graut. Hinzu kommt, daß die Stunde nicht weit, da der ehemals feudale Jagd- und Sommersitz sein beängstigendes Eigenleben entfaltet; das Gruselige, zur Tageszeit lachhaft, nimmt mit Einbruch der Dunkelheit entnervende Formen an. Das mürbe Haus, dem Verfall geweiht, läuft nächtens Amok, steigert sich von einschüchternder Bewegung zu rachsüchtigem Tumult. Türen öffnen sich grundlos und knirschend, Vorhänge wehen, obwohl die Fenster verriegelt und die Nacht windstill, Klinken klappen auf und nieder, im obersten, seit Jahrzehnten unbewohnten Stockwerk dröhnt, poltert und wütet es. Der Verdacht, daß Andreas, abgefeimt und durch und durch verbiestert, nächtliche Scherze treibt, erweist sich als kränkende Unterstellung; auch die von Experten vorgenommene Suche nach Siebenschläfern, Ratten und ähnlichem Getier erbrachte nichts. Der Briefträger – laut Juliane ein unrettbarer Fall von Alkoholiker – weigert sich, selbst bei Tag und anheimelndem Sonnenschein, den Fuß auf die Schwelle zu setzen, läßt, hinter vorgehaltener Hand und in demütigem Abstand vom Haus haltend, wissen, daß man Bescheid wisse im Dorf und anderswo um die finsteren Geister, die da geistern. »Was ist mit der Schlange?« frage ich, zwischen feuchten Decken Platz genommen habend. Ihr Blick fällt auf den Rauch einer unausgedrückten Zigarette. Entsetzen weitet die Augen, reißt die kurzen schwarzen Wimpern auseinander. »Teufelszeug, Satanskram!« schreit sie und läßt Streichhölzer, Schachtel, Kippe in Schürzentasche fallen. Nach erniedrigender Pause rutscht sie auf den Bettrand, murmelt: »Schlange, Schlange«, stiert geistesabwesend auf ihre breiten Knie. »Die AA hat ein Treffen. Vor übermorgen bin ich nicht zurück.« Sie spricht abgehackt, als lese sie einen unverständlichen Text. Schwerfällig erhebt sie sich, sagt, wie ein Erblindeter über meinen Kopf hinwegsehend: »Im Wohnzimmer war sie, zwei Meter lang ist sie. Was sie wohl im Wohnzimmer wollte? Der Andreas sagte, sie lebe im Garten.«
Zwei Tage später hämmert sie ans Haustor, stürzt aufgemöbelt in den Flur, juchzt: »Fabelhaft, fabelhaft. Neben mir saß ein Professor. Zehn Rückfälle in drei Jahren. Diesmal wird er’s schaffen. Ein neuer Tag, ein neues Leben. Juliane ist wüst.« Schon schleudert sie kiloschwere Töpfe, rammt den Besen in morsche Hockerbeine, singt Hymnen, schnippelt Gemüse, stürmt davon, wirft sich auf ächzenden Motorroller, das pralle Gesäß hängt beidseitig gleich zwei gefüllten Taschen über den Sattel; so kurvt sie durch Pfützen und Matsch, befiehlt Andreas, auf handgroßem Rücksitz Platz zu nehmen, dreht mit dem abscheulich Kreischenden schonungslose Runden um drei Müllkübel. Abends erscheint sie rüschenumflattert, taumelig torkelig, wünscht zu telefonieren. »Ein Privatflugzeug, wenn ich bitten darf«, schreit sie grandios und knallt den Hörer, daß die Muschel bricht, dann kauert sie auf zerwühltem Bett, stößt langanhaltende klagende Laute aus.
Die magere ältliche Frau, die einem wackligen Volkswagen entsteigt, sagt: »Ich möchte sie holen. Ich gehöre zur AA.« Juliane, mit verschwollenen Augen und zerkratzten Händen und Armen, wirft Wollknäuel, Koffer, Kleider, Schuhe, singt: »Ich brauche Liebe, nur ein wenig Liebe«, schlägt mit der Stirn gegen einen Achtender, folgt gefügig der Mageren, eine Ginflasche im Arm. Unbeholfen tattrig kriecht sie in den Wagen, drückt ihr tränenüberströmtes Gesicht gegen das Fenster. Wir sehen den hüpfenden Lichtern nach, packen Koffer, verlassen Haus, Andreas, Geister.
Die Pension liegt oberhalb einer Tankstelle. Es ist Spätsommer. Die Kegelbahn ist in Betrieb, schwedische Touristen singen unter Anleitung eines deutschen Reiseführers »Warum ist es am Rhein so schön?«. Es riecht nach Knoblauch, nach ausgelassenem Schmalz und ranzigem Öl. Die Klosettspülung röhrt seit Stunden. Um drei Uhr früh ziehen sie johlend, eine Conga-Reihe formend, Treppen und Flure entlang. Abends wartet Ungeheuer plus Wächter. »Während der Behandlung brauchen Sie Ruhe, viel Ruhe«, sagt der Primarius-Wächter und überläßt mich seinem Rotgeränderten, der da rattert, schweigt und frißt.
Vor der Tankstelle stehen ein Mann und eine Frau, sie trägt mein Kopftuch, drohend heben sie die Fäuste. »Die Drachen«, murmeln wir gleichzeitig. »Die Drachen« umschleichen Quartiere, bewegen Buschtrommeln, üben sich in Erpressung und Groll, planen Gewalt. »Gesocks«, denke ich, erschrecke vor meinem Zorn, vor der Vulgarität.
Ich wollte Erfolg, wollte »den gemalten Vogel«, wollte ihn, dessen Gefieder Mißtrauen, Neid, Heimtücke erweckt, ihn, der nach Feindseligkeit und Ausrottung schreit. Suspekt und ausnutzbar, ergiebig und wasserköpfig, Herrlichkeit und Beute. »You have haunted eyes«, hatte Tennessee Williams in Chicago gesagt. Verfolgte Augen. Verfolgt von wem, von was? Und plötzlich – vor den Zapfsäulen, die an öder Realität kaum zu überbieten, verschiebt sich der beiläufig aufgenommene Hintergrund, wird irreal, unfaßbar, wird von Reklameschild bis zur staubigen Topfpflanze hinter fleckigem Fenster zum von Tönen überspülten, an den Rändern sich auflösenden Bild. Selbst die Gesichter verzerren sich, doch ihre Verzerrung scheint erheiternd und keineswegs furchterregend. Und für einen Augenblick glaube ich aus meiner Zeit, aus meiner Existenz zu fallen. Die gespannten Schultern geben nach, die immer präsente Angst setzt aus, ich betrete eine leichte, kuriose, gewaltlose Welt, strebe einer schwerelosen Heiterkeit entgegen, aus der ich meine und aller anderen Ängste – selbst das Urteil – interessiert, doch emotionslos betrachte. Doch kaum dem Wagen entkommen und über eine Hintertreppe das Zimmer erreichend, falle ich über die Kiesel der Gewohnheit, die unbeweglich und unverschiebbar im Weg liegen.
An einem Montag, der zugleich der erste Januar war, schlurrten die Drachen in unser 1900 Meter hohes Schweizer Leben. Mit ihnen begann dieses Jahr 1973, das Jahr des Urteils, das Jahr des Kastanienbaums, das Bertha-lose Jahr. Denn Bertha, seit nahezu zwei Dekaden der Familie verbunden und ganz und gar zugehörig, hatte uns verlassen. Zum zweitenmal. Ungestraft verläßt Bertha nicht. Denn kaum war Bertha »unbekannt verzogen«, brach der Damm, gewährte den Strohmännern übellauniger Mächte Zugang zur möblierten Zurückgezogenheit in Alt-Engadiner Stuben. Bertha ordnet, greift ein, wehrt ab, selbst in ozonarmen Höhen. Bertha aus Thüringer Hügelland mit Waldbestand, vor 17 Jahren dürr, nun üppig und auch rheumatisch, beginnt jedwede Tätigkeit mit »So«, beendet mit »So«, eröffnet, schließt ab mit »So«, sagt Köpfe zählend, Uhren prüfend ihr abendliches »Nu machen wir ins Bette« und noch ein »So«. Berthas Schritte auf noch immer schlanken, wohlgeformten Beinen sind wettervoraussagend: Grotesk, wie jene des Albatros, melden sie: Miserabel; leichtfüßig schwebend: Man kann hoffen. Bertha also bricht aus nach Streit, dem der Mißmut einer dauerhaften Albatroszeit vorausgegangen, hinterläßt bleistiftgeschriebene Zettel und Chaos. Unbemuttert, ausgeliefert, rundrum verzweifelt, fragt man: Wo ist Bertha?
Just da schlurrten die Drachen ins Leben, wie sie wohl schon häufig in das Leben anderer geschlurrt waren; nur diesmal schien die Beute fetter, krankheitsbenagt, wehruntüchtig und allemal geeignet, verspeist zu werden. Die Bekanntschaft, aus Kindheitstagen herrührend und deshalb mit dem plumpen Du beschwert, gab Anlaß für einen fatal verhängnisvollen und gerade aus der Mode kommenden Kommune-Gedanken, obwohl ich wußte, daß die beiden zur Gruppe jener am Rande mancher Berufe und zumeist auf Pumpe Lebenden gehörten, die der Arbeit nichts abgewinnen und stets das zerknirschende »Das Schicksal hat uns mißhandelt« im Munde führen. Da war Libby: groß, schwerknochig, roßhaarig. Ihre röhrenförmigen Beine geben den Eindruck, die außerordentlich seltsam geformten Füße in den Boden zu pressen. Die Wölbung der Sohle, den Bedürfnissen eines Fußes konträr, ist Schaukelstuhl- oder auch Löschpapierhalter-ähnlich, das heißt: Zehen und Fersen bleiben selbst im Stand leicht erhoben, überlassen die beträchtliche Traglast der gerundeten Fußmitte. So also schiebt sich Libby auf zumeist zweifingerbreiten Kreppsohlen durch ihr fünftes Lebensjahrzehnt. Ihre Langsamkeit erweckt Vertrauen, ihre massiven Hände, erschütternd ungeschickt, bewirken Mitgefühl, und obwohl sie ihren Einsatz in Sachen Haushalt, wenn auch brabbelnd und deshalb kaum verständlich, anbietet, plant sie keinerlei Betätigung. Außerdem weiß sie in den wenigen registrierbaren Fällen der Inanspruchnahme um die Wirkung ihres schrillen Schreis, der laut aufheulenden Verzweiflung, sobald die erste Kanne zu Bruch gegangen. Da verzieht sich der Mund nach Kinderart, ein Röcheln und Glucksen aus ungeloteten Tiefen eines scheinbar unerschütterlichen Leibes bricht sich Bahn, kulminiert in einem Laut, der an das Gebrüll eines Formel-I-Wagens erinnert. In die darauf eintretende Stille tropft viel Flüssigkeit aus Augen und Nase, die mittels eines aus dem Jackenärmel zutage geförderten Männertaschentuches aufgesogen wird. Noch lange wird sie Gesicht, Stirn, selbst das kurzgeschnittene graue Roßhaar scheuern, als müsse sie von plötzlichem Regenguß Durchnäßtes rigoros trocknen. Das durchweichte Tuch im Jackenärmel verstaut habend, steht sie und blickt geschunden über die mehr oder minder, doch allesamt gebeugten Häupter ihres betroffenen Publikums hinweg. Tröstungen nimmt sie entgegen, läßt jedoch durch leicht irritiertes Zusammenziehen der Brauen wissen, daß kein Trost, wie immer geartet, ihrer Leidensfähigkeit das Wasser reichen kann. Nun erst wendet sie sich ihren Zigarillos und einem wasserverdünnten Cognac zu.
Kaum eingetroffen, nahm sie am Küchentisch Platz, verfolgte unbewegt und schweigend die Vorbereitungen zur ersten Mahlzeit. Sie saß, die Beine so weit als möglich gespreizt, den ungewohnten, wahrscheinlich ihrer Vorstellung von Reisegarderobe angepaßten Rock über die Oberschenkel emporschiebend, als wolle sie Äpfel in der Schürze sammeln. Aufregung und Cognac färbten die linke Ohrmuschel rosa, die rechte beharrte auf Gelblichweiß. Die Ohren, erstaunlich wie die Füße, schienen nur flüchtig, gleich einem lose sitzenden Knopf, mit dem Schädel verbunden. Übergroß und flattrig, schlappten sie zwischen Haarbüscheln einher, gemahnten an Geheftetes. Meine Frage nach dem Befinden wurde mit krachendem »Ha« beantwortet. Die Ohren schlossen sich pendelnd dem »Ha« an. Alles miteinander beinhaltete Vorwurf. Je länger der einsilbige Protest unangefochten im Räume lebte, desto mehr gewann er an Bedeutung, und schon erschien die Frage dreist, uneinfühlsam, den wunden Punkt treffend. Ihre wuchtige Hand umklammerte das Glas, führte es bedächtig zum Mund. Die Annahme, daß ein kräftiger, maskuliner Schluck es leeren würde, erwies sich als falsch, denn Libby nippte, die Lippen schürzend, horchte sogleich, den Atem anhaltend, in sich hinein, als erwarte sie Anzeichen einer Vergiftung. Aufatmend und Zustimmung nickend setzte sie das Glas ab, begann mit der anderen Hand in den Taschen ihres Männerjacketts zu graben. Nach einigen Fehlgriffen fand sie, was sie gesucht: eine Hornbrille sowie ein von Gummibändern zusammengehaltenes Kartenspiel. Fachmännisch schnell und überraschend geschickt mischte sie, zog drei Karten, deckte die Bilder auf, sagte, Kreuz-Bube, Pik-As, Kreuz-Neun anstarrend: »Da ham wa den Salat.« Das derbe Gesicht verbreiterte sich unter trostlosem Lächeln, einen Zigarillo entzündend, nuschelte sie: »Wat soll’s. Seit wa Dresden mitjemacht ham, kann uns ooch die jroße Welt nich aschüttern. Übrigens, wie haste dir det mit Samson jedacht?«
»Wer ist Samson?«
»Unsa Kanarienvogel«, sagte sie, »daß det mit Samson und deinem Kater nicht jeht, is wohl klar.«
Da marschiert Hummi in die Küche. Er läuft nicht, er schlurrt nicht, er marschiert. Zielstrebig rasant ist sein Gang, als passe er sich dem Rhythmus italienischer Marschmusik an. Hummi ist klein, muskulös, kurzbeinig und von jener hitzigen Erregbarkeit, die einer besonders ungünstigen Phase des männlichen Klimakteriums zu eigen. Sein herzförmiges Gesicht, beherrscht von leicht vorstehenden Augen, ist altmodisch attraktiv, erinnert an Bilder der pikiert oder erstaunt blickenden Mädchen der frühen zwanziger Jahre. Hummis Profil hingegen ist gleich dem des Haubentauchers, scharf, angriffsfreudig, hieb- und stichfest. Noch immer thronte eine bademützen-ähnliche Kappe auf dem spärlichen, gekrausten Haar. Auch der lange karierte Mantel hing, wo er gehangen, als die beiden dem Zug entstiegen und die Weiterfahrt des ansonsten auf dem dörflichen Bahnhof nur kurz anhaltenden Zuges um etliches verzögerten. Minutenlang hatten sie Papprollen, Kartons, Seesäcke, riemenumschnallte Steppdecken und zu guter Letzt ein Vogelbauer plus Kanarienvogel gereicht.
Hummi heißt ebensowenig Hummi, wie Libby Libby heißt. Hummi ist Ottokar und Libby ist Erna. Am Anfang ihrer langjährigen Ehe hatten sie sich zu nämlichen Titulierungen verstiegen. Libby, so weiß ich, entstammt der Libelle, dem schnurrig dünnhäutigen Insekt, Hummis Beginn ist nicht nachweisbar. Überlegungen, ob Hummi von Hummel oder gar Hummer, wurden entkräftet.