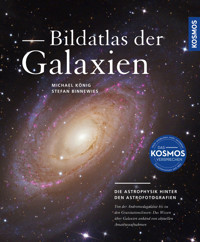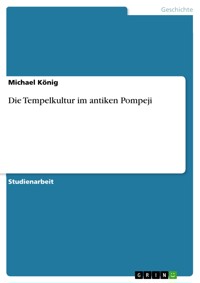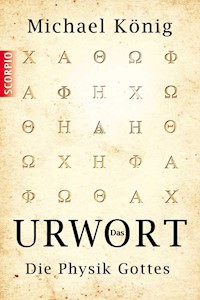
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Scorpio Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Das Urwort präsentiert erstmals die physikalische Theorie, dass Gott die elementare Wirkgröße unseres U niversums darstellt und dies auch naturwissenschaftlich hergeleitet werden kann. In der Folge lassen sich viele bisher ungeklärte Rätsel der Naturwissenschaft lösen: Was ist dunkle Energie und woher kommt die dunkle Materie, wie funktionieren unser Gedächtnis und Bewusstsein? Hat der Mensch eine unsterbliche Seele? Diese und viele andere Grundfragen unserer Existenz beantwortet Michael König wissenschaftlich fundiert und lässt ein neues Weltbild vor den Augen des Lesers entstehen – eine gelungene Synthese aus Naturwissenschaft und Spiritualität und der Essenz der Religionen und Weisheitslehren. Ein faszinierendes Buch auch für Nicht-Physiker, denn Michael König führt in den ersten Kapiteln auch den Laien Schritt für Schritt ins Reich der Quantenphysik ein.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 371
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Michael König
Das Urwort
Michael König
Das Urwort
Die Physik Gottes
Scorpio Verlag
Für Christina
1. eBook-Ausgabe
© 2011 Scorpio Verlag GmbH & Co. KG, Berlin • München
Umschlaggestaltung: David Hauptmann,
Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich
Innenlayout und Satz: Prill Partners producing, Berlin
Konvertierung: Brockhaus/Commission
ePub-ISBN: 978-3-942166-63-8
Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
www.scorpio-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbHMonika RoleffJohannisplatz 1581667 Mü[email protected]+49 89 18 94 [email protected]
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1 Von Raum und Zeit und Materie
Die Entwicklung der Physik bis zur Gegenwart
1.1 Galilei – Newton – Einstein – Quantenphysik
1.2 Die Wechselwirkungen und der Aufbau der Materie
2 Was sind Teilchen?
Transdimensionen und Partialstrukturen
2.1 Die Geometrisierung von Teilchenstrukturen
2.2 Das Elektron als Bewusstseinsteilchen
2.3 Die Entdeckung des Hyperraums
2.4 Jenseits von Heim und Charon: Das Streben nach Vollendung
3 Die Physik Gottes
Urwort-Herleitung und Entstehung der Partialstrukturen
3.1 Die Eigenschaften des Hyperraums
3.2 Eine kleine Ontologie Gottes
3.4 Das Urwort
3.5 Das Konzept der Druckgravitation
3.6 Ein wachsendes Universum
4 Das Leben ist ein Liebeswirbel
Ohne Liebe kein Leben
4.1 Das Licht des Lebens
4.2 Bioplasma – die Ursache für die Vitalität
4.3 Der Nachweis des Bioplasmas
4.4 Diamanten und Bioplasma
5 Woher kommen wir?
Das Geheimnis der Erlösung ist die Erinnerung
5.1 Die Struktur der menschlichen Seele und des Bewusstseins
5.2 Das Leben nach dem Leben
5.3 Anziehung und Schicksal
6 Wohin gehen wir?
Eine individuelle Entscheidung
6.1 Erinnerungen an die Unsterblichkeit
6.2 Die Manifestation physischer Unsterblichkeit
6.3 Polarisation und Transformation
7 Wo, bitte, geht’s hier zum Himmel?
Alles Gute kommt von oben
7.2 Himmelfahrt – der Aufstieg in den Hyperraum
Nachwort
Anhang
Glossar
Literaturverzeichnis
Namensregister
Sachregister
Griechisches Alphabet
Einleitung
Wir leben in einer Welt, die sich rasant verändert. Neue Technologien haben uns das Informationszeitalter beschert. Die Erkenntnisse der Physik wirkten – wie schon beim Aufkommen des Industriezeitalters – hierbei wie für die allgemeine Entwicklung der Zivilisation als Schrittmacher.
Technische Gegenstände und Einrichtungen des täglichen Lebens, die aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken sind, etwa das Telefon, das Auto, das Radio, der Fernseher, der Computer, das Internet, basieren auf Erkenntnissen, die auf Physiker des 19. und 20. Jahrhunderts zurückgehen. Die meisten Menschen verwenden diese Errungenschaften geradezu selbstverständlich und können sich ihr Leben und ihre Welt ohne sie gar nicht mehr vorstellen. Und sie sind sich kaum bewusst darüber, dass wir über diese Möglichkeiten erst seit einer relativ kurzen Zeit verfügen.
Wir reden nun zu Beginn des 21. Jahrhunderts bereits vom Übergang in das Bewusstseinszeitalter. Auf vielen Ebenen findet ein Umdenken statt, denn durch den hemmungslosen Umgang mit den Ressourcen unseres Planeten haben wir uns bereits viele Probleme eingehandelt. Ganzheitliche und holistische Denk- und Sichtweisen setzen sich zunehmend durch, sowohl in der Wirtschaft, der Gesellschaft als auch in den Naturwissenschaften.
Wird auch dieser Übergang in das Bewusstseinszeitalter durch neue Erkenntnisse in der Physik stimuliert? In der Tat befassen sich immer mehr Physiker mit Fragestellungen, die den Geist und das Bewusstsein zum Gegenstand physikalischer Grundlagenforschung machen. Hier kommt neben der Biophysik auch der Quantenphysik und insbesondere der Physik der Elementarteilchen und deren Wechselwirkungen eine besondere Bedeutung zu. Ist Bewusstsein auf der Ebene von Elementarteilchen verankert? Gibt es stabile Teilchen mit einer quasi unbegrenzten Lebensdauer und einem Gedächtnis? Überdauert menschliches Bewusstsein, da es an materielle Strukturen wie Elektronen gebunden ist, so auch den physischen Tod?
Die Erkenntnisse der modernen Physik werden durch genaue Naturbeobachtung und logische Schlussfolgerungen gewonnen. Die Physik bedient sich dabei in einem Ausmaß wie keine andere Wissenschaft der Sprache der Mathematik. Von physikalischen Theorien wird erwartet, dass sie in einer widerspruchsfreien Weise mathematisch formuliert sind. Eine Theorie im Sinne der Physik beinhaltet ein mathematisches Modell, mit dem bestimmte beobachtbare Prozesse beschrieben werden können.
Dieses Buch ist jedoch bewusst so verfasst, dass auch der naturwissenschaftliche Laie den dargelegten Gedankengängen folgen kann. Auf mathematische Formeln wird durchgängig verzichtet. Der naturwissenschaftlich versierte Leser wird auf die herangezogene Fachliteratur aufmerksam gemacht. Dennoch wird der Leser mit den für die hier formulierten Gedanken notwendigen physikalischen Begriffen vertraut gemacht, oder er wird sich diese wieder in Erinnerung rufen. Wenn wir damit ein naturwissenschaftlich fundiertes Verständnis des menschlichen Bewusstseins und des Verhältnisses des Menschen zu Gott gewinnen können, so ist dies allemal der kleinen Mühe wert, sich auch durch die ersten etwas abstrakteren Kapitel dieses Buches zu arbeiten.
Von besonderer Bedeutung für ein naturwissenschaftliches Verständnis ist eine genaue Beschreibung der Welt, in der wir leben und unsere Erfahrungen sammeln. Dazu werden wir uns mit der Struktur von Raum und Zeit ebenso vertraut machen wie mit der Materie, die im Raum vorhanden ist, und mit den Kräften bzw. Wechselwirkungen, die zwischen materiellen Teilchen wirken.
Zur genauen Beschreibung der physikalisch messbaren Eigenschaften von Teilchen ist ein Verständnis ihrer inneren metrischen Struktur erforderlich. Es wird sich zeigen, dass dies nur gelingen kann, wenn angenommen wird, dass sich »hinter den Teilchen« weitere Dimensionen befinden, die sich von den uns vertrauten drei Dimensionen des Raumes und der Dimension der Zeit unterscheiden. Aus den messbaren Eigenschaften von Teilchen lassen sich schließlich auch die Eigenschaften dieser weiteren Dimensionen herleiten. Wir werden sehen, dass neben dem Raum und der Zeit, in denen wir leben, weitere raumzeitliche Partialstrukturen existieren, und dass diese in besonderer Weise mit dem uns vertrauten Raum verbunden bzw. mit diesem verschränkt sind.
Wir werden einige physikalische Theorien und Modellvorstellungen kennen lernen, die in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt wurden und in denen solche transdimensionalen Partialstrukturen eine wichtige Rolle spielen. Die physikalischen Eigenschaften dieser Partialstrukturen und ihr Ineinanderwirken lassen die grundlegenden Merkmale und Wirkprozesse des Bewusstseins erkennen und führen zu anschaulichen Modellvorstellungen materieller und geistiger Strukturen.
Berühmte Physiker, darunter Nobelpreisträger wie Albert Einstein und Werner Heisenberg, haben immer wieder ihre persönliche Überzeugung zum Ausdruck gebracht, dass sie die Existenz eines höheren Wesens oder Bewusstseins annehmen. In der Tat zeigen die Ergebnisse der modernen Biophysik und Astrophysik, dass es wesentlich näherliegt, von der Existenz eines höheren, steuernden Bewusstseins oder Gottes auszugehen, als anzunehmen, dass die Biosphäre auf unserem Planeten nur das Ergebnis einer Zufallsentwicklung ist. Durch die Beobachtungen der modernen Physik ist Evidenz für die Existenz Gottes und die Existenz höheren Bewusstseins gefunden worden.
In diesem Buch führt sich Gott nun selbst als Wirkgröße im Rahmen einer neuen Strukturtheorie in die Welt der Physik ein. Ausgehend von Gott baut sich eine Welt mit genau den Eigenschaften auf, die wir in der Natur beobachten können. So offenbart Gott die unverfälschte göttliche Matrix – das Urwort –, womit alle Wirkgrößen des Universums auf einige quantisierte Elementarstrukturen zurückgeführt werden können.
Zentrale Fragen der physikalischen Grundlagenforschung können dadurch beantwortet werden, wie zum Beispiel die Herkunft und die Eigenschaften der dunklen Energie, der dunklen Materie und der Gravitation. Es zeigt sich, dass wir in einem Kosmos kontinuierlicher Schöpfung und Evolution leben und erst einen Bruchteil der gesamten Wirklichkeit erkannt haben. Gott erweist sich als Quelle aller Energie und allen Seins. Aus Gott geht ein Ozean aus Bewusstsein – Energie, Liebe und Information – hervor, aus dem alle raumzeitlichen und zeitlosen Strukturen und die darin enthaltenen Energien entstehen.
Daraus kann auch ein tieferes Verständnis der Lebensprozesse in biologischen Organismen, der Evolution des Lebens, der Natur der Psyche und des Bewusstseins des Menschen, der Struktur der menschlichen Seele und des Geistes sowie des Verhältnisses des Menschen zu Gott gewonnen werden. Die bisher nur in Religionen und Weisheitslehren beschriebenen unterschiedlichen Daseinsbereiche wie Diesseits und Jenseits sowie der Himmel mit all ihren spezifischen Eigenheiten können nun als Partialstrukturen mit physikalischer Evidenz beschrieben werden. Essenzielle Aussagen der Religionen und Weisheitslehren finden dadurch ihre Bestätigung und verschmelzen mit den Ergebnissen der modernen Physik zu einem einheitlichen Ganzen.
Woher kommen wir, und wohin gehen wir? Diese brennenden Fragen nach dem Sinn der menschlichen Existenz werden hier umfassender und nachhaltiger beantwortet, als es eine dogmatisch geprägte Religion zu leisten vermag. Schließlich entdecken wir, dass der Mensch in seiner gegenwärtigen, physisch sterblichen Form erst einen Teil seines Entwicklungspotenzials ausgeschöpft und verwirklicht hat.
Kapitel 1
Von Raum und Zeit und Materie
Die Entwicklung der Physik bis zur Gegenwart
Beginnen wir mit einem kleinen Überblick: die moderne Naturwissenschaft von der Antike über den Beginn der Neuzeit bis zur Gegenwart. Von der klassischen Mechanik, begründet durch Isaac Newton, reicht der Bogen bis zur Relativitätstheorie Albert Einsteins und zur Quantentheorie Max Plancks. Der bereits inder Antike vermutete Aufbau der Materie aus Teilchen wurde durch die moderne Physik des20. Jahrhunderts bestätigt. Die Physiker entdeckten, dass alle in der Natur vorkommenden Kräfte auf wenige Wechselwirkungen zwischen Elementarteilchen zurückgeführt werden können.
1.1 Galilei – Newton – Einstein – Quantenphysik
»So zuverlässig die Wissenschaft arbeitet, so bedenklich gestaltet sich die Frage nach dem Fundament, auf dem sich ihr Gebäude erhebt. Denn eine voraussetzungslose Wissenschaft gibt es nicht. Aus Nichts lässt sich nichts folgern, auch nicht mit den exaktesten Methoden. Die große Frage nun, an welche Grundprinzipien die exakte Wissenschaft anzuknüpfen hat, ist von jeher der Gegenstand der tiefsinnigsten Forschung der Philosophen aller Zeiten und Länder gewesen. Aber es hat sich immer wieder gezeigt, dass eine Antwort im abschließenden Sinn nicht zu finden ist.«
Max Planck, Begründer der Quantenphysik
Zu allen Zeiten war das Interesse des Menschen sehr groß, den inneren Aufbau der Materie und die Welt, in der er lebt, zu verstehen. Der Mensch lernte die Materie bis zu einem gewissen Grad intuitiv und aus praktischer Erfahrung zu beherrschen. Schon früh verstand er es, Legierungen wie Bronze und Messing herzustellen und Eisen zu gewinnen und zu schmieden. Der Mensch erhoffte sich aber auch, zu einem tieferen Verständnis seiner selbst und seiner Beziehung zur Welt, die ihn umgibt, zu gelangen.
So wurden bereits im alten Ägypten in den geistigen Schulen Modellvorstellungen vom Aufbau der Materie entwickelt und von den Priestern von Generation zu Generation weitergegeben. In den Jahrhunderten vor der Zeitenwende kannten griechische Philosophen noch einen Teil der altägyptischen Weisheiten. Von den alten Griechen ist überliefert, dass sie die »Elemente« Feuer, Erde, Luft und Wasser für die Bausteine der Materie hielten und die Entstehung aller Stoffe als Kombination dieser vier Grundelemente betrachteten.
Zwar hat sich mittlerweile herausgestellt, dass die Materie nicht aus den antiken vier Elementen besteht, sondern aus 92 verschiedenen chemischen Elementen. Doch wurde die antike Auffassung, dass alle Stoffe durch Kombination der Elemente entstehen, durch die moderne Chemie bestätigt. Bemerkenswert, dass die Griechen aus der rein philosophischen Betrachtung heraus zu solch grundlegenden Erkenntnissen über die Struktur der Materie gelangen konnten. Sie prägten auch bereits den Begriff des Atoms, des Unteilbaren – ahnten also, dass die Materie nicht beliebig oft teilbar ist, sondern dass es kleinste gleichartige Bausteine gibt, aus denen alle Körper aufgebaut sind. Dies ist wohl einer der ersten Ansätze zu einer Quantisierung der Materie.
Die Denker der Antike waren sich sehr wohl bewusst, dass in der Natur Gesetzmäßigkeiten und Ordnungsstrukturen wirksam sind. Sowohl in winzig kleinen wie auch in astronomischen Größenordnungen vermutete man Strukturen von hoher Symmetrie.
In der Antike stellte man sich die Atome als regelmäßig geformte geometrische Körper vor – sogenannte platonische Körper – und Himmelssphären als ineinandergeschachtelte platonische Körper. Eine solche von antiken Vorstellungen geprägte Sichtweise findet sich noch bei Johannes Kepler zu Beginn des 17. Jahrhunderts.
Bis zur Entwicklung der modernen Naturwissenschaften wie Physik und Chemie war es jedoch noch ein weiter Weg. Über viele Jahrhunderte hinweg wurde die Entwicklung systematischer Wissenschaften durch die vorherrschenden dogmatischen Glaubensvorstellungen blockiert. Im 15. und 16. Jahrhundert war es die vorherrschende Lehrmeinung, dass die Erde der Mittelpunkt des Universums sei und sich alle Himmelskörper um die Erde drehten. Die Meinung deckte sich mit den Beobachtungen des täglichen Lebens. Die Gestirne, einschließlich Sonne und Mond, schienen sich um die Erde herumzubewegen.
Und so setzte sich die Vorstellung durch, dass die Planeten an kristallenen Sphären befestigt, konzentrisch um die Erde angeordnet und ineinandergeschachtelt seien. So bahnte sich die erste große wissenschaftliche Revolution in der neueren Geschichte an.
Nach den Vorbereitungen durch Nikolaus Kopernikus (1473–1543), Tycho Brahe (1546–1601), Johannes Kepler (1571–1630) und Galileo Galilei (1564–1642) und anderen großen und mutigen Forschern hatte man in Mitteleuropa zögernd die Auffassung gewonnen, dass die römisch-katholische Kirche und der von ihr viele Jahrhunderte lang favorisierte Aristoteles (um 300 v. Chr.) über das Verhalten der Natur keine exakte Auskunft geben konnten.
Kopernikus schockierte seine Zeitgenossen mit der für sie abenteuerlich anmutenden Theorie, dass nicht die Erde, sondern die Sonne das Zentrum des Universums sei. Demnach sei die Erde nur ein Planet, der sich wie alle anderen Planeten auch auf einer Kreisbahn um die Sonne bewege. Für einen mittelalterlich geprägten Menschen war das durchaus revolutionär, wo man doch täglich sehen konnte, wie sich alle Himmelskörper – einschließlich der Sonne – um die Erde drehten …
Der dänische Astronom Tycho Brahe kam durch seine Beobachtungen allerdings zu dem Ergebnis, dass sich die Planeten nicht auf Kreisbahnen bewegten, vielmehr diese Bahnen komplizierter Natur waren. Brahes Beobachtungsdaten der Planeten waren aufgrund seiner für damalige Verhältnisse außergewöhnlich präzisen Messinstrumente genauer als alle anderen bis dato bekannten Bahndaten.
Johannes Kepler konnte aus Tycho Brahes Aufzeichnungen die Bewegungsgesetze der Planetenbahnen herleiten, später bekannt als Keplersche Gesetze. Kepler entdeckte, dass sich die Planeten auf elliptischen Bahnen um die Sonne bewegten. Tycho Brahe wiederum konnte anhand seiner Beobachtungsdaten eines Kometen zeigen, dass dieser die Umlaufbahnen mehrerer Planeten kreuzte, was im krassen Widerspruch zu der Vorstellung von kristallenen festen Sphären stand, an denen die Planeten »befestigt« sein sollten.
Galileo Galileis Entdeckung der Jupitermonde durch den ersten astronomischen Einsatz eines Fernrohrs zu Beginn des 17. Jahrhunderts sprengte endgültig das mittelalterliche Weltbild der starren Himmelssphären. Die Fallexperimente Galileis am schiefen Turm von Pisa waren ein Meilenstein in der Entwicklung der beobachtenden Experimentalphysik.
Allmählich entwickelten sich systematische Methoden, um die der Natur innewohnenden Gesetzmäßigkeiten zu ergründen – durch Experimente und sorgfältige Beobachtungen, verbunden mit logischem Denken. Eine Vielzahl von Naturgesetzen wurde gefunden und mathematisch formuliert, deren universelle Gültigkeit oft angezweifelt, aber schließlich doch anerkannt wurde.
Fortan wurden nur noch solche Beobachtungen und Forschungsergebnisse als wissenschaftlich akzeptiert angesehen, die unabhängig von Person und Standpunkt gemacht werden konnten. Für die Erforschung der unbelebten Natur ist ein solches Gebot der Reproduzierbarkeit sicher sehr nützlich, denn es begünstigt die klare und widerspruchsfreie Formulierung von grundlegenden Naturgesetzen.
So hat das Fallgesetz nicht nur seine Gültigkeit am schiefen Turm von Pisa, wo Galilei es durch Experimente fand, sondern an jedem Ort der Erdoberfläche. Das von Newton gefundene Gravitationsgesetz stellt eine Verallgemeinerung von Galileis Fallgesetz dar. Auch die Keplerschen Gesetze wurden später in der Form des Newtonschen Gravitationsgesetzes verallgemeinert. Mit ihm lassen sich die Bewegungen vieler Himmelskörper, zum Beispiel das System Erde – Mond, das Sonnensystem und etliche Lichtjahre weit entfernte Doppelsternsysteme, in erster Näherung recht gut beschreiben.
Die bedeutendsten Impulse zur weiteren Entwicklung der Physik bis zum Ende des 19. Jahrhunderts gingen im 17. und 18. Jahrhundert von dem englischen Physiker Isaac Newton aus. Er begründete die klassische Mechanik, ein Teilgebiet der Physik, das sich mit den Bewegungsvorgängen von Körpern unter der Einwirkung verschiedenster Kräfte beschäftigt. Um die Bewegungen von Körpern mathematisch zu beschreiben, definierte Newton die Begriffe »absoluter Raum« und »absolute Zeit«. Der absolute Raum Newtons entspricht unserer dreidimensionalen Wahrnehmung der Wirklichkeit, die uns umgibt. Dieser Raum ist nach Newton prinzipiell in allen drei Raumrichtungen, der Länge, Breite und Höhe, unendlich weit ausgedehnt. Die von Newton postulierte absolute Zeit sollte an jedem Ort im absoluten Raum gleich sein. Für die Größenordnungen, in denen sich unser Leben auf diesem Planeten abspielt, und bei den Geschwindigkeiten und Kräften, die auf die Objekte unseres täglichen Lebens einwirken, liefert die klassische Mechanik Newtons stets Ergebnisse, die mit den beobachteten Daten gut übereinstimmen.
Auch heute noch wird ein Ingenieur, der eine technische Maschine konstruieren will, die Gesetze der klassischen Mechanik anwenden. Die Vorstellung eines absoluten Raumes, der von allen in ihm enthaltenen Objekten unabhängig ist, und einer an jedem Ort gleichmäßig verstreichenden Zeit wurde von den Physikern bis zum Ausgang des 19. Jahrhunderts als universell gültig betrachtet. In der Newtonschen Mechanik wurden erstmals die Begriffe der Masse, des Raumes und der Zeit klar herausgearbeitet, um den zeitlichen Ablauf der Bewegung von Massen im Raum mathematisch exakt beschreiben zu können. Newtons Gravitationsgesetz stellt auch das erste Wechselwirkungsgesetz in der Physik dar, denn es beschreibt die Anziehungskräfte, also die Schwerkraft bzw. Gravitation, zwischen zwei Massen.
Im 19. Jahrhundert wurden in der Physik und auch in der Chemie noch weitere große Entdeckungen gemacht, die unser Leben bis in die Gegenwart maßgeblich beeinflussen. Der bereits in der Antike vermutete elementare Aufbau der Materie wurde offensichtlich. Man erkannte, dass sich chemische Grundstoffe nur in bestimmten ganzzahligen Massenverhältnissen verbinden. Damit konnten die Forscher an die antiken Vorstellungen der griechischen Philosophen anknüpfen.
Der Engländer John Dalton nannte diese kleinsten Teilchen Atome. Bald darauf wurde von Dimitri Mendelejeff und Lothar Meyer das Periodensystem der chemischen Elemente entdeckt. Heute wissen wir, dass die gesamte in der Natur vorkommende Materie aus 92 verschiedenen Atomsorten, den chemischen Elementen – von Wasserstoff bis Uran –, aufgebaut ist.
Einer der bedeutendsten Erfolge der Physik des 19. Jahrhunderts war die Formulierung der Theorie des Elektromagnetismus von James Clerk Maxwell. Damit war die Grundlage geschaffen für das Verständnis aller elektrischen und magnetischen Effekte – elektrostatische Entladungen, elektrischer Strom, Magnetfelder und elektromagnetische Wellen. Es wurde auch erkannt, dass sichtbares Licht aus elektromagnetischen Wellen besteht.
Ein Großteil aller Naturbeobachtungen des Menschen basiert auf visueller Wahrnehmung, also der Verarbeitung von optischen Reizen durch die Augen und das Gehirn. Große Entdeckungen in der Astronomie geschahen über Jahrhunderte hinweg auf rein visuellem Wege, verbunden mit immer leistungsstärkeren optischen Teleskopen.
Das sichtbare Licht stellt aber nur einen kleinen Ausschnitt aus dem gesamten Spektrum der elektromagnetischen Wellen dar. Man stelle sich ein Riesenklavier vor mit 24 Oktaven, das dem Spektrum der elektromagnetischen Wellen entspräche – dann entspräche nur eine Oktave in der Mitte dieses Klaviermanuals dem Spektrum des für den Menschen sichtbaren Lichts.
Von herausragender Bedeutung war die Entdeckung der Absorptionslinien im Spektrum der Sonne durch Joseph Fraunhofer im Jahr 1814. Damit war die Grundlage der Spektralanalyse geschaffen, die heutzutage aus vielen Forschungsbereichen nicht mehr wegzudenken ist. Mittlerweile haben sich die Astrophysiker künstliche »Augen« für nahezu alle Bereiche der elektromagnetischen Wellen geschaffen, zum Beispiel Radioteleskope, Infrarotteleskope, optische Teleskope oder Weltraum-Röntgenteleskope.
Basierend auf den Grundlagen der Spektralanalyse gelang es französischen Astrophysikern 1995 am Observatorium St. Michel in der Haute-Provence erstmals, einen Planeten außerhalb unseres Sonnensystems, der um einen viele Lichtjahre entfernten Stern kreist, zu entdecken. Inzwischen sind mehrere hundert solcher Exoplaneten, die andere Sterne umlaufen, entdeckt worden. Alles, was wir über die Struktur des Universums wissen, verdanken wir den elektromagnetischen Wellen.
Eine Theorie ist so lange eine gute Theorie, wie sie im Einklang mit allen Beobachtungen steht und in der Lage ist, die Wirklichkeit so zu beschreiben, wie sie beobachtet wird. Beobachtungen, die mit einer vorherrschenden Theorie nicht erklärt werden können, führen zu Widersprüchen – sogenannte Paradoxa, die erst durch eine neue verallgemeinerte Theorie, die die alte Theorie als Spezialfall enthält, aufgelöst werden.
So wurde durch die Verbesserung von astronomischen Beobachtungsmethoden im 19. Jahrhundert die Periheldrehung des Merkur entdeckt, die durch das Gravitationsgesetz Newtons nicht beschrieben werden kann. Die Periheldrehung ist eine ständige Drehung des jeweils sonnennächsten Bahnpunktes (Perihel) der elliptischen Umlaufbahnen der Planeten.
Eigentlich müsste der Merkur nach dem Newtonschen Gravitationsgesetz auf einer elliptischen Bahn laufen, die wieder in sich zurückführt. Tatsächlich verschiebt sich die Bahn aber mit jedem Umlauf um einen kleinen Winkel, sodass über viele Umläufe des Merkur dessen Bahn eine Rosette beschreibt. Beim Merkur, der der Sonne am nächsten steht, ist diese Periheldrehung im Vergleich zu den anderen Planeten am größten.
Diese und andere Widersprüche der Theorie der klassischen Mechanik mit Beobachtungen führten schließlich zur zweiten größeren Revolution in der neueren Geschichte der Physik, die im Übergang vom 19. ins 20. Jahrhundert stattfand. Es sind die Relativitätstheorie Albert Einsteins und die Quantentheorie Max Plancks, die die Entwicklung der Physik für die folgenden hundert Jahre prägen sollten.
Erst durch die spezielle Relativitätstheorie (1905) und die allgemeine Relativitätstheorie (1915) Albert Einsteins konnten die Periheldrehung des Merkur berechnet und andere Paradoxa der klassischen Mechanik aufgelöst werden. Allerdings musste die Physik dafür einen hohen Preis zahlen, denn die Vorstellung eines absoluten Raums und einer absoluten Zeit war nun erledigt und dahin.
In Einsteins Relativitätstheorie verschmelzen die drei Raumdimensionen und die Zeit zu einem sogenannten vierdimensionalen Raum-Zeit-Kontinuum. Auf den ersten Blick mag das ja gar nicht so dramatisch sein, denn hier werden Raum und Zeit einfach mathematisch zusammengefasst. Zeit wird nun als Dimension verstanden, obwohl wir eigentlich keinen Freiheitsgrad in ihr haben: In den drei Raumrichtungen können wir uns mehr oder weniger frei bewegen, aber in der Zeit haben wir keine Möglichkeit der Richtungsänderung. Die Zeit vergeht eben, und sie »reißt« uns alle mit.
Richtig bizarr wird es allerdings, wenn uns die allgemeine Relativitätstheorie etwas von »Raumkrümmung« erzählt. Hier hilft uns unser dreidimensionales Vorstellungsvermögen nicht mehr weiter. Wenn wir uns einen dreidimensionalen Raum als zweidimensionale Fläche vorstellen, so entspricht eine ebene Fläche einem nicht gekrümmten Raum und eine gekrümmte Fläche, etwa die Oberfläche einer Kugel, einem gekrümmten Raum.
Der absolute Raum Newtons ist ein nicht gekrümmter, »ebener« Raum. In der Mathematik nennt man einen solchen Raum »euklidisch«. In einem solchen euklidischen Raum ist die kürzeste Verbindung zwischen zwei Raumpunkten immer eine Gerade. In der allgemeinen Relativitätstheorie ist der Raum aber nichteuklidisch, das heißt die kürzeste Verbindung zwischen zwei Raumpunkten ist nicht immer eine Gerade, sondern im Allgemeinen eine Kurve. Der Grad der Raumkrümmung ist auch nicht überall gleich, sondern ortsabhängig.
Die allgemeine Relativitätstheorie zeigt, dass die Anwesenheit einer Masse eine Krümmung des Raumes verursacht. Materie verformt die metrische Struktur des Raumes in ihrer Umgebung. In einem Satz zusammengefasst lautet die wichtigste Aussage der allgemeinen Relativitätstheorie: Die Massen sagen dem Raum, wie er sich zu krümmen hat, und die Krümmung des Raumes sagt den Massen, wie sie sich zu bewegen haben.
Genau diese Raumkrümmung ist die Ursache für die Periheldrehung des Merkur. Die Sonne bewirkt durch ihre Masse die Raumkrümmung in ihrer Umgebung. Dabei nimmt die Raumkrümmung mit zunehmendem Abstand von der Sonne stetig ab. Daher ist die Periheldrehung beim Merkur, dem sonnennächsten Planeten, am größten und wird bei den anderen Planeten der Reihe nach kleiner.
Auch unsere normale Alltagsvorstellung von Zeit kommt in der Relativitätstheorie nicht ungeschoren davon. Überall auf der Welt scheint die Zeit doch gleichförmig zu vergehen, eine Stunde in München ist genauso lang wie eine Stunde in New York oder sonst wo. Einstein hat jedoch bereits in seiner speziellen Relativitätstheorie gezeigt, dass für zwei Beobachter die Zeit unterschiedlich schnell vergeht, wenn sie sich relativ zueinander mit einer sogenannten relativistischen Geschwindigkeit bewegen, die so groß ist, dass sie gegenüber der Lichtgeschwindigkeit nicht mehr vernachlässigt werden kann.
Wenn auch unser Alltagsleben von diesen relativistischen Effekten nicht unmittelbar tangiert wird, so haben die Elementarteilchenphysiker und auch die Astrophysiker doch nahezu ständig damit zu tun, weil sich einige ihrer Beobachtungsobjekte eben mit relativistischen Geschwindigkeiten bewegen.
Aus der allgemeinen Relativitätstheorie geht außerdem hervor, dass nicht nur der Raum, sondern auch die Zeit durch die Anwesenheit von Massen beeinflusst wird. Zwei identische Uhren »ticken« unterschiedlich schnell, wenn sie verschieden starken Gravitationsfeldern ausgesetzt werden – auf der Erde ticken Uhren langsamer als auf dem Mond. Die Relativitätstheorie hat die klassische Physik somit in einem Maße erschüttert, wie es seit dem Übergang vom geozentrischen zum heliozentrischen Weltbild nicht mehr der Fall war.
Es ist gut, wenn eine physikalische Theorie die Paradoxa von Vorgängertheorien auflösen kann, wie im Fall der Periheldrehung. Aber es ist noch besser, wenn eine Theorie Vorhersagen macht, die sich durch Beobachtungen bestätigen lassen. Auch dies hat die Relativitätstheorie geleistet.
1897 wurde als entscheidendes Ergebnis der Untersuchungen von Gasentladungen von dem Physiker Joseph J. Thomson das elektrisch negativ geladene Elektron als erstes echtes Elementarteilchen entdeckt. 1903 fand der Physiker Ernest Rutherford durch Experimente heraus, dass die Hauptmasse der Atome in einem zur Gesamtgröße des Atoms vergleichbar winzig kleinen, elektrisch positiv geladenen Atomkern konzentriert ist. Damit zeigte sich, dass die Atome ihren Namen eigentlich gar nicht verdienen, sondern dass sie über eine weiter erforschbare innere Struktur verfügen.
Einige Jahre später legte der dänische Physiker Niels Bohr ein erstes einfaches Atommodell vor, das bereits erstaunlich gut die bis dahin messbaren Eigenschaften der Atome beschreiben konnte. Es war nämlich schon bekannt, dass jedes Element bzw. jede Atomsorte ganz bestimmte Lichtwellen empfangen oder abstrahlen kann – die Physik spricht von Emissions- und Absorptionsspektren.
Im Jahr 1900 veröffentlichte Max Planck schließlich seine Quantentheorie. Planck zeigte, dass die Energie im Licht nur in bestimmten Portionen – er nannte sie Quanten – transportiert wird. Die Energie dieser Lichtquanten ist nur von der Frequenz, also der Spektralfarbe der Lichtstrahlung, abhängig. Violettes Licht hat eine höhere Frequenz als rotes Licht. So können wir uns an einem Lagerfeuer keinen Sonnenbrand holen, wohl aber durch die UV-Strahlung der Sonne. Die Quanten der UV-Strahlung transportieren pro Quant ausreichend viel Energie, um die Bindung in einem Molekül aufzubrechen oder sogar ein Atom zu ionisieren – ein Elektron wird durch das UV-Lichtquant aus der Atomhülle herausgekickt.
Normalerweise ist unser Körper in der Lage, solche Strahlenschäden wieder zu reparieren. Wird jedoch zu viel Energie von außen zugeführt, kommt es zu einem Strahlenkater. Dabei wird dann Zellgewebe so stark beschädigt, dass es abstirbt und durch neues Gewebe ersetzt werden muss – die Haut pellt ab nach einem Sonnenbrand. Die Lichtquanten eines gewöhnlichen Lagerfeuers haben hingegen nicht genug Energie, um einen Strahlenkater zu bewirken. Später nannten die Physiker diese Lichtteilchen bzw. allgemein die Quanten der elektromagnetischen Strahlung Photonen.
Die Physiker erkannten, dass alle Atome aus einem elektrisch positiv geladenen Atomkern und einer elektrisch negativ geladenen, aus einzelnen Elektronen aufgebauten Atomhülle bestehen. Weitere intensive Forschungen an der Struktur der Atome führten zum Verständnis des inneren Aufbaus der Atomkerne.
Bis Mitte der Dreißigerjahre war bekannt, dass sich der Kern aller Atome aus elektrisch positiv geladenen Protonen und elektrisch neutralen Neutronen aufbaut. Der Aufbau der atomaren Elektronenhülle wurde experimentell durch optische und Röntgenspektren eingehend untersucht und konnte um 1950 als weitgehend bekannt angesehen werden, ebenso wie sein Zusammenhang mit dem Periodensystem der Elemente.
In gleicher Weise gelangte man bis Mitte des 20. Jahrhunderts zu einem Verständnis der chemischen Bindung zweier oder mehrerer Atome zu einem Molekül durch die elektrischen Wechselwirkungen der äußeren Elektronen in den beteiligten Atomen. Neben der Atomphysik, welche die wesentlichen Vorgänge in der Elektronenhülle der Atome untersucht, entwickelte sich auch die Kernphysik, und so wurde ebenfalls die Struktur der Atomkerne entschlüsselt.
Als weiterer bedeutender Forschungszweig entwickelte sich die Festkörperphysik, die die Vielzahl der makroskopischen physikalischen Eigenschaften und den Aufbau fester Stoffe, zum Beispiel der Metalle, Halbleiter und Kristalle, untersucht und auf mikroskopische elementare Eigenschaften der Atome und ihrer gegenseitigen Anordnung zurückführt.
Den theoretischen Hintergrund und Rahmen zu den Untersuchungen über die Struktur der Materie bot die Quantenmechanik, die sich aus den bedeutenden Arbeiten von Planck, de Broglie, Schrödinger, Heisenberg, Born und vielen anderen entwickelte und die im Laufe der Jahrzehnte immer weiter verfeinert wurde. Aus der Erkenntnisflut, die aus den Labors der Physiker strömte, kristallisierte sich eine Reihe von grundsätzlichen Fragen heraus, die die Grundlagenforschung im Bereich der Physik bis in die Gegenwart beherrschen, etwa: Welche Teilchen sind die elementarsten Grundbausteine der Materie? Und: Welche Kräfte zwischen den Teilchen (Wechselwirkungen) sind elementare Grundkräfte, und lassen sich diese auf eine Urkraft zurückführen?
1.2 Die Wechselwirkungen und der Aufbau der Materie
Seit den Fünfzigerjahren steht die Elementarteilchenphysik in der physikalischen Grundlagenforschung weit oben, da man von ihr erwartet, dass sie diese Grundfragen beantworten kann. Mit immer größeren und leistungsfähigeren Teilchenbeschleunigern versuchen die Wissenschaftler, der Essenz der Materie auf die Spur zu kommen.
Die Vorgehensweise eines Elementarteilchenphysikers gleicht einem neugierigen Menschen, der versucht herauszubekommen, wie ein alter mechanischer Wecker funktioniert, und dabei keinen passenden Schraubenzieher zur Hand hat. So entschließt er sich, den Wecker mit voller Wucht gegen die Wand zu werfen, um dann aus den Bahnen der in alle Richtungen fliegenden Trümmer und Bruchstücke wie Zahnräder, Achsen, Federn, Schrauben zurückzurechnen, wie der Wecker zusammengesetzt war.
Bereits nach einigen Jahren entdeckten die Elementarteilchenphysiker einen zunächst unübersichtlichen Teilchenzoo. Durch Sortieren nach messbaren Eigenschaften wie etwa Masse, elektrische Ladung, Spin (Rotation), magnetisches Moment gelang es jedoch, diesen Teilchenzoo zu ordnen.
Neben den genannten physikalischen Eigenschaften gibt es noch weitere Unterscheidungsmerkmale, mit denen sich Elementarteilchen charakterisieren und klassifizieren lassen. So kann man zwischen stabilen und instabilen Teilchen unterscheiden. Stabile Teilchen haben eine faktisch unendliche Lebensdauer. Dazu gehören die Teilchen, aus denen herkömmliche Materie aufgebaut ist. Dies sind die Protonen und die Elektronen.
Instabile Teilchen haben meist eine so kurze Lebensdauer, dass sie für die normalen physikalischen Prozesse in unserem Lebensraum keine nennenswerte Bedeutung haben. Sie treten als kurzlebige, eben instabile Zustände auf, die schließlich in stabile Teilchen zerfallen.
Protonen und Neutronen, die Teilchen des Atomkerns, sind etwa gleich schwer und etwa zweitausendmal schwerer als ein Elektron. Da Protonen eine elektrisch positive Ladung und Elektronen eine elektrisch negative Ladung tragen, besteht zwischen ihnen eine Anziehungskraft – die elektrostatische Anziehung zwischen ungleichnamigen Ladungen.
In halbklassischer Vorstellung bewegen sich die Elektronen auf Kreisbahnen (Bohrsches Atommodell) bzw. elliptischen Bahnen (Sommerfeldsches Atommodell) um den Atomkern – wie die Planeten um die Sonne. Diese einfachen Modelle beschreiben die Verhältnisse im Atom recht gut, können aber einige weitere Eigenschaften der Atome nicht erklären.
Die Quantenmechanik liefert für die Elektronen in der Atomhülle keine wohl bekannten Bahnen, sondern sogenannte Orbitale. Dabei handelt es sich nicht mehr um wohl definierte Bahnen, sondern um wolkenartige Verteilungen der Wahrscheinlichkeit, wo sich die Elektronen aufhalten. Für das Elektron kann in der Quantenmechanik eben nur berechnet werden, mit welcher Wahrscheinlichkeit es sich zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort aufhält.
Der Aufenthaltsort und die Geschwindigkeit eines Elektrons (allgemeiner: eines Quantenobjekts) können jedoch nicht gleichzeitig mit beliebiger Genauigkeit angegeben werden, wie Heisenberg mit seiner »Unschärferelation« zeigte. Quantenobjekte sind eben so klein, dass der Einfluss des Beobachters auf das Quantenobjekt nicht mehr vernachlässigt werden kann.
Wenn wir einen Gegenstand des täglichen Lebens, etwa eine Blumenvase, betrachten, wird sich der Gegenstand durch die Beobachtung nicht verändern. Beobachten wir aber ein kleines Quantenobjekt, etwa ein einzelnes Atom, so wird durch die Beobachtung das Atom beeinflusst. Zum Beobachten müssen wir ja etwas von dem Atom »sehen«. Also muss das Atom Lichtteilchen abstrahlen oder reflektieren, damit wir es sehen können. Bei der Abstrahlung oder Reflexion von Lichtteilchen wird durch den Rückstoß aber die Lage des Atoms verändert. Also beeinflusst unsere Beobachtung in diesem Fall den Bewegungszustand des Atoms.
Alle stabile Materie, ob gasförmig, flüssig oder fest, ist aus Atomen und diese wiederum aus Protonen und Neutronen (Atomkern) und Elektronen (Atomhülle) aufgebaut. Dies gilt sowohl für die Erde und alle auf ihr befindlichen biologischen Lebewesen als auch für alle anderen Planeten, Sterne und sonstigen Himmelskörper sowie die verdünnte Materie (Staub, Gas) zwischen ihnen.
Seit den Sechzigerjahren wurde bei Experimenten in Teilchenbeschleunigern entdeckt, dass Protonen und Neutronen eigentlich keine Elementarteilchen sind, sondern wiederum aus anderen Teilchen zusammengesetzt sind, den Quarks. Je drei Quarks bilden ein Proton oder ein Neutron. Allerdings konnten Quarks noch nie als einzelne Teilchen isoliert werden. Sie treten vielmehr in Zweier- und Dreiergruppen auf – ein Umstand, der bei unserer späteren Diskussion noch von Bedeutung sein wird.
Eine weitere Gruppe von Teilchen stellen die Neutrinos dar. Sie entstehen in großer Zahl bei Kernreaktionen, zum Beispiel im Inneren der Sonne und allgemein bei Zerfallsprozessen von instabilen Teilchen. Allerdings ist die Wechselwirkung der Neutrinos mit anderen Teilchen sehr schwach. Nahezu ungehindert fliegen sie durch den ganzen Erdball. Nur ein winziger Bruchteil der Neutrinos kann in speziellen Neutrinodetektoren nachgewiesen werden. Lange Zeit war unklar, ob sie eine Masse besitzen oder nicht. Erst vor kurzem gelang der Nachweis, dass eine bestimmte Neutrinosorte eine zwar sehr kleine, aber von Null verschiedene Masse besitzt.
Schließlich gibt es noch Teilchen, die definitiv keine Masse besitzen: die Photonen. Sie sind die Quanten der elektromagnetischen Strahlung, wie bereits Max Planck in seiner Quantentheorie zeigte. Die Photonen sind auch Wechselwirkungsteilchen, das heißt, sie vermitteln zwischen anderen Teilchen, zum Beispiel den Elektronen, die elektrostatische Abstoßung.
Um verstehen zu können, wie Elementarteilchen komplexere Strukturen wie etwa Atome und Moleküle aufbauen, muss man die Kräfte studieren, die zwischen ihnen wirken. Hier hat sich in der Physik neben dem »Kraft«-Begriff (wie bei Schwerkraft) der Begriff der Wechselwirkung etabliert. Gegenwärtig lassen sich alle in der Natur vorkommenden Prozesse auf vier elementare Kräfte bzw. Wechselwirkungen zurückführen: die Gravitations-Wechselwirkung (Schwerkraft), die elektromagnetische Wechselwirkung, die elektroschwache Wechselwirkung und die starke Wechselwirkung.
Die Gravitation vermittelt die abstandsabhängige Anziehungskraft zwischen Massen. Damit haben sich Newton in seinem Gravitationsgesetz und Einstein in seiner allgemeinen Relativitätstheorie beschäftigt. Sie hat eine unendliche Reichweite und bestimmt die makroskopische, also mit dem Auge sichtbare Struktur des Universums. Die Gravitation ist etwa dafür verantwortlich, dass wir nicht in den Weltraum hinausgeschleudert werden oder dass die Planeten sich um die Sonne bewegen. Sie ist also zwischen allen massetragenden Teilchen wirksam.
Im mikroskopischen Bereich der Atome ist die Gravitation jedoch im Vergleich zu den anderen Wechselwirkungen sehr schwach. Wenn Teilchen mit sehr großer Geschwindigkeit, also mit hoher Bewegungsenergie, fliegen, kann die Gravitation zwischen ihnen nicht mehr vernachlässigt werden.
Heute ist es die Gravitation, die den Astrophysikern und Elementarteilchenphysikern am meisten Kopfzerbrechen bereitet, denn es wurde noch kein Wechselwirkungsteilchen (Graviton) entdeckt, das die Gravitationskraft vermittelt. Dennoch ist es unstrittig, dass es ein solches Wechselwirkungsteilchen der Gravitation geben muss.
Die elektromagnetische Wechselwirkung vermittelt die abstandsabhängige elektrostatische Abstoßung zwischen gleichnamigen bzw. Anziehung zwischen ungleichnamigen elektrisch geladenen Teilchen (Coulombsches Gesetz) und den Energie- und Informationstransport mit Lichtgeschwindigkeit durch elektromagnetische Wellen wie zum Beispiel das sichtbare Licht.
Klar erkennbar ist die Bedeutung der elektromagnetischen Wechselwirkung für den Aufbau und die Stabilität der äußeren Atom- und Molekularstrukturen, da die chemischen Bindungen durch Überlappung der Ladungen (Elektronen) in der Atomhülle zustande kommen. Die elektromagnetische Wechselwirkung hat eine quasi unendliche Reichweite, und wir werden sehen, dass ihr im Rahmen moderner physikalischer Modellvorstellungen eine überragende Bedeutung zukommt.
Die elektroschwache Wechselwirkung hat nur eine extrem kurze Reichweite und ist für einige Eigenschaften der Atomkerne von Bedeutung. Damit kann man Zerfallsprozesse in Atomkernen beschreiben. Es existiert eine vereinheitlichte Theorie der elektromagnetischen und der elektroschwachen Wechselwirkung, weshalb manche Theoretiker diese beiden Wechselwirkungen auch als eine Wechselwirkung auffassen.
Die starke Wechselwirkung vermittelt eine Anziehungskraft kurzer Reichweite zwischen schweren Teilchen wie den Protonen und den Neutronen untereinander. Die starke Wechselwirkung ist im Größenordnungsbereich der Atomkerne stärker als die elektrostatische Abstoßung der Protonen. Nur deshalb können Atomkerne aus einer Vielzahl von Protonen (1 bis 92) und Neutronen existieren. Sonst würden die elektrisch positiv geladenen Protonen im Atomkern sich abstoßen, und der Atomkern würde auseinanderfliegen.
Ohne die starke Wechselwirkung gäbe es im Universum nur Wasserstoffatome, da sie nur ein Proton enthalten. Atomkerne mit mehr als einem Proton könnten also ohne die starke Wechselwirkung nicht existieren.
Das Ziel der Grundlagenforscher ist es nun, die Zahl der elementaren Teilchen auf ein Minimum zu reduzieren und die vier Grundkräfte in einer vereinheitlichten Theorie zusammenzufassen.
Kapitel 2
Was sind Teilchen?
Transdimensionen und Partialstrukturen
In diesem Kapitel geht es recht physikalisch zu, und der in der Physik weniger bewanderte Leser wird sicherlich sehr herausgefordert, auch wenn auf jegliche Formeln verzichtet wird.Es geht um die Frage, welche innere Struktur bestimmte Elementarteilchen haben. Nur so lassen sich die physikalisch messbaren Eigenschaften der Teilchen, zum Beispiel die elektrische Ladung und die Masse, beschreiben. Da die herrschenden Modelle der Physik hierauf keine befriedigenden Antworten geben, befassen wir uns auch mit weniger bekannten Ansätzen, insbesondere der beiden Physiker Jean Émile Charon und Burkhard Heim.Es zeigt sich, dass die Existenz weiterer Dimensionen angenommen werden muss. Dadurch wird es erstmals möglich, auch geistige bzw. bewusstseinsrelevante Prozesse zu beschreiben. Die Frage nach der Existenz Gottes und eines höheren Bewusstseins wird durch die Ergebnisse der modernen Physik bereits nahegelegt.
2.1 Die Geometrisierung von Teilchenstrukturen
Aus der Vielzahl der in den vergangenen Jahrzehnten gesammelten experimentellen Daten aus Teilchenbeschleunigern entwickelte sich das Standardmodell der Elementarteilchenphysik. Es bringt zunächst einmal eine gewisse Ordnung in den Teilchenzoo, aus dem die uns bekannte Materie zusammengesetzt ist.
So wurde der innere Aufbau der Protonen und Neutronen auf die Quarks zurückgeführt. Neben den Quarks gelten noch die Elektronen sowie die Neutrinos als elementare Bausteine der Materie. All diese Teilchen existieren in verschiedenen »Generationen«, wobei die Teilchen der ersten Generation die stabilen Teilchen sind, aus denen die gewöhnliche Materie aufgebaut ist. Die Teilchen der zweiten und dritten Generation sind kurzlebige, angeregte Teilchenzustände, die in Teilchen der ersten Generation zerfallen.
Im Standardmodell der Elementarteilchenphysik ist die Gravitation nicht integriert. Viele Parameter des Standardmodells gehen daher nicht aus der Theorie hervor, sondern können nur anhand von experimentellen Daten bestimmt werden. Aus diesem Grund ist das Standardmodell der Elementarteilchenphysik eigentlich keine echte physikalische Theorie in dem Sinne, dass man von ihr erwarten kann, dass alle beobachteten Eigenschaften und Messgrößen auch berechnet werden können.
Eine Theorie, die ein umfassendes Verständnis vom Aufbau der Materie hat, sollte in der Lage sein, nur unter Zuhilfenahme weniger Naturkonstanten wie etwa der Lichtgeschwindigkeit, der Planckschen Konstante, der Gravitationskonstante und der elektrischen Elementarladung alle beobachtbaren Teilcheneigenschaften zu berechnen. Hingegen handelt es sich bei dem Standardmodell der Elementarteilchenphysik um einen Flickenteppich von verschiedenen Teilformalismen, in denen derzeit etwa zwanzig nicht aus der Theorie herleitbare Parameter verwendet werden, die nur aus experimentellen Daten ermittelt werden können. Zu diesen nicht theoretisch herleitbaren Parametern gehören unter anderen die Teilchenmassen (Quarks und Leptonen) und die Stärke der jeweiligen Wechselwirkungen.
Eine »Theorie«, die so viele »Fittingparameter«, wie die Physiker sagen, enthält, kann nicht für sich in Anspruch nehmen, sie »bilde eine Art Weltformel, nach der in der Vergangenheit von theoretischen Physikern wie Albert Einstein oder Werner Heisenberg ohne Erfolg gesucht wurde« (Harald Fritzsch, 2004). Eine solche »Theorie« kann nur vorläufigen Charakter haben. Sie kann sich auch keineswegs messen mit der Relativitätstheorie eines Albert Einstein oder der Quantenphysik eines Werner Heisenberg.
Unser Wissen über die physikalischen Eigenschaften der Elementarteilchen basiert einzig und allein auf experimentell gemessenen Daten. Die Masse, die Ladung, das magnetische Moment und der Spin des Elektrons können gemessen werden. Die herrschende Mainstream-Physik hingegen kann diese Größen nicht aus einer Theorie heraus berechnen und kann auch keine Antworten auf die Fragen geben, warum ein Elektron eine Masse und eine Ladung hat und was überhaupt Masse und Ladung sind.
Über den inneren Aufbau und die geometrische Struktur des Elektrons weiß die Mainstream-Physik überhaupt nichts. In der Theorie der Supergravitation werden Elementarteilchen, insbesondere das Elektron, als punktförmig betrachtet, also ohne jegliche räumliche Ausdehnung und Struktur. Das Problem, dass eine endliche Masse, die auf einem Volumen gleich Null (Punkt) konzentriert wird, zu einer unendlichen Dichte führt, wird durch geeignete mathematische Tricks wegnormiert. Dies belegt, dass die Struktur der Materie mit dieser Theorie auch nicht verstanden werden kann.
Da sich der Raum- und Zeitbegriff in der Relativitätstheorie grundlegend von der Konzeption eines absoluten Raumes und einer absoluten Zeit unterscheidet, wurde von einigen Theoretikern seit Beginn des 20. Jahrhunderts auch darüber spekuliert, ob es noch weitere Dimensionen gibt, die sich zwar der direkten Beobachtung und einem direkten Zugang entziehen, aber dennoch auf irgendeine Art und Weise an das vierdimensionale Raum-Zeit-Kontinuum ankoppeln.
Der Ansatz, weitere Dimensionen in die Physik einzuführen, um alle beobachtbaren Teilcheneigenschaften zu beschreiben, wird heute von der Mehrheit der Physiker als grundsätzlich richtig und zielführend betrachtet. Gestritten wird in der Forschergemeinde nur darüber, wie viele Dimensionen wofür gebraucht werden.
Den ersten bescheidenen theoretischen Vorstoß in diese Richtung machten Theodor Kaluza und Oskar Klein in den Zwanzigerjahren (siehe Walter Thirring, 1998). Sie versuchten, durch Einführung einer weiteren Dimension eine Vereinheitlichung der Theorien der Gravitation und des Elektromagnetismus herbeizuführen. Diese fünfte Dimension stellten sich die beiden jedoch nicht als unendlich ausgedehnte Dimension wie die drei Raumdimensionen vor, sie sollte vielmehr an jedem Raumpunkt des Einsteinschen Raum-Zeit-Kontinuums in Form einer ringförmig in sich geschlossenen Dimension ankoppeln.
Da sich diese Theorie jedoch nicht mit der bereits damals sehr erfolgreichen Quantentheorie verbinden ließ, geriet sie zunächst in Vergessenheit, bis sie in den Siebzigerjahren durch die Vertreter der Stringtheorie wieder aufgegriffen wurde.
Die Stringhypothese in all ihren verschiedenen Varianten wird seitdem in der Mainstream-Physik favorisiert, um die Struktur von Teilchen geometrisch zu beschreiben. Dabei stellt man sich ein Teilchen als einen vibrierenden eindimensionalen String (Saite) vor, wobei dieser String unendlich dünn ist, aber endlich lang. Eigentlich müsste man eher sagen, endlich kurz, denn die Strings sollen wirklich sehr, sehr kurz sein, größenordnungsmäßig um die 10-35 Meter (das ist ein Meter geteilt durch eine 1 mit 35 Nullen). Das ist so klein, dass es sich jedem messtechnischen Nachweis entzieht.
Eine weitere Variante der Stringtheorie sind die Branentheorien, bei denen Teilchen auch als mehrdimensionale schwingende Branen (abgeleitet von Membranen) dargestellt werden. In den Stringtheorien wird eine Vielzahl weiterer Dimensionen mathematisch eingeführt. Diese zusätzlichen Dimensionen sind aber dort nicht als unendlich ausgedehnte Dimensionen wie Länge, Breite und Höhe zu verstehen, sondern sie sind aufgerollt in dem Teilchenstring wie auf einer Spule – kompaktifiziert. Die Mathematik zur Beschreibung solcher kompaktifizierter Dimensionen wurde ja von Kaluza und Klein bereits entwickelt.
Mit zusätzlichen Dimensionen geizen die Stringtheoretiker nun wirklich nicht. Es sind bis zu 32 Dimensionen, die eine bestimmte Variante der Stringtheorie beansprucht, um alle messbaren Eigenschaften von Teilchen unterzubringen – ein recht hemmungsloser Gebrauch der Einführung weiterer Dimensionen.
Einige in den letzten Jahrzehnten gewonnene Erkenntnisse der Astrophysik bringen das Standardmodell der Elementarteilchenphysik in immer größere Erklärungsnot. Das Studium großer materieller Strukturen wie Galaxien und Galaxienhaufen führte zu dem Ergebnis, dass allein mit der Menge der sichtbaren Materie (Sterne inklusive braune Zwerge, Planeten und kleinere Himmelskörper, leuchtende Gasnebel) und der unsichtbaren Materie (schwarze Löcher und dunkle Staub- und Gaswolken) die Bewegungsvorgänge dieser Strukturen nicht erklärt werden können.
Aufgrund der beobachteten Dynamik von Galaxien muss angenommen werden, dass es eine dunkle Materie gibt, die nicht aus herkömmlichen Atomen oder deren Bausteinen (Quarks und Leptonen) besteht. Wir können diese rätselhafte dunkle Materie nicht direkt beobachten, weil sie keine Strahlung aussendet oder reflektiert, aber wir müssen ihre Existenz fordern, weil sie einen erheblichen Beitrag zur Gravitation leistet.
Nach Schätzungen führender Astrophysiker (siehe »Durch Welt und Himmel«, 2009) macht die sichtbare Materie nur vier Prozent der gesamten im Universum vorhandenen Energie und Masse aus. Über die restlichen 96 Prozent wissen wir so gut wie nichts. Wir wissen nur, dass diese dunkle Energie und Materie auch dort auftritt, wo sich herkömmliche Materie befindet. Ohne diese dunkle Materie können die Stabilität und die hohen Rotationsgeschwindigkeiten von Galaxien nicht erklärt werden.
Jüngste Untersuchungen von einigen hundert Supernovae zeigen außerdem, dass die Ausdehnungsgeschwindigkeiten in der Umgebung großer materieller Strukturen sich weiter beschleunigen, als ob die im Vakuum enthaltene dunkle Energie einen expansiven Druck ausübt. Der französische Astrophysiker Pierre-Olivier Lagage übt in diesem Zusammenhang Kritik am Standardmodell und fordert neue Ansätze zur Lösung dieser Paradoxa (siehe Durch Welt und Himmel, 2009). Die Mainstream-Physik steht hier nun wirklich schon lange genug auf dem Schlauch – oder sagen wir besser: auf dem String …
Ein weiteres ungelöstes Problem der Elementarteilchenund der Astrophysik ist die Tatsache, dass es im beobachtbaren Universum anscheinend nur Materie und keine nennenswerten Mengen Antimaterie gibt. Denn zu jedem Teilchen gibt es auch ein Antiteilchen, Proton – Antiproton, Neutron – Antineutron, Elektron – Positron. Es könnte also genauso gut ein Antiwasserstoffatom geben, bestehend aus einem elektrisch negativ geladenen Atomkern mit einem Antiproton, und eine Antiatomhülle mit einem elektrisch positiv geladenen Positron.
Eine Erklärungsmöglichkeit stellt die Annahme dar, kurz nach dem Urknall habe es sowohl Materie als auch Antimaterie gegeben. Aufgrund von Fluktuationen sei aber etwas mehr Materie als Antimaterie entstanden. Da Materie und Antimaterie sich gegenseitig vernichten bzw. sich in elektromagnetische Strahlung umwandeln, wenn sie in unserer Raumzeit aufeinandertreffen, sei nur die Materie übrig geblieben.
Diese Asymmetrie der Materie ist befremdlich und lädt ein zu der Spekulation, ob es vielleicht eine Spiegelwelt oder Parallelwelt zu unserer Welt gibt, die dann vielleicht mit Antimaterie gefüllt ist und somit wieder ein Gleichgewicht herstellt. Hätte eine solche Parallelwelt irgendeine Verbindung zu unserer Welt und wenn ja, wie würde diese Verbindung aussehen? Könnten hier einige weitere aufsehenerregende Entdeckungen in der Astrophysik die entscheidenden neuen Impulse zur Entwicklung einer umfassenderen Theorie liefern?
Es gibt innerhalb des Standardmodells bisher keinen befriedigenden Ansatz zur Beschreibung der Massen der Teilchen bzw. zur Beantwortung der Frage, warum bestimmte Teilchen eine Masse haben und andere nicht. Es fehlt also eine Theorie der Gravitation im Bereich der Elementarteilchen.