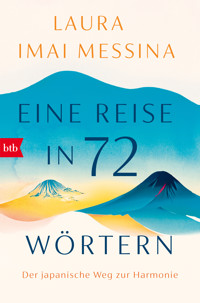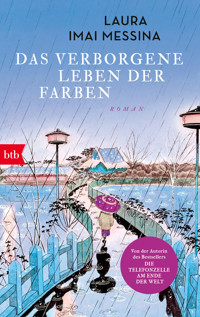
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Japan als Land der Gegensätze verpackt in eine unwiderstehliche Geschichte - Von der Autorin des internationalen Bestsellers "Die Telefonzelle am Ende der Welt"
Mitternachtsschwarz mit einem Hauch von Mond, Indigo, das nach Heidelbeere riecht, Pfirsichgelb kurz vor der Reife: Mio versteht es, alle Farben der Welt einzufangen und zu benennen. In dem Tokioter Atelier, in dem ihre Familie Hochzeitskimonos mit alten, seit Generationen überlieferten Symbolen näht und bestickt, lernte sie von klein auf die Bedeutung der Details und entdeckte das verborgene Leben der Farben. Seitdem sind Farben ihr Alphabet, ihr geheimer Schlüssel zur Welt. Aoi hingegen begleitet Beerdigungszeremonien: Er bereitet diejenigen vor, die von dieser Welt gehen, und kümmert sich um jene, die bleiben. Er besitzt die seltene Sensibilität, sein Gegenüber auf den ersten Blick zu verstehen. Als sich Mios und Aois Wege kreuzen, spiegeln sie sich wie zwei Komplementärfarben. Sie scheinen perfekt füreinander, doch ihre Begegnung ist kein Zufall.
Laura Imai Messina versteht es meisterhaft, die magische Kraft des Alltäglichen und der kleinen Dinge freizulegen. Und Japan, der Ort der Gegensätze, ist die ideale Projektionsfläche dieser Magie. So werden auf den Straßen Tokios, der zukunftsgewandten Stadt, immer noch die alten Rituale einer tausendjährigen Kultur gelebt, wie die Übergangszeremonien von Hochzeit und Beerdigung. »Das verborgene Leben der Farben« ist ein großstädtisches Märchen, das die Macht hat, uns zu verzaubern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 460
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Zum Buch
Mitternachtsschwarz mit einem Hauch von Mond, Indigo, das nach Heidelbeere riecht, Pfirsichgelb kurz vor der Reife: Mio versteht es, alle Farben der Welt einzufangen und zu benennen. In dem Atelier, in dem ihre Familie Hochzeitskimonos mit alten, seit Generationen überlieferten Symbolen näht und bestickt, lernte sie von klein auf die Bedeutung der Details und entdeckte das verborgene Leben der Farben. Seitdem sind Farben ihr Alphabet, ihr geheimer Schlüssel zur Welt. Aoi hingegen begleitet Beerdigungszeremonien: Er bereitet diejenigen vor, die von dieser Welt gehen, und kümmert sich um jene, die bleiben. Er besitzt die seltene Sensibilität, sein Gegenüber auf den ersten Blick zu verstehen. Als sich Mios und Aois Wege kreuzen, spiegeln sie sich wie zwei Komplementärfarben. Sie scheinen perfekt füreinander, doch ihre Begegnung war kein Zufall.
Laura Imai Messina versteht es meisterhaft, die magische Kraft des Alltäglichen freizulegen. Und Japan, der Ort der Gegensätze, ist die ideale Projektionsfläche dieser Magie. So werden auf den Straßen von Tokio, der zukunftsgewandten Stadt, immer noch die alten Rituale einer tausendjährigen Kultur gelebt, wie die Übergangszeremonien von Hochzeit und Beerdigung. »Das verborgene Leben der Farben« ist ein großstädtisches Märchen, das die Macht hat, uns zu verzaubern.
Zur Autorin
Laura Imai Messina wurde in Rom geboren. Mit dreiundzwanzig Jahren zog sie nach Japan. Ihr Studium an der University of Foreign Studies schloss sie mit dem Doktortitel ab, mittlerweile arbeitet sie als Dozentin an verschiedenen Universitäten. Laura Imai Messina lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern in Tokio. Ihr Roman »Die Telefonzelle am Ende der Welt« stand in Italien und Großbritannien wochenlang auf der Bestsellerliste und wurde in 25 Länder verkauft.
Laura Imai Messina
Das verborgene Leben der Farben
Roman
Aus dem Italienischen von Judith Schwaab
Die italienische Ausgabe erschien unter dem Titel »Le vite nascoste dei colori« bei Einaudi, Mailand.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2021 by Giulio Einaudi editore, Milano
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2021 by btb Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Published in arrangement with Grandi & Associati
Covergestaltung: semper smile, München
nach einem Entwurf von Einaudi unter Verwendung
eines Motivs von Igor Tuveri
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-29353-6V003
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/penguinbuecher
Für Emilio, der wächst
Prolog
In einer nicht näher bestimmten Zeit dieser Geschichte, an zwei verschiedenen Orten in Kantō, fertigen zwei Kinder von vier und sechs Jahren eine Zeichnung an.
Mio, das kleine Mädchen, liegt bäuchlings auf dem Boden und wippt dabei mit den Beinen. Sie hat ordentlich geflochtene Zöpfe, feuchte dunkle Augen und trägt ein himmelblaues Kleidchen. Sie zeichnet ein Blatt, ein einzelnes Blatt, und tupft mit den Fingerkuppen Dutzende von verschiedenen Grüntönen auf; sie mischt das Grün von Buntstiften, von Wachsmalkreiden, von Tempera- und Ölfarben. Wenn sie die Farbe nicht mit Pigmenten erreicht, verändert sie das Material. Sie klebt Papierstückchen auf, kratzt mit den kleinen Fingern an der Oberfläche; sie hat sogar eine alte Handtasche ihrer Mutter aus Kunstleder abgewetzt, um ein weiteres Grün zu gewinnen. Noch sieht es fürchterlich aus, aber das Ergebnis – davon ist sie überzeugt – wird wunderschön sein.
Aoi, der Junge, sitzt hingegen artig am Wohnzimmertisch. Er hat schwarze Augen, groß und ruhig, sein Mund ist schmal wie ein Strich, seine Stirn entspannt. Er zeichnet einen Baum, kein Blatt. Die Mutter geht am Tisch vorbei und wirft einen Blick auf die Zeichnung ihres Sohnes: Die Rinde des Baumes ist grün, seine Krone rosarot. Sie legt Aoi die Hände auf die Schultern, und ruft gerührt: »Das hast du aber gut gemacht!«
Erster Teil
灰桜 Aschgrau und Kirschrosa
Und in gewissen Momenten dieses außergewöhnliche Gefühl, dass nichts verloren gegangen ist; nichts verloren geht.
Giannis Ritsos
Unter gleich vollkommenen Farben wird sich die als die vorzüglichere zeigen, die in Gesellschaft ihres directen Gegentheiles gesehen wird … Azur zu Goldgelb, Grün zu Roth. Jede Farbe wird besser inmitten ihres Gegentheiles erkannt als inmitten ihresgleichen.
Leonardo da Vinci
Eins
Wer ihre Tochter war, ahnte Kaneko Yoshida zum ersten Mal an einem Maimorgen, als die Kleine erst ein paar Wochen alt war. In einer Gasse des Kagurazaka-Viertels in Tokio gleißte das Grün, und die Blätter der Teepflanzen konnte man mit dem Schriftzeichen shinryoku新緑 ausdrücken: Es war das neue und leuchtendste Grün des Jahres.
Die Mutter beobachtete sie wie verzaubert beim Spielen auf dem Bett, als sie am Eingang eine Stimme hörte: Die Nachbarin brachte ihr ein paar kleine, frisch gestampfte mochi. Obwohl auch ihr Ehemann und irgendwo im Haus ihre Eltern zu Hause waren, wäre es als unhöflich betrachtet worden, wenn Kaneko nicht höchstpersönlich an die Tür gegangen wäre, um für die Gabe zu danken. Und so verließ sie das Zimmer und ließ Mio zurück, die mit der ganzen Freude eines Kindes ihre kleinen Füße und Hände in der Sonne bewegte.
Als die Frau jedoch nur wenige Augenblicke später das Zimmer wieder betrat, war das Bett leer. Es war mucksmäuschenstill.
Kanekos Körper erfuhr eine extreme Beschleunigung. Eine Erfahrung, die sie in den folgenden Jahren als etwas beschreiben würde, was einer Zeitreise am nächsten kam.
In den nächsten dreißig Minuten, in denen das Haus von Laufen und Rufen erfüllt war, waren alle davon überzeugt, das Kind sei entführt worden: Das Fenster stand weit offen, der Wind bauschte den Vorhang wie ein Segel. Großmutter Yōko lief eilig nach draußen, wegen des engen Kimonos mit kurzen Schritten; Großvater Mamoru beobachtete sie von der Tür aus, wie sie in Richtung kōban lief. Mios Vater hingegen war außer sich vor Angst. Ohne ein Wort zu sagen, stellte er das ganze Haus auf den Kopf. Er durchwühlte die Stoffe auf dem Bett, riss Schubladen und Schränke auf, schaute unter dem kleinen Küchentisch. Fast war es, als wäre ihm ein Lungenflügel oder die Milz abhandengekommen.
Das gesamte Viertel wurde in die hektische Suche einbezogen: Die Frauen holten ihre Männer aus den Läden und Büros, der Stadtteilpolizist wurde zu Hilfe gerufen: Ein neugeborenes Mädchen sei der Mutter entrissen worden! Man folge jener Frau, deren Schatten jemand hinter einer Tür verschwinden gesehen hatte! Und man verfolge jenen Mann, der die Hauptstraße von Kagurazaka hinuntergelaufen war! Ja, das hatte Shimizu-san gesehen, und auch Abe-san hatte hinter einer Platane eine verdächtige Person wahrgenommen, ach nein, hinter einer Eiche! In der allgemeinen Aufregung, die die Häuser der Nachbarschaft erfasste, begannen die Kinder auf der Straße auf und ab zu laufen. Ohne den Grund für die Erregung zu begreifen. Für sie war es ein Grund zum Feiern.
Nur Mios Mutter war immer noch überzeugt, sie könne ihre kleine Tochter nur dort wiederfinden, wo sie sie zurückgelassen hatte.
So wie man unzählige Male auf der Suche nach verloren gegangenen Hausschlüsseln eine Tasche auf den Kopf stellt, kehrte Kaneko wieder und wieder zu dem Bett zurück, wo ihre Tochter zuvor gelegen hatte. Erneut sah sie sie dort spielen, sah den Wäscheständer aus Metall am Fenster schimmern und Messingreflexe ins Zimmer schicken.
In Tränen warf sich Kaneko auf den Boden, niedergeschmettert von einem Schmerz, der so gewaltig war, dass er ihr fast obszön erschien.
Es war in genau diesem Moment, dass sie inmitten des Stoffes, den sie so oft durchwühlt hatte, eine Bewegung wahrnahm. Der Wind war es nicht gewesen, sondern etwas Lebendiges, das sich rührte. Vielleicht die Katze? Nein, die sonnte sich auf der Veranda.
Die Mutter bückte sich.
Dort unter dem Bett, am Boden, lag eine Art Blume mit Blütenblättern aus Leinen, Hanf und Seide, und in ihrer Mitte sah man etwas gänzlich Neues.
Mit einer Langsamkeit, mit der man manchmal unerklärlicherweise die Lösung eines Problems hinauszögert, streckte sie schließlich die Finger aus. Und zupfte ganz behutsam die Blütenblätter der Rose auseinander.
Da lag ihre Tochter.
Sie schlief. Ihre Augen waren geschlossen und zuckten, kaum wahrnehmbar, als bemühte sich Mio im Traum zu schauen, so wie Hunde im Schlaf manchmal laufen und die Pfoten bewegen. Was sie vor allem betrachtete, waren Farben, verschiedene Kleckse, die für ihre Pupillen noch gar nicht erkennbar waren.
Reglos und stumm stand die Frau da. Wie war es nur möglich, dass ihre Tochter vom Aufruhr der Suche nicht geweckt worden war? Wie war es möglich, dass sie selbst mehrfach das Bettzeug und die Stoffe durchwühlt und sie doch nicht gefunden hatte? Wie konnte es sein, dass niemand auf die Kleine getreten war? Dass sie beim Fallen nicht geweint hatte? War es vielleicht wirklich eine Entführung gewesen, die unterbrochen wurde? Und weshalb?
Sie nahm ihre Tochter in die Arme und legte sie ins Bett zurück. Auf Zehenspitzen ging sie hinaus, um denjenigen, die immer noch schreiend auf der Straße suchten, Bescheid zu geben: dem Polizisten, der inmitten einer kleinen Menschenmenge, von Großmutter Yōko angeführt, gerade wieder ins Haus wollte; ihrem Mann, dessen Gesicht noch immer von Angst gezeichnet war; und Großvater Mamoru, der reglos auf der Schwelle stand.
Von jenem Tag an, der als Tag des Großen Schreckens in die Geschichte einging, legten sie Mio immer in eine Wiege, wo sie von feinstem Holz und Strohgeflecht gut geschützt war. Und die Mutter begann das Mädchen mit jener Mischung aus Bewunderung und Zweifel zu betrachten, die sie nie wieder loswurde.
Wer war ihre Tochter?
Mio war inmitten von Kimonos zur Welt gekommen, im Durcheinander eines Novembermorgens.
An jenem Tag hatte es ein großes Gewusel von Kindern gegeben, denn es war shichi-go-san, das Fest, mit dem ihr Heranwachsen geehrt wurde, alle trugen bunte Stoffe mit Motiven wie Falken, Helmen, Rasseln oder Pfingstrosen. Im Tempel von Akagi fand eine Hochzeit statt, und die Stoffe, die ihr Großvater gefärbt hatte, leuchteten auf der Haut der Braut in den herrlichsten Farben. Mios Familie hatte ihre gesamte Existenz den Stoffen gewidmet, ihrer Färbung und den traditionellen Motiven, die für die shiromuku, die Hochzeitskimonos, typisch sind.
Es war ein großes Fest, und zugleich ein Tag schrecklichen Leidens.
Seit nunmehr vierundzwanzig Stunden drückte Mios Mutter in Abständen, die immer kürzer aufeinander folgten, ein Taschentuch in ihren Fäusten. Ein quadratisches Handtuch steckte zwischen ihren Zähnen, das sie nur zwischen den Wehen losließ, um große Bissen onigiri zu sich zu nehmen.
Ab und zu ergoss sich Blut auf den Stoff, ohne dass jemand ein Wort darüber verlor. Es wurde von dem Stamm des Kirschbaums aufgesogen, der auf einem ausrangierten Kimono aufgemalt war. Mios Großmutter erinnerte sich, ihn jeden Frühling getragen zu haben, als sie noch ein junges Mädchen war. Ihre Wahl war nicht zufällig auf ihn gefallen: Der Stoff dieses Kimonos wusste von der Liebe und von der Eile.
Es handelte sich um eine Familientradition, die jeder andere für bizarr, wenn nicht gar für abstoßend gehalten hätte, doch unter den Frauen der Familie Yoshida wurde sie bereits seit mindestens drei Generationen befolgt – dass nämlich eine Geburt immer auf einem abgelegten Kleidungsstück stattfand und man diese besudelten Stoffe bis zum Tode der Frau aufbewahrte; der Ritus sah vor, dass die befleckten Streifen erst nach der Bestattung zusammen mit ihr verbrannt wurden.
Nur eine Minute nach vier ertönte der Schrei. Nun betrat das elfenbeinfarbene Handtuch die Bühne, jemand rief: »Das Kind kommt jeden Moment!«, was ebenso eine Feststellung wie auch eine Vorhersage war.
Nachdem man sie aus dem angespannten Körper ihrer Mutter gezogen hatte, legte man die Kleine auf ein Stück Baumwolle von der Farbe, die man hai-zakura nennt, ein Aschgrau mit einem Hauch Kirschrosa.
In dieser Farbe – so flüsterten es sich die drei Frauen zu, die bei der Geburt anwesend waren: die Mutter, die Großmutter und die Hebamme – vereinten sich das Leben und auch der Tod. In ihr waren der Anfang und das Ende.
Mio, die noch nicht dazu in der Lage war, das Sprudeln der gedämpften Stimmen zu hören, nahm dennoch alles in sich auf. Asche und Kirsche, würde sie eines schönen Tages denken, und von jenem Tag an würde sie fest daran glauben: Genau das war es, was es bedeutete, auf die Welt zu kommen.
Als Mio geboren wurde, machte der Stoff, der ihren Blick verhüllte, sie ruhig.
»Sie ist ein sehr entspanntes Kind«, brüstete sich die Mutter. »Nachts schläft sie manchmal zehn Stunden am Stück, und bei Tage mindestens sechs.«
Kaneko behielt sie in ihrer Wiege bei sich, während sie die Stoffe verarbeitete oder den jungen Bräuten den shiromuku um den Leib schlang. Wenn sie einkaufen ging, wenn sie aufräumte oder kochte, oder auch wenn sie Gäste hatten, band sie sich die Kleine auf den Rücken. Dort auf der Rückseite der Mutter hängend, war Mio damit zufrieden, nichts zu sehen. Einfach nur da zu sein genügte ihr vorerst.
Das Kind begnügte sich damit, zu trinken und zu schlafen; es weinte wenig, nur um anzuzeigen, dass es Hunger hatte oder dass ihm ein bisschen Luft in der Kehle stecken geblieben war.
Die Verwandlung fand erst statt, als das kleine Mädchen zu sehen begann. Sicherlich nahm sie damals noch nicht die Formen wahr, nur die vielfarbigen Schatten, die sich in ihrem eingeschränkten Gesichtsfeld bewegten. Doch sie genügten bereits, um dafür zu sorgen, dass Mio plötzlich – und nur in diesen Momenten – die Stimme erhob. Noch waren es nur Klänge, keine vollständigen Worte. Vielmehr war es so, dass sie in die Farbe eindrang, sie hatte so etwas wie eine körperliche Reaktion auf die Dinge, denen sie erst eines Tages, viel später Namen geben würde.
Und man konnte sich sicher sein, wenn jener ganz besondere Tag erst einmal gekommen war, dann würde Mio jede einzelne Farbe auf der Welt benennen können.
Hätte man sie ganz unvermittelt – vielleicht bei einer der vielen Befragungen, die in den Straßen von Tokio gemacht wurden – darum gebeten, ein paar Geräusche aufzuzählen, an die sie sich aus ihrer Kindheit erinnerte, so hätte Mio über das Rascheln der Kimonos gesprochen, die man aus einem einzigen, ellenlangen Stoffstreifen fertigte, über ihre Großmutter, die diese langen Bahnen streichelte, weil sie sie als etwas Lebendiges betrachtete, und sie so lobte, wie man kleine Kinder lobt (»Wie schön du bist!« »Du siehst toll aus!« oder »Du wirst bei der Hochzeit Eindruck machen!«); sie würde vom Knistern der obi sprechen, die eng um die Taille saßen und einen aufrecht hielten, oder von den Stoffballen, die in den oshiire, den Schränken, im ersten Stock gerollt und gestapelt wurden wie Zuckerstangen. Die kreisrunden Löcher in den Stoffballen, wie Augen, fingen am Boden an und reichten bis an die Decke.
»Ach, und was ich noch vergessen habe«, würde Mio zu dem Mann sagen, der ihr das Mikrofon vor die Nase hielt. Die Kamera wurde von hinten, von einer jungen Frau, gehalten. »Da war auch noch das Seidenpapier, das die Kimonos in den Schubladen der Kommode schützte. Sein feines Rascheln machte mich verrückt. Und dann … ach, lassen Sie mich auch noch das Plätschern der Farbe in den großen Farbbehältern erwähnen. Das ging vom Eisenblau bis zu Türkis, von Aprikosenfarben bis zu Violett.«
Der Interviewer würde sie bewundernd anschauen und über all die Einzelheiten staunen, die die junge Frau hinzufügte. Doch er würde auch der Kamerafrau einen Blick zuwerfen: Allmählich bereitete ihm die Länge des Interviews Sorge.
Rund um den Bahnhof von Yurakuchō, wo Mio an diesem Morgen für eine Beratung ausgestiegen war, versammelte sich indessen eine Menschentraube. Touristen mit gelben Hütchen, mit Anstecknadeln an der Brust, eine kleine Fahne, von der Reiseleiterin geschwenkt wie eine Peitsche.
»Und dann war da das Plaudern der Frauen im Haus nebenan, rund um einen shiromuku, Sie wissen, was das ist, oder? Dieses blendende Weiß, die Reiher, die Pflaumenbäume, die Umrisse der Kiefern … Für mich ist das der schönste Kimono der Welt. Die Menschen sehen nur das Weiß, doch es gibt Dutzende von Weißtönen. Es ist wie die halbe Skala einer einzigen Farbe, etwas Wunderbares … Können Sie es sich vorstellen?«
Ohne etwas zu erwidern, würde sich der Mann beeilen, ihr für die Zeit danken, die sie ihm gewährt hatte. Es genüge. Und würde sich fast ein wenig brüsk von ihr verabschieden.
Während der Interviewer und die Kamerafrau sich fragten, ob es wohl angebracht sei, noch ein paar andere Leute anzuhalten oder zuerst in dem kleinen Rāmen-Restaurant unter den Bögen des Bahnhofs einen Teller Nudelsuppe zu essen, würde Mio ihren Weg in Richtung Ginza fortsetzen. Während sie mit langen Schritten am elfenbeinfarbenen Schrein der Ginzadōri vorbeiging, an den Megastores von Dior, Chanel, Gucci und Prada – und an den blendend aussehenden Security-Männern, die stocksteif die Eingänge bewachten –, dachte sie, um den Generalbass ihrer Kindheit zu erklären, hätte es im Grunde genügt, einfach nur eine rasche Liste von Verben aufzustellen: das Sieben der Pflanzen, das Zerstückeln der Blätter, das vorsichtige Eintauchen. Und dann langsames Filtern, energisches Abgießen, Auswringen, Pressen, Drücken, das Blasen des Windes oder der Ventilatoren, um zu trocknen. Das Aufhängen an der Sonne. Und immer wieder das Nähen, das Bügeln, das Knoten der Gewänder.
Und dann am Ende »Oh!«: das Bewundern.
Trotz der großen Erwartungen hatte Mio bis zu ihrem vierten Lebensjahr noch kein einziges Wort gesprochen.
Angesichts des Mysteriums, das ihre Tochter war, hatte die Mutter, wenn eine Nachbarin oder ein entfernter Verwandter sich bei ihr erkundigte, wie die Kleine denn so sei, begonnen, sie laut als »eigensinnig«, »ungewöhnlich« oder auch »außergewöhnlich« zu bezeichnen. Innerhalb der Familie hingegen schlug Kaneko leisere Töne an und nannte sie »anders« oder auch »etwas eigen«. Doch in jenem etwas versuchte sie, soweit es möglich war, die Angst zu begrenzen, die sie doch von innen auffraß: dass Mio eines Tages sonderbar würde, ein Original. Eine Frau, die man nicht heiratete.
Was zur Besorgnis der Eltern und ihren Schuldgefühlen (denn sie hatten in der Tat nur sehr wenig Zeit, die sie ihrer Tochter widmen konnten) beitrug, war die Tatsache, dass Mio, um auf etwas hinzuweisen, einfach mit dem Finger darauf zeigte.
Trotz der Versicherungen der Ärzte, die davon überzeugt waren, dass es sich nur um eine besonders lange andauernde Sprechfaulheit handelte, hatte sich die Familie mittlerweile mit dem Gedanken abgefunden, dass das Mädchen für den Rest seines Lebens stumm bleiben würde. Eine wunderschöne, kaputte Puppe.
Insgeheim verhätschelte Großmutter Yōko Mio. Sie brachte sie in ihr Zimmer, öffnete für sie die Kommode, ließ sie die Kimonos streicheln, betrachtete sie dabei, wie sie mit ihren kleinen Fingern die Linien der Stickereien nachfuhr. Dann erklärte sie ihr, was es mit dem Panzer der Schildkröte auf sich hatte, mit akikusa, dem Herbstkraut, und warum früher das murasaki紫 Violett nur dem Adel vorbehalten gewesen war.
Mio lauschte ihrer Großmutter, legte sich vorsichtig mit weit ausgestreckten Beinen und Armen auf das riesige Stoff-T der Kimonos. Und es ging ihr durch den Kopf, wie lange es wohl noch dauern würde, bis sie endlich erwachsen war.
Erst mit etwa viereinhalb begann sie zu sprechen.
Dennoch zögerte sie, das genau gleiche Wort für zwei verschiedene Dinge zu verwenden, als könnte sie nur dann gelb sagen, wenn sie ein Objekt aus exakt dem Gelb vor sich hatte, zu dem sie sich dieses Wort zum allerersten Male gemerkt hatte.
Mio wunderte sich, dass sich um sie herum ständig falsche Entsprechungen bildeten. Jedes Mal, wenn sie den Erwachsenen zuhörte, empfand sie die Verpflichtung, all das, was sie bis zu jenem Moment begriffen hatte, neu formulieren zu müssen. So, wie wenn man zu seinem großen Erstaunen feststellt, dass zwei Menschen, die rein gar nichts gemeinsam haben, denselben Namen tragen.
Zwar geschah dies Mio bei allen Dingen (ob es sich nun um eine Tasse, einen Hund oder ein Paar Stäbchen handelte), doch es bestand kein Zweifel daran, dass es ihr vor allem bei den Farben so ging. Wo ein anderer einfach nur ein schlichtes Rot sah, kannte Mio von einem Farbton mindestens zehn verschiedene Abstufungen. Und sie alle mit einem einzigen Wort zu bezeichnen, erschien ihr ein Fehler.
An einem gewissen Punkt musste sie allerdings erkennen, dass man, um zu kommunizieren, auf Präzision verzichten muss. Und so sagte sie eben: »Ich möchte essen«, »Mir ist warm«, »Ich will nicht mehr aus dem Haus« oder »Hilfst du mir, mein Zimmer aufzuräumen?«
In der Familie war die Freude so groß, so riesengroß, dass Kaneko dazu überging, Mio jedes Mal, wenn sie etwas sagte, ein Bonbon schenkte. Das war nur ein kleiner Preis dafür, dass sie ihr eine riesige Sorge abgenommen hatte, schon die zweite nach dem Tag des Großen Schreckens, als das Mädchen auf rätselhafte Weise verschwunden war, um dann inmitten einer Stoffblume wieder aufzutauchen.
Und so kam es, dass Mio in ihrem vierten und fünften Lebensjahr immer die Backen voller Bonbons hatte.
Der Zahnarzt schimpfte sie und die Mutter: »Dieser ganze Zucker macht dir die Zähne kaputt. Bonbons sind ein Anschlag auf das schöne Gebiss eines Mädchens, und schlechte Angewohnheiten rächen sich, Frau Yoshida!«
Doch Mio bekam keine Karies, im Gegenteil: Ihre Zähnchen waren kerzengerade, ohne Löcher, und wuchsen alle in die richtige Richtung, und ihre Farbe war jenes emailfarbene Weiß, dessen Namen sie eines Tages genussvoll auf der Zunge zergehen lassen würde: enpaku,鉛白, das uralte Bleiweiß, das die Menschen so lange an ihre Körper gelassen hatten, bis sie entdeckten, wie giftig es war.
Sicher zögerte die Kleine noch immer, weil sie davon überzeugt war, dass sie niemals exakt das würde ausdrücken können, was sie wirklich sagen wollte. Doch dann ließ sie die Wörter alle auf einmal los, es war wie eine Kapitulation. Und ihre Mutter war darüber so entzückt, dass Mio regelrecht abhängig davon wurde, sie glücklich zu machen.
Kaneko freute sich und ging neue Bonbontüten kaufen.
»Yoshida-san, guten Tag! Aber Mio-chan ist ja wirklich verrückt nach diesem Zuckerzeug!«
»Ja, Sano-san, sie liebt es über alles … und wenn Sie nur wüssten, was sie heute Morgen zu mir gesagt hat.«
»Was denn?«
»Dass sie das Zebra und die Giraffe sowie alle Tiere aus dem Zoo zu ihrem Fest einladen will. Vergangene Woche waren wir mit ihr im Park von Ueno …«
»Ach, wie witzig! Wie alt ist sie noch mal?«
»Fünf, im November wird sie fünf.«
Die Mutter hatte schließlich damit aufgehört, ihre Tochter als »eigensinnig« oder »außergewöhnlich« zu bezeichnen. Mittlerweile wusste sie, dass Mio das wirklich war, und schwelgte mit unerhörter Freude in jeder Banalität, die das kleine Mädchen von sich gab: Ihre Tochter war in Sicherheit, nur das zählte.
Auch der zweite Raub, der ihr geschehen war – der Raub der Worte –, war nun beendet.
Nur eine Sache blieb, ein winziger Makel, der allerdings in jenem Jahr der Verwandlung immer größer wurde: Farben benannte Mio niemals, das verweigerte sie.
Sie hielten es für etwas Vorübergehendes (zumindest am Anfang), einen Zufall.
Nur die Mutter hatte ihre Zweifel.
Sie begann, die leckersten Bonbons beiseitezulegen, und versuchte ihre kleine Tochter, wie bei einem Hund, der nicht Pfötchen geben will, zu trainieren, indem sie ihr wieder und wieder die Frage stellte: »Was für eine Farbe hat das?« Und wenn die Tochter dann zögerte, hakte sie nach: »Welche Farbe ist das?«
Doch das kleine Mädchen wich ihr aus, benannte zwar den Gegenstand, beschrieb auf ihre Weise Form und Verwendung, erfand manchmal sogar noch eine kleine Geschichte dazu. Doch ihre Mutter wollte die Farbe hören, diesen Aspekt, der im Alltag ihrer Familie eine so große Rolle spielte: filtern, ausspülen, auswringen, an die Sonne hängen, nähen, bügeln, mit »Oh!« bewundern.
Die bunte Tüte, randvoll mit Bonbons, hing wie eine Ermahnung deutlich sichtbar in der Küche.
Und wieder fragte Kaneko sich besorgt: Wer war ihre Tochter?
Wenn Mio nicht sagte, welche Farbe ein Gegenstand hatte, dann existierte dieser Gegenstand für die Mutter nicht.
»Mama, hilfst du mir, bei dem Kleid den Reißverschluss zuzumachen?«
»Was für eine Farbe hat das Kleid?«
»Mama, die Knete!«
»Welche Farbe soll sie haben, die Knete?«
Nur beim Essen hielt sie sich zurück, weil der Gedanke, das Mädchen sei so dickköpfig, dass es verhungern könnte, ihr Angst machte.
»Hier im Haus gibt es so viele verschiedene Farben, vielleicht ist sie einfach nur verwirrt«, versuchte Großmutter Yōko, ihre Enkelin zu rechtfertigen; sie hatte von Anfang an nicht den Drang verspürt, Mio sprechen zu hören. Ja, wäre es nach ihr gegangen, hätte sie dem Mädchen noch eine Weile länger seine Kindheit gegönnt.
»Aber das ist doch absurd«, erwiderte Kaneko. »Warum kennt sie den Namen von jedem Gemüse und jedem Obst, sagt aber nicht, dass der Apfel rot ist? Er ist groß, glatt, vielleicht auch saftig, genau das hat sie gestern gesagt, saftig!, aber dass er rot ist, bringt sie nicht heraus. Das ist ungezogen, sie macht es absichtlich!«
»In diesem Alter sind Kinder nicht ungezogen, Kaneko. Lass sie in Ruhe, du wirst sehen, irgendwann sagt sie alles«, riet ihr die Großmutter.
Allerdings hatte Kaneko in einer Hinsicht recht: Mio machte es tatsächlich absichtlich. Aber sie tat es nicht, um sie vor den Kopf zu stoßen; ihre Mutter traurig zu machen, war das Letzte, was sie wollte.
Es kommt häufig vor, dass wir gerade die Dinge, die wir besonders lieben, in Schutz nehmen wollen. Und manchmal entsteht dabei auch eine Art Widerstand gegenüber der Art und Weise, wie alle anderen sie verstehen.
Und genau auf diese nervöse Weise verstand Mio die Farben. Sie lernte sogar die Wörter dafür, aber es waren nicht die Wörter, die andere Kinder verwendeten. Sie schienen bereits jetzt auf etwas gerichtet, das viel größer war.
Der großen Menge an gängigen Substantiven und Adjektiven fügte Mio ausgefallene Vokabeln hinzu. Unzufrieden mit der Wirkung eines »mehr« oder eines »weniger«, eines »hell« oder eines »dunkel«, versah sie die Farbbezeichnungen mit Ausdrücken, die für andere Menschen keinen Sinn ergaben – ein junges Grün, ein sechs Jahre altes Himmelblau, ein Gelb, das Ringelreihen tanzt, das Blau des Himmels um sieben Uhr abends. Es waren Worte, die mit ihr heranwuchsen und die die Erwachsenen der fröhlichen Unordnung eines kleinen Menschen zuschrieben, der eine andere Sprache lernt als die seiner Mutter.
»Verblüffend«, murmelten einige der Nachbarn, an Kaneko und ihre Mutter gerichtet, »dass sie in ihrem Alter das Japanisch so gut beherrscht.«
Von einer kleinen Stummen hatte sich das Mädchen zur wortgewandtesten Person des ganzen Viertels entwickelt.
Kanekos Erleichterung hielt nur ein paar Tage an. Sie hatte wieder damit begonnen, Mio Bonbons zu geben, doch jetzt nahm das Mädchen sie auf der Handfläche entgegen, dankte mit einem leichten Nicken und schob die Süßigkeit sofort in ihre Tasche, ohne sie in den Mund zu stecken. Fast schien es, als freute sie sich gar nicht über das Geschenk, weil sie es als eine Art Erpressung empfand.
Niemand ahnte es, doch für Mio war es schon der zweite große Kompromiss in ihrem noch winzig kleinen Leben. An diesem Punkt hatte sie nämlich bereits entdeckt, dass ein einziges Wort zwar zum Verzweifeln viele verschiedene Bedeutungen haben konnte, aber sie hatte auch eine Methode gefunden, es zu befreien: Man musste ihm einfach nur weitere Worte an die Seite stellen, mit denen es eine kleine Gruppe bildete.
Wenn ein Satz oder Ausdruck schief begann, konnte er durch einen kleinen Zusatz immer noch gerettet werden.
So wie es im Grunde auch beim Färben von Stoffen war: Man konnte die Farbe eindicken und intensiver machen oder sie durch Verdünnung mit Wasser verändern.
»Was hat das für eine Farbe, Mio?«
»Die Farbe einer reifen Traube mit zarter Schale.«
»Und das hier?«
»Das ist mitternachtsschwarz mit ein bisschen Mondschein.«
Über diese Zusätze für Gelb oder Grau amüsierten sich alle köstlich, aber die Mutter machten sie verrückt.
Es hatte ein Krieg begonnen.
Für Mio war der allerliebste Moment des Tages der, wenn sich das Haus zur Ruhe begab. Das Atelier schloss, der Geruch der Farben, mit denen Familie Yoshida die kleinen Accessoires zu den shiromuku einfärbte, blieb draußen vor der Veranda, die Sticknadeln wurden in die Nadelkissen gesteckt, der Strohduft der tatami erfüllte den Raum. Man rollte die Futons aus, die den ganzen Morgen an der Luft gehangen hatten, damit sie den Duft und die Wärme der Sonne in sich aufnahmen. Man deckte den Abend auf.
Dann streckte sich Mio auf dem Boden aus. Sie spürte die Kühle der Holzrahmen, die mit Reisstrohbinsen gefüttert waren, strich mit den Fingerkuppen über die Ränder, folgte den bunten Bändern wie auf Straßen. Genau so hatte Großvater Mamoru sie entworfen, nach der Tradition der alten daimyō: ein Luxus, den sich eine Familie von Textilhandwerkern problemlos erlauben konnte.
Sie dachte an die Streitereien zwischen den Großeltern zurück. Die alte Yōko, die so laut die Stimme erhob, als würde ihr Mann nicht direkt neben ihr sitzen: Sie hielt diese bunten Bänder für gewöhnlich, hätte sie lieber einfarbig gehabt, höchstens mit einem Hauch Indigo oder Zabaione-Gelb darin. Der Großvater gab zurück, sie habe eben keinen Geschmack und man müsse sich über die starren Vorstellungen der Leute hinwegsetzen.
Außerdem sei die Farbe immer schon ein Privileg und ein Zeichen für die Kaste gewesen.
Eines Tages würde Mio auf der Schulbank von den zwölf Schichten der Kimonos erfahren, die von den Damen des Kaiserhofes getragen wurden: Sie nannten sich jūnihotoe. Und sie würde alles über das System der kan’i jūnikai erfahren, das zu Beginn des sechsten Jahrhunderts nach Christus eine präzise gesellschaftliche Aufteilung herstellte, je nach dem Farbton der langen, schmalen Kopfbedeckungen, die man am Hofe trug. In beiden Fällen existierten zwölf Farbtöne, durch die man die Machtstruktur erkannte und wusste, an wen man sich zu wenden hatte und wie. Mit der Zeit würde sich Mio voller Bewunderung jene Epoche vorstellen, in der das Recht aus Farben und Abstufungen bestand. Sie würde davon träumen, dass die Welt eines Tages wieder so sein würde. Mit Farben, die ihr sagten, wie sie sich zu verhalten und die Beziehungen zwischen den Menschen zu deuten habe.
Am Tag gab es einen Moment, in dem sich der Vater einzig und allein mit der Tochter beschäftigte und in dem diese lernte, wer dieser Vater war.
Es war am Abend, kurz bevor man schlafen ging, wenn das Märchenbuch – immer dasselbe – aufgeschlagen wurde: Dann befeuchtete Yōsuke seinen Zeigefinger und las ihr eine neue Geschichte vor, gefolgt von einer zweiten, bei der es sich gewöhnlich um eine der beiden Lieblingsgeschichten von Mio handelte – Urihime und Amanojaku oder Des Kaisers neue Kleider.
Dann schmiegte sich das Mädchen an seinen Vater, legte den Kopf an den Übergang zwischen Bauch und Oberschenkeln. Irgendwann ging Mio dann dazu über, sich neben ihn zu setzen und die stacheligen Arme ihres Erzeugers nicht zu berühren.
Jenes Buch war nicht bebildert, doch das machte ihr nichts aus. Ganz im Gegenteil: Im Geiste entwickelte sich das alles mit einem ganzen Berg von Details, die keine Zeichnung jemals hätte darstellen können. Dinge abgebildet zu sehen war für Mio oft eine Enttäuschung.
Viel lieber war es ihr, den Vater zu unterbrechen und ihn zum Beispiel zu fragen, welche Farbe Momotarōs Lätzchen hatte, und wie das Fell des Hundes gefärbt sei, der sich ihm bei seiner Reise ins Land der Ungeheuer anschloss (war es kogecha 焦茶, das Braun verbrannter Teeblätter, oder tobi-iro鳶色, das rötliche Braun des Gefieders der Milane), oder wie der Kimono der Prinzessin Kahuya aussah, die aus einem Bambusrohr geboren wurde (wenn er rot war, handelte es sich dann etwa um akabeni-iro赤紅色, das Geranienrot der hochstehenden Damen Kyōtos?).
Dann lachte der Vater, ihn amüsierten die Fragen der Tochter.
Die Mutter hingegen weigerte sich sogar, im selben Zimmer zu bleiben. So sehr, dass Mio Kaneko, wenn die Mutter ihr (was zugegebenermaßen nur sehr selten geschah) eine Geschichte vorlas, niemals Fragen stellte. Dann lauschte sie mucksmäuschenstill ihrer Stimme, als würde Kaneko ein besonders langes sutra vortragen.
Großmutter Yōko beobachtete die Szenerie aus der Ferne: Sie war froh, dass ihr Schwiegersohn zu Mio nachgiebiger war als ihre Tochter. Abgesehen davon war auch ihr Mann so mit Kaneko gewesen, als sie klein war: Großvater Mamoru gehörte noch der Generation an, die ihre Kinder kaum wahrnimmt.
Als sie schließlich lesen gelernt hatte, sollte Mio leidenschaftlich gern Romane mit vielen Beschreibungen lesen: Salgaris sinnlicher und undurchdringlicher Dschungel, Stevensons geheimnisvolle Südsee oder die verschneiten Landschaften Kawabatas. Alles, worauf sich andere Menschen Hals über Kopf stürzten, darauf verwendete sie genüsslich viel Zeit.
Es ging nie um das Was. Für sie war es immer das Wie.
Das ging bis zu dem Morgen, der sie ins Weiße stürzen ließ. Damals war Mio etwa fünf Jahre alt.
Im Garten schrien die Katzen wie Neugeborene, und der Wind strich träge mit den Zweigen über die Fenster.
Aus Gunma war ein befreundetes Landwirtepaar gekommen. Seit Jahrzehnten füllten sie die jährlichen Vorräte der Yoshidas mit den kostbaren Blättern der Indigopflanze auf. Von der Augusthitze geplagt, saßen die Eheleute auf dem tatami und schlürften fröhlich ein Glas soba-cha auf Eis.
Als Geschenk hatten sie Mio vom Frühlingsfest eine Puppe mitgebracht, und das Mädchen war, ermuntert von der Gabe, geblieben, um zwischen den Beinen der Erwachsenen zu spielen. Während diese über das laufende Jahr sprachen – wie die Erträge waren und was es mit dem neuen kapillaren Bewässerungssystem auf sich hatte, das praktisch, aber nicht allzu effizient war – rollte die Kleine auf dem Tatami herum, spielte mit den sora-mame-Bohnen und sortierte die Krümel der senbei.
Dann auf einmal, vielleicht weil die Stunde der Heimfahrt nahte, versiegten die Gespräche und das Hauptaugenmerk richtete sich auf das kleine Mädchen.
»Was ist denn eigentlich deine Lieblingsfarbe, Mio-chan?«
Eine Frage, eigentlich belanglos, die aber doch eine Spannung schuf, die sich wie ein strammer Faden von einer Seite zur anderen durchs Zimmer zog.
Mio war daran gewöhnt; sie war mittlerweile in einem Alter, in dem Dinge ihr ganz offensichtlich erschienen, die dies doch ganz und gar nicht waren. Dinge wie die Wut der Mutter, wie die Bonbons, die aus der Tüte geholt oder dorthin zurückgelegt wurden, wenn sie die richtigen Worte sagte (oder nicht sagte), wie das Gebiss, das der Großvater auf den Tisch legte, bevor er seinen umeshu-Pflaumenlikör trank.
»Mir gefallen viele Farben, nicht nur eine.«
»Und gefällt dir denn Indigo, Mio-chan? Findest du unser Indigo schön?«
»Sehr.«
Es folgte ein allgemeines Lächeln der Erleichterung, als hätte das ganze Haus aufgeatmet.
»Aber noch mehr als alle anderen Farben«, fuhr sie fort, »gefällt mir die, die nach Heidelbeere schmeckt und ein bisschen feucht ist.«
»Heidelbeere?«, fragte die Frau, neugierig geworden. Sie blickte zur Großmutter hinüber: Hatte sie richtig gehört?
»Und dann mag ich Orange … das Orange des Sonnenuntergangs. Das von sechs Uhr nachmittags.«
»Das Orange des Sonnenuntergangs von sechs Uhr nachmittags«, wiederholte die Frau amüsiert. »Das ist ein sehr schönes Bild.«
»Und das Gelb?«, erkundigte sich ihr Ehemann lachend. Das musste ein Spiel sein, ganz bestimmt war es das.
Niemand hatte den Ausdruck bemerkt, der sich auf Kanekos Gesicht breitmachte. Nicht einmal Mio, die ansonsten immer auf die Stimmungen ihrer Mutter achtete, wurde seiner gewahr. Sie genoss es zu sehr, auf einmal im Mittelpunkt des Interesses zu stehen, nach all den Stunden, in denen sie sich wie das fünfte Rad am Wagen gefühlt hatte.
»Das Gelb, es muss …«
Plötzlich durchfuhr eine Hand die Luft wie ein Beil, von oben nach unten: »Jetzt reicht’s«, unterbrach sie die Mutter. »Es reicht!«
Niemand reagierte, so groß war die Überraschung.
Kaneko packte ihre Tochter an der Schulter. »Es reicht, Mio!«, schrie sie. »Es reicht mit diesen idiotischen Wörtern!«
Die Großmutter erhob sich, um ihr Einhalt zu gebieten. In Kaneko sah sie immer sich selbst: die Verwirrung über etwas, was im eigenen Körper entsteht, sich jedoch auf unvorhersehbare Weise entwickelt.
»Gelb ist Gelb«, schrie Kaneko weiter und schüttelte das Mädchen. »Es ist hell oder dunkel, nichts anderes! Hast du verstanden?«
Alle sprangen auf, und es war in diesem Moment, in dem alle so aufgeschreckt waren, dass Kaneko losließ. Vielleicht war es ihr peinlich, die Kontrolle verloren zu haben – jedenfalls brach die Frau zusammen und ging in die Knie.
Der Krieg war verloren.
An jenem Abend stürzte Mio Hals über Kopf ins Weiße.
Es war die erste Ohnmacht in einer ganzen Reihe von Vorfällen dieser Art, die sie im Lauf der Jahre ereilen würden, wie milchige Pausen, in denen das Leben stillstand.
Einige Stunden später, als sich die Gäste verabschiedet hatten, wurde das Mädchen auf dem Futon wieder wach. Mio hatte alles vergessen – das Zimmer, in dem sie sich befand, wer da gewesen war, die Mutter, die auf sie losging, ihr Gesicht, ganz nah, die Farben im Mund, die Großmutter, die ihr zu Hilfe kam, die Erwachsenen, die auf dem tatami erst saßen und dann standen, wie ein seit dem Morgen gewachsener Wald.
Sie vergaß alles. Alles außer dem dringlichen Verlangen, die Worte für das Gelb zu finden, so wie es war. Und das zusammen mit einer neuen, nachdrücklichen Vorsicht: der Entscheidung, niemals wieder jemanden in ihre Suche einzuweihen.
In der Werkstatt der Familie zeigte sich ihr der praktische Teil der Angelegenheit, als riefe die Poesie die Prosa zur Ordnung.
In der Normalität ihres Alltags tauchte Mio oft in den Arbeitsräumen auf und brachte Vater und Großvater ein Tablett mit Teetassen. Vorsichtig durchquerte sie mit ihrer kleinen Stimme das Lager, randvoll mit Materialien; und während sich der Vater mit fleckigen Fingern den Schweiß abwischte, blätterte sie wie in Bilderbüchern in den schweren Bänden mit den traditionellen Mustern, auf washi-Papier gedruckt. Manchmal hörte sie ihrem Vater zu, der von der (sogleich wieder unterdrückten) Versuchung sprach, neue Muster zu entwickeln. Großvater Mamoru hingegen schwieg, beschränkte sich darauf, den Tee in kleinen Schlucken zu schlürfen: Mit zunehmendem Alter schien ihm jeden Tag ein Wort mehr abhandenzukommen.
Das Mädchen machte sich mit den Pigmenten vertraut, so wie es in der Textilverarbeitung üblich ist, lernte die besonderen Bezeichnungen für die Kräuter. Noch bevor sie ihren eigenen Namen schreiben konnte, kannte sie den genauen Siedepunkt für die azuki-Bohnen, die Hände runzlig vom kalten Winterwind, wusste um den Indigo, den die allerersten fremden Besucher des Landes Japan Blue getauft hatten.
»Du musst den gesamten Prozess kennen, jeden Schritt darin, um den Wert des Endergebnisses schätzen zu können«, sagte der Vater zu ihr. »Das ist so, wie wenn man sich einen Weg merkt, um ihn auch im Dunkeln zu finden.«
Yōsuke Yoshida liebte es, in Bildern zu sprechen, aber es schwirrte einem auch tatsächlich der Kopf, wenn man bedachte, durch wie viele Hände ein Hochzeitskimono ging, bis er fertig war. Das, was am Ende sorgfältig in Seidenpapier und Stoff gewickelt wurde, bereit, getragen zu werden, war das Ergebnis einer unglaublichen Reise kreuz und quer durch Japan.
Beim Betreten des Ateliers spürte Mio deutlich den Zugang zu einer anderen Welt.
Um sich an den Ort zu begeben, an dem sich die Reise des shiromuku auf ihr Ziel zubewegte, musste sie nur den Hof durchqueren, einen Treppenabsatz hinter sich bringen, mehrere Türen beiseiteschieben, prüfen, ob sie makellos sauber war, den zigsten shōji durchschreiten und leise »sumimasen« flüstern und dabei den Kopf so neigen, wie ihre Großmutter es ihr beigebracht hatte.
Diesen Ort liebte das kleine Mädchen vor allem wegen seiner Unschuld, seiner Anmut, die vor allem moralischer Art war. Er strahlte Reichtum aus, und in diesem Reichtum schien die Illusion enthalten, mit einem Hochzeitskimono könne man auch das Glück mit nach Hause nehmen.
Das Atelier war in der ganzen Gegend bekannt und geschätzt, und die meisten Mädchen aus der Nachbarschaft hatten früher oder später die beiden Holztüren durchquert, um sich den kundigen Händen der Yoshida-Frauen anzuvertrauen. Von Generation zu Generation bewahrten sie den gleichen munteren Wortschatz, zeigten Effizienz beim Anprobieren und Beraten und sprachen dabei ebenso von praktischen Dingen, wie sie die zukünftigen Bräute von der Poesie der Ehe überzeugten.
Unendlich viele Male hatte Mio die Geschichte des shiromuku gehört, hatte vernommen, wie die kostbarsten Stoffe ebenso zu seiner Entstehung beitrugen wie das Talent der allerbesten Handwerker des Landes. Es war eine Erzählung, die die jungen Frauen faszinierte, wenn sie das Atelier verließen, im Kopf ein Kaleidoskop aus Kranichen mit ausgebreiteten Schwingen, aus Schildkröten, aus Nebel und Symbolen wie dem goshoguruma, dem von Ochsen gezogenen Wagen. Während sie einen obi banden oder mit Stoff die sinnliche Kurve eines weiblichen Schlüsselbeins betonten, versäumten die Yoshida-Frauen es nie, auch Ratschläge für den Hochzeitstag zu geben: zum Beispiel, wie eine Braut zu gehen habe, damit ihr die Perücke nicht vom Kopf rutschte, mit leicht nach innen gedrehten Füßen und einem Blick, der nicht mehr und nicht weniger als drei Meter weit reichte. Und sie zeigten ihr den genauen Punkt, an dem man das Gewand mit Zeige- und Mittelfinger der rechten Hand zu halten hat, damit es auf dem Weg zum Tempel nicht über die Steine schleifte.
Doch mehr noch als diese Themen bezauberte Mio die große Bandbreite von Weißtönen des Stoffes, von denen ein jeder einen eigenen Namen hatte: Die Palette reichte von Elfenbein (zōge-iro象牙色) zum gebrochenen Weiß (kinari-iro生成色), von Muschelweiß (gofun-iro胡粉色) zu Deutzienweiß (unohana-iro卯の花色). Und es erstaunte sie jedes Mal, wie man einen wunderschönen Kimono verderben konnte, wenn er von einer Frau mit einem bestimmten Teint getragen wurde, ebenso, wie ein Stoff es selbstverständlich schaffen kann, die Unvollkommenheit eines Körpers zu kaschieren.
Fasziniert betrachtete sie die von Nadeln zerstochenen Finger, die Stickereien, die Monate dauerten, verfolgte die Anprobe, für die man Stunden veranschlagen musste. Ja, genau, dachte Mio, Schönheit hat für jeden einen Preis. Ihrer Mutter und Großmutter hatte sie die Augen verdorben, ihrem Vater und Großvater die Haut an den Fingern. Nein, mit der Schönheit hatte man es nicht leicht.
Das Atelier durfte sie nur unter der Bedingung betreten, dass niemand sie bemerkte. »Wenn du schauen willst, darfst du nicht gesehen werden, und wenn du zuhören willst, darf niemand wissen, dass du da bist.« Die Kimonos zu berühren war ihr kategorisch verboten, ebenso wie sie sich weder der Kundschaft nähern, noch das Wort an sie richten durfte.
Mucksmäuschenstill, den Rücken an die Wand gedrückt, um sich unsichtbar zu machen, schaute sie sich die zukünftigen Bräute an und musterte ihre Gesichter. Alle wirkten sie wunderschön, und doch verstand Mio nicht, was diese Frauen empfanden. Hatten sie Angst oder waren sie glücklich? Und wenn sie sich freuten, warum war da in ihren Augen dieser Wunsch zu fliehen? Konnte es denn sein, dass im Glück auch all diese Angst enthalten war?
»Aber das ist ganz normal, Mio«, sagte eines Tages die Großmutter. »Sie kommen, um sich einen shiromuku auszusuchen, aber ein wenig bereiten sie sich auch auf den Tod vor.«
»Den Tod?«, erwiderte sie verwirrt.
»Du weißt, was das Weiß in unserer Geschichte bedeutet, oder? Weiß ist die reinste Farbe von allen, die heilige Farbe par excellence. Doch seit der Antike ist sie mehr der Trauer verbunden als dem Leben. Weiß war immer die Farbe des Endes, während Rot die des Anfangs war.«
Mio war noch nie bei einem Begräbnis gewesen. Nur einmal hatte sie eines Morgens eine schwarz gekleidete Menschenmenge gesehen, die langsam und dicht gedrängt die Straße entlangging. Man hatte ihr erklärt, es sei ein Mann gestorben, der alte Abe-san von der wagashi-Konditorei.
»Früher war ein Bekleidungsstück für eine Beerdigung nicht schwarz, sondern weiß«, erklärte ihr damals geduldig Großmutter Yōko. »So weiß wie ein Brautkimono.«
Das Mädchen war verblüfft.
»Denk doch nur, in beiden Fällen bleibt die Vergangenheit stehen, sei es, dass man vom Leben in den Tod übergeht, sei es, dass man nicht mehr ledig, sondern verheiratet ist. Man verlässt das Haus des Vaters und hört auf, Teil jener Familie zu sein. Das heißt, man stirbt als Tochter und wird als Ehefrau in einem neuen Zuhause geboren.«
»Und das Rot?«, fragte Mio.
Das Rot kam traditionsgemäß direkt nach der Zeremonie am Schrein, wenn die Braut den shiromuku auszieht, sich umkleidet und in einem Kimono aus Karmesinrot und Gold beim Hochzeitsmahl die Gäste empfängt. Es war in genau dieser Welle aus Blut, in der sich ihre neue Existenz zeigte.
Sich ins Weiß stürzen, im Rot untergehen: An jenem Nachmittag ihres sechsten Lebensjahres fragte sich Mio – oder besser, sie ahnte es, ohne dass der Gedanke Form annahm –, ob es wirklich die Mühe wert war, für einen Mann zu sterben.
Mio grauste es vor den Händen ihres Vaters.
An das leuchtende Weiß der shiromuku gewöhnt, an die unabdingbare Pflicht, selbst die kleinste Verunreinigung abzuwaschen, bevor man auch nur die Nase ins Atelier steckte, riefen seine gedrungenen, mit Farbe beschmierten Finger weniger Liebe hervor, als dass sie eine Drohung darstellten.
Dennoch hatten sie eine außergewöhnliche Macht: Sie konnten Dinge reparieren.
Oft klingelten irgendwelche unbekannten Nachbarn an der Tür, denen man von Yoshida-sans Fähigkeit, einen Ofen oder eine Waschmaschine, ein Transistorradio oder einen Bilderrahmen in Stand zu setzen, erzählt hatte: »Man hat uns gesagt, das könnten Sie hervorragend«, behaupteten sie dann nach der kurzen Begrüßungsformel. Gewiss, sie boten auch an, ihn dafür zu bezahlen, doch da er sagte: »Nein, das ist nicht nötig, für mich ist das keine Arbeit«, trafen am Ende des Jahres allerlei kleine Geschenke ein: mochi-Küchlein, ein Kasten Bier, Säcke mit Kartoffeln oder Tomaten. Das Haus füllte sich mit Blumen.
Indessen, zu anderen Tageszeiten, stellten sich auch die Kinder des Viertels ein und baten ihn, Spielzeug zu richten, das ihre Eltern als kaputt abgetan hatten.
Yōsuke Yoshida ließ sich die Teile bringen, sagte knapp: »Ist gut« oder »Komm morgen wieder«, und wenn dann am Abend alle schliefen, breitete er auf dem Küchentisch ein reiches Sortiment an Schraubenziehern, Feilen, Rohrzangen, Zahnstochern und anderen, höchst eigenwillig geformten Werkzeugen aus. Am nächsten Tag dann, wenn die Kinder, die oft vergaßen, ihm zu danken – so groß war ihre Freude, ihre Schätze wiederzuhaben, die sie doch für immer verloren geglaubt hatten –, wieder weg waren, lächelte der Mann auf seine ganz eigene, verschmitzte Weise, die er sich nur gestattete, wenn ihn niemand ansah.
Seine Tochter entdeckte das erst mit der Zeit. Zum allerersten Mal sollte es eines Morgens sein, als sie in ihrem Zimmer war und sich anzog – einen rosa-orangefarbenen Kimono anlässlich ihres achten Geburtstages – und dieses Lächeln im Flur wahrnahm. Beim zweiten Mal würde Mio es wiedersehen, während sie auf dem Nachhauseweg von der Schule die Straße überquerte und Yōsuke, an der Tür stehend, lachend sah, während ein kleiner Junge denselben Plastikdrachen, der noch am Abend vorher ohne eine einzige Schwinge auf dem Küchentisch gelegen hatte, steigen ließ.
Hätte man sie gebeten, ihre Eltern zu malen – eine Aufgabe, die bei Kindern oft sehr viel über die hierarchischen Strukturen in einer Familie aussagt – hätte Mio ihre Mutter als gewaltigen Ginkgobaum gezeichnet, der im Garten wuchs, und ihren Vater als ein winziges, spontan gesprossenes Blümchen.
Sie hätte ihn sich entschlossener gewünscht, mehr auf ihrer Seite. Während der stürmischen Diskussionen zwischen Mio und ihrer Mutter begriff man zwar, dass der Mann mit seiner Tochter übereinstimmte, doch Yōsuke schien immer darauf zu verzichten, seine eigene Meinung einzubringen. Er blieb stumm, offenbar überzeugt davon, ganz gleich, was er sagen würde, könnte er die Dinge sowieso nicht ändern. Hätten sie ihm doch nur in die Augen geblickt! Mio wunderte es, dass niemand im Haus in diese glänzenden Augen schaute, die die Farbe von Baumrinde hatten und auf beinahe kindliche Weise erzählten, was ihm durch den Kopf ging. Mios Frustration, wenn die Mutter sie angriff, war riesig. Warum sagte er nie etwas zu ihrer Verteidigung?
Doch dann zog der Vater auf einmal einen winzigen Kreisel aus der Tasche, und Mio war, statt die konzentrischen, bunten Kreise auf dem Spielzeug zu betrachten, wie hypnotisiert vom Antlitz ihres Vaters. Die Schönheit all dieser praktischen Spielsachen, die alle zusammen verwenden konnten, ohne ein Wort zu sagen, machte jedes Ungemach wieder wett. So wie Großvater Mamoru schien auch ihr Vater den Worten nur wenig Bedeutung beizumessen. Er verwendete sie, doch nur sparsam, als vertraute er ihnen nicht.
An jenem Abend, als das Atelier geschlossen und das Abendessen verspeist war, ließ sich Mio lange in der Wanne einweichen. Zusammen mit Mutter und Großmutter im großen ofuro liegend, lauschte sie ihrem Geplauder, bis das Wasser wieder kalt wurde.
Als Mio noch sehr klein gewesen war, hatte sie gewöhnlich mit dem Vater und Großvater gebadet. Man zog sich im Vorzimmer aus, und dann striegelten sich die Männer mit aller Kraft in dem kleinen Raum, der mit himmelblauen Emaillefliesen ausgelegt war, um die Farben aus den Haaren und den Nägeln zu entfernen. Dann goss sich der Vater einen randvollen Eimer Wasser über dem Kopf aus und ließ sich lachend in die Wanne hinab. Von unten gesehen sah der ofuro in Mios Augen wie ein dampfender Kochtopf aus, in dem eine riesige Suppe siedete.
Mio sah, wie Papa Yōsuke und Großvater Mamoru sich an den Rand der Wanne lehnten, die Augen schlossen, das Handtuch auf den Kopf gelegt. Ihr komprimiertes Schweigen schien ihr ein Mysterium zu sein, als streckten die beiden Männer mühevoll die Finger nach ihrer eigenen Mitte aus: Dort im Wasser befreiten sie sich nicht nur vom Schmutz, sondern vom ganzen Tag. Von allen Tagen der Welt. Im heißen Wasser wurden Vater und Großvater in Mios Augen zu Göttern ohne Erinnerung.
Im Gegensatz zu den Männern plauderten die Frauen im ofuro viel. Und sie ließen den Tag nicht hinter sich, sondern formten ihn mit ihren Händen neu.
So entdeckte sie, dass das Leben ihrer Familienmitglieder, obwohl sie zusammenlebten, doch nur zu einem Teil übereinstimmte.
Mal schienen sie alle vereint zu sein, doch dann gab es Momente, wenn einer von ihnen ein Zimmer verließ und sich einer anderen Arbeit zuwandte, in denen einer Pause machte, um ins Bad oder an die Tür zu gehen. Kaneko trennte sich von der Mutter, um Küchenarbeit zu machen, der Großvater nahm sich die Zeit, mit den Helfern ein paar senbei und ein Bier zu sich zu nehmen, der Vater rauchte eine Zigarette.
Und vor allem war da noch das andere Leben, ganz intim und geheim, das in jedem Mitglied der Familie präsent war. Jenes Leben, das dazu führte, dass Mios Großmutter und Mutter oft einen Satz begannen mit: »Als ich heute eine Zwiebel schnitt, ging mir durch den Kopf, dass …« »Während ich den Stoff ausbreitete, habe ich mir überlegt …« »Gerade hatte ich die Stickerei auf Yoshiko-sans Gewand beendet, als ich mich daran erinnerte …«
Dort in der heißen Wanne entspannte sich das Antlitz der Frauen, und Mio konnte die Verwandlung miterleben. Ganz langsam erweiterten sich die Poren, und das Mädchen ahnte, dass das Baden im Lauf der Jahre auch ihre eigene Leidenschaft sein würde.
Von jenem Moment an und bis ans Ende ihrer Tage, an dem auch sie verbrennen würde – eingehüllt in Kimonos, die mit dem Blut ihrer Geburt befleckt waren –, würde Mio immer nach den geheimen Farben der Menschen suchen.
Nach der ganz eigenen und exakten Nuance, die ihn oder sie ausmachte.
Vielleicht war es der unbeschreibliche Gesichtsausdruck des Mädchens, während die Grillen des Sommers laut zirpten. Oder womöglich lag es einfach daran, dass Mio wuchs und der Fluss der Jahre sie mitzog. Jedenfalls wurde sie an jenem Tag auf einen Schlag erwachsen.
Überzeugt davon, ihre Tochter sei bereits im Atelier, stand Großmutter Yōko reglos am Küchentisch, die Hände auf dem Gesicht. Sie weinte um eine Freundin, die gestorben war. Indessen hielt sich Kaneko, ihrerseits sicher, dass die Mutter bereits im Laden sei, noch im Bad auf, wie so oft von Migräne geplagt.
Die Kundin, die sich im Laden gut auskannte, war in die Stille des Ateliers eingetreten. Selbstsicher war sie zu dem mit einem Vorhang abgetrennten Raum gegangen, der als Umkleidekabine fungierte, und hatte sich in der Erwartung, dass gleich jemand kommen würde, ausgezogen. Die Bräute, die sich hier einen shiromoku anfertigen ließen, kamen immer mehrmals, um die Details, das Material, den Schnitt zu überprüfen.
Als Mio eintrat, bemerkte sie als Erstes, dass der Ventilator eingeschaltet war. Der Luftstrom richtete sich auf den Vorhang, bauschte ihn auf und bedeckte und enthüllte abwechselnd den halbnackten Körper einer jungen Frau. Das beeindruckte sie so sehr, dass sie sich nicht einmal fragte, wo ihre Mutter und die Großmutter waren.
Es war das erste Mal, dass Mio eine derart gezeichnete Haut sah: Sie sah aus wie ein Blatt Papier, auf dem jemand lange und sorgfältig gemalt hatte, und wo danach mit einem spitzen Bleistift kreuz und quer alles durchgestrichen wurde.
Verblüfft betrachtete das kleine Mädchen das Muster der Narben und der Bilder, die erstaunlichen Farben.
Ihr Blick war so intensiv, dass ihr ein leiser Schrei entfuhr: Erschrocken drehte sich die Braut um. Dann sah sie, wie klein der Eindringling war, und beruhigte sich wieder.
»Komm her«, sagte sie zu Mio und winkte sie heran. »Komm ruhig näher.«
Mio hob verwirrt die Augenbrauen.
»Hast du denn noch nie eine Tätowierung gesehen?« Die Frau hatte bemerkt, wie begierig das kleine Mädchen ihre Haut betrachtet hatte, und ging auf Mio zu, damit sie sie berühren konnte. »Möchtest du mal anfassen?«, flüsterte sie und hielt ihr die Hand hin.
Da streckte Mio ihre kleine Hand aus, und die Frau ergriff sie. Eine Bewegung, die ganz schnell und natürlich war.
Die Braut führte die Fingerspitzen des Mädchens über ihre nackte Seite, wo eine Flut aus Pfingstrosen der knochigen Linie des Brustkorbs folgte. Dann schloss sie die kleine Hand zu einer Faust und ließ nur den Zeigefinger übrig, damit er allein über die Rippen einer Schlange fahren konnte, die sich um den linken Schenkel wand; sie fuhr den Körper des Tieres entlang, das sich bis zum Fußknöchel schlang. Zusammen wanderten sie zum rechten Fuß und folgten in Gegenrichtung den Kirschblüten, die an einem knotigen Zweig wuchsen und sich quer über den Bauch erstreckten.
Obwohl sie Mio bereits alt erschien, konnte die Unbekannte nicht älter sein als zwanzig.
Sie ging vor dem Mädchen in die Knie und drehte sich um, entblößte ihren Rücken. »Und das hier ist das kostbarste Tattoo«, sagte sie. »Das Wappen meiner Familie.«
Auf der linken Seite des Rückens entfaltete sich eine gewaltige Zeichnung in verschiedenen Schwarztönen. In der Mitte standen sich zwei nach innen geneigte Eichenblätter kriegerisch gegenüber.
»Aber … entfernen kann man sie nicht, oder?«, fragte Mio erstaunt. Ihre Finger bewegten sich selbstständig über die Haut der Braut.
»Wenn ich es will, vielleicht, eines Tages.«
Über ihre Narben sagte sie hingegen nichts, und sie ließ die Finger der Kleinen auch höchstens zufällig darübergleiten.
Damals ahnte Mio noch nicht, dass erst viele Jahre später etwas anderes sie ähnlich schwer beeindrucken würde, und zwar eine Fotografie von Andy Warhol. In einer französischen Zeitschrift, die ihr in die Hände fiel, zeigte der Künstler die Narben an seiner Brust, die die Kugeln aus der Pistole von Valerie Solanas hinterlassen hatten, das Einschussloch und die Nähte, die ihn gerettet und in die Welt zurückgeholt hatten. Liebe und Wut – würde Mio dann denken – hinterlassen ihre Spuren.
Jenen Sommernachmittag ihres siebten Lebensjahres würde Mio niemals vergessen. Nicht nur, weil jene Tätowierungen sie so sehr erstaunten, sondern weil ihr zum ersten Mal der Gedanke gekommen war, dass Farbe nicht nur auf den Dingen existieren konnte, sondern auch unter der Haut. Was sie jedoch am allermeisten beeindruckte, das war ein Schatten, den sie auf dem Körper der Frau wahrnahm.
Es handelte sich um einen unbestimmten Farbton zwischen dem Lila einer Aubergine, dem Schwarz von Lakritz und von Lauge. Eine nie zuvor gesehene Farbe, zwischen dem unteren Rücken und dem Gesäß.
Für Mio war es eine Offenbarung: Dann hatte also jedes Körperteil verschiedene Farbnuancen! Es existierte ein Punkt, der wahrer war als andere und dazu in der Lage, vom Intimsten eines Mannes oder einer Frau zu erzählen.
Es war genau in diesem Moment, als sie den Finger ausstreckte, um jenen Schatten zu berühren, als sie Schritte hörte, die sich eilig näherten.
Dann stand Kaneko atemlos da. »Bitte verzeihen Sie mir, die Kleine belästigt Sie«, sagte sie und zog ihre Tochter von der Braut weg.
Mio wich mit einer Verbeugung zurück. »Sumimasen, gomennasai, mōshiwakearimasen deshita.«