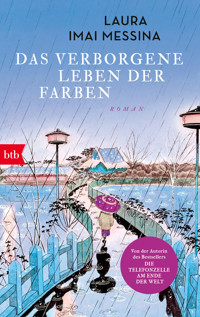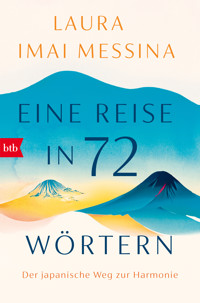
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Reise zur wahren Seele des Landes der aufgehenden Sonne: 72 philosophische, spirituelle, etymologische, persönliche Versuche die Faszination Japan in Worte zu fassen.
Die Lehren, die aus Japan kommen, sind auch im Westen aktueller denn je. Aber was genau macht den japanischen Geist aus?
72 Begriffe gibt es im Japanischen, um die Jahreszeiten zu beschreiben und das Jahr in Abschnitte zu gliedern, die alle fünf Tage die Gelegenheit zur Erneuerung und inneren Reflexion bieten.
So heißt etwa Harmonie auf Japanisch wa, aber wie alle japanischen Wörter beinhaltet es viel mehr: In Harmonie mit den Dingen zu sein, das bedeutet in Japan Schönheit, Freude und Gemeinsinn in den Mittelpunkt des Lebens zu stellen, durch kontinuierliche Arbeit an sich selbst, durch das Erlernen von Geduld, durch überlegtes Handeln und gelebtes Miteinander.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 486
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Die Lehren, die aus Japan kommen, sind auch im Westen aktueller denn je. Aber was genau macht den japanischen Geist aus?
72 Begriffe gibt es im Japanischen, um die Jahreszeiten zu beschreiben und das Jahr in Abschnitte zu gliedern, die alle fünf Tage die Gelegenheit zur Erneuerung und inneren Reflexion bieten.
So heißt etwa Harmonie auf Japanisch wa, aber wie alle japanischen Wörter beinhaltet es viel mehr: In Harmonie mit den Dingen zu sein, das bedeutet in Japan Schönheit, Freude und Gemeinsinn in den Mittelpunkt des Lebens zu stellen, durch kontinuierliche Arbeit an sich selbst, durch das Erlernen von Geduld, durch überlegtes Handeln und gelebtes Miteinander.
Laura Imai Messina nimmt uns mit auf eine Reise zur wahren Seele des Landes der aufgehenden Sonne: 72 philosophische, spirituelle, etymologische, persönliche Versuche, die Faszination Japans in Worte zu fassen.
Laura Imai Messina wurde in Rom geboren. Mit dreiundzwanzig Jahren zog sie nach Japan. Ihr Studium an der University of Foreign Studies schloss sie mit dem Doktortitel ab, mittlerweile arbeitet sie als Dozentin an verschiedenen Universitäten. Laura Imai Messina lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern in Tokio. Ihr Roman »Die Telefonzelle am Ende der Welt« war ein internationaler Bestseller und wurde in 25 Länder verkauft. Messinas Romane zählen zu den meistübersetzten italienischen Büchern weltweit.
Laura Imai Messina
Eine Reise in 72Wörtern
Der japanische Weg zur Harmonie
Aus dem Italienischenvon Stefanie Römer und Judith Schwaab
Die italienische Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel »WA. la via giapponese all’armonia: 72 parole per capire che la felicità più vera è quella condivisa« bei Antonio Vallardi editore, Mailand.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Verlag und Übersetzerinnen danken Klaus-Dieter Wirth für seine Übertragung von vier Haiku ins Deutsche.
Die Übersetzung dieses Buchs erfolgte mit finanzieller Unterstützung des italienischen Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten und Internationale Zusammenarbeit.
Questo libro è stato tradotto grazie a un contributo per la traduzione assegnato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano.
Copyright © der Originalausgabe 2018, 2019 by Antonio Vallardi Editore, Milano
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2024
btb Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
Umschlaggestaltung: semper smile, München
Umschlagmotiv: ©Shutterstock/Nastya Vaulina, digital_mimik
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
sl · Herstellung: han
ISBN 978-3-641-26472-7V001
www.facebook.com/penguinbuecher
Für Yōko und Yōsuke Imai,meinen persönlichen Leitfaden für wa
Inhalt
Vorbemerkung
Wa和 oder: Japan und die Harmonie
Frühling 4. Februar bis 4. Mai
1 人hito oder: Vom gegenseitigen Haltgeben
2個人主義kojinshugi oder: Vom »Ich«, das inmitten des »Wir« wächst
3ょっとchotto oder: Von der Klarheit des Nichtgesagten
4外・内soto/uchi oder: Vom Außen und vom Innen
5楽しみtanoshimi oder: Vom Warten auf die Freude
6忙しいisogashii oder: Vom Tod des Herzens
7神kami oder: Vom Heiligen, das überall ist
8懐かしいnatsukashii oder: Von der Sehnsucht nach dem niemals Erlebten
9ころkokoro oder: Vom Herz-Geist
10色iro oder: Von der Farbe und der Vielfalt der Welt
11限定gentei oder: Von der Begrenzung, die die Welt größer macht
12生き甲斐ikigai oder: Von der Antriebskraft des Lebens
13間ma Von dem Dazwischen oder dem Nichts, das notwendig ist für das Ganze
14 いただきますitadakimasu oder: Von der Dankbarkeit
15愛ai oder: Von der Liebe, die flüstert
16すっきりsukkiri oder: Von der Befreiung vom Überflüssigen
17様子を見ましょうyōsu wo mimashō oder: Vom Schauen-wir-mal-was-Passiert
Sommer5. Mai bis 6. August
1 めんなさいgomennasai oder: Von der Bitte um Verzeihung
2言わぬが花iwanu ga hana »Nichts zu sagen, ist eine Blume«
3 ~ますように~masuyōni oder: Von der Praxis des Wünschens
4有難迷惑arigatameiwaku oder: Von der Nächstenliebe, die Egoismus ist
5 前・本音tatemae/honne oder: Vom äußeren Schein, der die Substanz beschützt
6褒めるhomeru oder: Vom Loben
7金継ぎkintsugi oder: Von der Kunst, Verletzungen mit Gold zu füllen
8頑張るgambaru oder: Wenn man alles gibt
9楽しかったね~tanoshikattane oder: Inwiefern das Glück eine Frage ist
10粋iki oder: Von der Beredsamkeit des Kleinen
11仕様がないshiyōganai oder: Von dem Moment, in dem man loslassen sollte
12幸せshiawase oder: Wie man Glück auf Japanisch dekliniert
13気分転換kibun tenkan oder: Von der Veränderung des Gefühls
14 こだわりkodawari oder: Von dem Detail, das von uns erzählt
15 道草michikusa oder: Wie man sich findet, indem man sich verläuft
16休むyasumu oder: Vom Sichausruhen
17有終の美yūshu no bi oder: Von der Schönheit des Endes
Herbst 7. August bis 6. November
1断捨離danshari oder: Von der Schönheit der Leere
2 節度setsudo oder: Von der Mäßigung
3型kata oder: Die Form der Dinge
4付喪神tsukumogami oder: Der den Dingen innewohnende Geist
5もったいないmottainai oder: Von der verschwendeten Zeit
6もののあはれmono no aware oder: Von der Vergänglichkeit der Schönheit
7信shin oder: Vom Vertrauen
8失敗shippai oder: Von der Bedeutung des Scheiterns
9思いやりomoiyari oder: Vom Gedanken an den Nächsten
10かわいいkawaii oder: Vom Wunder der Kindheit
11節setsu oder: Die Bambusknoten
12忍耐nintai oder: Von der Geduld
13縁en oder: Von der Bedeutung der Bindungen
14空気を読むkūki wo yomu oder: Vom Lesen der Luft
15一日一生ichinichi isshō, »Ein Tag, ein ganzes Leben«
16気丈kijō oder: Von der Gefasstheit und Erhabenheit des Schmerzes
17序破急johakyū oder: Die ausgewogene Abfolge der Dinge
Winter 7. November bis 3. Februar
1美bi oder: Von den tausend Übersetzungen von Schönheit
2甘えamae oder: Von dem vollständigen Vertrauen in die Liebe
3ゆっくりyukkuri oder: Davon, sich zur Langsamkeit zu zwingen
4気持ちkimochi oder: Vom Gefühl
5ポジティブpojitibu oder: Davon, sich immer das Beste vorzustellen
6音oto oder: Die Stimme der Dinge
7侘び寂びwabi-sabi oder: Von der Schönheit, zu altern und nicht perfekt zu sein
8ありがとう・すみませんarigatō/sumimasen oder: Vom »Danke«, das sich entschuldigt
9謙虚kenkyo oder: Von der Bescheidenheit
10作法sahō oder: Von der japanischen Etikette
11元気genki oder: Davon, sich niemals selbst zu bemitleiden
12おもてなしomotenashi oder: Vom freundlichen Empfang
13道michi oder: Vom Weg
14挨拶aisatsu oder: Vom Grüßen
15我慢gaman oder: Von der Duldsamkeit
16無視するmushi suru oder: Vom Wert des Ignorierens
17優しさyasashisa oder: Vom Mut zur Freundlichkeit
Schlussgedanken
Dank
Glossar
Bibliografie
Stichwortverzeichnis
Vorbemerkung
Für die Transkription japanischer Begriffe wurde das sogenannte Hepburn-System verwendet, laut dem die meisten Vokale wie im Deutschen ausgesprochen werden und die Konsonanten wie im Englischen. Außerdem gilt:
ch wie tsch in Peitsche
g wie im Deutschen; auch ng
h stimmhaft, wie im Deutschen
j stimmhaft, wie dsch in »Dschungel«
s stimmlos, wie in »Masse« oder »Maße«
sh wie ein weiches, deutsches ch
u wie ein u mit nicht gerundeten Lippen; klingt oft auch wie ein ü
w wie das w im Englischen, aber ohne Rundung der Lippen
y wie das deutsche j in »Jacke«
z stimmhaftes s wie in »sagen« oder »Sonne«.
Der Strich über einigen Vokalen, das sogenannte Makron, kennzeichnet einen langen Vokal.
Die fett gedruckten Bezeichnungen im Text verweisen auf eines der 72 Kapitel. Diese sind am Ende des Buches zur Erleichterung alphabetisch und mit Seitenzahlen versehen aufgelistet.
Für Begriffe aus dem Japanischen, die nicht direkt im Text erklärt werden und sich dem deutschen Publikum möglicherweise nicht erschließen, sei auf das Glossar verwiesen.
In Japan wird bei Personenbezeichnungen üblicherweise zuerst der Nachname, dann der Vorname genannt. Die im Text erwähnten Namen japanischer Persönlichkeiten oder Autor*innen folgen jedoch dem im Westen üblichen Schema – also zuerst Vor-, dann Nachname.
Vor allem vier historische Epochen werden im Buch mehrfach erwähnt, die aus pragmatischen Gründen auf unsere Zeitrechnung übertragen und wie folgt benannt werden: die Heian-Zeit (794 – 1185), die Muromachi-Zeit (1333 – 1568), die Edo-Zeit (1603 – 1867) und die Meiji-Zeit (1868 – 1912).
Wa和 oder: Japan und die Harmonie
Das japanische Volk sei der größte Schatz Japans, schrieb der französische Anthropologe Claude Lévi-Strauss, der zeit seines Lebens ein großer Freund Nippons war und mit dieser Behauptung den Kern der Bedeutung von wa und des entsprechenden Kanji 和 getroffen hat.
Im Gegensatz zu dem, was Menschen aus anderen Ländern (ebenso wie viele Japaner*innen) glauben, steht wa weder für den Kimono noch für Sushi, es repräsentiert weder die traditionelle Bauweise japanischer Häuser noch die bunte Vielfalt japanischer Anime und Manga. Wa – das sind weder die Schreine inmitten einer üppigen, als heilig verehrten Natur, noch sind es die acht Millionen Gottheiten oder die sinnlich-anmutigen Bewegungen der Geishas von Kanazawa oder Pontochō. Wa steht auch nicht für den Matcha-Tee oder das Schnattern der jungen kostümierten Mädchen, die das Harajuku-Viertel der japanischen Hauptstadt bevölkern. Unter wa versteht man weder das Fest zu Ehren der Vorfahren, das im Frühjahr gefeiert wird, noch die geflochtenen Tatami-Matten oder das Ikebana, die Kunst des Blumensteckens, und auch nicht die sprichwörtlich wortkarge und nüchterne Art der Japaner*innen oder das zarte Bimmeln eines Tempelglöckchens in einer leichten Sommerbrise.
Aber was genau steckt dann dahinter? Was ist denn nun typisch japanisch? Und wie erreicht man jene Harmonie, die in der Kultur dieses Landes eine so vorrangige Rolle spielt und sowohl die Ausdrucksweise als auch das Verhalten seiner Bevölkerung bestimmt? Was macht die japanische Gesellschaft so friedfertig und ordnungsliebend? Und was verbirgt sich hinter dem Ideogramm für wa和?
Was bedeutet wa?
Wa ist ein schönes und geheimnisvolles Wort, und wie immer, wenn man sich über ein unbekanntes Wort Klarheit verschaffen will, ohne allzu sehr zu vereinfachen, ist es am besten, ein Wörterbuch der betreffenden Sprache zurate zu ziehen.
In dem einsprachigen Wörterbuch Kōjien stößt man unter dem Eintrag wa auf eine ganze Bandbreite von Bedeutungen. So verweist das Wort auf Japan und alles, was mit Japan zu tun hat (日本のこと); auf Dinge, die im japanischen Stil oder in Japan selbst produziert wurden (日本風、日本製などの意味); auf alles, was ruhig, gelassen, sanft, lieblich, herzlich, heiter ist (穏やか、なごやかなこと). Wa steht für Einigung und ein Leben in perfekter Harmonie (仲よくすること), für das, was sich gut vermischt und vereint, für den harmonischen Einklang zwischen den Dingen, für Annäherung und Anpassung (合わせること), für die Summe und das Ganze (二つ以上の数字を合わせた値).
Das Kanji wa和 steht also im Japanischen sowohl für Harmonie als auch für alles, was eng mit der Kultur Nippons verbunden ist; es evoziert dessen milden, heiteren und gemäßigten Charakter, steht für die Gemessenheit des Tons, für den friedfertigen und ruhigen Einklang der Elemente, für die Gelassenheit und Anmut von Menschen und Dingen. Es ist Bestandteil der Worte für »Frieden« (heiwa平和 und wahei和平) und eines so zentralen Begriffs wie chōwa調和, »Harmonie und Eintracht«, der als Verb (chowa suru調和する) für das Bemühen steht, sich zu vermischen, ohne die jeweiligen Teile zu verfälschen.
Was das gesellschaftliche Miteinander angeht, so wird man in Japan zu einem genau festgelegten Benehmen angehalten und ermuntert: Man soll unerfreulichen Dingen aus dem Wege gehen, es vermeiden, laut zu werden, ruhig bleiben und versuchen, anderen Menschen stets mit gutem Beispiel voranzugehen. Auch soll man nicht der Versuchung nachgeben, seinen Gefühlen freien Lauf zu lassen, nur weil man hofft, sich damit von seiner Wut oder anderen negativen Emotionen zu befreien; vor allem jedoch sollte man nicht um jeden Preis die Konfrontation suchen, denn dieser Preis kann sehr hoch sein. Unter dem Strich, so denkt man in Japan, stelle das Ausleben von Gefühlen keine wirkliche Abhilfe dar; bestenfalls ließen sich die Wunden der Seele auf diese Weise lindern, niemals jedoch heilen.
Das Kanji wa和 ist einer ganzen Reihe von Wörtern vorangestellt und verleiht ihnen die Bedeutung »kulturell japanisch«, »aus japanischer Herstellung«, »nach japanischer Tradition« oder auch »im japanischen Stil«: so etwa in den zusammengesetzten Wörtern washi和紙 für Japanpapier, washoku和食 für die traditionell japanische Küche, wafuku和服 für japanische Kleidung, washiki和式, dem japanischen Stil, oder auch wayaku和訳, womit eine Übersetzung ins Japanische gemeint ist.
Der alte Name für Japan lautet Yamato大和. In seine Ideogramme zerlegt, bedeutet dieser heute »großes wa« und somit »große Harmonie«. In früheren Zeiten hingegen bezeichneten Japaner*innen ihr Land, vermutlich wegen der zahlreichen Gebirge, als »Durchgang zwischen den Bergen«. In dieser einmalig schönen Landschaft mit ihren verschneiten Gipfeln, ihrer üppigen Vegetation, den mit blühenden Kirschbäumen bestandenen, sanft geschwungenen Hügeln und diesem ganz besonderen, ins Blaue changierenden Grün haben sich Japaner*innen schon immer wiedererkannt.
In der seit jeher landwirtschaftlich geprägten Kultur Nippons spielte bereits in der Antike die Harmonie der Gruppe, deren Zusammenspiel bei der Durchsetzung gemeinsamer Ziele, eine weitaus wichtigere Rolle als die Verwirklichung persönlicher Interessen.
Entscheidend hierfür ist das besondere Verständnis von wa im Sinne eines »Vermischens«. Gemeint ist damit nicht etwa die Auflösung eines Elements in einem oder vielen anderen, sondern vielmehr das friedliche und von Respekt geprägte Zusammenleben der Teile und die harmonisch-ausgewogene Nutzung ein und desselben Raumes. Oder wie es Claude Lévi-Strauss formulierte: »Im Abendland folgen Lebensstile und Produktionsweisen einander. Man könnte meinen, dass sie in Japan koexistieren.« Diese Konzeption hat weitreichende Implikationen. So ist es hierfür zum Beispiel keineswegs erforderlich, dass alle an dieselbe Wahrheit glauben, dass alles harmonisch aufeinander abgestimmt werden muss (oder umgekehrt nichts in auffallender Weise herausragen darf). Vielmehr ist es durchaus möglich, vordergründig Unvereinbares miteinander zu versöhnen. Sehr deutlich zeigt sich das an dem religiösen Synkretismus: Shintoismus und Buddhismus koexistieren nicht nur nebeneinander, sondern wirken auf demselben Gebiet oft sogar zusammen (kami). Darüber hinaus steht wa für das unbedingte Vermeiden von Auseinandersetzungen. Daraus ergeben sich diverse Verhaltensmuster, wie etwa die Geduld (nintai), das prophylaktische Um-Verzeihung-Bitten, obwohl man sich eigentlich keiner Schuld bewusst ist (gomennasai), das Ignorieren des Negativen (mushi suru), das stetige Sich-vor-Augen-Führen der Gefühle des anderen (omoiyari) oder auch die Bereitschaft, sich zu opfern (gaman).
Jedes dieser Verhaltensmuster ist in ein Netzwerk aus Gesten und Worten gebettet, tief verwurzelte Entsprechungen, die das Gerüst japanischen Denkens bilden. Unmöglich, einen Aspekt auszuklammern, ohne das gesamte Konstrukt aus dem Gleichgewicht zu bringen.
Das Unvollständige und Unvollkommene zur Geltung kommen lassen
Daisetz T. Suzuki (1870 – 1966), eine herausragende Autorität auf dem Gebiet des Zen-Buddhismus, spricht von vier Elementen, die »unabdingbar« für die Kunst und »Grundvoraussetzungen eines brüderlichen und geordneten Zusammenlebens« seien: erstens die »Harmonie« (wa), zweitens »Verehrung« (kei), drittens »Reinheit« (sei) und schließlich »Stille« (jaku); und er erinnert an die Bedeutung der Beziehung zwischen Geist und Form. »Durch das Transzendieren aller Form die höchste Wirklichkeit zu erfassen, darum geht es letztlich im Zen; aber das Zen erinnert uns auch daran, dass die Welt, in der wir leben, eine Welt bestimmter Formen ist und die höchste Wirklichkeit nur durch die Form zum Ausdruck kommen kann.«
In jedem Bereich und auf allen gesellschaftlichen Ebenen ist erkennbar, welch hohen Stellenwert Japaner*innen wa seit jeher beimessen, und dass dieser Stellenwert zumindest teilweise auf der Morphologie ihres Heimatlandes beruht. So werden gewisse Eigenheiten und Verhaltensweisen tatsächlich oft mit dem Ausdruck shimaguni da kara島国だから, zu Deutsch: »weil wir auf einer Insel leben« oder »weil wir eine Insel sind«, gerechtfertigt.
Zudem ist dieser Inselstaat wegen seines großen Anteils an Gebirgsland nur in begrenztem Maße bewohnbar. Diese räumliche Einschränkung dürfte das Bemühen um ein friedfertiges Zusammenleben noch verstärkt haben und tut dies selbst heute, in Zeiten, in denen Transport- und Kommunikationsmittel die Entfernungen haben schwinden lassen. In Ermangelung unmittelbarer Ausweichmöglichkeiten und Fluchtwege war es klüger, sich nicht in kriegerische Auseinandersetzungen verwickeln zu lassen, was nur möglich war, wenn man eine gewisse Zurückhaltung übte. Deshalb unterwarf man sich einer inneren Zensur, vermied es, deutlich seine Meinung zu vertreten, hielt die eigenen Gefühle unter Kontrolle und definierte in weiser Voraussicht genaue gesellschaftliche Konventionen, wobei besonderes Augenmerk auf die Trennung zwischen dem »Privaten«, dem »Eigenen« (uchi) und dem »Öffentlichen«, dem »anderen« (soto) gelegt wurde.
Wer sich wirklich auf Japan einlassen möchte, sollte sich Zeit nehmen, gar nicht erst versuchen, alles sofort zu begreifen, und sich stattdessen darum bemühen, gerade in den Bereichen, in denen keine Eile geboten ist, eine solide und tief reichende Bindung herzustellen. Wichtig ist, nicht alles, was anders ist, sofort deuten oder entschlüsseln zu wollen, sondern sich stattdessen darauf zu beschränken, zunächst einmal die »Maske« zu betrachten und erst dann langsam – und ohne jeglichen Zwang – den Vorhang zurückzuziehen (honne/tatemae).
In jedem Fall liegt der Reiz Japans – und das wird immer so sein – in seiner Zweideutigkeit, in der Fähigkeit, dem, was man nicht sieht, einen gleichen, wenn nicht gar höheren Wert beizumessen als dem, was für alle auf der Hand liegt. »Wenn das griechische Altertum uns denken und das Christentum uns glauben lehrte, so lehrt das Zen uns, die Logik zu überspringen und keinen Augenblick zu zögern, auch nicht vor dem, ›was unsichtbar ist‹«, schreibt Daisetz T. Suzuki in Zen und die Kultur Japans.
Es gibt viele Formen des Schönen, und ebenso vielfältig sind im Japanischen die Definitionen von Schönheit (bi). Eine dieser Definitionen unterstreicht die Bedeutung des Unvollkommenen, des Kreises, der offen bleibt, des Zeichens, das Platz frei lässt, um Raum für das Wort oder für ein anderes Zeichen zu schaffen: »Schönheit geht nicht zwingend von einer vollkommenen Form aus.«
Wa bedeutet also, das Unvollständige, das Asymmetrische, das Unvollendete zu akzeptieren, ja ihm sogar den Vorzug zu geben, vor allem jedoch der Leere, die der Ursprung von allem ist.
Aufnehmen, auswählen, verändern
Über das Wesen von wa nachzudenken, führt zu tiefschürfenden Überlegungen. Was genau ist wa? Und wie ist es entstanden?
Zu den Besonderheiten der japanischen Kultur gehört es, Feste und Feiertage zu übernehmen, die eigentlich weder traditionell noch geografisch in dieser Kultur verankert sind (Valentinstag, Weihnachten, Halloween usw.), um damit zu zeigen, dass man im Land der aufgehenden Sonne keine Berührungsängste hat. Ausländer sind die strengsten Richter, wenn es darum geht, zu bestimmen, was authentisch japanisch ist, und oft hört man sie klagen, dass so viele fremdsprachige Begriffe Einzug ins katakana halten und sich immer mehr amerikanische oder europäische Sitten durchsetzen würden. Doch Japan lehrt uns, dass für alles Platz ist und das Herausragende einer Kultur darin liegt, sich der Schönheit von außen nicht zu verschließen, sondern sich daran zu erfreuen. Es gilt, das Leben zu feiern, es reicher und interessanter zu machen und zum Beispiel kulinarisch zu erweitern, indem man neue Gerichte übernimmt und variiert, sich ohne schlechtes Gewissen dem Genuss ungewohnter Speisen hingibt und sich ein fremdes Fest zu eigen macht, bei dem man mit anderen zusammenkommen oder Geschäfte und Häuser schöner dekorieren kann.
Es ist nicht immer leicht, anderen die gebührende Anerkennung zu zollen, befürchtet man dabei doch oft, selbst herabgesetzt zu werden und auf einmal als jemand dazustehen, dem es an Originalität mangelt – eine Eigenschaft, die im westlichen Denken als vorrangig gilt, im östlichen hingegen für illusorisch gehalten wird. Denn hier gilt einzig und allein die Natur als original, als der Rohstoff, den der Mensch vorfindet und den er notgedrungen zu bearbeiten hat. Das Herausragende an Japan liegt genau hierin – in der Fähigkeit, aufrichtig zuzugeben, dass man in einem anderen seinen Meister gefunden hat (was sich auch darin äußert, dass den meisten Japaner*innen im Alltag ein Lob – homeru – leicht über die Lippen geht). Die Überlegenheit anderer anzuerkennen, hat es den Japaner*innen ermöglicht, sich genau diese zu eigen zu machen und vom Besten, was ihnen im Lauf der Jahrhunderte begegnet ist, zu profitieren.
Der zeitgenössische Haiku-Dichter und feinsinnige Kenner der japanischen Kultur Kai Hasegawa betont, dass genau das, was in der Geschichte Japans vermeintlich als Schmach oder Nachteil hätte gelten können, im Grunde dessen Stärke war: Ursprünglich war das Land »leer«, ohne eigenes Schriftsystem und ohne charakteristische Stärken, die es uneinnehmbar und gegen jeglichen Einfluss von außen resistent gemacht hätten.
Der japanische Nationalismus, der dem Bild des Landes so sehr geschadet hat, dieses sinnlose Sichverschanzen hinter all dem, von dem man glaubte, es sei japanisch im ureigensten Sinne und mache das Land zu etwas ganz Besonderem, ist – wie jeder Nationalismus, ganz gleich, in welchem Land der Welt er sich manifestiert – nicht so sehr Zeichen von Macht und Übermacht, sondern Symptom einer tief verwurzelten Unsicherheit. Derselben Unsicherheit, die, wenngleich mit der Zeit etwas abgemildert, bis heute für jeden, der das Land der aufgehenden Sonne aus der Nähe kennt, deutlich spürbar bleibt.
Die vermeintliche Überlegenheit, auf der manche beharren, greift auf eine vergiftete Rhetorik der Kriegszeit zurück, als eine rechtsgerichtete Regierung zunächst im Krieg gegen China (in den japanisch-chinesischen Grenzkonflikten) und dann gegen Amerika (Zweiter Weltkrieg) eine Diskussion um den Anspruch auf Einzigartigkeit vom Zaun brach.
Und doch muss man nur auf die Geschichte der kulturellen Kontakte Japans mit der restlichen Welt zurückblicken, auf jene fast unterschiedslose Aufnahmebereitschaft, die das Land in den verschiedenen historischen Phasen geprägt hat (und deren Spuren sich etwa in den schmerzlich wehmütigen Worten einer ganzen Generation von Schriftstellern der Meiji-Zeit und der darauffolgenden Epoche wiederfinden), um sich bewusst zu machen, dass es sich dabei weder um kulturelle Überheblichkeit noch um Arroganz handelt, sondern um das genaue Gegenteil.
Jene verzerrte Sicht hat ihren Ursprung in der Unterscheidung zwischen Yamato-gogoro大和心, dem »Herzen von Yamato«, und Yamato-damashii大和魂, dem »Geist von Yamato«. Während sich hinter dem ersten Begriff die authentische Seele Japans verbirgt, die offen und neugierig in die Welt blickt, handelt es sich bei dem zweiten um ein in Kriegszeiten entwickeltes Konzept, in dessen Namen ganze Generationen von Japaner*innen niedergemäht wurden. In dem Versuch, dem Schrecken kriegerischer Konflikte einen Sinn abzuringen, ließen sich jene Menschen den Traum vom Opfertod für das verfälschte Ideal eines Heimatlandes von tiefem Wert und Schönheit vorgaukeln.
Kommen wir wieder auf unsere Frage zurück: Was genau ist dieses wa? Wofür steht es, was stellt es dar?
Wa ist ein veränderliches Konzept, ein System der Aneignung, der Harmonisierung, der Auswahl und der Anpassung. Kai Hasegawa spricht in seinem Buch Wa no shisō von drei geordnet aufeinanderfolgenden Phasen, welche die beständige Aufnahme des Fremden und anderen regeln: Zuerst kommt juyō受容, die »Annahme, Akzeptanz, Aufnahme«, dann folgt sentaku選択, also die »Wahl oder Auswahl«, und schließlich henyō変容, die »Transformation, Veränderung, Verwandlung, Metamorphose«.
Der Versuch, a priori zu bestimmen, was wa genau ist, verflacht nicht nur die japanische Kultur und reduziert sie auf rein äußerliche Manifestationen, sondern schwächt Japan selbst, das Gefahr läuft, sich hinter der Materialität vergänglicher Güter zu verschanzen, seien diese auch noch so reichlich vorhanden, und sich zum Sklaven eines Blickes von außen zu machen, der das Land nach einem ganz anderen Werteschema beurteilt (ohne es eigentlich zu kennen).
Und genau das ist der Grund, warum wa keinesfalls mit den materiellen Dingen Japans gleichzusetzen ist: Wa ist vielmehr die Fähigkeit, das andere, Verschiedene anzunehmen, es einzubinden und Harmonie zu schaffen. Etwas, das das Spezifische überwindet und damit zu einem Prinzip wird, das überall anwendbar ist, zu jeder Zeit und in jedem Kontext.
Der »Preis« für wa
Japans Anziehungskraft besteht in einer gewissen Konzeption von Schlichtheit, in der Höflichkeit und Aufrichtigkeit, die jeden Fremden beeindrucken, der das Land der aufgehenden Sonne bereist oder davon erzählt bekommt; Japan fasziniert durch ein gesellschaftliches Lebensmodell, in dem Millionen von Bewohnern in sauberen und sicheren Städten wohnen können, in dem anscheinend alles funktioniert und der Respekt für die Umwelt und die Achtsamkeit gegenüber dem Nächsten nach wie vor weitverbreitet sind.
Ohne es genauer benennen zu können, spürt die Welt wa und nimmt in Japan die Harmonie wahr, von der sie sich – dank allem, was man über das Land liest, dank der Reisen, die unternommen werden, um Land und Leute zu erkunden, dank des Studiums der Sprache oder der Erfahrungen mit Japans Kunst, seiner Philosophie oder seinen Kampfsportarten – nur allzu gern anstecken lassen würde.
Die Harmonie wird in Japan wie ein Fest gefeiert, das weder einer Dekoration noch besonderer Speisen bedarf: Sie ist wie ein luftiger, lichterfüllter Raum, in dem jeder Mensch willkommen ist und so gut wie möglich behandelt wird, wo alles geregelt und doch wandelbar ist und wo man nicht zuletzt zum Schutz dieses Menschen bereit ist, kleine oder auch größere Opfer zu bringen, die freilich stets gesellschaftlich belohnt werden.
Eine gewisse Rigidität ist folglich unverzichtbar, doch sowohl die individuelle als auch die kollektive Erfahrung lehren uns, dass absolute Freiheit niemals glücklich macht, so, wie die Verweigerung von Normen unweigerlich dazu führt, dass unser Leben ins Chaos stürzt und wir nur mehr nach der eigenen Befriedigung trachten.
Wenn man diese intensiven Anstrengungen, diese Mühen außer Acht lässt, begreift man auch nicht, wie das alles funktionieren kann. Dass die Städte sauber und rein sind, liegt zum Beispiel keineswegs daran, dass es keinen Schmutz gibt, sondern ist der Tatsache geschuldet, dass auf einen, der Dreck macht, neun kommen, die ihn wegputzen (sei es tatsächlich die Straßenreinigung, sei es eine Privatperson, die Verunreinigungen vor ihrem Haus einfach wegräumt, seien es Grüppchen von Freiwilligen, die sich regelmäßig am Sonntagmorgen mit großen Müllsäcken und langen Greifzangen treffen, oder einfach Passanten, die eine Dose oder Flasche vom Boden aufheben und ein paar Meter zum nächsten Mülleimer tragen).
Wie es der Philosoph Tatsuru Uchida in seinem Buch Nihon henkyōron treffend erklärt hat, geht der japanische Nationalstolz mit einem intensiven Minderwertigkeitsgefühl einher, und in der japanischen Kultur gibt es Elemente, die einer Art Randständigkeit geschuldet sind, jenem Unterschied, der zwischen Grenzländern und Ländern, die in der Mitte liegen, entstehen kann und durch den Japaner*innen sozusagen den Eindruck haben, ihre eigene Kultur sei immer anderswo. Das ist auch der Grund, warum im Land der aufgehenden Sonne so viele Bücher über die Eigenschaften der Japaner*innen erscheinen, von denen wohlgemerkt ein guter Teil extrem selbstkritisch ist. Man vergisst offenbar sofort, wie viel man eben doch von außen in sich aufgenommen hat, vielleicht weil man sich selbst von vorneherein fremd ist, und genau in diesem Vergessen liegt auch die unerschöpfliche Frage nach der eigenen Kultur begründet, die sich Japaner*innen gerne stellen – eine Frage, auf die es niemals eine endgültige Antwort geben kann.
Die japanische Kultur habe weder einen Ursprung noch irgendwo ein Vorbild, heißt es bei Masao Maruyama (1914 – 1996), vielmehr existiere sie einzig und allein in der Gestalt der immer wieder aufs Neue gestellten Frage, was die japanische Kultur sei. Als herausragender Politiker, Denker und Autor mehrerer Schlüsseltexte zur Definition des Nationalgedankens beschreibt Maruyama Japan als ein Land, das draußen nach neuen Dingen sucht, sich dabei aber immer wieder umblickt. Dabei verwendet er den Ausdruck kyoro-kyoroきょろきょろ, der genau das bedeutet, nämlich »den Blick ständig voller Neugier auf etwas oder jemanden richten«, wobei sich dieses Verhalten sowohl auf den Einzelnen als auch auf die Gruppe beziehen kann. In diesem Zusammenhang greift Maruyama auf einen Begriff aus der Welt der Musik zurück, den italienischen basso ostinato, ein immer wiederkehrendes musikalisches Element, das auf Wiederholung und einer Melodie basiert, die niemals im Mittelpunkt, sondern nur begleitend am Rande steht. Genauso verhält es sich mit Japan: Es unterliegt einer durchgängigen Entwicklung, die nicht in der eigenen Veränderung als solcher besteht, sondern in der Tatsache, dass ebendieser Wandel keinerlei Anstalten macht, unterbrochen zu werden. Sodass man sagen könnte, das Unveränderliche bestehe eben genau darin, dass es einer regelmäßigen Veränderung unterworfen sei.
Die 72 Jahreszeiten Japans
Vier Jahreszeiten gibt es auf der Welt. Wie die vier Viertel eines Apfels gliedern sie ein Jahr, und in manchen Gegenden reduzieren sie sich auch auf zwei, eine Regen- und eine Trockenzeit.
Der Frühlingsanfang fällt in Japan auf den 4. Februar, der des Sommers auf den 5. Mai, der Herbst wird am 7. August eingeläutet, und der Winter beginnt am 7. November.
Der alte japanische Kalender (kyūreki旧暦) sagt jedoch etwas anderes, und zwar, dass die vier Jahreszeiten in 24 sogenannte Perioden gegliedert sind, die sich jeweils noch in drei Teile aufteilen, sodass am Ende 72 verschiedene Zeiten entstehen. Was im Grunde bedeutet, dass alle fünf Tage eine neue »Jahreszeit« beginnt.
So lange die Entstehung dieses alten Kalenders auch zurückliegen mag – er erweist sich als genau und richtig. Man muss nur das Haus verlassen und wird feststellen, dass in der »Jahreszeit« vom 10. bis zum 14. Mai, deren Name mimizu izuru蚯蚓出ずる, also »Die Regenwürmer lugen aus der Erde« lautet, tatsächlich jede Menge Regenwürmer zu sehen sind. Alle Jahreszeiten haben Namen voller Poesie: So kommen zum Beispiel Glühwürmchen darin vor, wie in der Jahreszeit vom 10. bis zum 15. Juni, oder die Wärme des Windes (7. bis 11. Juli), das Zwitschern der gelben Bachstelze (12. bis 16. September), das Zirpen der Zikaden (12. bis 16. August) oder die Pfirsichblüte (10. bis 14. März).
Wenn alle fünf Tage eine neue Jahreszeit beginnt, führt dies zu einer gewaltigen Abfolge von Anfängen.
Der Wecker klingelt, man schlägt die Augen auf und sieht sich einer funkelnagelneuen Jahreszeit gegenüber. Eine Jahreszeit hört auf, eine andere löst sie ab. Das Negative wird fortgespült, und die Hoffnung kommt auf, dass von morgen an alles anders wird.
Erst wenn man die Zeit auf diese uralte Art erlebt, beginnt man, die Schönheit in ihrer Mannigfaltigkeit wahrzunehmen, was besonders wertvoll ist in unserer heutigen Zeit, in der wir dazu neigen, diese Mannigfaltigkeit auf witterungsbedingte oder pragmatische Aspekte zu beschränken. (Was soll ich anziehen? Muss ich einen Schirm mitnehmen? Ist es kalt? Können wir am Wochenende ans Meer fahren?)
Einen Ort auf der Welt zu kennen, der ganz besonders ist, verleiht uns die Kraft, mit dem Banalen umzugehen, mit dem rauen Grundton, der sich an manch trübem oder trägem Tag einschleicht, oder mit der Angst – die in unterschiedlichem Maße in uns allen vorhanden ist –, einen Neuanfang noch nicht klar erkennen zu können. Aber was soll’s – es gibt ja 72 Jahreszeiten und deshalb 72 Anfänge. Und jeder dieser Jahreszeiten wohnen die Wunder der Welt inne, in jeder verbirgt sich eine kleine mögliche Freude, kostbar und ganz für dich allein: »Ich stützte mich auf die Schönheit der Welt / Und hielt den Geruch der Jahreszeiten in meinen Händen«, schreibt Annie Ernaux in Die Jahre.
Auch wenn nicht jeder die Namen der 72 kurzen Jahresabschnitte im Kopf hat, so sind doch die 24 größeren Abschnitte ebenso in den Sonnenkalendern, die seit 1873 im Gebrauch sind, wie in allen handelsüblichen Taschenkalendern zu finden.
Dies alles lädt dazu ein, das Wetter wertzuschätzen, so gut oder schlecht es auch sein mag, und die Natur in der Umgebung zu erkunden, ob es nun bei einem Spaziergang durch den Stadtpark in der Nähe der eigenen Wohnung ist oder auf einem Feld vor den Toren des Dörfchens, in dem wir unsere Sommerferien verbringen. Wir werden angeregt, den alten Kalender der japanischen Kultur neu zu entdecken und uns auf die Schönheit der Welt einzulassen.
Die Unterteilung dieses Buches in 72 Kapitel – mit den vier »großen« Jahreszeiten, die den 17 »kleinen« jeweils vorangestellt sind – hat genau hier ihren Ursprung.
Sagen können, denken können
Der uruguayische Dichter und Schriftsteller Mario Benedetti schrieb: »Ihnen, den Gefühlen, haben wir es zu verdanken, dass wir lernen, uns von anderen zu unterscheiden und wir selbst zu sein. Die Gefühle geben uns einen Namen, und mit diesem Namen sind wir die, die wir sind.« Sagen können, zum Ausdruck bringen können, überhaupt etwas zu können – das macht uns stärker.
Den eigenen Wortschatz zu erweitern, dient dazu, sich anderen Menschen besser verständlich zu machen und auch uns selbst einen Namen zu geben. Wir verstehen uns besser, es gelingt uns, herauszufinden, was wir uns wirklich wünschen, und genau darin liegt der Ursprung von Glück: Es gilt, zu begreifen, wonach man sucht, dieses Etwas in Beziehung zum Wohlergehen anderer zu setzen und durch ein System des wechselseitigen Verweisens von sich selbst auf andere und umgekehrt zu einer Art selbstregenerativen Freude zu gelangen: Man setzt sich ein Ziel, auf das man seine Lebenskraft richtet (ikigai).
In der japanischen Sprache, so stellt sich heraus, gibt es oft Begriffe, die unübersetzbar sind, vielleicht wegen der Neigung der Japaner*innen zur Stille und der daraus resultierenden Selbstreflexion und wegen der Demut, die nötig ist, um sich andere Sprachen und Kulturen anzueignen, sie sich zu eigen zu machen, was im Grunde ja die Quintessenz von wa ist.
Es gibt sehr viele solcher Begriffe, und ein jeder bringt ein Füllhorn von Bedeutungen mit sich. Tatsächlich scheint in Japan bis heute die Lehre des Dichters und Samurai Musashi Miyamoto (1584 – 1645) zu gelten, dass man nämlich »ausgehend von dem tiefen Wissen um eine einzige Sache zehntausend Dinge wissen kann«. Zusammenfassend sollte es also wenig und gut sein statt viel und schlecht. Was eigentlich auf der Hand liegt, denn wie es der polnische Schriftsteller Jerzy Lec in Sämtliche unfrisierte Gedanken formuliert, ist es »viel leichter, aus drei Worten hundert zu machen als aus zehn fünf«.
In einem anderen Aphorismus sagt Lec, es gebe »Gedanken, die nur einer einzigen Sprache angehören«, woraus sich vielleicht auch der Reiz ergibt, eine fremde Sprache zu erlernen. Wenn ein Wörterbuch statt mit einem äquivalenten Begriff mit einer Erklärung aufwartet, die sich mehrerer Wörter bedient, überschreitet man bereits die Grenze hin zum Unübersetzbaren, einem faszinierenden und unwegsamen Gebiet, das es in jeder Sprache gibt. Wo kulturelle Besonderheit ins Spiel kommt, scheint das Wort so lange und widerstandsfähige Wurzeln zu bilden, dass es unmöglich ist, es an einen anderen Ort zu verpflanzen.
Zum Beispiel ist dies der Fall bei chotto, bei tanoshimi, bei sukkiri und bei itadakimasu – allesamt Ausdrücke, für die es im Italienischen oder Deutschen zwar eine Entsprechung gibt, die aber, damit nicht ein Teil ihrer eigentlichen Bedeutung verloren geht, einer genaueren Umschreibung bedürfen. So gibt es unter den hier ausgewählten Stichwörtern solche, die sich leicht in ein Alltagsvokabular übernehmen lassen, während andere Fremdkörper bleiben, weil ihnen der nötige soziokulturelle Zusammenhang fehlt.
Und doch sind es genau diese Zwischenräume, die wie Felsspalten zwischen den Sprachen liegen und oft als unüberwindliche Kluft abgetan werden, in denen sich das Wunderbare offenbart.
Es handelt sich um eine Art dritte Sprache, die man sich ganz allmählich aneignet; wie ein Paar Schuhe, das uns auf einem langen Weg begleitet, müssen wir auch unsere Sprache einlaufen, damit sie uns weit bringen kann. Vor allem jedoch muss sie in der Lage sein, uns genau dorthin zu bringen, wo wir eigentlich hinwollten.
Die Blätter des Sagens und die Sprache nach Maß
In Worte fassen – das ist »ein Blatt sprechen lassen«, einen Baum, der wächst, der Zweige entwickelt, der knospt, der hier eine Blüte, dort eine Frucht oder ein anderes Blatt hervorbringt. Ein Bild, poetisch heraufbeschworen durch die beiden Ideogramme von kotoba言葉, »Wort«, wobei das erste Schriftzeichen »sagen« bedeutet, während das zweite für leise und zarte Dinge steht, für Blütenblätter oder Laub. Das Bild eines Busches, der kraftvoll in die Höhe wächst und ein üppiges, saftiges Blattwerk entwickelt, ist eine wundervolle Metapher für die Sprache, ein Sinnbild dafür, wie viel ein jedes Wort – ob im Singular oder im Plural – darstellen sollte. Denn das Japanische unterscheidet bei Substantiven zwar nicht zwischen Ein- oder Mehrzahl, besitzt aber eine überraschende lexikalische Vielfalt.
Das stellt man insbesondere fest, wenn es um die detaillierte Beschreibung von Natur geht: sakura-fubuki桜吹雪 ist zum Beispiel der »(Schnee-)Sturm der sakura« und beschreibt den magischen Moment, in dem die Kirschblüten federleicht, aber dicht wie Schneeflocken zu fallen beginnen, während sakura-ame桜雨 der Regen der Blütenblätter ist, ein Gestöber wie eine Liebkosung. Bleiben wir bei den Niederschlägen und dem Wort ame雨, »Regen«, so steht harusame春雨 für einen leichten Frühlingsregen, während es sich bei shigure時雨 um die heftigen Niederschläge am Ende des Herbstes und zu Winterbeginn handelt; ryokū緑雨 wiederum bezeichnet den Regen zum Sommeranfang, wenn das Grün der Natur besonders saftig ist. Es gibt unzählige andere Wörter, darunter auch solche, die wundervoll malerisch sind, wie zum Beispiel nekonke-ame猫毛雨, das die Kanji für »Katze«, »Fell« und »Regen« in sich vereint und einen hauchfeinen Regen beschreibt, weich und leicht wie Katzenfell; oder yarazu-no-ame遣らずの雨, ein Ausdruck, der das Ideogramm für »schicken, auf den Weg bringen« in der verneinten Form enthält, womit der Regen gemeint ist, der scheinbar absichtlich fällt, damit ein Gast noch nicht gehen kann.
Der japanische Wortschatz ist reich an Bezeichnungen für den Wind, den Regen, den Schnee, es gibt jede Menge Wörter für Berge, den Mond, die Sterne, ein reicher Fundus an Ausdrücken, der auf poetische Weise vor Augen führt, wie unendlich viele Nuancen und Schattierungen es in dem gibt, was wir so lapidar »Natur« nennen.
Erst recht gilt dies für die japanische Schrift, für die Ideogramme, die das Wunder noch vertiefen, indem sie Geschichten erzählen, Bilder erzeugen. Viele Schriftzeichen sind selbst Haiku, kleine poetische Kompositionen, die auf winzigstem Raum all das heraufbeschwören können, was über das reine Wort hinausgeht.
Die Kanji: Mikrogeschichten aus wenigen Strichen
In Kürze zusammengefasst – und durch eine ausführliche Bibliografie untermauert –, kann man sagen, dass die japanische Sprache im Klang entstanden ist und Bestand hat, in der Mündlichkeit, die bis zum ersten Kontakt mit der chinesischen Schrift reichte, durch die sie dann in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts nach Christus materielle Gestalt annahm. Seitdem wurden Strategien zur Transformation der Sprache entwickelt, mit denen sich diese zwar herausragende Elemente der fremden Gesellschaft aneignete, dabei jedoch den Geist der Heimat und der ursprünglichen Kultur beibehielt.
Die japanische Schrift, die einerseits das in wa enthaltene Prinzip des Aufnehmens, Auswählens und Anpassens bekräftigt, lehrt uns andererseits, dass eben die schönsten Dinge oft auch die kompliziertesten sind.
Für denjenigen, der die Sprache lernt, sind die Kanji der am wenigsten greifbare Teil, den man sich niemals ganz aneignen kann. Um sie sich einzuprägen, genügt es nicht, sie anzuschauen. Wer sie mit der ganzen gebührenden Sorgfalt erlernen will, muss die Kanji verinnerlichen wie Melodien, die man so oft auf dem Klavier gespielt hat, dass schon die allererste Note – und nicht mehr das gesamte Notenbild – genügt, damit die Finger wie schlafwandlerisch über die Tasten wandern. Das ist vor allem ein Automatismus, es ist Gewohnheit, die die Hand führt. Es sind Klinken, die Türen öffnen: Man muss sie nur berühren.
»Man nennt dich einen Meister der Kunst, wenn Körper und Gliedmaßen die Technik so zum Ausdruck bringen, als geschähe es unabhängig von deinem Bewusstsein«, zitiert Daisetz T. Suzuki frei aus dem Traktat über das Schwert des Samurai Munenori Yagyū (bekannt als Yagyū Tajima no kami Munenori, 1571 – 1646). Genauso verhält es sich auch mit dem Erlernen von Kanji: Es bedarf jenes gewissen Grades des bewussten Loslassens, einer Haltung, zu der es ebenso gehört, sich zu füllen, wie sich anschließend wieder zu leeren.
Kanji sind Zeichnungen, Collagen von Elementen aus der Welt der Pflanzen, der Mineralien und der Tiere, aus einer Zeit, in der Menschen und Götter entschlossen die Anordnung der Dinge bestimmten, ihre Natur definierten, sie zu Zeichen erhoben und schließlich eine Schrift entwickelten. So kommt es, dass der Schnee yuki雪 eine Hand ist, die den Regen wegwischt, den Regen ame雨, der sich auch in der Wolke kumo雲 wiederfindet, im Dunst kasumi霞, im Nebel kiri霧, im Zittern 震. Der Abend, yoru夜, trägt den Mond unter seinem Dach, und kita北, der (kalte) Norden, hat die Form zweier Männer, die einander den Rücken zukehren.
Die Erklärung ihres Ursprungs ist oft kontrovers und scheint nach wie vor großen Interpretationsspielraum zu lassen, sodass man diese Zeichen immer wieder neu betrachten, neu erfinden kann.
Auch heute noch vermögen die Kanji den Kern der Dinge und die ursprüngliche Bedeutung der Wörter zu erklären. Sie erzählen vom kokoro, dem Herz-Geist der Japaner und von ihrer üppigen Kultur. Aus diesem Grunde habe ich mich in den 72 Kapiteln oft zunächst einmal bei den Wörtern selbst aufgehalten, habe zu Lupe und Pinzette gegriffen und begonnen, diese Wunderwerke auseinanderzunehmen, zu betrachten und zu bestaunen. Eine Operation, die – obwohl Kanji ja lebendige Materie sind – sehr leicht durchführbar ist, ohne dass bei dieser Zergliederung das Leben aus ihnen weicht.
In einer Zeit wie der unseren, in der es nicht mehr nötig ist, eine Feder zur Hand zu nehmen, um etwas zu schreiben, muss man zu diesem Zweck genau das tun – die Hand benutzen. Man zeichnet Striche – in einer Anordnung, die streng vorgegeben ist –, betrachtet die Teile und rekonstruiert daraus den Sinn. Wie bei dem Schwein unter einem Dach 家, das im Japanischen bis heute »Haus« bedeutet.
Unabdingbare Voraussetzung für das Verständnis: nicht vergleichen
Bei der Erklärung von Begriffen wird man immer wieder auf Reibungspunkte zwischen der japanischen Denk- und Handlungsweise und ihrem westlichen Pendant stoßen. Obwohl die Gegenüberstellung Japans und des Westens weit verbreitet ist, bleibt diese doch nur ein Instrument, um auf möglichst einfache Weise genau diejenigen Begriffe zu erklären, die, wenn man sie aus ihrem theoretischen Kontext herauslöst, Gefahr laufen, an Konkretheit zu verlieren.
Die allererste Lektion – wenn wir denn von Lektionen sprechen wollen –, die man aus dem japanischen Denken ziehen kann, ist die, dass man nicht versuchen sollte, den anderen zu belehren: Dem Geist Japans, Yamato-gokoro, gemäß, besteht die beste Methode, die Welt willkommen zu heißen und sie zu genießen, darin, der Versuchung des Vergleichs zu widerstehen. Eine reine Gegenüberstellung von Begriffen macht den Diskurs eher ärmer, als ihn zu bereichern, denn sie führt unweigerlich dazu, eine der beiden Seiten herabzusetzen. »Ach, wie toll die Japaner das machen! Wir in Europa hingegen …« »Was für eine wundervolle Tradition, die in Japan! Im Westen hingegen, oje …«
Deshalb ist es wichtig, nicht in Wettstreit zu treten und einerseits zu vermeiden, die eigene Kultur der japanischen gegenüberzustellen (welche nach einer allzu geschönten Lesart irrtümlicherweise oft in die Nähe von Perfektion gerückt wird), und andererseits nicht ins Gegenteil zu verfallen, indem man gegen scheinbar irrige und wenig schlüssige Verhaltensweisen wettert, weil man den Fehler begeht, sie in einem Kontext außerhalb Japans zu sehen. Beides sind Fallen, in die man leicht tappen kann.
Es stimmt, dass die Lebensqualität in Japan sehr hoch ist, dass der Gemeinsinn an erster Stelle steht, dass die Sicherheit, Aufrichtigkeit und Harmonie, die man allerorten spürt, einen besonders festen Bund geschlossen haben, doch es stimmt auch, dass man, um einen solchen Zustand der Ruhe zu erreichen, vor allem weniger an sich selbst und mehr an andere denken muss: Es hilft, wenn man zumindest teilweise die individuelle Lebensfreude im Namen eines gemeinschaftlichen Glücks opfert, eines Glücks, an dem nicht nur Freunde und Familie teilhaben, sondern auch vollkommen Fremde, mit denen man weder einen Blick noch Worte gewechselt hat.
Vor allem muss man sich von der eher beschränkten Gegenüberstellung von Öffentlichem und Privatem lösen, die der Philosoph Raymond Geuss in seinem Buch Privatheit. Eine Genealogie als ebenso unbegründete wie schädliche »philosophische Erfindung« bezeichnet; nicht in dem Sinn, dass Privateigentum abgeschafft werden solle, sondern dass eine zu klare Grenzziehung zwischen dem Ich und den anderen, zwischen dem, was mir gehört, und dem, was nicht, das Risiko in sich berge, den Grad von Empathie in einer Gesellschaft zu verringern. Außerdem stehe die Überheblichkeit, die aus dem Besitz entstehe (das ist mein Haus, hier rede ich etc.), nur auf tönernen Füßen. Ebenso gilt im japanischen Denken, beeinflusst vom buddhistischen Konzept des mujō無常, der Unbeständigkeit und Vergänglichkeit, dass man Glück nur erlangen kann, wenn man von der Materialität der Welt Abstand nimmt, von den Leidenschaften, die unser Herz zerrütten und uns flattern lassen wie Wetterfahnen im Wind. Nur wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf unseren tatsächlichen Einflussbereich richten, wenn wir darauf verzichten, weltliche Güter im Überfluss zu besitzen, sinnlosen Reichtum anzuhäufen oder eine Karriere voranzutreiben, die doch, wie alles, irgendwann enden wird, nähern wir uns unseren wirklichen Bedürfnissen und können unbeschwert und heiter durchs Leben gehen.
Wie man dieses Buch lesen sollte
Ein Teil der Texte in diesem Buch stammt aus meinem viele Jahre lang geführten Blog Giappone Mon Amour, der den nach und nach gereiften Erkenntnissen und Erfahrungen gewidmet war, die ich während meiner intensiven und äußerst kostbaren Zeit in Japan gesammelt habe. Das gesamte Material, das aus dem Blog stammt, wurde überarbeitet, zum Teil auch umgeschrieben, auf den neuesten Stand gebracht und dann eingefügt.
Jedes der 72 Stichworte und viele andere, die in die einzelnen Kapitel einbezogen wurden, haben zum Ziel, einen Aspekt japanischen Denkens zu beleuchten, möchten dem Lesepublikum jedoch auch Anstöße geben, wie es das eigene Wohlbefinden steigern kann. Die Auswahl der Begriffe stellt eine Mischung dar; bei manchen geht es um eher populäre Phänomene aus dem zeitgenössischen Japan oder der gesprochenen Sprache, andere sind literaturwissenschaftlich orientiert. Auch die Reihenfolge ist bewusst willkürlich. Innerhalb der vier großen Überkapitel, die den vier eigentlichen Jahreszeiten entsprechen (auch diese werden als vier eigene Kapitel betrachtet, da sie unsere Wahrnehmung der Welt zu schärfen vermögen), finden sich Begriffe sehr unterschiedlicher Art. Eine abstraktere Systematisierung hätte zu einer stärkeren thematischen Einschränkung geführt. Das war jedoch nicht gewollt, sondern es ging mir vielmehr darum, zu inspirieren und zu positiver Nachahmung anzuregen.
Im Verlauf der Lektüre wird man in der Tat bemerken, wie sich die Wörter immer weiter verzweigen und alle Themen in der einen oder anderen Weise miteinander verknüpft sind. Allerdings wurden diese – einer für die japanische Kultur typischen Neigung entsprechend, nach der es kein Zentrum geben soll, um das sich alles dreht, sondern die Dinge permanent in Bewegung sind – eher lose, wie Murmeln in einer Tasche, nebeneinander angeordnet, sodass der Leser je nach Interesse von einem Kapitel zum nächsten springen kann, ohne beim Lesen zu einer bestimmten Reihenfolge gezwungen zu sein. Stattdessen kann er immer wieder das Inhaltsverzeichnis konsultieren und nach Lust und Laune entscheiden, wohin ihn sein Lektüreweg als Nächstes verschlägt, denn manchmal führt uns gerade eine vordergründige Zufälligkeit zu dem, was wir am meisten brauchen.
Wenn es beim Lesen eines Ausgangspunkts bedarf, so liegt auf der Hand, dass es auch Umwege und eine Rückkehr gibt. Und genau diese Rückkehr soll eine Veränderung des Blickwinkels ermöglichen – auf dass man sich nicht so sehr (oder nicht ausschließlich) Japan widme, sondern auch auf seine eigene Welt blicke, auf das, was man immer griffbereit und vor Augen hat und was uns aus diesem Grunde scheinbar nichts mehr zu sagen hat.
Frühling 4. Februar bis 4. Mai
Kirschblütenblätterzwischen den ReissetzlingenSterne und Mond
Yosa Buson
Alles beginnt mit einer Zeichnung, dem Piktogramm von haru春, das in seiner ursprünglichen Form eine keimende Pflanze mit Wurzeln zeigt. Haru, der Frühling, steht für den Beginn eines neuen Lebens, das sich lange Zeit vor der winterlichen Kälte in die Erde geduckt hat, sich endlich streckt und dem Licht entgegenwindet.
Wir hören das Zwitschern des uguisu鶯, der Japanischen Nachtigall, einem Singvogel mit hellbraunem Gefieder (nicht zu verwechseln mit dem leuchtend grünen mejiro目白, dem Brillenvogel), der mit seinem wohlklingenden und unverkennbaren Gesang als Vorbote des Frühlings gilt; während sein Name in den Haiku gleichbedeutend mit der Sichtbarwerdung des Beginns ist, gilt sein Gesang in Literatur und Film als Signal dafür, dass der Winter endlich hinter uns liegt.
Auch wenn die warme Luft, die die Natur zu neuem Leben erweckt, aus dem Süden kommt, heißt es im Japanischen, der allererste Wind des Frühlings blase aus dem Osten, und so nennt man ihn wörtlich auch kochi東風, »Wind aus Osten«, so wie in der chinesischen Tradition, nach der der Kalender in 72 Abschnitte gegliedert ist.
In Japan ist der Frühling die erste Jahreszeit. Er ist der Beginn von allem. Das spiegelt sich in vielen Bereichen des Alltagslebens. So ist es kein Zufall, dass der Beginn des Schuljahres, der Arbeit und des Steuerjahres allesamt auf den April fallen, wenn überall im Land die Kirschbäume blühen, wenn die Wipfel der Bäume saftig grün sind und zwischen Ende März und Anfang April die »Rasenkirschen« shibazakura die Landschaft leuchtend rosa färben und für spektakuläre Ausblicke sorgen, wie etwa in Yamanashi mit dem Fujiyama direkt dahinter oder an den Ufern des Flusses Shibuta in Kanagawa oder auch auf Hokkaidō zwischen den geschwungenen Hügeln des Shibazakura-Parks, der nach ebendieser Blütenpflanze benannt ist.
Die Feierlichkeiten zur Immatrikulation, zu Beginn des neuen akademischen Jahres an der Universität oder zum neuen Eintritt in eine Firma – sie alle werden von einem eher wechselhaften Wetter begleitet, einer unsteten Witterung, die typisch für den Beginn des Frühlings ist und den zaghaft hoffnungsvollen Hintergrund zahlloser Schnappschüsse für das Fotoalbum bildet – Aufnahmen, auf denen junge Männer und Frauen begeistert und mit gespreiztem Zeige- und Mittelfinger, dem Victory-Zeichen, in die Kamera blicken. Sankanshion三寒四温, »drei Tage Kälte, vier Tage Wärme«, wie es im Japanischen so schön heißt. Und genau so nähert er sich auch, der Frühling, er macht Schritte vor und zurück, bringt Regen an Tagen, an denen man fest mit Trockenheit gerechnet hatte, und wärmt plötzlich an anderen, obwohl noch kurz zuvor ein eisiger Winterwind geweht hat.
Und so beschwört auch der Ausdruck harusame春雨 – eine ebenso schlichte wie visuell suggestive Verbindung aus dem Kanji für haru春, Frühling, und dem für Regen, ame雨 – den Frühlingsregen herauf, den man wie hinter einer Scheibe wahrnimmt, Tropfen, die langsam herabrinnen.
Laut dem alten japanischen Kalender beginnt der Frühling im Februar, genauer gesagt am vierten dieses Monats, und endet am 4. Mai. In Wirklichkeit jedoch ist in dieser Zeit von haru oft noch wenig zu erkennen, und wenngleich der Frühling in der Vorstellung vor allem eine Jahreszeit der Wärme ist, so erinnert die japanische Sprache uns daran, wie sehr die Wärme immer noch der Kälte verpflichtet ist und umgekehrt. Als handelte es sich um zwei Gegenpole der Seele, wie bei dem Kanji für Glück (shiawase幸), das sich nur durch den Verlust eines einzigen Striches in sein Gegenteil, das Leid (tsurai辛), verwandelt.
Zur Vesperzeit, wenn man Gäste erwartet oder sich eine kleine Pause gönnt, werden Süßigkeiten wie sakura-mochi oder kusa-mochi auf Holzbrettchen oder kleinen Keramiktellern, die in Farbe und Motiv zur Jahreszeit passen, zum Tee gereicht. Dann übernimmt die Farbe Rosa die Oberhand auf dem Tisch, im Kleiderschrank oder, allgemeiner gesprochen, auf dem Markt; es gibt Getränke, die nach sakura oder Erdbeere schmecken, zartrosa Sakura-Krabben (sakura-ebi), rosa Fächer, rosa Hüllen für Schirme und Sonnenschirme, rosa furoshiki oder ebensolches Porzellan. An den Kirschblüten kommt in der japanischen Gesellschaft keiner vorbei. Man legt Decken unter die Kirschbäume, reserviert sich bereits eine Nacht zuvor seinen Platz und wartet sehnsüchtig auf den Durchbruch der Knospen; in den Nachrichten wird tagtäglich über die Entwicklung der Blüten berichtet, über dieses wundervolle und zugleich tragische Schauspiel, das symbolisch für das Leben steht, für die unfassbare Schönheit und für die Zerbrechlichkeit menschlichen Daseins. Manchmal genügt nur ein wenig Wärme, um das Öffnen der Knospen zu beschleunigen, und ein einziges Gewitter lässt die Blütenblätter zu Boden regnen.
Es gibt verschiedene Bezeichnungen für diese Blüten, und sie alle erzählen von ihren vielfältigen Erscheinungsformen. Yozakura夜桜 zum Beispiel verknüpft das Kanji für Nacht 夜 mit dem für Kirschblüten 桜 und verweist auf die nächtliche Kontemplation in den Tempeln, in den Parks oder auf Straßen und Wegen, wo die Bäume anlässlich besonderer Veranstaltungen illuminiert werden.
Auch hierin liegt die besondere Weisheit Japans: dass man nämlich die Freude vergrößern kann, indem man dieselbe Sache wie durch ein Prisma betrachtet, um sie in all ihren Facetten zu sehen, und indem man den Dingen Namen gibt – man tauft den Regen, benennt die vielen Spielarten des Windes oder das sich langsam wandelnde Aussehen einer Blüte.
Im Frühling feiert man in Japan zwei bedeutende Feste: das Mädchenfest Hina-matsuri雛祭り, das auf den 3. März fällt, und die Tagundnachtgleiche O-higanお彼岸.
Der Internationale Frauentag am 8. März wird in Japan nicht gefeiert – nicht etwa weil den Frauenrechten, der Gleichberechtigung und dem Kampf gegen die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern keine Bedeutung zugemessen würde, sondern weil der Frauentag Teil einer anderen Kultur ist, die in gewisser Hinsicht im Land der aufgehenden Sonne bislang nur zarte Wurzeln geschlagen hat. Stattdessen gibt es am 3. März ein anderes Fest, bei dem seit jeher die Frau bzw. das Mädchen im Mittelpunkt steht. Es ist die Zeit, in der in Japan die Pfirsichbäume blühen, und an Hina-matsuri betet man für das Wohlergehen, das Glück und das gesunde Aufwachsen der kleinen Japanerinnen.
Der Ursprung dieses Festes liegt in China. Dort wusch man am 3. März traditionell Hände und Füße, um sich von bösen Geistern reinzuwaschen. Als diese Sitte nach Japan kam, wandelte sie sich: Nun befreite man sich vom Unglück nicht durch eine Waschung, sondern indem man es auf Puppen übergehen ließ, eines der Lieblingsspielzeuge kleiner Mädchen, und die Puppen dann in einen Fluss warf, um jegliches Unglück von ihren kleinen Besitzerinnen fernzuhalten.
Heute wird dieser durch und durch weiblich geprägte Brauch so begangen, dass man, einer genau festgelegten Ordnung folgend, mehrere rituelle Puppen im Haus auf Stufen aufreiht und dazu einige besonders farbenfrohe und symbolträchtige Speisen wie etwa chirashizushiちらし寿司, hishi-mochi菱餅, hinaarare雛あられ und hinagashi雛菓子 zu sich nimmt.
Bei O-higan handelt es sich hingegen um die Tag-Nacht-Gleiche des Frühlings. In Japan wird dieses Fest nur von den Anhängern des buddhistischen Glaubens begangen. Es dauert eine Woche und ist dem Gedenken an die Toten und die Ahnen gewidmet. Dazu begibt man sich ans Familiengrab, schmückt es gemeinsam und sorgfältig, bringt Blumen als Geschenk, zündet zwischen den sogenannten tōba塔婆, den Totenbrettchen, Räucherstäbchen an und richtet seine Gedanken und Worte auf die Vorfahren. Manche lassen sogar Mönche kommen, damit diese am Grab Rituale abhalten und besondere Gebete sprechen. Während der Frühjahrs-Tagundnachtgleiche isst man botan-mochi牡丹餅, köstliche, winzige Reiskuchen aus Klebreis (mochi), die in ihrer Farbe an die Pfingstrosen (botan牡丹) erinnern, nach denen sie benannt sind.
Das Grab pflegen, Blumen bringen und Gebete sprechen – das alles sind Tätigkeiten, die in Japan im Verlauf eines Jahres oft verrichtet werden und die zeigen, wie viel den Menschen im Land der aufgehenden Sonne das Verhältnis der Lebenden zu den Toten bedeutet, wie sehr sie sich bei diesen in der Schuld sehen. Es ist eine fließende Beziehung zwischen Vergangenheit und Gegenwart und der fruchtbare Boden, auf dem man eine stabile und mit Sinn erfüllte Zukunft aufbauen kann.
1 人hito oder: Vom gegenseitigen Haltgeben
Hito人 heißt auf Japanisch Mensch.
Zwei schlichte Striche für eines der wichtigsten Kanji der Sprache: ein Körper, dargestellt durch eine Linie, von rechts oben nach links unten, und eine zweite Linie, die von dem schmalen Körper ausgeht und in die entgegengesetzte Richtung nach unten verläuft, wie um ihn in Bewegung zu setzen. Es ist ein Schriftzeichen, das fest auf das vertraut, was es darstellt – ein dynamisches Kanji, das aussieht, als würde es marschieren.
Allerdings sind es bei der gedruckten Version des Schriftzeichens – das sich von dem mit der Hand geschriebenen stets unterscheidet – zwei Linien, die an der Spitze, wo sie sich berühren, miteinander zu verschmelzen scheinen.
Nach meiner ganz eigenen Interpretation, wie es sie in unendlicher Anzahl gibt, ist das Schriftzeichen hito der Tatsache geschuldet, dass Menschen sich gegenseitig stützen müssen, um sich aufrecht zu halten.
Genau so interpretiert es übrigens auch der Protagonist einer der bekanntesten Fernsehserien Japans mit dem Titel »Die 3B von Lehrer Kinpachi« (San-nen B-gumi Kinpachi-seinsei3年B組金八先生). Besagter Lehrer Kinpachi, der dem emotionalen Entwicklungsstand seiner Schüler stets mehr Beachtung schenkt als ihren schulischen Leistungen, eine charismatische Figur, die in der Gedankenwelt der Zuschauer einer ganzen Generation verankert ist, erklärt darin seiner Klasse 3B die Bedeutung gegenseitiger Unterstützung und Solidarität, und wie wichtig es ist, füreinander da zu sein.
Das Haltgeben bildet folglich die Grundlage einer jeden Beziehung und einer Gesellschaft, die sich Stück für Stück um diesen essenziellen Kern des Füreinanderdaseins entwickelt. Dabei versteht es sich von selbst, dass man fest auf die Hilfe seines Nächsten zählen kann und zugleich die Verantwortung dafür hat, diesem umgekehrt ebenfalls beizustehen.
Es ist durchaus üblich, ein Kanji nicht nur zu bestimmten Zwecken auf seine Anwendungen und Konnotationen hin zu untersuchen und Mutmaßungen über seinen Ursprung anzustellen, sondern es in seine Bestandteile aufzuspalten und es dadurch möglichst vielen Menschen zu ermöglichen, sich Gefühle, Situationen oder auch Dinge des alltäglichen Lebens besser zu erklären. Diese Schriftzeichen sind die Samenkörner, die den ursprünglichen Sinn der alten chinesischen und japanischen Kultur beibehalten, dabei allerdings ganz neue Blüten treiben können, je nachdem, in welche Erde man sie sät.
Ein Beispiel hierfür liefert uns das Zeichen oya親 für »Elternteil«, das im Land der aufgehenden Sonne oft und gern von Geburtshelferinnen und Erzieherinnen herangezogen wird.
In dem Kanji für oya sieht man oben links das Verb tatsu立つ, das »stehen, aufstehen« bedeutet, unten ki木, das Zeichen für »Baum«, und rechts miru見る für »schauen, betrachten«. Folgt man diesen Komponenten dem Sinn nach, so ergibt sich folgender Satz:
Oya no yakuwari wa, ki no ue ni tatte miru koto da親の
役割は、木の上に立って見ることだ oder: »Die Aufgabe des oya, des Elternteils, ist es, auf einem Baum zu stehen und aus der Ferne zu schauen.«
Die Erklärung, was Eltern tun sollten, liegt folglich bereits im Wort: dass sie nämlich erst dann eingreifen sollen, wenn es wirklich nötig ist. Um niemals die Stelle des Kindes einzunehmen und den Verlauf der Dinge auf diese Weise zu hemmen, muss sich oya vor allem auf das Beobachten aus der Distanz beschränken, auf ein diskretes Überwachen. Das bedeutet, dass man das Weinen eines Kindes hinnimmt, es sogar duldet, wenn es ihm einmal schlecht geht und, so schwer dies manchmal auch fallen mag, akzeptiert, dass man nur eine Figur am Rande ist, die es dem Nachwuchs nicht abnehmen kann, selbst Fehler zu begehen. Stattdessen soll man sich mit dem Gedanken trösten, wie gefährlich es wäre, dem Kind Erfahrungen und die Möglichkeit von Fehlern vorzuenthalten. Es würde dadurch nur unsicher werden und durch unser irriges Verhalten sogar in Abhängigkeit geraten.
Das Kanji oya zeigt auf, wie wichtig es ist, Kindern beizubringen, etwas allein zu schaffen, und ihnen dabei zu helfen, Schritt für Schritt ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Außerdem unterstreicht es, wie unverzichtbar für Kinder die Gewissheit ist, dass jener »Blick aus der Ferne« niemals schwinden wird: Immer dann – und nur dann –, wenn es nötig ist, wenn sie in Schwierigkeiten sind oder einen Fehler gemacht haben, werden ihre Väter und Mütter schnell vom Baum steigen und ihnen, ohne zu zögern, zu Hilfe eilen.
2個人主義kojinshugi oder: Vom »Ich«, das inmitten des »Wir« wächst
Züge sind das zweite Zuhause der Bewohner Tokios.
Bevor man sie am Morgen besteigt, muss man in zwei Reihen vor dem Eingang in der Schlange stehen, die sich zu Stoßzeiten oft genug um ein x-Faches verlängert. Da stehen die Menschen und harren der Dinge, scheinbar unbeteiligt und doch angespannt; in Reih und Glied, jeder für sich, warten sie darauf, dass sich die Türen öffnen und den Weg für die zusteigenden Fahrgäste freigeben. Einzig und allein in diesem Moment, beim Einsteigen, findet die Verwandlung statt, und sie dauert genau die zwei oder drei Sekunden an, die nötig sind, um sich einen Weg durch den Dschungel der Absichten anderer Fahrgäste zu bahnen oder ihnen auszuweichen und dann Platz zu nehmen.