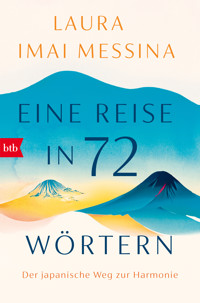10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der internationale Bestseller ∞ Inspiriert von einer wahren Geschichte
Eine Tagesfahrt von Tokio entfernt steht in einem Garten am Meer einsam eine Telefonzelle. Nimmt man den Hörer ab, kann man dem Wind lauschen – und den Stimmen der Vergangenheit. Viele Menschen reisen zu dem Telefon des Windes, um mit ihren verstorbenen Angehörigen zu sprechen und um ihnen die Dinge zu sagen, die zu Lebzeiten unausgesprochen blieben. So kommt eines Tages auch Radiomoderatorin Yui an den magischen Ort. Im Tsunami von 2011 verlor sie ihre Mutter und ihre kleine Tochter. Yui lernt in dem Garten den Arzt Takeshi kennen, auch er muss ein Trauma verarbeiten. Die beiden nähern sich an, gemeinsam schöpfen sie neuen Mut. Und erlauben sich zum ersten Mal, dem Leben einfach seinen Lauf zu lassen. Ganz gleich, was es für sie vorgesehen hat ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 264
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Zum Buch
Eine Tagesfahrt von Tokio entfernt steht in einem Garten am Meer einsam eine Telefonzelle. Nimmt man den Hörer ab, kann man dem Wind lauschen – und den Stimmen der Vergangenheit. Viele Menschen reisen zu dem Telefon des Windes, um mit ihren verstorbenen Angehörigen zu sprechen und um ihnen die Dinge zu sagen, die zu Lebzeiten unausgesprochen blieben. So kommt eines Tages auch Radiomoderatorin Yui an den magischen Ort. Im Tsunami von 2011 verlor sie ihre Mutter und ihre kleine Tochter. Yui lernt in dem Garten den Arzt Takeshi kennen, auch er muss ein Trauma verarbeiten. Die beiden nähern sich an, gemeinsam schöpfen sie neuen Mut. Und erlauben sich zum ersten Mal, dem Leben einfach seinen Lauf zu lassen. Ganz gleich, was es für sie vorgesehen hat.
Zur Autorin
LAURA IMAI MESSINA wurde in Rom geboren. Mit dreiundzwanzig Jahren zog sie nach Japan. Ihr Studium an der University of Foreign Studies schloss sie mit dem Doktortitel ab, mittlerweile arbeitet sie als Dozentin an verschiedenen Universitäten. Laura Imai Messina lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern in Tokio. Ihr Roman »Die Telefonzelle am Ende der Welt« stand in Italien und Großbritannien wochenlang auf der Bestsellerliste und wurde in 25 Länder verkauft.
Laura Imai Messina
Die Telefonzelle am Ende der Welt
Roman
Aus dem Italienischen von Judith Schwaab
Die italienische Ausgabe erschien 2020 unter dem Titel »Quel che affidiamo al vento« bei Piemme, Mailand.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2020 by Mondadori Libri S.p.A., Milano
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2021 by btb Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
This edition published in agreement with Grandi & Associati
Umschlaggestaltung: semper smile, München
nach einem Entwurf und einer Illustration von Alexandra Allden
unter Verwendung einer Abbildung von © Shutterstock.com
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-26321-8V002www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag
Für Ryōsuke, für Sōsuke und Emilio, und für die Stimmen, die euch immer begleiten werden.
Vorbemerkung
Für die Transkription japanischer Begriffe wurde das sogenannte Hepburn-System verwendet, laut dem die meisten Vokale wie im Deutschen ausgesprochen werden und die Konsonanten wie im Englischen. Außerdem gilt:
ch wie in Peitsche
g wie im Deutschen, auch ng
h stimmhaft, wie im Deutschen
j stimmhaft, wie in »Dschungel«
s stimmlos, wie in »Masse« oder »Maße«
sh wie ein weiches, deutsches ch
u wie ein u mit nicht gerundeten Lippen; klingt oft auch wie ein ü
w wie das w im Englischen, aber ohne Rundung der Lippen
y wie das deutsche j in »Jacke«
z stimmhaftes S wie in »sagen« oder »Sonne«.
Der Strich über einigen Vokalen, das sogenannte Makron, kennzeichnet einen langen Vokal.
Diese Geschichte erzählt von einem Ort, den es wirklich gibt. Er liegt im Nordosten Japans, in der Präfektur Iwate.
Eines Tages errichtete ein Mann am Fuße des Kujirayama, des Walberges, ganz in der Nähe der Stadt Ōtsuchi, im Garten seines Hauses eine Telefonzelle. Ōtsuchi gehört zu den Städten, die von dem verheerenden Tsunami des 11. März 2011 am schwersten betroffen waren.
Im Inneren der Zelle steht ein altes, nicht angeschlossenes Telefon, aus dem die Stimmen des Windes zu hören sind.
Hunderttausende von Menschen pilgern Jahr für Jahr zu diesem Telefon.
Es ist der Übergang der Gestalten von einem Leben/ zum anderen. Ein Konzert, in dem / nur das Orchester wechselt./ Doch die Musik bleibt, sie ist da.
Mariangela Gualtieri
Steh auf, Nordwind, und komm, Südwind, und wehe durch meinen Garten, dass der Duft seiner Gewürze ströme! Mein Freund komme in seinen Garten und esse von seinen edlen Früchten.
Hoheslied 4, 16, Anrufung der Braut
Verschenke sie also nicht zu schnell, die Liebe.
Kojiki
Prolog
Der Wind peitschte auf die Pflanzen des großen, an einem Hang gelegenen Gartens von Bell Gardia ein.
Instinktiv nahm die Frau den Arm vors Gesicht, um sich zu schützen, und beugte sich nach vorn. Doch dann richtete sie sich wieder auf, stemmte sich der Witterung entgegen.
Kurz vor Morgengrauen war sie gekommen, hatte zugesehen, wie es hell wurde, noch bevor die Sonne aufging. Sie hatte große Säcke aus dem Auto geladen: fünfzig Meter aufgerollte, dicke Plastikfolie, mehrere Packungen Isolierband, zehn Schachteln Nagelringe für die Befestigung im Boden sowie einen Hammer mit Damengriff. Bei Conan, dem großen Baumarkt, hatte ein Verkäufer sie gebeten, ihm ihre Hand zu zeigen, er wolle lediglich ihre Größe für den Griff messen, doch sie zuckte zusammen und blieb ihm eine Antwort schuldig.
Mit schnellen Schritten näherte sie sich jetzt der Telefonzelle, die ihr unendlich zerbrechlich erschien, wie aus Zuckerwatte und Baiser gemacht. Schon jetzt war der Wind zu einem Sturm angewachsen, und die Zeit wurde knapp.
Gut zwei Stunden arbeiteten beide ohne Unterlass dort auf dem Hügel von Ōtsuchi: sie – die nicht nur die Zelle, sondern auch die Bank, das Schild am Eingang und den kleinen Bogen, der als Wegweiser diente, in Plastikplanen wickelte – und der Wind, der nicht einen Augenblick lang aufhörte, sie zu umtosen. Ab und zu schlang sie unwillkürlich die Arme um sich, als wollte sie sich selbst umarmen, so wie sie es seit Jahren tat, wenn ihre Gefühle sie überwältigten, doch jedes Mal richtete sie sich wieder auf, streckte den Rücken und stemmte sich erneut trotzig der Wolkenbank entgegen, die mittlerweile den gesamten Hügel einhüllte.
Erst als sie mit allem fertig war, als sie sogar glaubte, den Geschmack des Meeres im Mund zu haben, als wäre die Luft von unten aufgestiegen und die Welt stünde Kopf, hielt sie endlich inne. Erschöpft ließ sie sich auf die Bank sinken, die unter ihrer dicken Plastikhülle aussah wie eine Seidenraupe, ihre Schuhsohlen dick verkrustet von Lehm.
Wenn die Welt jetzt unterginge, so sagte sie sich, dann würde sie eben mit ihr untergehen. Doch sollte auch nur die geringste Möglichkeit bestehen, sie auf den Beinen zu halten, selbst in einem ungelenken Gleichgewicht, dann würde sie auch das letzte Körnchen Energie aufbringen, um ihr zu helfen.
Die Stadt unter ihr schlief noch immer. In manchen Fenstern brannte bereits Licht, doch in Erwartung des Taifuns hielten die meisten Menschen die Fensterläden geschlossen und vernagelten sie mit Brettern. So mancher hatte gar Sandsäcke vor seinem Haus gestapelt, um den Wind in seinem Wüten davon abzuhalten, die Barrikaden zu durchbrechen und den Wassermassen Tür und Tor zu öffnen.
Doch Yui schien den Regen gar nicht zu bemerken, den Himmel, der bis zu ihren Schuhen herabgesunken war. Sie betrachtete ihr Werk, die dicken Schichten aus Plastikfolie und Isolierband, in die sie alles eingewickelt hatte: die Telefonzelle, die Holzbank, die akkurat aufgereihten Steinplatten, die den Weg formten, den Bogen am Eingang und das Schild mit der feierlichen Aufschrift: »Telefon des Windes«.
Alles war mit einer Schicht aus Erde und Regentropfen bedeckt. Selbst wenn der Taifun etwas wegrisse oder gar mit sich forttrüge – Yui würde bleiben, um es zurückzuholen.
Das Augenscheinlichste in diesem Moment kam ihr gar nicht in den Sinn – nämlich, dass die Dinge nicht so hinfällig sind wie das Fleisch. Materielles kann immer repariert oder ersetzt werden, der Körper hingegen ist irreparabel; wenngleich er auch stärker ist als die Seele, für die es keine Heilung gibt, wenn sie erst einmal in Stücke gegangen ist, so ist er doch schwächer als das Holz, das Blei, das Eisen. Dass sie selbst in Gefahr war, war ihr nicht einen Augenblick bewusst.
»Es ist schon September«, flüsterte Yui und betrachtete die schwarze Himmelswand, die sich aus Osten näherte. Nagatsuki長月, der »Monat der langen Nächte«, der Name, den man ihm schon in uralten Zeiten gegeben hatte. Sie erinnerte sich, dass sie damals genau diesen Satz jeden Monat gesagt hatte. Es ist schon Oktober, November, Dezember. Es ist schon April, hatte sie gesagt, und dann war es Mai und so weiter, während ein Tag auf den anderen folgte, seit jenem 11. März des Jahres 2011.
Jeder Tag, jede Woche war ein Kampf, jeder Monat einfach nur angehäufte Zeit, gesammelt und eingemottet für eine aufgeschobene Zukunft, von der Yui gar nicht wusste, ob sie jemals eintreffen würde.
Yui hatte langes rabenschwarzes Haar, das nur an den Spitzen blond war, als wäre der Ansatz von unten nach oben nachgewachsen. Seit ihre Mutter und ihre Tochter in den Mahlstrom des Meeres gesogen worden waren, hatte sie ihr Haar nicht mehr gefärbt. Stattdessen hatte sie es nur ab und zu ein Stückchen abgeschnitten und ansonsten wachsen lassen, wie eine Aureole, die langsam nach unten wanderte. So kam es, dass die Farbe ihres Haares, genauer der Abstand zwischen dem fahlen Gelb von früher und dem ursprünglichen Schwarz, von der Dauer ihrer Trauer erzählte. Sie war zu einer Art Kalender geworden.
Ihr Überleben hatte sie vor allem diesem Garten zu verdanken, dieser weißen Zelle mit der Schiebetür und dem schwarzen Telefon auf der Ablage, dem Spiralheft daneben. Sie wählte eine beliebige Nummer auf der Wählscheibe, hielt sich den Hörer ans Ohr und ließ ihre Stimme hineinfallen. Manchmal weinte sie, aber manchmal musste sie auch lachen, weil das Leben so komisch sein kann, auch wenn etwas Schreckliches geschieht.
Jetzt war er fast über ihr, der Taifun. Yui hörte, wie er sich näherte.
In dieser Gegend waren Wirbelstürme nichts Ungewöhnliches, besonders im Sommer. Sie brachten Chaos, deckten Dächer ab und verstreuten die Dachziegel wie Samenkörner in der Landschaft, und jedes Mal beschützte Suzuki-san, der Hüter von Bell Gardia, den Garten mit der liebevollen Fürsorge, die ihm zu eigen war.
Dieses Mal jedoch kündigte sich ein besonders furchterregender Taifun an, und Suzuki-san war nicht da. Das Gerücht, er sei krank, hatte sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Wie schlecht es wirklich um ihn bestellt sein mochte, wusste niemand, nur, dass er im Krankenhaus war.
Wenn er diesen Ort nicht schützte, wer dann?
Yui kam dieser Taifun wie ein kleines, boshaftes Kind vor, das einen Eimer Wasser auf die Sandburg eines anderen Kindes schütten wollte, welches in seiner Unschuld nicht damit rechnete; er beobachtete es aus der Ferne, hinter einem Felsen verschanzt, und wartete auf seine Gelegenheit zuzuschlagen.
Die Wolken am Himmel veränderten ständig ihre Position, alles dort oben raste, und das Licht zog sich rasch in Richtung Westen zurück. Von Minute zu Minute senkte es sich ein wenig mehr über sie herab, legte sich wie eine dunkle Hand auf die Stirn des Hügels, als wollte es prüfen, ob sie wirklich heiß war oder das Fieber nur vortäuschte.
Als das Gebrüll des Windes über den Garten hereinbrach, schien sich alles unter seinem Wüten zu ducken. Tu mir nicht weh, schien es zu flüstern.
Yuis Haare öffneten sich wie die Fangarme einer Qualle, sanken schlaff in sich zusammen, fächerten sich wieder auf. Man musste sich nur den Kopf dieser Frau anschauen, um zu erahnen, welche Partitur der Wind spielte, dieses unheimliche Pfeifen, kurz bevor er die Pflanzen aus der Erde riss: die higan-bana, die Spinnenlilie mit ihren scharlachroten Dolden, die Blume des Nirwana, die Totenblume, die Hortensie, die all ihrer Blütenblätter beraubt und wieder zum nackten Strauch wurde, oder die weißen Blüten der fūsen-kazura mit ihren grünen Früchten, die die Kinder zum Klingeln brachten wie Glöckchen.
Obwohl es ihr mittlerweile Mühe bereitete, sich auf den Beinen zu halten, ging Yui noch ein letztes Mal in die Hocke, um sich zu vergewissern, dass alles geschützt war. Mal schleppte sie sich über den Boden, mal stemmte sie sich mit ihrem ganzen Gewicht gegen jene Wand aus Luft, bis sie schließlich die allerletzte Steinplatte des Weges erreicht hatte. Noch einmal prüfte sie die Haken, mit denen sie die Planen um die Telefonzelle festgesteckt hatte, pflügte mit beiden Armen durch den Wind, als wollte sie schwimmen.
Eine einzige Platte des Weges knirschte wie mürbe unter ihren Füßen, und Yui fiel ein, wie ihre Tochter die Steinplatten über der Abwasserrinne bei ihrem Haus immer Kekse genannt hatte.
Sie lächelte, dankbar dafür, dass sie sich daran wieder erinnert hatte.
Als Kind nimmt man das Glück als Ding wahr. Eine Spielzeugeisenbahn, die aus einem Karton hervorlugt, die Folie, mit der ein Stück Torte eingewickelt ist. Oder vielleicht auch ein Foto, das das Kind als Mittelpunkt einer Szene zeigt, bei der sich alle Augen auf diesen kleinen Menschen richten.
Als Erwachsener wird das alles komplizierter. Glück – das ist Erfolg, die Arbeit, das sind ein Mann oder eine Frau, alles Dinge mit vielen Nuancen, schwer zu erreichen. Und wenn dieses Glück dann da ist – und auch wenn es nicht da ist –, wird es vor allem das: ein Wort.
Genau, dachte Yui jetzt, aber die Kindheit lehrt uns etwas anderes: nämlich dass es genügt, die Hand in die richtige Richtung zu strecken, und schon ist es zum Greifen nah.
Dort unter der gräulich-matschigen Masse des Himmels blieb eine Frau von etwa dreißig Jahren trotz allem aufrecht stehen. Sie dachte darüber nach, wie wesenhaft Glück sein kann, verlor sich in ihren Gedanken, so wie sie sich früher in Büchern verloren hatte, in den Geschichten anderer, die ihr schon als kleines Mädchen stets und ausnahmslos schöner erschienen waren als die eigene. Ja, sie fragte sich sogar, ob nicht genau das der Grund war, warum sie beschlossen hatte, im Rundfunk zu arbeiten. So sehr faszinierte es sie, dem Leben anderer zu lauschen und den verschlungenen Pfaden ihrer Erzählungen zu folgen.
Für Yui wohnte das Glück schon seit Jahren in der Telefonzelle und in jenem schwarzen und schweren Ding mit den kreisförmig angeordneten Nummern von 1 bis 0. Den Hörer ans Ohr gedrückt, verlor sie sich im Anblick des Gartens, auf jenem entlegenen Hügel im Nordosten Japans. Von hier aus konnte sie das Meer sehen, nahm den salzigen Duft der Wellen wahr. Hier träumte Yui davon, mit ihrer Tochter zu sprechen, die für immer drei Jahre alt sein würde, und mit ihrer Mutter, die das Mädchen bis zum Ende im Arm gehalten hatte.
Und wenn das Glück ein Ding ist, so wird alles, was es in Gefahr bringt, zum Feind. Auch wenn es etwas Ungreifbares ist wie der Wind, oder wie der Regen, der in Sturzbächen vom Himmel fällt.
Und koste es sie ihr unbedeutendes Leben: Yui würde niemals zulassen, dass diesem Ding und diesem Ort, die ihr die Stimme schenkten, etwas zustieß.
I
1
Zum allerersten Mal hatte sie in ihrer Radiosendung davon erfahren.
Ein Zuhörer hatte sich am Ende zugeschaltet und erzählt, was er tat, damit es ihm nach dem Tod seiner Frau besser ginge.
Die Redaktion hatte ausgiebig über das Thema diskutiert, bevor sie es festlegte. Alle wussten von dem Abgrund, den sie in sich trug. Doch Yui hatte darauf bestanden und gesagt, ganz gleich, was im Verlauf der Sendung passiere, sie sei gewappnet. Gerade weil sie so sehr gelitten habe, könne kein Leid der Welt sie mehr berühren.
»Was hat es Ihnen leichter gemacht, am Morgen aufzustehen und am Abend zu Bett zu gehen, nachdem Sie einen Verlust erlitten hatten? Was hilft Ihnen, wenn die Trauer Sie übermannt?«
Die Sendung war wesentlich weniger bedrückend verlaufen als erwartet.
Eine Frau aus Aomori berichtete, wann immer sie traurig sei, gehe sie in die Küche; sie backe süße und salzige Kuchen, Macarons, koche Marmelade ein, bereite Leckereien wie Kroketten oder gegrillten Fisch mit karamellisierter Sojasauce zu oder gekochte Gemüsehäppchen für eine Bento-Box. Sie habe sich sogar eine Gefriertruhe zugelegt, um ihre kulinarischen Schätze aufzubewahren. Für Hina-matsuri, das Mädchenfest am 3. März, welches ihre Tochter Jahr für Jahr gefeiert hatte, leerte sie die Truhe sorgfältig. Sie wusste ganz genau, wenn sie die Puppensammlung im Wohnzimmer betrachten würde, jene auf Stufen aufgereihten Figuren in den Gewändern der kaiserlichen Familie, würde sie das zwingende Bedürfnis überkommen, zu schälen, zu schnippeln, zu überbrühen. Wenn sie koche, gehe es ihr gut, sagte sie, denn es helfe ihr dabei, wieder Hand an die Welt zu legen und sie zu spüren.
Eine junge Angestellte aus Aichi rief an und erzählte, sie gehe in bestimmte Cafés, wo man Hunde, Katzen und Frettchen streicheln könne, besonders Frettchen. Es genüge, dass die Tiere mit ihren kleinen Schnauzen ihre Hände streiften, und schon kehre in ihr die Freude zurück, am Leben zu sein. Ein alter Herr, der im Flüsterton sprach, damit ihn seine Frau im Schlafzimmer nicht hörte, gestand, dass er pachinko spiele, die japanische Variante eines Glücksspiels. Und ein Handelsreisender, der die Trennung von seiner Verlobten wie einen Trauerfall erlebt hatte, hatte es sich angewöhnt, große Tassen heißer Schokolade zu trinken und dazu sembei, Reiscracker, zu knabbern.
Alle mussten lächeln, als eine Hausfrau aus Tokio, eine Frau von etwa fünfzig, die bei einem Unfall ihre beste Freundin verloren hatte, erzählte, sie habe begonnen, Französisch zu lernen, und allein die fremde Modulation ihrer Stimme, das kehlige R und die komplexe Betonung vermittelten ihr die Illusion, ein anderer Mensch zu sein. »Die Sprache werde ich nie lernen, dafür bin ich vollkommen unbegabt, aber wenn ihr wüsstet, wie gut ich mich fühle, wenn ich auch nur bonjourrrrr sage!«
Der allerletzte Anruf kam aus Iwate, einem der Orte, die 2011 von der Tsunami-Katastrophe am schlimmsten betroffen gewesen waren. Die Programmleiterin der Sendung warf dem Tontechniker einen vielsagenden Blick zu, der einen Moment lang zur Moderatorin schaute und dann den Blick aufs Mischpult senkte, um ihn bis zum Ende des Anrufs nicht mehr von dort zu heben.
Wie Yui hatte auch der Zuhörer jemanden an den Tsunami verloren: seine Frau. Das gemeinsame Haus war von den Fluten überspült und die Leiche mitsamt den Trümmern weggerissen worden, sie zählte zu den sogenannten yukue fumei, den Vermissten, von denen jede Spur fehlte. Mittlerweile wohnte der Mann bei seinem Sohn im Inneren des Landes, wo das Meer nur eine Vorstellung war.
»Jedenfalls« – sagte die Stimme im Radio, immer wieder unterbrochen vom Ziehen an einer Zigarette – »gibt es da diese Telefonzelle mitten in einem Garten, auf einem einsam gelegenen Hügel. Das Telefon ist nicht angeschlossen, doch der Wind trägt die Stimmen fort. Ich sage Yoko, wie geht es dir?, und schon scheint mir alles wie früher zu sein, meine Frau, die mir aus der Küche zuhört, immer mit der Zubereitung einer Mahlzeit beschäftigt, dem Frühstück oder dem Abendessen, und ich meckere, weil ich mir an dem heißen Kaffee die Zunge verbrannt habe. Gestern Abend habe ich meinem Enkel die Geschichte von Peter Pan vorgelesen. Von diesem Jungen, der fliegen kann und seinen Schatten verliert, doch dann näht dieses Mädchen ihn an der Fußsohle fest. Und genau so, glaube ich, sind auch wir, die wir auf diesen Hügel steigen. Wir wollen unseren Schatten zurückhaben.«
Im Studio war es ganz still geworden, als wäre ein riesiger Fremdkörper zwischen ihnen abgestürzt.
Auch Yui, die es normalerweise immer schaffte, mit kurzen, ausgewogenen Worten einen zu langen Wortbeitrag zu unterbrechen, hielt den Atem an. Erst als der Mann hustete und die Regie seine Stimme ausblendete, erwachte Yui aus ihrer Trance. Hastig kündigte sie die nächste Musik an, stutzte nur kurz bei dem zufällig passenden Titel: Mrs Dalloway: In the Garden von Max Richter.
In jener Nacht erreichten sie noch viele Anrufe dieser Art, selbst als Yui längst im vorletzten Zug nach Shibuya und im allerletzten nach Kichijōji saß.
Sie schloss die Augen, doch der Schlaf wollte sich nicht einstellen. Wieder und wieder kehrte sie im Geiste zu den Worten des Anrufers zurück, als würde sie ihren eigenen Schritten folgen, immer wieder die gleiche Straße entlanggehen und dabei ständig neue Details entdecken. Ein Straßenschild, einen Ortsnamen, eine kleine Stadt. Sie schlief erst ein, als sie sicher sein konnte, den gesamten Weg auswendig zu kennen.
Am nächsten Tag nahm Yui zum ersten Mal, seit ihre Mutter und ihre kleine Tochter gestorben waren, zwei Tage Urlaub.
Sie ließ den Motor ihres Autos an, tankte, lud die Batterie auf, die fast leer war, und machte sich mit Hilfe des Navis und seinen streng geäußerten Anweisungen auf den Weg zu Suzuki-sans Garten.
Und so wurde zwar nicht das Glück, aber doch der Trost allmählich zu einem Ding.
2
Playlist dieser Nacht, die in Yuis Radiosendung gespielt wurde
Fakear, »Jonnhae Pt. 2«
Hans Zimmer, »Time«
Plaid, »Melifer«
Agnes Obel, »Stone«
Sakamoto Kyū, »Ue wo mite arukō«
The Cinematic Orchestra, »Arrival of the Birds & Transformation«
Max Richter, »Mrs Dalloway: In the Garden«
Vance Joy, »Call If You Need Me«
3
Während sie das Navi bediente, kämpfte Yui verzweifelt dagegen an, sich zu übergeben.
Diese Wirkung hatte das Meer jedes Mal auf sie, wenn sie es erblickte. Es war, als dringe es buchstäblich in ihren Mund ein, als würde jemand versuchen, es ihr mit Gewalt einzutrichtern. Deshalb steckte sie sich rasch etwas zwischen die Lippen, ein Stückchen Schokolade, ein Bonbon. In kurzer Zeit hatte sich ihr Herz dann beruhigt, und auch der Brechreiz ließ nach.
In dem Monat direkt nach dem Tsunami hatte sie als Evakuierte in der Sporthalle einer Grundschule gelebt und ein zwei auf drei Meter großes Leintuch ihr Zuhause genannt, inmitten von hundertzwanzig anderen Menschen. Und doch war sie nie einsamer gewesen als an jenem Ort.
Trotz starker Schneefälle, die beispiellos für März waren, verließ Yui damals das Gebäude, so oft sie konnte. Sie zwängte sich durch einen Riss in der Mauer, die den Schulhof umgab, schlang die Arme um einen Baum, der ihr genügend fest in der Erde verwurzelt schien, betrachtete das Meer, das auf seinen Posten zurückgekehrt war, und die Schneise der Verwüstung, die es hinterlassen hatte.
Wochenlang spähte sie konzentriert auf das Wasser hinaus, wochenlang schaute sie nichts anderes an. Denn irgendwo dort, davon war sie überzeugt, gab es eine Antwort.
Jeden Morgen und jeden Abend begab sie sich zum Informationszentrum mit der gleichen Frage: zwei Namen, Zöpfchen, mittellanges graues Haar, die Farbe eines Rockes, ein Muttermal auf dem Bauch.
Wenn sie zurückkehrte, ging sie rasch an der Schultoilette mit ihren kleinen Kloschüsseln vorbei, die normalerweise von Kindern zwischen sieben und elf Jahren benutzt wurden. Sie durchquerte Flure, die mit bunten Zeichnungen und Basteleien aus Papier geschmückt waren, und kehrte auf das weiße Rechteck zurück, das jetzt ihr Leben bedeutete, verstummt ob all dieser Absurdität.
Es gab Menschen, die zwischen diesen Tüchern auf dem Linoleumboden saßen oder standen und ohne Unterlass redeten. Sie mussten das Geschehene in Worte fassen, um sich sicher zu sein, dass es wirklich passiert war. Andere hingegen sagten kein Wort, wie versteinert, aus Angst vor der nächsten Seite des Buches, von der sie wussten, dass sich genau dort die Tragödie zutragen würde, denn sie waren zu der Überzeugung gelangt, wenn sie nicht umblätterten, würde auch das, was natürlicherweise folgte, nicht geschehen. Andere wieder, die Bescheid wussten, hatten nichts mehr zu sagen. Der größte Teil jedoch wartete, und Yui war eine von ihnen.
Je nachdem, was du im Informationszentrum erfuhrst, gehörtest du zu der einen oder der anderen Gruppe: die, die warteten, und die, die wussten. Von Zeit zu Zeit packten Menschen ihre Sachen und begaben sich zu einer anderen Notunterkunft, wo diejenigen ihrer harrten, auf die sie selbst gewartet hatten.
Hunderte erschütternde Geschichten umschwirrten sie. Im Rückblick erschien ihnen das alles jetzt wie im Lichte eines Zufalls (»hätte ich nicht krank im Bett gelegen«, »wäre ich an jenem Tag im Auto nach rechts abgebogen und nicht nach links«, »wären wir an jenem Tag nicht zum Mittagessen nach Hause gegangen«).
Sie alle hatten die Stimme der jungen Angestellten der Stadtverwaltung gehört, die über Lautsprecher, etwa hundert Meter vom Meer entfernt, nicht einen Moment lang aufgehört hatte, vor dem herannahenden Tsunami zu warnen, die die Menschen aufgefordert hatte, in Richtung Berge zu laufen oder sich in die obersten Stockwerke von Gebäuden aus Stahlbeton zu flüchten. Und alle wussten, dass sich auch diese junge Frau nicht hatte retten können.
Die Bilder auf ihren Handys, für die sie nun stundenlang Schlange stehen mussten, um sie aufzuladen, zeigten dieses absurde Spektakel: Menschen, die sich an Dächer klammerten, von den Fluten umgestürzte Autos, die auf dem Kopf standen, Häuser, die, nachdem sie lange hartnäckig standgehalten hatten, schließlich doch nachgaben und den Menschen folgten, die wie Wasser in einem Waschbecken hinweggespült wurden.
Und dann das Feuer, von dem sich niemand hatte vorstellen können, dass es noch stärker war als das Wasser, denn schon von klein auf hatte man gelernt, dass die Schere über das Papier siegt, so wie das Papier über den Stein; und dass das Wasser immer über das Feuer siegt, weil es die Flammen löscht und dich rettet. Keiner dachte in dieser kindlichen Gewissheit daran, dass das Wetter über alles entscheidet und der Rauch trotz seiner Flüchtigkeit eine Lunge zu füllen vermag. Und dass man mitten in einem Tsunami sterben kann, ohne das Wasser auch nur berührt zu haben.
Von der Anhöhe, die das Städtchen umgab, und auf die sie sich an jenem Tag, kaum waren die schlimmsten Erdstöße abgeebbt, geflüchtet hatte, hatte Yui gesehen, wie das Meer heranrückte. Ihr war dieses Heranrücken langsam, aber überzeugend erschienen, als bliebe dem Meer gar keine andere Wahl. Was sonst sollte ein Meer schon tun?
Sie war weit weg von zu Hause, und ihre Mutter hatte in ihrer SMS so beruhigend geklungen, als sie ihr mitteilte, sie und Yuis Tochter befänden sich ganz in der Nähe in einer örtlichen Rettungsstation, dass Yui einfach den Leuten um sie herum folgte. Sie stand sogar noch einer alten Frau bei, die Probleme beim Gehen hatte, und half so gut sie konnte, überzeugt davon, eine Überlebende zu sein. Einen Moment lang hatte sie sogar Schuldgefühle, weil sie selbst so viel Glück hatte.
Als sie auf der Lichtung am Berg angekommen waren, standen alle da und schauten hinab, wie im Theater aus einer Loge, die Handys in der Hand, beseelt von einem maßlosen Vertrauen in die Technik. Es schien, als wären sie alle wieder zu Kindern in dem Alter geworden, in dem die Grenze zwischen Aufregung und Angst nicht existiert. Doch in dem Moment, als das Meer aufs Land traf und nicht mehr anhielt, bis es die Ausläufer der Berge erreicht hatte, herrschte nur noch Schweigen.
Jene Szene war für Yui so surreal, dass sie sich lange Zeit nicht sicher war, was genau sie da eigentlich erlebt hatte.
Das Wasser stieg viel höher als vorausgesehen, sodass Schutzräume zur Falle wurden. Wie eine Formel, die nicht aufgeht, wie ein falsches Wort, wie eine ungenaue Definition, die zwischen zwei Dingen, die sich doch überhaupt nicht ähneln, eine Äquivalenz herstellt. Genau so war es auch ihrer Mutter und ihrer Tochter ergangen, die dort in dem Schutzraum den Tod gefunden hatten.
Einen Monat lang hatte Yui dort auf jener zwei auf drei Meter großen Plane gewartet und ab einem gewissen Punkt nicht einmal mehr gewusst, worauf. Die wenigen Dinge, die sie im Moment des Erdbebens bei sich gehabt hatte, um sich herum verteilt wie eine Girlande. Dazu Wasserflaschen, Handtücher, Becher mit Instantnudelsuppe, onigiri-Reisbällchen, Müsliriegel, Slipeinlagen, Energydrinks. Umringt von Dingen, die immer älter wurden, wartete sie darauf, dass das alles ein Ende fand.
Schließlich wurden die Leichen gefunden, und Yui hörte auf, aufs Meer zu schauen.
4
Das Unglück von Tōhoku laut den statistischen Erhebungen, wie sie von der Website Hinansyameibo.katata.info veröffentlicht wurden (letzter Stand 10. Januar 2019)
Todesopfer: 15897
Vermisste: 2534
Evakuierte: 53709
Todesopfer, die mit der Katastrophe in Verbindung gebracht werden können: 3701
5
Yui fuhr mit dem Auto auf den grauen Straßen des menschenleeren Ōtsuchi, einer Region, die von der Katastrophe vom März 2011 besonders stark betroffen gewesen war. Jeder Zehnte war damals entweder vom Meer verschlungen oder bei den Bränden, die tagelang gewütet hatten, den Flammen zum Opfer gefallen.
Buchstäblich ausgehöhlt von dem Tsunami wirkte die Gegend, durch die sie fuhr, wie ein gewaltiges Brachland. Darin lediglich wenige, notdürftig errichtete Gebäude sowie einzelne Schaufelbagger und Maschinen, deren Zweck sich ihr nicht recht erschloss.
Yui fühlte sich an einen dieser riesigen, halbleeren buddhistischen Friedhöfe erinnert, auf die Wanderer manchmal unvermittelt in den Bergen stießen.
Die hohen, länglichen Fahnen, auf denen stand, welche Arbeiten hier im Gange waren und welche Baufirma damit beauftragt war, flatterten im Wind, der hier ohne Unterlass wehte.
Während sie auf der Höhe von Niiji-itakaigan unterwegs war, auf einer Straße, die sich gemäß der welligen Struktur der Landschaft mal weitete und mal verengte, kamen Yui auf einmal Zweifel. Und wenn der Mann im Radio sich irrte? Nicht, was den Ort selbst anging, den sie zusammen mit einer Telefon- und einer Faxnummer auf der Karte gefunden hatte, sondern die Tatsache, dass das, was für jenen Mann funktioniert hatte, möglicherweise für sie nicht gelten könnte.
Eine Telefonzelle in einem Garten, ein nicht angeschlossenes Telefon, durch das man mit seinen verstorbenen Angehörigen sprechen kann. Konnte so etwas wirklich Trost spenden? Und was sollte sie denn zu ihrer Mutter sagen, und was zu ihrem kleinen Mädchen? Allein bei dem Gedanken wurde ihr schwindelig.
Das Navi gab ihr weiterhin widersprüchliche Anweisungen, doch mittlerweile war sie fast da, und es konnte ihr sowieso nicht mehr weiterhelfen. Sie machte den Motor aus, stellte den Wagen ab.
Und wenn Bell Gardia voller Leute war und sie sich anstellen musste? Hatte denn nicht jeder Tote zu beklagen, mit denen er gerne kommuniziert hätte? Hatten wir nicht alle noch eine offene Rechnung mit dem Jenseits?
Auf einmal sah Yui eines dieser riesigen chinesischen Schwimmbäder vor sich, Fleischmassen, bunte Bademützen und aufgeblasene Schwimmringe. Alle wollten dorthin, doch schwimmen konnte niemand, weil es viel zu voll war und das Wasser darunter nur eine Idee.
Yui war überzeugt davon, dass sie es nie und nimmer schaffen würde, etwas zu sagen, wenn vor der Telefonzelle Menschen stünden und warteten.
Wie in der Schule auf dem Klo. Wann bist du fertig? Hast du’s bald?
Sie kramte in der Plastiktüte, die sie auf dem Beifahrersitz ausgeleert hatte, wickelte eines der onigiri aus, die sie zusammen mit je einem Becher Kakao und Kaffee gekauft hatte, bevor sie aus Tokio wegfuhr. Kauend sah sie aus dem Fenster und betrachtete die Landschaft.
Es war ein unscheinbares Stück Land in der Provinz: heruntergekommene Gebäude, zweistöckige Häuschen mit den typischen blauen Dächern und ausgedehnte Gärten mit Schuppen und gepflegten Beeten, ein paar Hühnerställe. Rechts lag das Meer, die geschwungene Linie des Ausläufers eines Hügels. Dahinter, regungslos, die Berge.
Inmitten dieser Landschaft spürte sie, wie sie ruhiger wurde. Hier gab es weder Straßenverkehr noch Geschäfte. Ihre Angst vor einer Menschenmenge, die in Trauben vor der Telefonzelle wartete, erwies sich als unbegründet.
In genau diesem Moment stahl sich plötzlich, nach Stunden der Regenwolken, ein Lichtstrahl durch die Himmelsdecke. Erst jetzt bemerkte Yui eine Girlande aus Kakifrüchten, die zum Dörren unter der Gaube eines Hauses aufgehängt waren. Im Rückspiegel sah sie, wie ein Mann das Haus verließ und über eine Sprossenleiter auf einen Baum mit vielen Ästen stieg. Er hatte eine Gartenschere in der Hand und begann den Baum zu beschneiden.
Kurz überlegte sie, ob sie ihn nach dem Haus von Suzuki-san und dem Telefon des Windes fragen sollte: Ja, Bell Gardia, kennen Sie das? Doch sie zögerte, weil ihr einfiel, dass sie durch diese Frage dem Unbekannten auch offenbaren würde, dass sie um jemanden trauerte, und sie hasste es, wie sich das Verhalten der Menschen schlagartig änderte, wenn sie das erfuhren, wie sie nervös zu lächeln begannen oder sich hinter unnahbarer Höflichkeit versteckten.
Doch dann sah sie im Seitenspiegel einen Mann mit jungem Gesicht und ergrautem Haar vorbeigehen, und Yui wusste, dass er wie sie ein Überlebender war.
Genau hätte sie es nicht erklären können, doch da war ein winziger dunkler Schatten auf seinem Gesicht, wie Yui ihn auch hatte, obwohl sie ihn nicht genau lokalisieren konnte. Es war ein Fleck, wie ihn jeder Überlebende mit sich trug, ein Ort, an dem er sich jegliches Gefühl – auch Mitgefühl – versagte, um nicht auch noch den Schmerz anderer durchleben zu müssen.