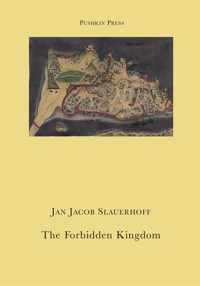Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es gibt Romane, unbeschreibliche, die den Autor eines 'Waschzettels' zu einer ganz eigenen Lyrik nötigen wollen. Und ja, dies ist so ein Buch - eine Erzählung wie die Fahrt mit der Geisterbahn, die den Leser vom Portugal der Renaissance bis ins vorrevolutionäre China führt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 254
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Voor D.
Inhaltsverzeichnis
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Nachbemerkung
Prolog
Für Allino Forjaz de Sampaio
I
Im September 1540, Lian Po hatte fast achtzehn Jahren bestanden, traf vor dem Nordtor eine kaiserliche Abordnung ein, die, obschon sie den Himmlischen Namen auf ihrem Banner führte, keine Gastgeschenke dabei hatte und in hellblaue Trauergewänder gekleidet war. Der Anführer verlangte Zutritt zum Gouverneur Antonio Farria. Da es Nacht war, wurde er mit brennenden Fackeln durch die Stadt zur Herberge geleitet und trotz murrender Ungeduld erst den darauffolgenden Tag vor Farria geführt, der, von ihrer Ankunft und ihrem Aufzug unterrichtet, geharnischt auf einem Thronsitz wartete.
Der Älteste trat vor, ohne seine Kalotte abzunehmen und sagte mit unbewegter Stimme: „Lian Po wird verwüstet werden, die Portugiesen und ihre Sklaven werden unter der Folter ihre Geburt verwünschen, falls ihre Brüder im Süden fortfahren, Malakka zu erobern.“
Farria nahm, ohne seine Stimme oder seinen Körper zu erheben, eine Pergamentrolle vom Tisch neben sich, entfaltete eine Karte von Malakka und deutete auf eine rote Linie, die den Hals der Halbinsel abschnitt, wies durchs Fenster auf den Fluß, wo die Schiffe ihre Flaggen hißten und Standarten entrollten. Dann gab er ein Zeichen, ein Schuß fiel, viele Geschütze antworteten, und über Stadt und Strom brach Jubel aus. Die Gesandten traten in geschlossenen Sänften den Rückweg durch eine feiernde Stadt an.
Am Ende des Jahres erschien vor der Reede eine kaiserliche Flotte von weit über tausend Schiffen. Auf jeden Portugiesen in Lian Po kam ein Schiff. Spione meldeten den Anmarsch eines großen Heers, drei Tagemärsche entfernt. Farria ließ Lian Po in der Obhut von Perez Alvadra und warf sich mit den dreißig im Hafen liegenden Schiffen unter die Dschunken. Auf sechs seiner Schiffe hatte er ein Festungsgeschütz und eine Feldschlange aufstellen lassen. Diese schickten ihre Kugeln gegen die Dschunken, während seine Flotte langsam zum Feind hin trieb. Noch ehe sie aneinandergerieten, waren Hunderte gesunken. Plötzlich kam Landwind auf, die schweren Geschütze stürzten ins Meer, und die Karavellen fuhren nach allen Seiten feuernd rasch hin und her durch den Feind hindurch. Doch schließlich hatten sich an jedes Schiff zig Dschunken geheftet und hunderte schrill kreischender Krieger sprangen Krummschwerter schwingend auf die Decks. Granaten aus den Mastkörben, Musketenfeuer von Kampanje und Steven, Messer und Lanzen auf den Decks vernichteten die Mandschus wie Heuschreckenschwärme.
Des Nachts wurde bei Fackellicht weitergefochten, bewaffnete Schaluppen beteiligten sich am Gefecht und Schwärme von Haien, die Hyänen der Seeschlacht, machten einander die blutenden Ertrinkenden streitig.
Die Fackeln brannten nieder, als man von Land her ein großes Leuchten wahrnahm. Eine breite rote Wand erhob sich aus trägen Flammen über den ganzen Horizont. Als Farria dies sah, geriet er in Raserei und signalisierte seine Schiffe zum letzten Angriff herbei. Neun scharten sich um sein Schiff, die anderen konnten sich nicht aus dem Gewirr befreien oder wurden überwältigt.
Kurz nacheinander durchschnitten sie dreimal die Flotte, unentwegt schießend und rammend, was ihnen vor den Bug kam. Das Morgengrauen sah, über dem Horizont aufsteigend, die flüchtenden Dschunken, vier Schiffe wandten ihnen das hohe Heck zu und kehren zurück in die Bucht. Aber Lian Po war bereits verschwunden, dicker Rauch hing über totenstillen Trümmerbergen aus eingestürzten Mauern und verkohlten Balken.
Farria schritt zu der Stelle, an der seine Stadt gestanden hatte. Die Straßen waren beinahe unter Schutt begraben, aber er fand seinen Weg, spießte mit seinem Degen Leichen zur Seite, wenn sie ihm den Weg versperrten, einmal zwei umschlungene Körper zugleich, und befand sich schließlich vor den Ruinen seines Hauses. Er wagte nicht, über die Schwelle zu treten. Dahinter befanden sich seine Frau, seine Kinder, verbrannt oder… Er stützte sich auf sein Schwert und wartete, bis einige Soldaten herbeikamen. „Suchen,“ befahl er heiser, „räumt die Balken fort, öffnet den Keller.“
Er saß nun auf einer steinernen Bank, die einst zwischen Blumen und Sträuchern vor einem kleinen Teich gestanden hatte. Mit seinem Helm schöpfte er ein wenig Wasser aus dem Tümpel und kühlte sein Haupt. Kohle und Ruß bedeckten sein Haar; er merkte es nicht. Ihm zu Füßen legte man einige schwarzgeglühte Degen und einen eisernen Krug: Das Einzige, was noch zu erkennen war.
Dann betrat Farria selbst sein niedergebranntes Haus, nahm ein paar Hand voll Asche in seinem Schnupftuch mit.
Am Abend segelten vier Schiffe, alles, was von der ersten Niederlassung in Cathay übrig war, dicht beieinander südwärts.
Die kleine Flotte war umstanden von Sternen, darüber der Mond am schwarzen Himmel, auf der Kampanje der Mae de Deus Farria und Mendez de Pinto. Sie starrten zu den Segeln, aufs Kielwasser, liefen bisweilen einige Male von einer Seite auf die andere, dann blieben sie wieder stumm stehen.
Über der Kajütstreppe brannte eine Lampe, das Kupfer der Kappe und die Bronze der Kanonen glänzten, der Rest blieb von Dunkelheit umfangen, dunkel um die beiden Einsamen, dunkel um die Segel. Doch nach und nach trat der dunkle Rumpf aus einem grünen Zwielicht, das erst die Segel aufscheinen ließ, dann den Bug aus der Nacht erhob, in der ein leises Murmeln wie von Erwachenden anhob.
Endlich waren auch Farrias große Gestalt und der kleine, zarte Mendez von einem Schimmer umfangen. „Grün ist die Farbe der Hoffnung.“ sagte Farria ohne Überzeugung. Aber Mendez widersprach: „Das ist das St. Elmsfeuer, das Unheil, Tod bedeutet. Was kann es anderes bedeuten?“ Und mit einem Mal brach eine Flut aus Worten über die Lippen des kleinen, stillen Mannes, der tagelang keine Silbe herausgebracht, nichts getan hatte, außer zwischen einem Bord und dem anderen zu laufen, Kanonen kontrolliert, getrunken, viel getrunken zu haben. Und bei der Verschanzung schweigend geflucht hatte.
Endlich fand sein Groll einen Ausweg.
„Alles, alles für nichts. Zwanzig Jahre Streit, Einsamkeit, Verhandlungen mit gelben Schurken, Geduld, flehentliche Bitten um Munition, um Truppen.
Die überheblichen Briefe der Schacherer in Malakka, der stolzen Verwaltungsbeamten in Goa, die uns fragen, was wir so fern suchen, wo die Gewürze, die den meisten Vorteil erbringen, in Malakka zum Einladen bereitstehen. Die quälenden Briefe der Prälaten, wann Cathay endlich christianisiert sein würde. Jene des Königs, warum seine Gesandtschaft in Peking nicht besser empfangen worden wäre, warum sie nicht mehr Geschenke zurückgebracht hätte.
Sie wollen nur behalten, was sie haben, ihre Feinde abfinden und selbst auf ihren Landgütern auf der faulen Haut liegen.
Am Rand der fabelhaftesten Reichtümer, fortwährend handgemein mit den verschlagensten und grausamsten Teufeln der Erde, werden wir unserem Los überlassen, auf einem unhaltbaren Posten, auf dem wir unser Leben verschleudert haben. Nun erhalten wir der Toren Lohn, unsere Frauen wurden zu Tode gemartert, unsere Kinder verbrannt oder entführt.
Wir sind ebenso mittellos, als wir aus dem Tejo ausliefen, arme Edelleute, noch glücklich, mit dem Segen des Kardinals und einem Ritterorden des Königs.
Was wird uns erwarten, wenn wir zurückkehren? Der Bannfluch, daß wir uns verketzerten, die Ungnade des Königs, der Kerker vielleicht. Denke an Kolumbus, denke an Gama, an so viele.
Wohin uns wenden? Unserer Hände Werk hatte zwanzig Jahre bestanden und ist in einer Nacht niedergebrannt. Laß’ uns zu einer Insel fahren, nach der niemand trachtet. Und dort den Tod abwarten. Oder laß’ uns auf alles lauern, was die portugiesische Flagge führt und sie in den Grund bohren. Nein, besser, wir unternehmen die Rückreise, lassen wir Malakka beschießen und Goa und Lissabon, bis der Tod eintritt. Warum sind wir geboren und ausgezogen.
Seine Züge waren aschgrau im grünen Licht, seine Hände brachen Holz entzwei und sein Leib lag zuckend gegen das Schanzkleid. Bis daß Farria, träge und bedächtig, wie er stets sprach, versuchte, seinen Unterbefehlshaber zur Einsicht zu bringen.
„Es ist alles wahr. In Malakka wird man uns voll Spott empfangen und triumphieren. In Goa ins Verhör nehmen, warum der Ort nicht gehalten wurde. Fünfhundert Soldaten und dreizehn Schiffe, wovon die Hälfte Kriegsschiffe, sind doch eine unüberwindliche Macht gegen selbst das größte Kaiserreich. In Lissabon wird man uns einkerkern. Ich fürchte es nicht, ich denke wie Ihr. Meine Rache geht weiter. Ich werde erneut landen, kämpfen, unterhandeln, bauen, ein zweites Lian Po, reicher und stärker als das erste. Es wird Malakka in den Schatten stellen, Goas Neid erwecken. Dann, sollte ich des Postens enthoben werden, um für einen Bastard des Königs Platz zu machen, hisse ich meine eigene Flagge und werde mit meiner Flotte und meinem Heer meine Schöpfung behaupten oder selbst vernichten, sollte sie sich als unhaltbar erweisen.“
Mendez schüttelte traurig sein Haupt.
„Wir sind zu alt. Es dauert zu lang. Die Jahre, die mir noch bleiben, will ich meiner Rache widmen. Gib mir die Kopie der Briefe, die Bittbriefe und Befehlsschreiben, mit denen wir Verstärkung forderten, gib mir die dünkelhaften und geringschätzigen Antworten. Es soll mein tägliches Brevier sein. Daran will ich meinen Mut entlehnen, sollte ich vor grausamer Einsamkeit umkommen.“
Farria sah, daß er entschlossen war.
„Wisse, daß du meinen Hafen stets offen finden wirst, liegt auch die ganze portugiesische Flotte auf der Reede.“
„Sprecht nicht so. Tut das niemals, sonst könnt Ihr Euren Racheplan nicht ausführen. Womöglich werde ich es sein, der Euch Hilfe bietet.“
Das grüne Licht verging, und beide schliefen noch einen unruhigen Schlaf auf den Bänken der Kajüte.
Und des Morgens gab Farria ihm, der seinen eigenen Weg gehen wollte, ein Bündel Papiere in einer kleinen Kiste und seinen Prunkdegen.
Die Schiffe lagen beigebraßt, Schaluppen fuhren hin und her. Alle, die Mendez’ Schicksal teilen wollten, mußten sich an Bord der Pinta begeben, das kleinste Schiff, auf dem nun die schwarze Flagge gehißt wurde. Als Farria zu Mittag dorthin ruderte, traf er Mendez düster beim Fallreep an, das Schiff spärlich bemannt.
Die Abschiedsgaben wurden an Bord gesetzt, sie hielten sich lang bei den Händen. Dann fiel ein dumpfer Schuß und Mendez ging auf der Pinta seines Wegs.
Von ihm fehlt weiter jede Nachricht.
II
Mit drei Schiffen fuhr Farria nach Süden. In der See zwischen dem Land Fu Kien und der Insel Formosa, wo die Winde über Asien und dem Ozean zusammenströmen, näherte sich ein Taifun, der große, aus der Vereinigung Vieler geborene Wind, der die See aufpeitscht, den Himmel umfängt, See und Himmel ineinanderpreßt und wringt und wieder auseinanderreißt und zwischen Geweben aus Luft und Wasser alles, was dieser überirdischen Alchemie zu nahe kommt, vernichtet.
Die Mae de Deus konnte den Anderen noch Nan Wei als Sammelplatz signalisieren. Dann waren die Schiffe schon durch Wolken- und Nebelzonen getrennt, von Wirbelwinden und Flutwellen attackiert, die von allen Seiten unter einem rasenden Regen auf sie einstürzten.
Farria stand, an einen Mast gebunden, und schrie seine Befehle, aber niemand hörte ihn. Er sah niemanden, hörte nichts als hin und wieder einen Hilferuf, das schneidende Geräusch eines gespaltenen Segels unter dem Knarren der Rahen und das Klatschen einer losgerissenen Kanone aufs Meer. Unter ihm lag in der stockdunklen, stickigen Kajüte Dona Miles, die einzige aus Lian Po wohlbehaltene Frau, knieend vor Nossa Dama da Penha. Manchmal wurde sie gegen sie geworfen. Wurde das Gebet dadurch nicht inbrünstiger? Sie betete einen Tag und eine Nacht. Das Leben war gewichen, das Gebet an seine Stelle getreten.
Bis die Böen sich legten, ein Licht durch die einen spaltbreit offene Tür drang und Farria sie aufhob. Sie vereinten sich in einem kurzen Gebet und einer langen Umarmung, als fände die Liebe der Geretteten kein Ende mehr, wäre der Tod dem Verzücken gewichen, oder vor einer sanften Sonne, die über die schäumenden, aber sich biegenden Wellen in einem runden offenen Fenster schien.
III
Vor der Bucht von Nan Wei lag die Mae de Deus schon eine Woche hinter einer schmalen Landzunge wartend vor Anker. Endlich kam die Coimbra um die Ecke des Vorgebirges, noch ein Mast aufrecht. Die Rafael erschien nicht mehr. Einige glauben, daß sich das Schiff Mendez angeschlossen hat.
Die Bewohner des Wracks – mehr war die Coimbra nicht mehr – suchten um Übernahme auf die große Mae de Deus nach. Aber Farria wollte kein Schiff mehr verlieren, die Coimbra war für die Aufklärung der Küste unverzichtbar.
Der kahle Strand verwandelte sich in einen geschäftigen Schiffbaubetrieb.
Farria selbst hatte, ins Topp steigend, um Ausschau nach der Rafael zu halten, auf der anderen Seite einen Bambushain entdeckt. Der ergab Rahen und Tauwerk.
Nan Wei müßte Wasser und Wegzehrung liefern. Es lag aber unerreichbar im Binnenland, hinter der Stromschleife, halb Stadt, halb Floß, mit Hütten und Häusern am Ufer, Dschunken auf dem Fluß so dicht aufeinander, daß ein Streifen Wasser zwischen ihnen offenblieb. Zwischen Land und Wasserviertel stand ein hoher grauer Palast mit goldnen, in der Sonne glitzernden Statuen und sich aufringelnden Dachspitzen, bunten Bannern, die von den Torbalken herabkräuselten.
Dahin mußte eine Abordnung mit kärglichen Geschenken, um Hilfe und Lebensmittel bitten.
Farria, der wußte, welch eine begehrte Geisel er wäre, traute sich nicht. Alvarez ging mit drei Mann aus Lian Po, getauften Chinesen, und einem Geschenk aus Stoffen und Wein. Farria besaß nichts anderes. In einem Brief wies er auf die Freundschaft, die zwischen beiden Monarchen bestand, die so weit voneinander entfernt waren, weil ihrer beider Macht so weit reichte. Er betonte die Dienste bei der Ausmerzung der Piraten und verschwieg den Streit um und den Fall von Lian Po. Dann bat er um Hilfe.
Alvarez kehrte nach vier Tagen zurück, indes ohne Antwort. Der Mandarin hatte die Geschenke kühl empfangen, war wutentbrannt, als er einen Fleck auf einem der Teppiche entdeckte, las den Brief und entflammte in noch größere Wut. Er rühmte seinen Kaiser als Sohn des Himmels, setzte Portugals Fürst als unscheinbaren Vasallen herab, der dem Himmelssohn tributpflichtig sei; der doch die Welt beherrschte, ganz gleich wie weit im Westen Portugal auch liegen möge. Er befahl ihnen, aus der Stadt zu verschwinden und mit ihren Schiffen die Küste zu verlassen.
Der Admiral hörte schweigend zu und ordnete an, abfahrbereit zu machen. Aber nicht, um die Küste zu verlassen. Am Abend lagen die Mae de Deus und die Coimbra eine Meile stromab von Nan Wei und beschossen die schwimmende Hälfte der Stadt im Mondschein. Bald entstanden große Lücken, und plötzlich bewegte sich die dunkle Masse stromaufwärts. Ruhig nahmen die beiden Karavellen den Platz von tausenden Dschunken ein und schossen die Stadt mit Leuchtraketen in Brand. An verschiedenen Orten flammte das Feuer auf, dann breitete es sich rasend unter Knallen und Zischen und dem Aufleuchten intensiver Freudenfarben aus: grün, rot, violett verflossen ineinander, durchschossen von feurigen Schlangen, rotierenden Sonnen, ausschießenden Sternen, feuerspeienden Drachen und schnell sich entfaltenden Riesenblumen.
Die Portugiesen, zunächst entsetzt, stoppten den überflüssigen Beschuß und wohnten als Zuschauer dem imponierenden Feuerwerk bei.
Die Unterbefehlshaber erinnerten sich an Farrias Zuspruch angesichts ihrer Klagen:
„Dies ist kein ungewisser Kampf. Dies ist ein Fest mit Illumination. Die Nan Weier werden uns prunkvoll empfangen, denn es ist der 1. Februar.“
Nur Farria, der alles bedachte, hatte den Vorabend des chinesischen Neujahrs für den Angriff benutzt, der sich, einmal begonnen, von selbst fortsetzte.
Am Morgen war Nan Wei verschwunden.
Der graue Palast auf der Außenmauer stand, schwarz verrußt, in einer Wüste aus schwarzer Asche. Lian Po war noch erkennbar gewesen. Nan Wei war wie von schwarzem Schiefer ausgewischt. Hoch und einsam ragte lediglich der Mandarinpalast.
Man landete – hundert Soldaten und zwei Feldschlangen, die die Dächer und Fenster unter Schnellfeuer hielten, das Volk der Mae de Deus nahm das Tor unter Beschuß. Abseits wartete Farria mit einem Sturmtrupp. Aber nach einer Salve flogen die Torflügel auf.
Ein Haufen Bewaffneter stürzte heulend und von Krämpfen geschüttelt durch die Öffnung auf die Landungstruppen zu. Wenige erreichten ihr Ziel, binnen weniger Minuten war das Flußufer von bunten Leichnamen und bezopften Häuptern übersät. Dann trat Stille ein. Im Palast ertönte ein gewaltiger Gong. Farria wußte, was kommen würde und zog sich ein wenig zurück.
Das Tor spie nunmehr noch weitere Krieger aus, und endlich erschien mitten in einer Reiterschar der Mandarin in einem vielfarbigen Kriegsgewand, auf einem Streitwagen, ein gewaltiges Flammenschwert schwingend.
Farria befahl im Sturmlauf den Mandarin zu schonen, und binnen zwanzig Glaubensbekenntnissen war es erledigt. Wieder bedeckten Leichen die Erde, in der Ferne flüchteten versprengte Reiter, und der Mandarin saß in seiner Karosse, deren Pferde niedergeschossen waren.
Farria trat heran und setzte ihm die Spitze des Degens auf die Brust, stieß aber auf einen Gegenstand aus Metall. In ihm erhob sich eine dunkle Vermutung, er riß mit mit der Klinge die Gewänder fort und stieß auf eine veraltete Art von Brustküraß.
Farria erkannte ihn. Hatte er nicht selbst Perez, den ersten Abgesandten nach Peking, ausziehen sehen? Man wußte nichts von ihm, außer, daß er unterwegs ermordet worden war.
Farria befahl dem Chinesen, die besudelte Rüstung abzulegen. Der Mandarin wies auf den Kreis, der sich um ihn gebildet hatte, und Farria, der absichtlich mißverstand, winkte vier Söldner herbei, die unter lautem Gejohle dem Anderen halfen, sich seiner gestohlenen Schale zu entledigen. Zitternd stand der hohe Stadthalter mit nacktem, wabblig-fettem Oberleib im Hohn der fremden Teufel. Farria trieb ihn zum Fluß und befahl ihm, den Harnisch von seiner Berührung zu reinigen, zu waschen und zu bürsten. Dann rief er seinen Henker, daß er nähertrat, einen großen Mandschu, der mit vor Wollust hervorquellenden Augen sein ansehnliches Opfer nach allen Regeln der Kunst folterte und tötete. Währenddessen fand eine weitere Zeremonie statt.
Farria hob den wieder blitzblanken Küraß hoch, dem die Sonnenstrahlen neuen Glanz gaben. Er schwor: „Ich werde in meiner Stadt eine Kathedrale stiften. Dieser Harnisch wird die einzige Reliquie sein. Kein heiliges Gebein soll ihren Platz einnehmen. Die Kathedrale wird gleichzeitig eine Festung sein und die Stadt gegen Überfälle und Belagerung verteidigen. Der Küraß wird vom Kreuzgewölbe des Kirchenschiffs herabhängen.
Denn der Scharfrichter hatte sein Werk verrichtet, und der Leichnam des Herrschers von Nan Wei hing am Torbalken seines Palasts.
IV
Weit im Süden, in einem verlassenen Gebiet, obschon nicht mehr als zwei Tagesreisen vom Millionen-Kanton entfernt, reicht eine kleine unbewohnte Halbinsel ins Meer. In einem Klippenkreis bei der Landzunge erhebt sich zwischen den Felsblöcken ein unbehauenes rothölzernes Heiligtum, spärlich vergoldet. Weder anmutige Statuen noch wohlriechende Weihrauchfässer. In einer Nische steht ein rohes steinernes Standbild auf einem großen Seeungeheuer, dessen gespaltenes Maul sich drohend gegen das friedfertige Antlitz der Göttin aufsperrt. An der Decke hängen kleine ungeschlachte hölzerne Dschunken und Sampans. Auf den Stufen vor dem Altar getrocknete Fische.
Es handelt sich um das Heiligtum von A Ma O, Gebieterin über die Taifune. Nur Fischer und Piraten verehren sie.
Auf der äußersten Spitze der Halbinsel steht noch ein Stein. Das ist alles, was hier von Menschenhand errichtet wurde. Niemand weiß mehr, welcher Stamm der Göttin ihre Heiligtum und Opferplatz gab. Der Stein trägt sogar Namen und Jahreszahl der Stiftung. Es ist ein padrão: ein Gedenkstein, wie so viele, die die erste Landung an der afrikanischen und Malabarküste anzeigen, aber kein anderer in China. Und dieser ist nicht nur Entdeckungs-, sondern auch Grabstein. Da steht: Hier landete Joaquim Ferreio mit der Padre und der Tejo. A.D. 1527.
Er hatte ein sehr bescheidenes Ziel vor Augen: Seine Ladung, die durch übergehende Seen durchnäßt war, trocknete in der Sonne. Auf diese Weise lagen auf dem flachen, trocknen Strand Gewürze und Stoffe ausgebreitet, neben einigen Zelten, in denen er mit seiner Besatzung hauste, während die Schiffe neu getakelt wurden.
Eines morgens umzingelten Horden chinesischer Krieger die Zelte. Ein Abgesandter kam und forderte tausend Goldstücke für die Schändung ihrer Erde, die von keinem Fremden mit großen Augen und langen Locken betreten werden durfte. Ferreio bezahlte und fuhr mit noch halb feuchter Ladung und eilig geklarten Schiffen. Er wußte wohl, daß wenn er bliebe, am folgenden Tag von einem anderen Mandarin das Doppelte verlangt würde, womit der gesamte Gewinn seiner katastrophalen Reise aufgebraucht wäre.
In der Eile ließ er einen padrão aufstellen, der seinen Aufenthalt an dieser kargen Küste vermeldete. Den padrão ließen die Chinesen unversehrt, da sie den Geist fürchteten, der dem Stein innewohnte.
Zwölf Jahre stand das grobe Denkmal allein in dem einsamen Landstrich.
Dann strandete wiederum ein Schiff, ohne weitere Ladung als an die zehn Jesuiten auf einer Mission nach Peking. Auch sie mußten von einer Havarie genesen, die ihnen durch Durchfall zugefügt wurde. Drei von ihnen starben dort und wurden um den padrão herum beerdigt, bedeckt von groben Grabplatten.
Und der Ort wurde im weiten Umkreis gemieden.
So bestand sehr früh im Verbotenen Reich ein Platz, der Portugal gehörte, durch seine Toten – ehe Farria ihn anlief und landete, um dort die Stadt zu gründen, die er gegen die Chinesen behaupten und verstärken wollte: gegen die Chinesen, für die Portugiesen.
Es schien, daß er dies geheime Ziel erreichen konnte, die Stadt lag uneinnehmbar. An der schmalsten Stelle der Landzunge reichten ein kleines Fort und keine dreihundert Mann, um sich Tausender zu erwehren. Von der Seite wurde es durch Inselgruppen und Sandbänke beschützt.
Er baute ein paar Forts und Lagerhäuser – Kirchen kamen von selbst.
Die Schiffe kamen und gingen immer zahlreicher. Macao lag auf halber Strecke zwischen Malakka und Japan an einer geschützten Reede. Und Lian Po war der Sturmseite der Straße von Formosa ausgesetzt gewesen. – Doch Farria starb, als er sich gerade stark fühlte, und Macao blieb – auch in Zeiten der Schwäche und des Verfalls – fast als einzige: „el más leal“ – dem König ergeben, auch als es weder König noch Portugal gab.
Weder Pinto noch Farria haben sich gerächt – und die Art und Weise, wie ein anderer sich später gerächt hat, wird nicht als Rache, sondern als Zustimmung empfunden.
Erstes Kapitel
I
Lissabon, August 15.. Gott weiß, daß ich sie gemieden habe, so gut ich konnte. Aber der König weiß es nicht. Und vielleicht war es umgekehrt besser. Er weiß auch nicht, daß es seine eigene Schuld ist, daß das Unverzeihliche geschah. Sie ist dem Infanten bestimmt. Und obschon ich sie liebte, geriet mein Blut dadurch nicht in Wallung. Der Infant ist, wie viele Fürstensöhne, jemand mit dem man in Kontakt kommen, ja sogar engen Umgang haben kann, ohne sich dadurch auch nur im Mindesten zu ändern. Es ist, als wären sie auch Einrichtungen des Staates und keine Menschen. Sie, die ich Diana nenne, konnte ihn heiraten, mit ihm Thron und Bett teilen, ihm Kinder gebären und dennoch Diana bleiben.
Und was ist mit mir? Wir würden heftige Gefühlsregungen erleben, sie würde von einem Gefühl ins andere geworfen werden; nach ein paar Jahren liebte ich sie nicht mehr, denn sie wäre nicht mehr die Frau, die ich jetzt und für alle Zeit Diana nennen werde, nicht nur, um ihren Namen nicht preiszugeben, sondern, weil ich sie dann weder für mich selbst beschreiben, noch mich peinigen muß, indem ich sie aus meiner Seele, in der sie in dunkelster Heimlichkeit mit meiner Existenz verwoben lebt, löse, in einem kraftlosen Versuch, sie in meinem Wort zum Leben zu erwecken, das zwar Welten und Meere zu umfassen vermag, aber ihr Wesen nicht.
Um mir noch einmal vor Augen zu halten, was ihr Leben hätte gewesen sein können: Eine retraite auf dem verlassenen Landgut, wo sie langsam, durch Mutterschaft und dem täglichen Zusammenleben bar jeden Zaubers zu einer trägen Frau würde; ich dagegen, der verzehrt vom Verlangen nach fernen Ländern, die ich nicht erreichte, ihr meinen insgeheimen Groll entgegenbringt.
Aber wer könnte sein Verlangen durch Reden besiegen. Nur derjenige, in dem es dem flüchtigen Frühlingswind gleichkommt. In mir war es sengend und stetig wie der Passat. Aber ich kämpfte.
Der Kampf zwischen der Entsagung und dem Verlangen machte meine Stimme unsicher, meine Augen unstet, meine Haltung zaudernd, wenn ich ihr begegnete. Von Bedauern erfüllt und gelangweilt wandte sie sich dann ab, und die Augen des Infant und seines königlichen Vaters glänzten triumphierend.
Damals fand ich den Augenblick günstig und ging, den König zu bitten, mir ein Schiff zu geben.
„Später einmal, wenn Eure Haltung mehr der eines Eroberers entspricht als jetzt, kann ich Euch vielleicht anstellen.“
Er fürchtete meine Konkurrenz zu seinem Sohn schon nicht mehr. Gebückt wandte ich mich ab, meine Wut vor der königlichen Provokation verbergend.
Auch gut. Dann werden wir uns die Haltung nicht für Übersee aufheben, sondern uns hier schon herausnehmen. Ihr habt es gewollt.
Nun mußte ich, um sie zu erobern, mit einer Waffe kämpfen, mit der ich sehr wohl gut umzugehen wußte, die ich aber lieber nicht gebrauchte.
Diana stand im Bann der Mode, die aus Italien zu uns herübergeweht ist (das Sprichwort sagt zwar: der Wind, der aus Spanien weht, bringt nichts Gutes, doch ich wollte, man fügte hinzu: der aus Italien nichts als Elend); sie machte Gedichte und wollte, daß man Gedichte über sie machte. Was ist die Poesie für ein Volk, das genug anderes zu tun hat, als mit einem widerspenstigen Metrum zu kämpfen, das jahrhundertelang auf einen schmalen Landstrich zusammengedrängt mit der Gewalt der Mauren, Spanier und Meere gekämpft hat, dessen Sprache durch eine seltsame Grille der Natur überdies schon melodiös genug ist! Sogar die Sprache der Blumen genannt wird!
Daß die Frauen, die nichts besitzen als das Weben, dieses abwechseln mit dem Sticken nach der Schablone der Sprache, darin ihren Geschlechtsgenossinnen an den unzähligen kleinen italienischen Höfen nacheifernd, kann man noch durchgehen lassen; daß aber Männer sich dieser nichtigen Beschäftigung hingeben, während es noch so viele Länder zu erobern, zu entdekken gibt und sich die Mauren noch soeben an der gegenüberliegenden Seite niedergelassen haben, das ist schlimmer.
Und dann hielt Diana einen literarischen Hof in ihrem eigenen Lustschloß Santa-Clara. Um dort zugelassen zu werden, mußte man Verse vortragen.
Es stimmt, ich hatte meinen Mund noch nie geöffnet (außer zum Gähnen oder auf Fragen zu antworten, die sie stellte), und doch waren ihre großen grünen Augen oft auf mich gerichtet. Ich bewunderte sie aus der Ferne – sie war schön, eine wahre Fürstin – und verabscheute die reimenden Schleimer, die sie umgaben. Jetzt wollte ich mich ihr nähern, mußte bei der Mode mittun, nahm all meine Kenntnis des Dichtens zusammen, die ich in den Jahren auf dem verlassenen Landgut meines Vaters erworben hatte, wo Lesen, Schreiben und Jagen die einzigen Vergnügungen waren, und machte ein Sonett und einige redondilhas.
Hiermit ging ich an dem Donnerstagmittag nach der Weigerung des Königs nach Santa-Clara.
Meine Mitteilung, daß ich ebenfalls Verse vortragen würde, erregte Aufsehen. In spöttischer Eile machten die Schmeichler, die um sie herumstanden, nach beiden Seiten hin weit Platz, doch Diana blieb ernst, richtete ihre Augen auf mich.
Ich tat als ob ich nur zu ihr spräche, in der Stille hörte ich meine eigene Stimme nicht. An ihren Augen sah ich was geschah: sie bewunderte das Sonett, wurde aber durch die freimütige Eile und die schamlose Ergriffenheit der redondilhas getroffen, so gut wurde mein Gefühl einzig für sie, allen anderen verborgen, ausgesprochen. Die Anderen murmelten ganz gegen ihren Willen Beifall; allein sie sprach nicht, ging vielmehr eine Stunde später mit mir im Hof von Santa-Clara spazieren. Der Mond schien als Sichel, hell, aber das Tageslicht hing unter dem Laubwerk der Pfade. Ihre Augen waren licht, sanft wie der Mond, ihre Nähe wie die Sonne, ihr Busen das Sanfteste und Erhebenste.
Niemals seit der Berührung meiner Amme hatte ich so die Anwesenheit des Weiblichen gespürt. Ich dachte nicht mehr an Mythologie, obwohl ich etwas über Endymion und Diana sagte; nicht mehr an ihren hohen und meinen niederen Adelsstand.
Wir waren wie die ersten Wesen im wiedergefundenen Wundergarten, obschon wir still und würdevoll nebeneinander gingen, denn aus dem Fenster starrte, wie wir wußten, die eifersüchtige Welt zu uns herab, für eine Stunde waren: Luiz, Diana.
Und wegen dieser einen Stunde –
Nein, die Verkettung meiner Katastrophen begann nach dieser Stunde, folgte aber nicht daraus. Sie begann bei meiner Geburt. Denn über meiner ersten Stunde auf Erden standen die bösartigsten Sternbilder einer überirdischen Konstellation; keine einzige gute Fee, die da war, mein Schicksal zu mildern. Und diese Liebe kam noch hinzu, um mir ihre Mühsal aufzuerlegen.
Die nächsten Male kam ich ohne Verse – wir gingen nicht in den Hof, sondern standen zusammen in der Nische des Fensters. Die anderen Männer und Frauen mieden uns von selbst, solange wir zusammen waren.
Einige Wochen danach verblaßte der Infant und Dianas Augen glänzten, wenn ich auf sie zuging. Hatte sie mich früher wegen meiner Zweifel verachtet? Nicht begriffen? Ich weiß nicht mehr, was ich zu ihr sagte, die Worte spielten vielleicht auch keine Rolle, aber der Klang muß gut gewesen sein. Ich fesselte ständig ihre Aufmerksamkeit. Der Infant dagegen stotterte, errötete und lachte nur, zu unser beider Vergnügen.
Nun erreichte meine Eroberung auf diesem verbotenen Gebiet, was mein guter Wille nicht vermocht hatte. Wäre ich ein Mann gewesen, in der Welt gereift, anstelle eines Burschen, der vom Land kommt, hätte ich das früher verstanden.
Eines Mittags stand ich bei der Fensterbank mit Diana; der Infant, in der Mitte des Zimmers, sprach verbittert und zerstreut mit seinem Kammerherrn. Eine ältere Hofdame, die vor der Tür stand, versuchte hartnäckig und vergeblich, seinen Blick auf sich zu ziehen. Sie wurde dabei gestört, als die Tür plötzlich aufging. Ein Schildknappe kam mich holen. Der König ließ mich rufen. Ich ging mit ihm.
„Wir können nunmehr Eurem Wunsch entsprechen. Die Estrella liegt klar zum Auslaufen. Sie hat Soldaten an Bord. Ihr seid zu jung für einen Befehl über ein Kriegsschiff, aber eine Kompanie mit einem fähigen Hauptmann zur Seite könnt Ihr schon anführen. Seid Ihr bereit?“
Ich tat als müßte ich überlegen, Haupt und Knie gebogen.
„Also?“ verriet der Monarch seine Spannung.
Ich gab meine Antwort erst, als ich sie ganz bereit hatte.
„Ich danke Eurer Majestät für Eure Aufmerksamkeit und Gunst. Die Fähigkeiten, die Ihr vor einiger Zeit als unverzichtbar für die Befehlshaberschaft erachtet habt, besitze ich auch jetzt nicht. Zudem hält mich eine wichtige Angelegenheit zurück.“
Ich hielt einen Augenblick inne, schielte aus meiner gebückten Haltung nach oben und sah, wie der Zorn im Gesicht des Monarchen, durch meine Kühnheit aufgestaut, anschwoll.
„Wenn Ihr meint, daß Ihr...“ Er kam nicht weiter.
„Es ist wegen meines Vaters. Er fühlt, daß seine Zeit gekommen sei und läßt mich zur Regelung seines Nachlasses kommen. Ich muß Euch alleruntertänigst darum ersuchen, mich vom Hof entfernen zu dürfen. Mein Vater kann jederzeit sterben, ich bin sein einziger Erbe.“
„Euer Vater kann noch lange leiden.“
„Dann bin ich der Einzige, den er ständig an seinem Krankenbett wünscht.“
Ich log wissentlich. Mein Vater hatte keinen ruhigen Augenblick, wenn ich bei ihm war. Der König wußte es ebensogut, aber offiziell sind Vater und Sohn einander zugetan. Ich fuhr fort, da der König sprachlos blieb:
„Ich ersuche Eure Majestät also nochmals, den Hof verlassen zu dürfen. Montag fährt ein Schiff den Tejo hinauf, mit dem ich die Reise großenteils machen kann.“
„Ihr könnt natürlich gehen. Versichert Euren Vater meines fürstlichen Wohlwollens. Und danach?“