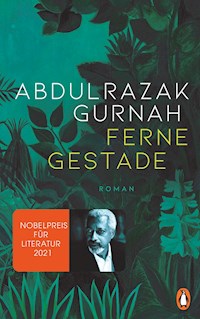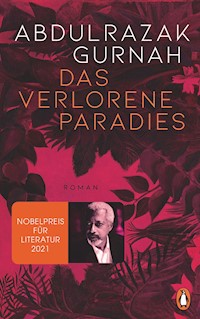
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Wer als weißer Europäer Gurnah liest, begreift die eigene Provinzialität, den so engen Ausschnitt, mit dem er die Welt und ihre Geschichte betrachtet. Was für eine glückliche Wahl aus dem so fernen Schweden.« DIE ZEIT
Feinsinnig, lebendig und in leichtem, humorvollem Ton erzählt Abdulrazak Gurnah vom Erwachsenwerden des zwölfjährigen Yusuf in einer Welt des Übergangs: Als sich Yusufs Vater mit seinem kleinen Hotel verschuldet, wird der Junge in die Hände von »Onkel« Aziz gegeben und muss vom Land in die Stadt umziehen. Täglich erlebt er, wie subtile Hierarchien das Zusammenleben von afrikanischen Muslimen, christlichen Missionaren und indischen Geldverleihern bestimmen. Als sein Onkel Yusuf auf eine Karawanenreise ins Landesinnere mitnimmt, endet dessen Jugend abrupt. Die Kolonialisierung durch die Europäer beginnt in seiner ostafrikanischen Heimat Spuren zu hinterlassen. Das alte Leben verschwindet und mit ihm Yusufs Traum von seinem kleinen Garten Eden. Im Original 1994 erschienen, stand der Roman u.a. auf der Shortlist des Booker Prize und bedeutete Gurnahs Durchbruch als Schriftsteller.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 431
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Endlich wieder in deutscher Übersetzung lieferbar: das Buch, mit dem Abdulrazak Gurnah der Durchbruch gelang
Feinsinnig, lebendig und in leichtem, humorvollem Ton erzählt Abdulrazak Gurnah vom Erwachsenwerden des 12jährigen Yusuf in einer Welt des Übergangs: Gerade erst beginnt die Kolonialisierung durch die Europäer in seiner ostafrikanischen Heimat ihre Spuren zu hinterlassen. Das alte Leben verschwindet und mit ihm Yusufs Traum von seinem kleinen Garten Eden. Im Original 1994 erschienen, stand der Roman u.a. auf der Shortlist des Booker Prize.
Abdulrazak Gurnah (geb. 1948 im Sultanat Sansibar) wurde 2021 mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet. Er hat bislang elf Romane veröffentlicht, darunter »Admiring Silence« (1996; dt. »Donnernde Stille«), »By the Sea« (2001; dt. »Ferne Gestade«; nominiert für den Booker Prize und den Los Angeles Times Book Award), »Desertion« (2006; »Die Abtrünnigen«; nominiert für den Commonwealth Writers‘ Prize) und »Afterlives« (2020; nominiert für den Walter Scott Prize und den Orwell Prize for Fiction). Gurnah ist Professor emeritus für englische und postkoloniale Literatur der University of Kent. Er lebt in Canterbury. Seine Werke erscheinen auf Deutsch im Penguin Verlag.
»Wer als weißer Europäer Gurnah liest, begreift die eigene Provinzialität, den so engen Ausschnitt, mit dem er die Welt und ihre Geschichte betrachtet. Was für eine glückliche Wahl aus dem so fernen Schweden.« DIE ZEIT, Adam Soboczynski
»Einer der weltweit herausragendsten postkolonialen Schriftsteller. Immer wieder hat er in seinen Werken mit großem Mitgefühl die Auswirkungen des Kolonialismus in Ostafrika und seine Auswirkungen auf das Leben entwurzelter und migrierender Menschen durchleuchtet.« Anders Olsson, Vorsitzender des Nobelkomitees
»Gurnahs poetische Prosa ist rein und klar. Die Emotionen, die in all den leuchtenden Facetten dieses Buches aufscheinen, klingen lange nach und sind einfach wunderschön.« The Guardian
»›Das verlorene Paradies‹ lebt vom Unerwarteten. In einer packenden Geschichte holt Gurnah eine Welt zurück, die dem Vergessen anheimgegeben war.« The Sunday Times
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook
Roman
Aus dem Englischen von Inge Leipold
Die Originalausgabe erschien 1994 unter dem Titel Paradise bei Hamish Hamilton, London.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © der Originalausgabe 1994 by Abdulrazak Gurnah
Copyright © der deutschen Übersetzung 1998 S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main, 2021
Copyright © dieser Ausgabe 2021
Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Favoritbuero, München
Umschlagabbildung: © Bridgeman Images
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-29437-3V004
www.penguin-verlag.de
Für Salma Abdalla Basalama
Der Garten hinter der Mauer
1
Erst der Junge. Sein Name war Yusuf, und in seinem zwölften Jahr verließ er ganz überraschend sein Zuhause. Er erinnerte sich, es war die Zeit der Dürre, in der ein Tag war wie der andere. Unvermutete Blumen blühten auf und welkten. Seltsame Insekten flüchteten aus ihrem Versteck unter Felsbrocken und wanden und krümmten sich in dem glühend heißen Licht, bis sie starben. Die Sonne ließ Bäume in der Ferne zittern und die Häuser leicht schwanken und nach Atem ringen. Jeder verirrte Fußball wirbelte Staubwolken auf, und über den Tagesstunden lastete angespannte Stille. Scharf umrissene Bilder wie diese fielen ihm ein, wenn er an die Jahreszeit zurückdachte.
Damals sah er auf dem Bahnsteig zwei Europäer, die ersten, die er je zu Gesicht bekommen hatte. Er hatte keine Angst vor ihnen, zuerst nicht. Zum Bahnhof ging er oft, um zu beobachten, wie die Züge geräuschvoll und gewichtig einfuhren, und dann zu warten, bis sie auf das Signal des unwirsch dreinblickenden indischen Stellwärters mit seinen kleinen Fähnchen und einer Pfeife wieder aus dem Bahnhof stampften. Oft wartete Yusuf Stunden auf einen Zug. Auch die beiden Europäer warteten; mit ihrem Gepäck und ordentlich gestapelten, wichtig aussehenden Paketen standen sie unter einer Plane aus Segeltuch. Der Mann war kräftig und so groß, dass er seinen Kopf einziehen musste, um nicht an die Zeltbahn zu stoßen, unter der er Schutz vor der Sonne suchte. Die Frau stand ein wenig weiter hinten, im Schatten; ihr glänzendes Gesicht war teilweise von zwei Hüten verdeckt. Ihre weiße Rüschenbluse war am Hals und an den Handgelenken zugeknöpft, und ihr langer Rock reichte ihr bis auf die Schuhe. Auch sie war groß und kräftig, aber auf andere Weise. Während sie wie ein formbarer Klumpen aussah, der jederzeit eine andere Gestalt annehmen konnte, schien er wie aus einem einzigen Stück Holz geschnitzt. Sie starrten in verschiedene Richtungen, als kennten sie einander nicht. Als er sie so beobachtete, sah Yusuf, wie die Frau sich mit dem Taschentuch über die Lippen wischte und nachlässig kleine Schuppen getrockneter Haut abrieb. Das Gesicht des Mannes war rotfleckig, und während seine Augen bedächtig über das verwinkelte Bahnhofsgelände glitten und die versperrten Lagerhäuser aus Holz und die riesige gelbe Flagge mit dem Bild eines schwarzen Vogels mit funkelnden Augen in sich aufnahmen, konnte Yusuf ihn ausgiebig betrachten. Dann drehte er sich um und bemerkte, wie Yusuf ihn anstarrte. Zuerst sah der Mann weg, doch dann musterte er Yusuf eindringlich. Der konnte seine Augen nicht abwenden. Plötzlich entblößte der Mann die Zähne zu einem unwillkürlichen Knurren und krümmte seine Finger auf seltsame Weise. Yusuf verstand die Warnung und ergriff die Flucht, die Worte vor sich hin murmelnd, die man ihn zu sagen gelehrt hatte, wenn er plötzlich und unerwartet Hilfe von Gott brauchte.
Das Jahr, in dem er sein Zuhause verließ, war auch das Jahr, in dem der Holzwurm die Pfosten der hinteren Veranda befiel. Sein Vater schlug wütend gegen die Balken, sooft er daran vorbeiging, und gab dem Getier so zu verstehen, dass er sehr wohl wusste, was für ein Spiel es trieb. Der Holzwurm hinterließ Spuren auf dem Gebälk, die aussahen wie die aufgeworfene Erde über den unterirdischen Gräben der Tiere im ausgetrockneten Flussbett. Weich und hohl klangen die Pfosten, wenn Yusuf dagegen schlug, und winzige Körner von Modersporen stäubten auf. Wenn er nach etwas zu essen quengelte, sagte seine Mutter, er solle die Würmer essen.
»Ich habe Hunger«, jammerte er ihr die Litanei vor, die niemand ihm beigebracht hatte und die er jedes Jahr mit lauterem Murren herunterleierte.
»Iss Holzwürmer«, schlug seine Mutter vor und lachte dann über den übertriebenen Ausdruck entsetzten Ekels auf seinem Gesicht. »Na los, stopf dich damit voll, wann immer du Lust hast. Nur zu.«
Er seufzte auf die weltverdrossene Art, die er einstudierte, um ihr zu zeigen, wie armselig ihr Witz war. Gelegentlich aßen sie Knochen, die seine Mutter kochte, um daraus eine dünne Suppe zuzubereiten, auf der eine farbig schillernde Schicht Fett schwamm und in deren Tiefen sich Klumpen von schwarzem, schwammigem Mark verbargen. Schlimmstenfalls gab es nur gumbo-Eintopf *, aber Yusuf konnte noch so hungrig sein, die schleimige Soße brachte er nicht hinunter.
*Glossar ab Seite 323.
Damals kam auch sein Onkel Aziz zu Besuch. Seine Visiten waren kurz und selten; normalerweise kam er in Begleitung einer Horde von Reisenden und Trägern und Musikanten. Auf der langen Reise vom Meer zu den Bergen, zu den Seen und Wäldern und über die dürren Ebenen und die kahlen Felshügel im Landesinneren machte er bei ihnen halt. Oft begleitete die Musik von Trommeln und tamburis und Hörnern und siwa seine Expeditionen, und wenn er mit seinem Gefolge in die Stadt einmarschierte, gingen die Tiere durch und ergriffen die Flucht, und die Kinder waren nicht mehr zu bändigen. Onkel Aziz verströmte einen ungewöhnlichen Geruch, ein Gemisch aus dem Duft nach Fellen und Parfum und Harzen und Gewürzen und einem anderen, nicht so einfach zu bestimmenden Geruch, der in Yusuf ein Gefühl von Gefahr aufkommen ließ. Gewöhnlich trug er einen dünnen, fließenden kanzu aus feiner Baumwolle und eine kleine gehäkelte Mütze, die er auf dem Kopf nach hinten geschoben hatte. Mit seinem kultivierten Auftreten und seiner höflichen, gleichmütigen Art ähnelte er eher einem Mann, der am Spätnachmittag seinen Spaziergang macht, oder einem Gläubigen auf dem Weg zum Abendgebet als einem Kaufmann, der sich seinen Weg durch dorniges Buschwerk und Vipernnester gebahnt hatte. Selbst in dem Aufruhr bei seiner Ankunft, inmitten des Chaos und der Unordnung durcheinanderliegender Ballen, umringt von müden und lärmenden Trägern und scharfäugigen, raffgierigen Händlern, brachte Onkel Aziz es fertig, ruhig und gelassen zu wirken. Diesmal war er alleine gekommen.
Yusuf freute sich über jeden seiner Besuche. Sein Vater erklärte, sie machten ihnen Ehre, da er ein so reicher und berühmter Kaufmann – tajiri mkubwa – war, aber das war nicht alles, so sehr er die Ehre auch zu schätzen wusste. Denn unweigerlich gab Onkel Aziz ihm jedes Mal, wenn er sie besuchte, ein Zehn-Anna-Stück. Dafür brauchte er nichts weiter zu tun, als im richtigen Augenblick zur Stelle zu sein. Onkel Aziz hielt Ausschau nach ihm, lächelte und gab ihm die Münze. Jedes Mal wenn der Augenblick kam, hatte Yusuf das Bedürfnis, ebenfalls zu lächeln, aber er unterdrückte es; wahrscheinlich hätte ihm das nicht zugestanden. Yusuf staunte über die schimmernde Haut von Onkel Aziz und seinen geheimnisvollen Geruch, der noch Tage nach seiner Abreise in der Luft hing.
Am dritten Tag seines Besuches war klar, dass Onkel Aziz’ Abreise unmittelbar bevorstand. In der Küche war ungewöhnlich viel Betrieb, und es roch unverkennbar nach den Vorbereitungen zu einem Festmahl. Süße Gewürze brutzelten, Kokossauce siedete, Hefewecken, Fladenbrot und Kuchen wurden gebacken, Fleisch gesotten. Yusuf achtete darauf, sich den ganzen Tag über nicht allzu weit vom Haus zu entfernen für den Fall, dass seine Mutter Hilfe bei der Vorbereitung der Gerichte brauchte oder seine Meinung dazu hören wollte. Er wusste, in derlei Dingen gab sie viel auf sein Urteil. Oder sie vergaß vielleicht, eine Soße umzurühren, oder versäumte den richtigen Augenblick, wenn das heiße Öl genügend siedete, um die Gemüse hineinzugeben. Eine knifflige Angelegenheit, denn einerseits wollte er die Küche im Auge behalten, andererseits sollte seine Mutter nicht sehen, wie er neugierig darum herumstrich. Denn dann würde sie ihn unweigerlich auf endlose Botengänge schicken, was an sich schon schlimm genug war. In diesem Fall aber könnte es passieren, dass er die Gelegenheit verpasste, Onkel Aziz Auf Wiedersehen zu sagen – das Zehn-Anna-Stück wechselte nämlich immer bei der Abreise den Besitzer, wenn Onkel Aziz ihm die Hand hinstreckte, damit er sie küsste, und Yusuf über den Kopf strich, wenn dieser sich darüberbeugte. In diesem Augenblick ließ er die Münze gekonnt lässig in Yusufs Hand gleiten.
Normalerweise arbeitete sein Vater bis kurz nach Mittag. Wahrscheinlich würde er Onkel Aziz dann mitbringen; es war also noch ziemlich viel Zeit totzuschlagen. Sein Vater führte ein Hotel. Es war die letzte einer Reihe von Unternehmungen, mit denen er sein Glück und sich einen Namen zu machen versucht hatte. Wenn er dazu aufgelegt war, erzählte er zu Hause Geschichten über andere Pläne, von denen er geglaubt hatte, sie würden Erfolg haben, und stellte sie als albern und lächerlich hin. Oder Yusuf hörte, wie er sich beklagte, sein ganzes Leben sei schiefgelaufen, alles, was er versucht habe, sei fehlgeschlagen. Das Hotel, ein Speisehaus mit vier sauberen Betten in einem Raum im Obergeschoss, stand in der kleinen Stadt Kawa, in der sie seit mehr als vier Jahren wohnten. Davor hatten sie im Süden gelebt, in einer anderen Kleinstadt in einer Gegend mit Ackerbau; dort hatte sein Vater einen Laden betrieben. Yusuf erinnerte sich an einen grünen Hügel und die fernen Schatten von Bergen; und an einen alten Mann, der auf einem Hocker auf dem Pflaster vor dem Laden saß und Kappen mit Silberfäden bestickte. Nach Kawa waren sie gezogen, weil es zu einer aufstrebenden Stadt geworden war, als die Deutschen hier einen Bahnhof für die Eisenbahnlinie eingerichtet hatten, die sie ins Hochland im Landesinneren bauten. Mit dem Aufschwung war es jedoch bald vorbei, und jetzt hielten die Züge dort nur noch, um Holz und Wasser aufzuladen. Auf seiner letzten Reise war Onkel Aziz mit der Eisenbahn bis Kawa gefahren, ehe er sich zu Fuß Richtung Westen durchgeschlagen hatte. Bei seiner nächsten Expedition, erklärte er, würde er mit der Bahn fahren, soweit es möglich war, ehe er nach Nordwesten oder Nordosten zog. In beiden Gegenden könne man noch immer gute Geschäfte machen, meinte er. Manchmal hörte Yusuf seinen Vater sagen, die ganze Stadt gehe zum Teufel.
Der Zug zur Küste fuhr am frühen Abend; mit dem würde Onkel Aziz wohl fahren, dachte sich Yusuf. An irgendetwas in seinem Verhalten erriet er, dass Onkel Aziz auf dem Weg nach Hause war. Aber bei Erwachsenen konnte man nie ganz sicher sein, und es war genauso denkbar, dass er den Zug hinauf ins Bergland nahm, der nachmittags abfuhr. Yusuf stellte sich auf beide Möglichkeiten ein. Jeden Nachmittag, nach den Mittagsgebeten, wollte sein Vater ihn im Hotel sehen – damit er etwas vom Geschäft mitbekam und lernte, auf eigenen Füßen zu stehen, in Wirklichkeit aber, um die beiden jungen Männer zu entlasten, die in der Küche halfen, aufräumten und den Gästen das Essen servierten. Der Hotelkoch trank, fluchte und beschimpfte, wen immer er zu Gesicht bekam, nur Yusuf nicht. Wenn er den sah, unterbrach er sich mitten in einem unflätigen Wortschwall und lächelte ihm zu. Trotzdem hatte Yusuf Angst und zitterte, wenn er vor ihm stand. An dem Tag ging er nicht ins Hotel, und auch seine Mittagsgebete verrichtete er nicht; in der entsetzlichen Hitze um diese Tageszeit würde sich wohl niemand die Mühe machen, ihn aufzustöbern. Stattdessen drückte er sich in den schattigen Winkeln hinter den Hühnerställen im Hof herum, bis der erstickende Gestank, der mit dem Staub des frühen Nachmittags aufstieg, ihn vertrieb. Er versteckte sich in den tiefpurpurnen Schatten des dunklen Holzlagerplatzes mit dem gewölbten Strohdach neben ihrem Haus; dort lauschte er dem leisen Hin-und-her-Huschen der flinken Eidechsen und hielt die Augen offen, um das Zehn-Anna-Stück nicht zu verpassen.
Die düstere Stille auf dem Holzplatz machte ihm nichts aus; er war daran gewöhnt, alleine zu spielen. Sein Vater wollte nicht, dass er zu weit weg von zu Hause spielte.
»Wir sind von Wilden umringt«, erklärte er. »Washenzi, die nicht an Gott glauben und Geister und Dämonen anbeten, die in Bäumen und Felsen hausen. Die tun nichts lieber, als kleine Kinder entführen, mit denen sie dann machen, was sie wollen. Oder du gehst mit diesen anderen Leuten weg, denen alles egal ist, mit diesen Faulenzern und Kindern von Faulenzern, und die werden sich nicht um dich kümmern und zulassen, dass die Wildhunde dich fressen. Bleib hier in der Nähe, wo es sicher ist und jemand ein Auge auf dich haben kann.«
Yusufs Vater sah es lieber, wenn er mit den Kindern des indischen Ladenbesitzers in der Nachbarschaft spielte, nur bewarfen die indischen Kinder ihn mit Sand und lachten ihn aus, wenn er ihnen nahe kam. »Golo, Golo«, riefen sie im Chor und spuckten in seine Richtung. Manchmal saß er bei den Grüppchen von älteren Jungen, die im Schatten der Bäume oder auf der windgeschützten Seite der Häuser herumlungerten. Er war gerne mit ihnen zusammen, weil sie immer Witze erzählten und lachten. Ihre Eltern arbeiteten als vibarua, als Tagelöhner, und schufteten für die Deutschen in den Bautrupps für die Eisenbahn, leisteten Akkordarbeit auf der Strecke, die gerade in Bau war, oder trugen Reisenden und Händlern das Gepäck. Sie wurden nur für die Arbeit bezahlt, die sie verrichteten, und manchmal gab es keine Arbeit. Yusuf hatte gehört, wie die Jungen erzählten, die Deutschen erhängten die Leute, wenn sie nicht hart genug arbeiteten. Wenn sie zu jung waren, um sie zu hängen, schnitt man ihnen die Hoden ab. Die Deutschen hatten vor nichts Angst. Sie machten, was sie wollten, und niemand konnte sie daran hindern. Einer der Jungen sagte, sein Vater habe gesehen, wie ein Deutscher seine Hand mitten in ein loderndes Feuer gehalten habe, ohne sich zu verbrennen, so als wäre er ein Geist.
Die vibarua, ihre Eltern, kamen von überall her, aus den Usambarabergen nördlich von Kawa, von den sagenhaften Seen im Westen des Hochlandes, aus den vom Krieg verheerten Savannen im Süden; viele kamen auch von der Küste. Sie lachten über ihre Eltern, äfften ihre Arbeitslieder nach und tauschten Geschichten über den abstoßenden, säuerlichen Geruch aus, den sie mit nach Hause brachten. Sie erfanden Namen für die Gegenden, aus denen ihre Eltern stammten, komische und hässliche Namen, mit denen sie sich gegenseitig beschimpften und verhöhnten. Manchmal prügelten sie sich, fielen übereinander her, traten sich und taten sich gegenseitig weh. Wenn es ging, suchten die älteren Jungen sich eine Arbeit als Diener oder Boten, aber meistens lungerten sie herum und warteten darauf, stark genug zu werden, um die Arbeit von Männern verrichten zu können. Wenn sie ihn ließen, setzte Yusuf sich zu ihnen, hörte ihren Gesprächen zu und erledigte kleine Botengänge für sie.
Um sich die Zeit zu vertreiben, schwatzten sie oder spielten Karten. Von ihnen hörte Yusuf zum ersten Mal, dass in Penissen Babys leben. Wenn ein Mann ein Kind wollte, steckte er das Baby in den Bauch seiner Frau, wo es mehr Platz hatte, um zu wachsen. Er war nicht der Einzige, der die Geschichte nicht so recht glaubte, und die Jungen zogen ihre Penisse heraus und maßen sie, wenn der Streit hitziger wurde. Schon bald hatte man die Babys vergessen, und die Penisse als solche wurden interessant. Die älteren Jungs protzten mit den ihren und zwangen die jüngeren, ihre kleinen Pimmel herzuzeigen, damit sie darüber lachen konnten.
Manchmal spielten sie kipande. Yusuf war zu klein, um je beim Schlagen dranzukommen, denn wer den Ball schlagen durfte, das hing vom Alter ab und davon, wie stark man war. Aber wenn sie ihn ließen, lief er in der Horde der Fänger mit, die auf staubigen Plätzen wie wild hinter einem runden Stück Holz herjagten. Einmal ertappte sein Vater ihn, wie er mit einer kreischenden Meute Kinder, die einem kipande hinterdrein hetzte, durch die Straßen rannte. Er sah ihn missbilligend an und gab ihm einen Klaps, ehe er ihn nach Hause schickte.
Yusuf machte sich selbst einen kipande und änderte das Spiel, damit er es alleine spielen konnte. Und zwar tat er so, als sei er gleichzeitig auch alle anderen Mitspieler; das hatte den Vorteil, dass er den Ball so lange schlagen konnte, wie er Lust hatte. Er jagte die Straße vor ihrem Haus hinauf und hinunter, brüllte vor Aufregung und versuchte, den kipande zu erwischen, den er ebenso hoch in die Luft geworfen hatte, wie er konnte, damit er genügend Zeit hatte, um an die Stelle zu kommen, an der er herunterfiel.
2
Am Tag von Onkel Aziz’ Abreise hatte Yusuf also keine Gewissensbisse, ein paar Stunden zu vertrödeln, während er auf das Zehn-Anna-Stück lauerte. Um ein Uhr nachmittags kehrten sein Vater und Onkel Aziz zusammen nach Hause zurück. Er sah, wie ihre Körper in dem gleißenden Licht verschwammen, als sie auf dem steinigen Pfad, der zum Haus führte, langsam näher kamen. Mit gesenktem Kopf, die Schultern hochgezogen, um sich gegen die Hitze zu schützen, gingen sie schweigend nebeneinander her. Auf dem schönsten Teppich im Gästezimmer war bereits das Mittagsmahl aufgetragen. Yusuf hatte selbst noch bei den letzten Vorbereitungen geholfen, einige Gerichte zurechtgerückt, damit sie richtig zur Geltung kamen; ein dankbares Lächeln seiner erschöpften Mutter war die Belohnung dafür gewesen. Solange er noch hierbleiben durfte, nutzte Yusuf die Gelegenheit, um das Festessen zu inspizieren. Zwei verschiedene Currys, eines mit Huhn, das andere mit gehacktem Lammfleisch. Der beste Peshawar-Reis, in der halb flüssigen Butter glänzend und mit Sultaninen und Mandeln gesprenkelt. Ein mit einem Tuch bedeckter Korb, der fast überquoll von Gewürzbrötchen, maandazi und mahamri. Spinat in Kokossoße. Ein Teller mit Wasserbohnen. Streifen von getrocknetem Fisch, in der Glutasche des Feuers, auf dem man das Essen gekocht hatte, geröstet. Yusuf kamen fast die Tränen vor Verlangen, als er diesen Überfluss vor sich sah, so anders als die kargen Mahlzeiten, die es sonst gab. Seine Mutter runzelte die Stirn, als sie ihn beobachtete, aber plötzlich blickte er derart tragisch drein, dass sie am Ende doch lachen musste.
Sobald die Männer sich hingesetzt hatten, kam Yusuf mit einem Krug und einer Schale aus Messing herein, ein sauberes Tuch aus Leinen über seinem linken Arm. Langsam goss er das Wasser ein, während Onkel Aziz und sein Vater sich die Hände wuschen. Gäste wie Onkel Aziz mochte er, er mochte sie sehr. Das ging ihm durch den Kopf, als er sich vor dem Gästezimmer hinkauerte für den Fall, dass seine Dienste gebraucht würden. Er wäre gerne im Zimmer geblieben, um zuzusehen, aber sein Vater hatte ihn gereizt angefunkelt und hinausgejagt. Wenn Onkel Aziz hier war, passierte immer irgendetwas. Er nahm alle Mahlzeiten in ihrem Haus ein, obwohl er im Hotel schlief. Das bedeutete, es blieben immer besondere Leckerbissen übrig, wenn sie fertig waren – außer seine Mutter inspizierte sie als Erste, denn dann landeten sie normalerweise im Haus eines Nachbarn oder im Magen eines der Bettler, die gelegentlich an ihre Tür kamen und greinend Gottes Lob murmelten. Seine Mutter meinte, es sei gütiger, das Essen Nachbarn und Bedürftigen zu geben, als selbst in Völlerei zu schwelgen. Yusuf konnte das nicht so recht einsehen, aber seine Mutter erklärte, Tugend berge ihre eigene Belohnung in sich. An ihrer schneidenden Stimme merkte er, wenn er jetzt noch ein Wort sagte, müsste er sich eine lange Predigt anhören, und davon bekam er mehr als genug von dem Lehrer in der Koranschule.
Einen Bettler gab es, bei dem machte es Yusuf nichts aus, mit ihm zu teilen, was er übrig hatte. Sein Name war Mohammed, ein ausgezehrter Mann mit schriller Stimme, der nach verdorbenem Fleisch stank. Eines Nachmittags hatte Yusuf ihn entdeckt, wie er neben ihrem Haus saß und sich eine Handvoll roter Erde nach der anderen, die er aus der Außenwand kratzte, in den Mund schob und aß. Sein Hemd war verdreckt und voller Flecken, und er hatte die zerrissensten kurzen Hosen an, die Yusuf je gesehen hatte. Die Krempe seiner Kappe war dunkelbraun von Schweiß und Schmutz. Ein paar Minuten beobachtete Yusuf ihn und überlegte hin und her, ob er sich erinnern konnte, je einen Menschen gesehen zu haben, der dreckiger war. Und dann ging er und holte ihm eine Schale cassava, die übrig geblieben war. Nachdem Mohammed ein paar Mundvoll gegessen und zwischendurch immer wieder vor Dankbarkeit gewinselt hatte, erzählte er ihm, die Tragödie seines Lebens sei das Kraut. Es sei ihm einmal recht gut gegangen, erklärte er, bewässertes Land und ein paar Tiere habe er gehabt und eine Mutter, die ihn liebte. Tagsüber hatte er mit all seiner Kraft und Ausdauer auf seinem herrlichen Stück Land gearbeitet, und abends hatte er bei seiner Mutter gesessen, die Gottes Lob sang und ihm wundersame Geschichten von der großen weiten Welt erzählte.
Aber dann war das Böse über ihn gekommen, und mit solcher Macht war es über ihn gekommen, dass er Mutter und Land verlassen hatte auf der Suche nach dem Kraut, und jetzt durchstreifte er die Welt, wurde von allen getreten und fraß Erde. Nirgendwo auf seinen Wanderungen hatte er ein so vollkommen zubereitetes Essen gekostet wie das seiner Mutter, außer jetzt vielleicht, das Stück cassava da. Sie lehnten an der Hauswand, und als er Yusuf von seinen Reisen erzählte, wurde seine schrille Stimme lebhaft, und sein verschrumpeltes junges Gesicht durchzog sich mit Lachfältchen, als er ihn zwischen seinen Zahnstummeln hervor angrinste. »Lass dir mein schreckliches Schicksal eine Lehre sein, mein kleiner Freund. Meide das Kraut, ich beschwöre dich!« Seine Besuche dauerten nie lange, und Yusuf freute sich jedes Mal, wenn er ihn sah und von seinen neuesten Abenteuern hörte. Am liebsten mochte er es, wenn Mohammed das bewässerte Land südlich von Witu beschrieb und von dem Leben berichtete, das er in jener glücklichen Zeit geführt hatte. Am zweitliebsten war ihm die Geschichte, wie Mohammed zum ersten Mal ins Irrenhaus von Mombasa gebracht worden war. »Wallahi, ich erzähle dir keine Lügen, Kleiner. Die haben mich für verrückt gehalten! Kannst du dir das vorstellen?« Zuerst hatten sie ihm Salz in den Mund gesteckt und ihn ins Gesicht geschlagen, als er versucht hatte, es auszuspucken. Nur wenn er ruhig dasaß, während die Salzbrocken in seinem Mund zergingen und seine Eingeweide zerfraßen, hatten sie ihn in Frieden gelassen. Von dieser Folter berichtete Mohammed mit Schaudern, aber auch belustigt. Er hatte noch andere Geschichten auf Lager, die Yusuf nicht mochte, von einem blinden Hund, den man gesteinigt, und von Kindern, die man grausam misshandelt hatte. Er erwähnte eine junge Frau, die er in Witu gekannt hatte. Seine Mutter hatte ihn verheiraten wollen, sagte er, und dann lächelte er blöde.
Anfangs versuchte Yusuf, ihn zu verstecken, aus Angst, seine Mutter würde ihn wegjagen, aber wann immer sie auftauchte, buckelte und winselte Mohammed mit solcher Dankbarkeit, dass er einer ihrer Lieblingsbettler wurde. »Ehre deine Mutter, ich flehe dich an!«, wimmerte er, sobald sie in Hörweite war. »Lass dir mein schreckliches Beispiel eine Lehre sein.« Man erzählte sich, sagte Yusufs Mutter ihm später, dass weise Männer, Propheten oder Sultane sich als Bettler verkleideten und sich unter das gemeine Volk und die Armen mischten. Es war immer am besten, sie mit Ehrerbietung zu behandeln. Sobald Yusufs Vater auftauchte, stand Mohammed auf und schlich sich unter winselnden Respektsbekundungen davon.
Einmal stahl Yusuf eine Münze aus der Jacke seines Vaters. Er wusste nicht, warum er das tat. Während sein Vater sich wusch, nachdem er von der Arbeit zurückgekommen war, hatte Yusuf mit der Hand in die stinkende Jacke gegriffen, die an einem Nagel im Zimmer seiner Eltern hing, und eine Münze herausgenommen. Als er sich später das Geldstück ansah, stellte sich heraus, es war eine Silberrupie, und er hatte Angst, etwas damit zu kaufen. Es überraschte ihn, dass niemand dahinterkam, und er war versucht, sie zurückzustecken. Ein paarmal überlegte er, ob er sie Mohammed geben sollte, bekam aber Angst vor dem, was der Bettler zu ihm sagen oder welcher Missetat er ihn beschuldigen würde. Eine Silberrupie, das war die größte Geldsumme, die Yusuf je in Händen gehalten hatte. Er versteckte sie also in einem Spalt unten an einer Mauer, und manchmal stocherte er mit einem Stock darin herum, um eine Ecke davon aufblitzen zu sehen.
3
Den Nachmittag verbrachte Onkel Aziz im Gästezimmer und hielt einen Mittagsschlaf. Yusuf schien dies eine lästige Verzögerung. Auch sein Vater hatte sich in sein Zimmer zurückgezogen, wie jeden Tag nach dem Essen. Yusuf verstand nicht, warum die Leute nachmittags schlafen wollten, als wäre dies ein Gesetz, dem sie gehorchen müssten. Sie nannten das »Ruhen«, und manchmal machte das sogar seine Mutter: Sie verschwand in ihrem Zimmer und zog die Vorhänge zu. Ein- oder zweimal hatte er das auch probiert, aber dabei war ihm so langweilig geworden, dass er Angst bekam, nicht mehr aufstehen zu können. Beim zweiten Mal dachte er sich, so muss es sein, wenn man tot ist: Man liegt wach da, kann sich aber nicht bewegen; wie eine Bestrafung ist das.
Während Onkel Aziz schlief, musste Yusuf in der Küche und im Hof aufräumen. Das ließ sich nicht vermeiden, wenn er bei der Verteilung der Reste mitreden wollte. Zu seiner Überraschung überließ seine Mutter ihn sich selbst und ging zu seinem Vater, um etwas mit ihm zu besprechen. Normalerweise überwachte sie ihn streng und trennte echte Überreste von dem, was noch einmal eine Mahlzeit ergeben konnte. Also zermanschte er das Essen, so gut er konnte, und legte so viel wie möglich beiseite. Er schrubbte und wusch die Töpfe und fegte dann den Hof. Anschließend bezog er im Schatten neben der Hintertür Posten und seufzte über die Last, die er zu tragen hatte.
Als seine Mutter ihn fragte, was er mache, antwortete er, er ruhe. Er versuchte, es nicht wichtigtuerisch klingen zu lassen, aber so klang es und entlockte seiner Mutter ein Lächeln. Unvermittelt streckte sie die Arme nach ihm aus, umschlang ihn und hob ihn hoch, während er wütend um sich trat, um freizukommen. Er hasste es, wie ein Baby behandelt zu werden, und das wusste sie. Seine Füße suchten Halt auf dem nackten Boden, um so seine Ehre zu retten, und er krümmte und wand sich mit unterdrückter Wut. Nur weil er für sein Alter klein war, machte sie das, immer wieder – hob ihn hoch, kniff ihn in die Wangen, umarmte ihn und gab ihm sabbernde Küsse –, und lachte dann über ihn, als wäre er ein Kind. Er war schon zwölf. Zu seiner Überraschung ließ sie ihn diesmal nicht los. Meistens setzte sie ihn ab, sobald er wütend um sich zu treten begann, und gab ihm einen Klaps auf den Po, wenn er davonrannte. Jetzt hielt sie ihn fest, drückte ihn an ihren weichen Busen, sagte nichts und lachte auch nicht. Der Rücken ihres Mieders war noch nass von Schweiß, und ihr Körper roch nach Rauch und Erschöpfung. Er hörte auf, um sich zu schlagen, und ließ zu, dass seine Mutter ihn an sich presste.
Das war seine erste Vorahnung. Als er die Tränen in den Augen seiner Mutter sah, machte sein Herz vor Schrecken einen Sprung. Noch nie hatte er seine Mutter weinen sehen. Er hatte miterlebt, wie sie bei einem Trauerfall in der Nachbarschaft jammerte und klagte, als würde die Welt untergehen, er hatte gehört, wie sie den Allmächtigen anrief, er möge den Lebenden gnädig sein, und ihr Gesicht zerfloss fast vor Flehen. Aber nie dieses stumme Weinen. Er dachte, irgendetwas mit seinem Vater sei vorgefallen, er hätte sie gescholten. Möglicherweise war das Essen für Onkel Aziz nicht gut genug gewesen.
»Ma«, bat er inständig, aber sie legte ihm die Hand auf den Mund.
Vielleicht hatte sein Vater davon gesprochen, wie vornehm seine andere Familie gewesen war. Das hatte Yusuf ihn sagen hören, wenn er wütend war. Einmal war er dabei gewesen, wie er ihr vorgehalten hatte, sie sei die Tochter eines Eingeborenen von der anderen Seite Taitas, der in einer verräucherten Hütte lebte, stinkende Ziegenfelle anhatte und fünf Ziegen und zwei Säcke Bohnen als einen guten Preis für jede Frau betrachtete.
»Wenn dir etwas zustößt, verkaufen sie mir eine andere aus ihrem Pferch, die genauso gut ist wie du«, erklärte er. Sie brauche gar nicht vornehm zu tun, nur weil sie bei zivilisierten Leuten an der Küste aufgewachsen sei. Es machte Yusuf Angst, wenn sie stritten, er spürte ihre harschen Worte wie Messerstiche und erinnerte sich an Geschichten von Gewalt und Verstoßung, die er von anderen Jungen gehört hatte.
Seine Mutter hatte ihm von der ersten Frau berichtet; lächelnd und in dem Ton, der sonst Märchen vorbehalten blieb, erzählte sie ihm die Geschichte. Sie war eine Araberin aus einer alteingesessenen Familie in Kilwa gewesen, nicht ganz eine Prinzessin, aber doch von angesehener Herkunft. Yusufs Vater hatte sie gegen den Willen ihrer stolzen Eltern geheiratet, deren Ansicht nach er nicht vornehm genug für sie war. Denn obwohl er einen guten Namen trug, konnte jeder, der Augen hatte, sehen, dass seine Mutter eine Wilde gewesen sein musste und er selbst nicht mit Reichtümern gesegnet war. Und obgleich ein Name durch das Blut einer Mutter nicht entehrt werden konnte, mussten in der Welt, in der sie lebten, einige praktische Voraussetzungen erfüllt sein. Sie hatten höherfliegende Pläne für ihre Tochter, als sie die Mutter armer Kinder mit den Gesichtern von Wilden werden zu lassen. Sie sagten zu ihm: »Sir, wir danken Gott für die Ehre, die Ihr uns erweist, aber unsere Tochter ist noch zu jung, um ans Heiraten zu denken. In der Stadt gibt es Töchter in Hülle und Fülle, die Eurer würdiger sind als unsere.«
Yusufs Vater hatte jedoch die junge Frau einmal gesehen und konnte sie nun nicht mehr vergessen. Er hatte sich in sie verliebt! Diese Liebe machte ihn verwegen und tollkühn, und er suchte nach Mitteln und Wegen, an sie heranzukommen. Er war fremd in Kilwa, war nur im Auftrag seines Arbeitgebers hier, um eine Lieferung tönerner Wasserkrüge abzugeben, aber er schloss Freundschaft mit dem Besitzer einer Dhau, einem nahodha. Der nahodha bestärkte ihn fröhlich in seiner Leidenschaft für die junge Frau und half ihm bei seinen Listen, um sie für sich zu gewinnen. Abgesehen von allem anderen würde es ihrer selbstzufriedenen Familie einigen Verdruss bereiten, meinte der Bootsführer. Yusufs Vater traf sich heimlich mit der jungen Frau und entführte sie schließlich. Der nahodha, der alle Anlegestellen an der Küste von Faza im hohen Norden bis Mtwara im Süden kannte, brachte sie unbemerkt aufs Festland, nach Bagamoyo. Yusufs Vater fand Arbeit in einem Elfenbeinlager, das einem indischen Kaufmann gehörte, zuerst als Wachmann, dann als Verkäufer und Gelegenheitshändler. Acht Jahre später kam die Frau, die er geheiratet hatte, auf die Idee, nach Kilwa zurückzukehren, nachdem sie zuerst einen Brief an ihre Eltern geschrieben und sie um Vergebung gebeten hatte. Ihre zwei Söhne sollten sie begleiten, um jegliche Vorwürfe ihrer Eltern im Keim zu ersticken. Die Dhau, in der sie segelten, hieß »Jicho«, das Auge. Nachdem sie Bagamoyo verlassen hatte, wurde sie nie wieder gesehen. Yusuf hatte auch seinen Vater von seiner Familie erzählen hören, oft, wenn er sich über etwas ärgerte oder enttäuscht war. Er wusste, die Erinnerungen schmerzten seinen Vater und machten ihn sehr zornig.
Bei einer dieser furchtbaren Auseinandersetzungen, als sie vergessen zu haben schienen, dass er draußen vor der offenen Tür saß, während sie aufeinander losgingen, hörte er seinen Vater stöhnen: »Meine Liebe zu ihr war nicht gesegnet. Du weißt, wie das schmerzt.«
»Wer weiß das nicht?«, fragte seine Mutter. »Wer kennt nicht diesen Schmerz? Oder glaubst du, ich wüsste nichts vom Schmerz einer unerfüllten Liebe? Glaubst du etwa, ich fühle nichts?«
»Nein, nein, klage mich nicht an, nicht du. Du bist das Licht meiner Augen«, rief er, und dabei wurde seine Stimme lauter und brach. »Klage mich nicht an. Fang nicht wieder mit alledem an.«
»Das werde ich nicht«, erwiderte sie, und ihre Stimme sank zu einem zischenden Wispern ab.
Ob sie wieder gestritten hatten? Er wartete darauf, dass sie etwas sagte, wollte hören, was los war, verwirrt, dass es nicht in seiner Macht stand, sie dazu zu bringen, darüber zu reden und ihm zu sagen, warum sie weinte.
»Dein Vater wird es dir sagen«, erklärte sie schließlich. Sie ließ ihn los und ging ins Haus zurück. Unversehens hatte die Düsternis des Vorraums sie aufgesogen.
4
Sein Vater kam zu ihm heraus. Er war eben erst aus seiner Siesta aufgewacht, und seine Augen waren noch rot vom Schlaf. Seine linke Wange war gerötet, vielleicht war das die Stelle, auf der er gelegen hatte. Er zog einen Zipfel seines Unterhemdes heraus und kratzte sich den Bauch, während er mit der anderen Hand über die Stoppeln auf seinem Kinn strich. Sein Bart wuchs rasch, und normalerweise rasierte er sich jeden Nachmittag nach seinem Schläfchen. Nun lächelte er Yusuf zu, und das Lächeln wurde zu einem breiten Grinsen. Yusuf saß immer noch neben der Hintertür, wo seine Mutter ihn zurückgelassen hatte. Jetzt hockte sich sein Vater neben ihn. Yusuf hatte den Eindruck, sein Vater versuche, gleichgültig zu wirken, und das machte ihn unruhig.
»Würdest du gerne eine kleine Reise unternehmen, kleiner Krake?«, fragte sein Vater und zog ihn näher zu sich. Yusuf roch seinen Schweiß, den Schweiß eines Mannes. Er spürte das Gewicht des Armes auf seiner Schulter und widerstand dem Drang, sein Gesicht an der Brust seines Vaters zu vergraben. Für derlei war er zu alt. Seine Blicke flogen zum Gesicht seines Vaters, um die Bedeutung seiner Frage zu verstehen. Sein Vater lachte leise glucksend und drückte ihn einen Augenblick lang fest an sich. »Schau nicht so erfreut drein«, meinte er.
»Wann?«, fragte Yusuf und wand sich vorsichtig los.
»Heute«, erwiderte sein Vater mit lauter Fröhlichkeit. Mit einem kleinen Gähnen grinste er ihn an und versuchte, unbeschwert zu erscheinen. »Jetzt gleich.«
Yusuf stand auf, stellte sich auf die Zehenspitzen und beugte seine Knie. Ganz kurz verspürte er ein Bedürfnis, auf die Toilette zu gehen, aber er starrte ängstlich seinen Vater an und wartete auf das, was noch kommen würde. »Wohin? Und was ist mit Onkel Aziz?«, fragte Yusuf. Der Gedanke an das Zehn-Anna-Stück war stärker als die plötzlich in ihm aufsteigende dumpfe Angst. Er konnte nirgendwohin, solange er nicht sein Zehn-Anna-Stück in Empfang genommen hatte.
»Du fährst mit Onkel Aziz«, antwortete sein Vater und verzog den Mund zu einem schwachen, bitteren Lächeln. Das tat er immer, wenn Yusuf etwas Törichtes zu ihm sagte.
Yusuf wartete, aber sein Vater redete nicht weiter. Einen Augenblick später lachte er und machte dann einen Satz in seine Richtung. Yusuf wich ihm hastig aus und lachte auch.
»Du wirst mit dem Zug fahren«, erklärte sein Vater. »Die ganze Strecke, bis an die Küste. Du magst doch Züge, oder? Die lange Reise ans Meer wird dir gefallen.«
Yusuf wartete, dass sein Vater noch etwas sagte, und konnte nicht verstehen, warum die Aussicht auf seine Reise ihm nicht behagte. Schließlich gab sein Vater ihm einen Klaps auf den Schenkel und sagte, er solle zu seiner Mutter gehen, damit sie ein paar Sachen für ihn zusammenpackte.
Als es Zeit wurde aufzubrechen, schien das Ganze irgendwie unwirklich. An der Vordertür des Hauses sagte er seiner Mutter Auf Wiedersehen und folgte dann seinem Vater und Onkel Aziz zum Bahnhof. Seine Mutter umarmte ihn nicht, gab ihm auch keinen Kuss und vergoss keine Tränen. Das hatte er nämlich befürchtet. Später konnte Yusuf sich nicht erinnern, was seine Mutter getan oder gesagt hatte, aber er erinnerte sich, dass sie krank und wie betäubt ausgesehen und sich erschöpft an den Türpfosten gelehnt hatte. Wenn er an seine Abreise dachte, sah er die flimmernde Straße vor sich, auf der sie gingen, die beiden Männer vorneweg. Vor ihnen schwankte der Träger dahin, der Onkel Aziz’ Gepäck auf seine Schultern geladen hatte. Yusuf durfte sein kleines Bündel selbst tragen: zwei kurze Hosen, einen kanzu, wie neu, vom letzten Idd, ein Hemd, einen Koran und den alten Rosenkranz seiner Mutter. Sie hatte alles außer dem Rosenkranz in einen alten Schal gewickelt und dann die beiden Enden zu einem dicken Knoten geschlungen. Mit einem Lächeln hatte sie einen Stock durch die Schlinge gesteckt, damit Yusuf sein Bündel über der Schulter tragen konnte, so wie die Träger es machten. Den Rosenkranz aus rötlichbraunem Sandstein hatte sie ihm ganz zum Schluss heimlich zugesteckt.
Nie kam ihm der Gedanke, nicht einmal für einen einzigen kurzen Augenblick, er könnte für lange Zeit von seinen Eltern getrennt sein oder sie vielleicht nie wiedersehen. Nie kam ihm der Gedanke zu fragen, wann er zurückkommen würde. Nie dachte er daran, sich zu erkundigen, warum er Onkel Aziz auf seiner Reise begleitete oder warum die Sache so plötzlich hatte entschieden werden müssen. Am Bahnhof sah Yusuf außer der gelben Flagge mit dem grimmigen schwarzen Vogel noch eine andere mit einem schwarzen, silbern eingefassten Kreuz. Die hissten sie, wenn die obersten deutschen Offiziere mit dem Zug fuhren. Sein Vater beugte sich zu ihm hinunter und schüttelte ihm die Hand. Er redete ziemlich lange auf ihn ein, und schließlich wurden seine Augen feucht. Später konnte Yusuf sich nicht erinnern, was er zu ihm gesagt hatte, aber Gott war darin vorgekommen.
Der Zug war schon eine Weile unterwegs, ehe der Reiz des Neuen für Yusuf verflog, und jetzt überwältigte ihn der Gedanke, dass er von zu Hause weg war. Er dachte an das fröhliche Lachen seiner Mutter und fing an zu weinen. Onkel Aziz saß auf der Bank neben ihm, und schuldbewusst blickte Yusuf zu ihm hin, aber er war eingedöst, zwischen die Bank und das Gepäck eingezwängt. Kurz darauf merkte Yusuf, jetzt würden keine Tränen mehr kommen, aber er wollte das Gefühl von Traurigkeit nicht verlieren. Er wischte die Tränen ab und begann, seinen Onkel eingehend zu mustern. Dazu sollte er noch oft Gelegenheit haben, aber dies war das erste Mal, seit er ihn kannte, dass er ihm direkt ins Gesicht blicken konnte. Onkel Aziz hatte gleich, als sie in den Zug gestiegen waren, seine Mütze abgenommen, und Yusuf war erstaunt, wie streng er aussah. Ohne die Kappe wirkte sein Gesicht vierschrötiger, irgendwie unregelmäßig. Als er so still vor sich hin dösend dalag, war seine huldvolle Art, die sonst immer die Blicke auf sich zog, verschwunden. Aber er roch immer noch sehr gut. Das hatte Yusuf immer an ihm gemocht. Das und seine leichten, fließenden kanzus und die mit Silberfäden bestickten Kappen. Wenn er einen Raum betrat, schien seine Gegenwart wie etwas von der Person Losgelöstes hereinzuwehen und Überfluss, Reichtum und Wagemut anzukündigen. Jetzt, als er sich so an das Gepäck lehnte, wölbte sich unter seiner Brust ein kleiner, rundlicher Schmerbauch. Der war Yusuf vorher nie aufgefallen. Während er ihn beobachtete, sah er den Bauch sich mit den Atemzügen heben und senken, und einmal lief ein kleines Zittern darüber.
Seine Geldtaschen aus Leder waren wie üblich um seine Leiste gegürtet und über die Hüftknochen geschlungen; über der Stelle zwischen seinen Schenkeln wurden sie von einer mit Riemen verschnürten Schnalle zusammengehalten, wie eine Art Rüstung. Nie hatte Yusuf gesehen, dass sein Onkel den Geldgürtel ablegte, nicht einmal, wenn er nachmittags schlief. Er musste an die Silberrupie denken, die er in dem Spalt unten an einer Mauer versteckt hatte, und er zitterte bei dem Gedanken, jemand könnte sie entdecken und seine Schuld offenbar werden.
Der Zug war laut. Staub und Rauch wehten durch die offenen Fenster und mit ihnen der Geruch nach Feuer und verkohltem Fleisch. Das Land, das sie durchquerten, erstreckte sich zu ihrer Rechten als flache Ebene, auf die in der sich herabsenkenden Dämmerung lange Schatten fielen. Vereinzelte Höfe und Behausungen klammerten sich an den Boden, schmiegten sich an die dahinwirbelnde Erde. Auf der anderen Seite massige Umrisse von Bergen, um deren Gipfel die untergehende Sonne gleißende Feuerringe aufflammen ließ. Der Zug hatte es nicht eilig, murrend zuckelte er dahin und kämpfte sich der Küste entgegen. Gelegentlich blieb er fast stehen, bewegte sich nur mehr unmerklich und machte dann plötzlich, unter dem quietschenden Protest der Räder, einen Satz nach vorn. Yusuf konnte sich nicht erinnern, dass sie irgendwo angehalten hätten, aber später wurde ihm klar, dass es so gewesen sein musste. Er erhielt seinen Teil von dem Essen, das seine Mutter für Onkel Aziz zubereitet hatte: maandazi, gesottenes Fleisch und Bohnen. Sein Onkel packte das Essen mit geübter Sorgfalt aus, murmelte ein »Bismillah« und lächelte; dann forderte er Yusuf mit einer einladenden Geste seiner halb geöffneten Hand zum Mitessen auf. Freundlich sah er ihm zu und lächelte, als er seine sehnsüchtigen Blicke bemerkte.
Er konnte nicht schlafen. Die Latten der Bank bohrten sich in sein Fleisch und hielten ihn wach. Bestenfalls döste er ein oder lag halb wach da, gequält von dem Bedürfnis, sich zu erleichtern. Als er mitten in der Nacht die Augen aufmachte, ließ der Anblick des nur zur Hälfte besetzten, in düsteres Licht getauchten Waggons den Wunsch in ihm aufkommen, laut zu schreien. Die Dunkelheit draußen war eine unermessliche Leere, und er hatte Angst, der Zug sei schon zu weit in sie eingedrungen, um sicher zurückkehren zu können. Er versuchte, sich auf den Lärm der Räder zu konzentrieren, aber ihr Rhythmus war unregelmäßig und hielt ihn erst recht wach. Er träumte, seine Mutter sei eine einäugige Hündin; er hatte einmal gesehen, wie eine von den Rädern eines Zugs zermalmt worden war. Später träumte er, er sähe seine Feigheit im Mondlicht glimmen, bedeckt vom Schleim seiner Nachgeburt. Er wusste, es war seine Feigheit, denn jemand, der im Schatten stand, sagte ihm, das sei so, und er selbst sah sie atmen.
Am nächsten Morgen kamen sie an ihrem Ziel an, und ruhig und bestimmt geleitete Onkel Aziz Yusuf durch die kreischende Schar von Händlern in und vor dem Bahnhof. Er sprach kein Wort mit Yusuf, als sie durch die Straßen gingen, die bedeckt waren mit den Überbleibseln des Festes, das man kurz zuvor hier gefeiert hatte. Um die Türpfosten wanden sich zu Bögen geformte Palmblätter. Verwelkte Ringelblumen- und Jasmingirlanden lagen zertreten auf den Wegen, und die Straße war mit Obstschalen übersät, die allmählich schwarz wurden. Ein Träger schleppte ihr Gepäck vor ihnen her; er schwitzte und murrte in der Vormittagshitze. Yusuf hatte ihm sein kleines Bündel überlassen müssen.
»Lass es den Träger nehmen«, hatte Onkel Aziz gesagt und dabei auf den grinsenden Mann gedeutet, der, leicht zur Seite gebeugt, vor dem übrigen Gepäck stand.
Der Träger hopste und hüpfte beim Gehen, als er versuchte, das Gewicht von seiner kranken Hüfte auf die andere zu verlagern. Der Straßenbelag war sehr heiß, und Yusuf, der barfuß ging, wünschte, er könnte auch hüpfen, aber ohne dass dieser etwas gesagt hätte, wusste er, Onkel Aziz wäre das nicht recht. An der Art, wie man ihn auf den Straßen grüßte, merkte Yusuf, sein Onkel war ein bedeutender Mann. Der Träger brüllte den Leuten zu, sie sollten Platz machen – »Lasst den Seyyid durch, waungwana« –, und obwohl er so zerlumpt und krank aussah, stellte sich ihm niemand in den Weg. Hin und wieder blickte er sich mit seinem schiefen Grinsen nach ihnen um, und allmählich hatte Yusuf das Gefühl, der Träger wisse von etwas Gefährlichem, von dem er keine Ahnung hatte.
Onkel Aziz’ Haus war ein lang gestrecktes, niedriges Gebäude am Stadtrand. Es stand einige Meter von der Straße zurückversetzt, davor war eine große, baumumstandene Lichtung: kleine Neems, Kokospalmen, ein Sufi- und ein riesiger Mangobaum in einer Ecke des Hofes. Auch noch andere Bäume gab es, die Yusuf jedoch nicht kannte. Im Schatten des Mangobaumes saß, obwohl es noch so früh am Tag war, eine Handvoll Leute. Neben dem Haus verlief eine lange, mit Zinnen bestückte Mauer, über der Yusuf Baum- und Palmwipfel erspähte. Als sie sich näherten, standen die Männer unter dem Mangobaum auf, breiteten ihre Arme aus und riefen Begrüßungen.
Ein junger Mann mit Namen Khalil kam ihnen aus dem Laden an der Vorderseite des Hauses entgegengelaufen, einen Schwall von Willkommensrufen hervorsprudelnd. Ehrerbietig bedeckte er Onkel Aziz’ Hand mit Küssen und hätte sie wieder und wieder geküsst, hätte nicht Onkel Aziz sie schließlich zurückgezogen. Gereizt sagte er etwas; Khalil blieb stumm vor ihm stehen, krampfte seine Hände ineinander und hatte sichtlich Mühe, sich zurückzuhalten und nicht nach Onkel Aziz’ Hand zu greifen. Sie tauschten Begrüßungen und Neuigkeiten in Arabisch aus, während Yusuf zusah. Khalil war ungefähr siebzehn oder achtzehn, sehr mager und zappelig, und auf seiner Oberlippe wuchs ein leichter Flaum. Yusuf merkte, in dem Gespräch war auch von ihm die Rede, denn Khalil drehte sich um, sah ihn an und nickte aufgeregt. Onkel Aziz entfernte sich und ging zu der lang gestreckten, weiß getünchten Seitenmauer des Hauses, in der Yusuf einen offenen Torweg sah. Er erhaschte einen Blick durch das Tor und glaubte dort Obstbäume und blühende Büsche und aufblitzendes Wasser zu erkennen. Als er Onkel Aziz folgen wollte, spreizte dieser die Hand seitwärts ab und hielt sie so ausgestreckt, während er weiterging. Noch nie zuvor hatte Yusuf diese Geste gesehen, aber er spürte den Tadel, der darin lag, und wusste, es bedeutete, er solle ihm nicht folgen. Er blickte zu Khalil und merkte, wie dieser ihn mit einem breiten Lächeln abschätzend musterte; er nickte Yusuf zu und wandte sich wieder zum Laden. Yusuf hob das Bündel mit dem Stock auf, das der Träger hatte liegen lassen, als er Onkel Aziz’ Gepäck ins Haus gebracht hatte. Den Rosenkranz aus rötlichbraunem Sandstein hatte er schon verloren, er hatte ihn im Zug vergessen. Auf einer Bank auf der Terrasse vor dem Laden saßen drei alte Männer; ihre ruhigen Blicke folgten Yusuf, als er sich unter der Klappe des Ladentisches hindurchduckte und in den Laden trat.
5
»Das ist mein kleiner Bruder, er ist gekommen, um für uns zu arbeiten«, erklärte Khalil den Kunden. »Er sieht so klein und schwach aus, weil er gerade erst aus der Wildnis gekommen ist, von da hinten, auf der anderen Seite der Hügel. Dort gibt es nur cassava und Kräuter zu essen. Deswegen sieht er aus wie ein lebender Leichnam. Hey, kifa urongo! Schaut euch den armen Kerl an. Schaut euch diese dünnen Ärmchen und seine sehnsüchtigen Blicke an. Aber wir werden ihn mit Fisch, Bonbons und Honig vollstopfen, und im Handumdrehen ist er fett genug für eine von euren Töchtern. Begrüße die Kunden, Kleiner. Schenk ihnen ein freundliches Lächeln.«
In den ersten paar Tagen lächelte jeder ihm zu, außer Onkel Aziz, den Yusuf nur ein- oder zweimal täglich zu Gesicht bekam. Leute eilten auf Onkel Aziz zu, wenn er vorbeiging, um ihm die Hand zu küssen, falls er dies zuließ, oder sich in ehrfurchtsvollem Abstand von ein oder zwei Metern grüßend vor ihm zu verneigen, wenn er sich unnahbar gab. Die kriecherischen Begrüßungen und Segenswünsche ließen ihn unbeeindruckt, und wenn er lange genug zugehört hatte, um nicht unhöflich zu erscheinen, ging er weiter und steckte dabei noch den Erbärmlichsten seiner Schranzen eine Handvoll Münzen zu.
Yusuf war die ganze Zeit mit Khalil zusammen, der ihn über sein neues Leben aufklärte und über sein altes ausfragte. Khalil kümmerte sich um den Laden, er lebte in dem Laden und interessierte sich offenbar für nichts anderes. Seine ganze Energie und Kraft schien er dafür einzusetzen, wenn er mit einem Ausdruck der Besorgtheit eine Aufgabe nach der anderen erfüllte und dabei vergnügt die Katastrophen herunterhaspelte, die über den Laden hereinbrechen würden, wenn er auch nur zum Verschnaufen innehielte.
»Von dem vielen Reden wirst du noch das Kotzen kriegen«, warnten die Kunden ihn. »Renn nicht so viel rum, junger Mann, sonst trocknest du vor der Zeit aus.«
Khalil aber grinste und plapperte weiter. Er hatte den ausgeprägten Tonfall eines Menschen, der Arabisch sprach, obwohl er fließend Kiswahili konnte. Irgendwie brachte er es fertig, seinen sorglosen Umgang mit der Grammatik geistvoll und ausgefallen zugleich erscheinen zu lassen. Wenn er wütend war oder Angst hatte, stieß er einen nicht einzudämmenden Schwall Arabisch hervor, der die Kunden zu schweigendem, aber verständnisvollem Nachgeben zwang. Als er das zum ersten Mal vor Yusuf machte, musste dieser über sein Ungestüm lachen; da trat Khalil auf ihn zu und schlug ihn mitten auf die linke Wange. Die alten Männer lachten glucksend, wiegten sich hin und her und warfen einander vielsagende Blicke zu, als hätten sie die ganze Zeit gewusst, dass das passieren musste. Sie kamen jeden Tag und saßen auf der Bank, plauderten miteinander und lächelten über Khalils Albernheiten. Waren keine Kunden da, wandte Khalil seine ganze Aufmerksamkeit ihnen zu; er verwandelte sie in ein Publikum für sein groteskes Schwadronieren und unterbrach sie in ihrem geflüsterten Austausch von Neuigkeiten und Kriegsgerüchten mit seinen unvermeidlichen Fragen und gewichtigen Einsichten.
Yusufs neuer Lehrer verlor keine Zeit, eine Reihe von Dingen klarzustellen. Der Tag begann mit der Morgendämmerung und war erst zu Ende, wenn Khalil dies sagte. Albträume und Weinen in der Nacht waren töricht, also genug davon. Jemand könnte meinen, er sei verhext, und würde ihn zum Masseur schicken, damit dieser ihm rot glühende Eisen auf den Rücken legte. An die Zuckersäcke im Laden gelehnt ein Nickerchen einzulegen, war die größte Niedertracht überhaupt. Angenommen, er würde sich dabei in die Hose machen und den Zucker besudeln! Wenn ein Kunde einen Witz reißt, lächle, bis du einen Furz lässt, wenn es sein muss, aber wag es nicht, gelangweilt dreinzuschauen!
»Und was Onkel Aziz betrifft, er ist nicht dein Onkel, damit das klar ist«, sagte er. »Das ist ungeheuer wichtig für dich. Hör mir gut zu, hey, kifa urongo. Er ist nicht dein Onkel.«
So nannte Khalil ihn damals. Kifa urongo, lebender Leichnam. Sie schliefen auf dem Boden der Terrasse vor dem Laden, tagsüber Ladenverwalter und nachts Wachmänner, und deckten sich mit Tüchern aus grober Baumwolle zu. Ihre Köpfe lagen dicht nebeneinander und ihre Körper weit voneinander entfernt, sodass sie leise miteinander reden konnten, ohne sich zu nahe zu kommen. Sooft Yusuf sich zu eng an ihn heranwälzte, stieß Khalil ihn heftig weg. Stechmücken schwirrten um sie herum, wimmerten schrill nach ihrem Blut. Wenn die Tücher von ihren Körpern glitten, sammelten sich die Stechmücken augenblicklich zu ihrem lüsternen Gelage. Yusuf träumte, er sähe, wie ihre gezackten Säbel sich in sein Fleisch fraßen.
Khalil sagte zu ihm: »Du bist hier, weil dein Ba dem Seyyid Geld schuldet. Ich bin hier, weil mein Ba ihm Geld schuldet – nur ist er inzwischen tot, Gott sei seiner Seele gnädig.«
»Gott sei seiner Seele gnädig«, stimmte Yusuf ein.
»Dein Vater muss ein schlechter Geschäftsmann sein …«
»Ist er nicht«, rief Yusuf, der sich damit zwar nicht auskannte, aber nicht bereit war, sich derlei Dreistigkeiten gefallen zu lassen.