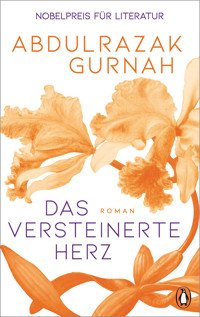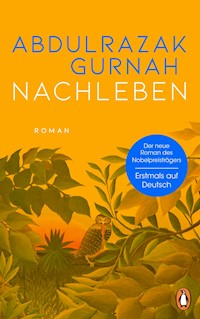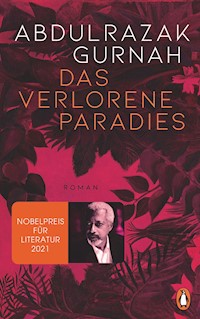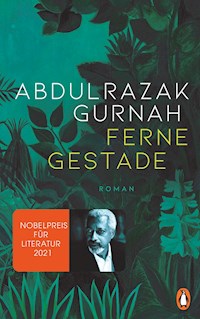
19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Entdecken Sie eine weitere Facette des vielschichtigen Werks von Nobelpreisträger Abdulrazak Gurnah: Die verschlungene Lebens- und Fluchtgeschichte zweier Menschen aus Sansibar – ergreifend, zeitlos und so wahrhaftig wie das Leben selbst
Es ist ein später Novembernachmittag, als Saleh Omar auf dem Flughafen Gatwick landet. In einer kleinen Tasche, dem einzigen Gepäck, das der Mann aus Sansibar bei sich trägt, liegt sein wertvollster Besitz: eine Mahagonischachtel mit Weihrauch. Eben noch war Omar Inhaber eines Geschäftes, er besaß ein Haus, war Ehemann und Vater. Jetzt ist er ein Asylbewerber, und Schweigen ist sein einziger Schutz. Während Omar von einem Beamten ins Verhör genommen wird, lebt nicht weit entfernt, zurückgezogen in seiner Londoner Wohnung, Latif Mahmud. Auch er stammt aus Sansibar, hatte jedoch bei der Flucht aus seiner Heimat einst den Weg über den »sozialistischen Bruderstaat« DDR gewählt. Als Mahmud und Omar Jahre später in einem englischen Küstenort aufeinandertreffen, entrollt sich beider Vergangenheit: eine Geschichte von Liebe und Verrat, von Verführung und Besessenheit, und von Menschen, die inmitten unserer wechselvollen Zeit Sicherheit und Halt suchen. Ein differenzierter Blick auf die Themen Exil und Erinnerung, so bewegend wie meisterhaft erzählt.
Im Original 2002 erschienen, wurde »Ferne Gestade« für den Booker-Preis nominiert. Jetzt liegt der Roman erstmals wieder in der Übersetzung von Thomas Brückner auf Deutsch vor, durchgesehen und mit einem erläuternden Glossar.
»Von den ersten Zeilen an weiß man, dass man sich in den Händen eines echten Schriftstellers befindet, eines Menschen, der etwas über die Welt zu sagen hat.« The Observer
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 548
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Die verschlungene Lebens- und Fluchtgeschichte zweier Menschen aus Sansibar – ergreifend, zeitlos und so wahrhaftig wie das Leben selbst.
Es ist ein später Novembernachmittag, als Saleh Omar auf dem Flughafen Gatwick landet. In einer kleinen Tasche, dem einzigen Gepäck, das der Mann aus Sansibar bei sich trägt, liegt sein wertvollster Besitz: eine Mahagonischachtel mit Weihrauch. Früher war Omar Inhaber eines Geschäftes, er besaß ein Haus, war Ehemann und Vater. Jetzt ist er ein Asylbewerber, und Schweigen ist sein einziger Schutz. Während Omar von einem Beamten ins Verhör genommen wird, lebt nicht weit entfernt, zurückgezogen in seiner Londoner Wohnung, Latif Mahmud. Auch er stammt aus Sansibar, hatte jedoch bei der Flucht aus seiner Heimat einst den Weg über den »sozialistischen Bruderstaat« DDR gewählt. Als Mahmud und Omar Jahre später in einem englischen Küstenort aufeinandertreffen, entrollt sich beider Vergangenheit: eine Geschichte von Liebe und Verrat, von Verführung und Besessenheit und von Menschen, die inmitten unserer wechselvollen Zeit Sicherheit und Halt suchen. Ein differenzierter Blick auf die Themen Exil und Erinnerung, so bewegend wie meisterhaft erzählt.
Im Original 2002 erschienen, wurde »Ferne Gestade« für den Booker Preis nominiert. Jetzt liegt der Roman erstmals wieder in der Übersetzung von Thomas Brückner auf Deutsch vor, durchgesehen und mit einem erläuternden Glossar.
»Von den ersten Zeilen an weiß man, dass man sich in den Händen eines echten Schriftstellers befindet, eines Menschen, der etwas über die Welt zu sagen hat.« The Observer
»Die Echos von Gewalt und Verlorenheit finden sich überall im Werk von Abdulrazak Gurnah, mit dem die Akademie einen Autor geehrt hat, der eine einzigartige Perspektive auf die Geschichte Afrikas bietet.« taz
Abdulrazak Gurnah (geb. 1948 im Sultanat Sansibar) wurde 2021 mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet. Er hat bislang zehn Romane veröffentlicht, darunter »Paradise« (1994; dt. »Das verlorene Paradies«; nominiert für den Booker Prize), »Admiring Silence« (1996; »Donnernde Stille«), »By the Sea« (2001; »Ferne Gestade«; nominiert für den Booker Prize und den Los Angeles Times Book Award), »Desertion« (2006; »Die Abtrünnigen«; nominiert für den Commonwealth Writers’ Prize) und »Afterlives« (2020; nominiert für den Walter Scott Prize und den Orwell Prize for Fiction). Gurnah ist Professor emeritus für englische und postkoloniale Literatur der University of Kent. Er lebt in Canterbury. Seine Werke erscheinen auf Deutsch im Penguin Verlag.
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook.
ABDULRAZAKGURNAH
FERNEGESTADE
ROMAN
Aus dem Englischen von Thomas Brückner
Die Originalausgabe erschien 2001 unter dem Titel By the Sea bei Bloomsbury, London.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © der Originalausgabe 2001 by Abdulrazak Gurnah
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2022
Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: Favoritbuero, München
Covermotiv: © Bridgeman Images
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-29442-7V002
www.penguin-verlag.de
Für Denise
SPUREN
1
Sie hat gesagt, sie wird später vorbeikommen. Und manchmal, wenn sie das ankündigt, tut sie es auch. Rachel. Sie hat mir eine Karte geschickt, weil ich kein Telefon habe. Ich will keins. Auf ihrer Karte hat sie auch bemerkt, ich solle sie anrufen, wenn mir ihr Besuch ungelegen käme, aber ich habe sie nicht angerufen. Es drängt mich nicht danach. Inzwischen ist es spät geworden, und so nehme ich an, dass sie doch nicht vorbeikommen wird, zumindest heute nicht mehr.
Obwohl es auf ihrer Karte hieß, dass sie heute nach sechs vorbeikommen würde. Aber vielleicht war es auch nur eine dieser Gesten, die sich darin erfüllen, dass sie gemacht werden, die mir sagen sollte, dass sie an mich gedacht hatte, in der sicheren Annahme, dass mir das Trost spenden würde. Und das tut es. Es spielt keine Rolle, ich will nur nicht, dass sie in den dunklen Stunden der Nacht hier aufkreuzt, die bedeutungsschwangere Stille mit einem Wirbel aus Erklärungen und Bedauern zertrümmert und mit Plänen herausplatzt, die nur noch mehr von den verbleibenden Stunden der Dunkelheit verschlingen.
Ich staune darüber, wie sehr mir die Stunden der Dunkelheit ans Herz gewachsen sind, wie diese scheinbare Stille der Nacht mit Gemurmel und Gewisper erfüllt ist, während sie doch zuvor so furchteinflößend lautlos wirkte, aufgeladen mit einer unheimlichen Geräuschlosigkeit, die über den Worten hing. Als ob jetzt hier zu leben eine schmale Tür geschlossen und eine andere aufgestoßen hätte, die sich zu einem weiten Platz hin öffnet. In der Dunkelheit verliere ich das Gefühl für den Raum, und in diesem Nirgendwo spüre ich mich selbst deutlicher und kann auch das Spiel der Stimmen klarer ausmachen, als ob sie sich mir zum ersten Mal offenbarten. Manchmal höre ich in der Ferne Musik, gespielt unter freiem Himmel und für mich doch nur als gedämpftes Flüstern vernehmbar. An jedem neuen öden Tag sehne ich mich nach der Nacht, obwohl ich die Dunkelheit mit ihren grenzenlosen Kammern und wechselnden Schatten fürchte. Manchmal glaube ich, dass es mein Schicksal ist, in den Trümmern und dem Durcheinander zerfallender Häuser zu leben.
Es ist schwer zu sagen, wodurch sich die Dinge so entwickelt haben, wie sie jetzt sind, und mit einiger Sicherheit behaupten zu können, erst kam das eine, und das führte zu diesem und jenem, und da sind wir nun. Die Wahrheiten gleiten mir durch die Finger. Selbst wenn ich mir die Ereignisse nochmals ins Gedächtnis rufe, kann ich nur den Nachhall dessen hören, was ich verdränge, an was mich zu erinnern ich vergessen habe, und das macht das Erzählen dann so schwierig, wenn ich es am wenigsten brauchen kann. Doch es ist möglich, wenigstens etwas in Worte zu fassen, und es drängt mich, diesen Bericht loszuwerden, Rechenschaft über die unbedeutenden Dramen abzulegen, die ich erlebt habe und an denen ich beteiligt war und deren Folgen und Anfänge sich mir entziehen. Ich glaube kaum, dass das ein besonders ehrenvolles Bedürfnis ist. Ich meine, weder bin ich im Besitz einer großen Wahrheit, die ich unbedingt kundtun möchte, noch habe ich beispielhafte Erfahrungen gemacht, die unsere Zeitlast und die Umstände unseres Seins erhellen könnten. Aber ich habe gelebt. Ich habe gelebt. Hier, an diesem Ort, ist alles so anders, dass es mir vorkommt, als wäre ein Leben zu Ende gegangen und ich lebte jetzt ein anderes. Vielleicht sollte ich also über mich sagen, dass ich einst an einem anderen Ort ein anderes Leben geführt habe, das jetzt aber vorbei ist. Und doch weiß ich, dass sich dieses frühere Leben einer unverschämt guten Gesundheit erfreut, und das gilt für die Vergangenheit wie für meine Zukunft. Ich habe Zeit, bin ihr geradezu ausgeliefert, und so kann ich ebenso gut Rechenschaft über mich selbst ablegen. Früher oder später müssen wir alle uns dem stellen.
Ich wohne in einer kleinen Stadt am Meer. So wie mein ganzes Leben schon, obwohl ich den größten Teil davon an einem warmen, grünen Meer weit weg von hier verbracht habe. Jetzt führe ich das Halbleben eines Fremden, erhasche über das Fernsehbild Einblicke in das Innere des Lebens hier und errate manches aus den ruhelosen Ängsten, von denen die Leute heimgesucht werden, denen ich auf meinen Spaziergängen begegne. Ich habe keine Vorstellung von ihren Nöten, obwohl ich die Augen offen halte und beobachte, was ich nur kann. Ich befürchte aber, dass ich nur einen Bruchteil dessen erkenne, was ich sehe. Es ist nicht so, dass sie mir geheimnisvoll vorkämen. Es ist ihre Fremdheit, die mich entwaffnet. Ich verstehe so wenig von dem Streben, das noch ihre gewöhnlichsten Handlungen zu begleiten scheint. Sie kommen mir verbraucht und zerfahren vor, und ihre Augen brennen, wenn sie sich gegen innere Unruhen stemmen, die mir unverständlich bleiben. Vielleicht übertreibe ich. Oder ich kann es nicht lassen, darauf herumzureiten, dass ich anders bin als sie, und vermag dem Schauspiel unserer Gegensätzlichkeit nicht zu widerstehen. Vielleicht stemmen sie sich ja bloß gegen den kalten Wind, der vom trüben Meer hereinweht, und ich versuche zu angestrengt, den Anblick zu verstehen. Es fällt mir nach all den Jahren noch ziemlich schwer, nicht hinzusehen, Zurückhaltung zu üben im Hinblick auf die Bedeutung dessen, was ich zu sehen glaube. Ich bin von ihren Gesichtern fasziniert. Sie verhöhnen mich. Glaube ich zumindest.
Die Straßen hier machen mich nervös und verkrampft, und manchmal kann ich wegen des Raschelns und Wisperns, das die niederen Lüfte erfüllt, selbst in meiner abgeschlossenen Wohnung keinen Schlaf finden oder auch nur entspannt dasitzen. In den höheren Lüften herrscht immer große Aufregung, weil dort Gott und seine Engel wohnen und die hohe Politik erörtern und Verrat und Aufruhr aushecken. Zufällige Lauscher oder Spitzel oder Selbstsüchtige sind ihnen nicht willkommen, und das Schicksal des Universums verdüstert ihnen die Brauen und lässt ihr Haar weiß werden. Als Vorsichtsmaßnahme entfesseln die Engel dann und wann einen ätzenden Regenschauer, um übelwollende Lauscher mit der Drohung entstellender Wunden abzuschrecken. Die mittleren Lüfte sind Schlachtfeld des Streits zwischen Lakaien und Vorzimmer-Afreets, weitschweifigen Dschinns und schlaffen Schlangen, die sich dort winden und wälzen und vor Wut schäumen, während sie sich nach den Anweisungen ihrer Herren recken. Ack, ack, hast du gehört, was er gesagt hat? Was kann das heißen? Und in der Dunkelheit der niederen Luftschichten begegnet man den giftlosen Zeitdienern und den Fantasten, die alles glauben und sich allem fügen, den leichtgläubigen und geistlosen Massen, welche die immer engeren Räume bevölkern und verseuchen, in denen sie sich zusammenrotten, und ebendort bin auch ich zu finden. Kein anderer Ort passt auch nur annähernd so gut zu mir. Vielleicht sollte ich sagen: Kein anderer Ort passte auch nur annähernd so gut zu mir. Hier wäre ich in meinen besten Jahren zu finden gewesen. Denn seit ich hier gestrandet bin, fühle ich mich nicht dazu in der Lage, über die Unruhe und die bösen Ahnungen hinwegzusehen, die ich in den Lüften und Gassen dieser Stadt spüre. Nicht überall, das muss ich zugeben. Ich meine, ich empfinde diese Unruhe nicht immer und überall. Möbelgeschäfte zur Morgenstunde, das sind stille, weitläufige Orte, und ich durchstreife sie mit einiger Gelassenheit, weil ich nur von den winzigen Kunstfaserteilchen belästigt werde, von denen die Luft erfüllt ist und die meine Nasenscheidewände und Bronchien angreifen und mich schließlich wieder für einige Zeit hinaustreiben.
Ich habe die Möbelgeschäfte rein zufällig entdeckt, gleich in den ersten Tagen, nachdem sie mich hierher verlegt hatten. Aber ich habe mich schon immer für Möbel interessiert. Zumindest beschweren sie uns und sorgen dafür, dass wir auf dem Boden bleiben, und sie bewahren uns davor, auf die Bäume zu klettern und nackt ein Geheul anzustimmen, wenn uns der Schrecken unseres nutzlosen Daseins überkommt. Sie halten uns davon ab, ziellos durch eine weglose Wildnis zu wandern und auf Waldlichtungen und in tropfenden Höhlen dem Kannibalismus zu verfallen. Ich spreche nur für mich, auch wenn ich annehme, die schweigende Masse in meine kümmerliche Weisheit einbeziehen zu können. Wie dem auch sei, die Flüchtlingsleute haben diese Wohnung für mich aufgetan und mich aus Celias Pension, meiner vorherigen Unterkunft, hergebracht. Die Fahrt von dort hierher war kurz, doch voller Biegungen und Kurven, durch kurze Straßen mit Reihen einander ähnelnder Häuser. Mir war, als verfrachtete man mich in ein Versteck. Nur dass die Straßen so still und gerade dalagen, dass es ein Teil der Stadt hätte sein können, in der ich früher gewohnt habe. Nein, das stimmt nicht. Hier war es zu sauber, zu licht und zu übersichtlich. Zu still. Die Straßen waren zu breit, die Laternenpfähle zu regelmäßig aufgestellt, die Bordsteinkanten waren noch ganz, und alles in bestem Zustand. Nicht dass die Stadt, in der ich früher gelebt habe, besonders düster und schmutzig gewesen wäre, das nicht, aber ihre Straßen wanden sich um sich selbst, rankten sich fest um den faulen Schutt vergorener Heimlichkeiten. Nein, das hier konnte kein Teil jener Stadt sein. Und doch schimmerte da eine Ähnlichkeit durch, denn auch hier kam ich mir eingeengt und beobachtet vor. Und so bin ich, sobald die Flüchtlingsleute weg waren, hinunter auf die Straße gegangen, um zu sehen, wo ich mich befand, und zu versuchen, ans Meer zu gelangen. Dadurch bin ich auf das kleine Dorf aus Möbelgeschäften nicht weit von hier gestoßen, sechs insgesamt, im Viereck um einen Platz angeordnet, mit Parkplätzen und jedes einzelne so groß wie ein Lagerhaus. Die Anlage nennt sich Middle Square Park. Morgens ist es hier meistens leer und ruhig, und ich streife zwischen den Betten und Sofas umher, bis mich die Kunstfasern hinausjagen. Jeden Tag besuche ich ein anderes Geschäft, und nachdem man ein- oder zweimal da gewesen ist, suchen die Verkäufer auch keinen Blickkontakt mehr. Ich wandere um die Sofas und Esstische, die Betten und Kommoden, rekele mich ein paar Sekunden auf einem Ausstellungsstück, probiere den Mechanismus aus, prüfe den Preis, vergleiche den Stoff eines Möbelstücks mit dem eines anderen. Unnötig zu sagen, dass einige hässlich und übermäßig verziert sind, aber andere sind grazil und kunstvoll gearbeitet, und eine Zeit lang empfinde ich in diesen Lagerhäusern eine Art Zufriedenheit und die Aussicht auf Gnade und Vergebung.
Ich bin Flüchtling. Asylbewerber. Diese Worte sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen, auch wenn man so an sie gewöhnt ist, dass sie einem alltäglich erscheinen. Ich bin am Spätnachmittag des 23. November vergangenen Jahres auf dem Flughafen Gatwick angekommen. Es ist ein gewohnter, unbedeutender Höhepunkt in unseren Lebensgeschichten, dass wir hinter uns lassen, was wir kennen, und an fremden Gestaden landen, zusammengewürfelte Kleinigkeiten im Gepäck und geheime und verstümmelte Sehnsüchte unterdrückend. Für einige, wie für mich auch, war es die erste Flugreise überhaupt und zugleich die erste Ankunft an einem Ort von der gewaltigen Größe eines Flughafens. Dabei bin ich durchaus schon gereist, zu Land und per Schiff. Und in meiner Fantasie. Langsam lief ich durch etwas, das mir damals wie stille, leere und von kaltem Licht erhellte Tunnel vorkam und von dem ich rückblickend heute weiß, dass es Stuhlreihen, große Glasfenster und Warnschilder und Hinweiszeichen waren. Ein Tunnel nach dem anderen, draußen flutende Dunkelheit, die mit einem feinen Regen um sich schlug, und das Licht drinnen, das mich einsog. Das, was wir kennen, lässt uns beständig unsere Unwissenheit erfahren, lässt uns die Welt sehen, als hockten wir noch immer in jenem seichten, lauwarmen Teich, der uns seit den Schrecken der Kindheit vertraut ist. Ich ging langsam, an jeder Kreuzung in banger Erwartung eines überraschenden Hinweisschilds, das mir sagte, wohin ich zu gehen hatte. Ich ging langsam, damit ich keine Abzweigung verpasste oder ein Schild falsch deutete und damit ich nicht vorzeitig die Aufmerksamkeit auf mich zöge, indem ich orientierungslos herumirrte. Sie fischten mich an der Passkontrolle raus. »Den Pass«, sagte der Mann, nachdem ich einen Wimpernschlag zu lange vor ihm gestanden hatte, darauf wartend, dass man mich überführte, dass man mich festnahm. Sein Gesicht sah streng aus, obwohl die Leere in seinen Augen darauf abzielte, nichts preiszugeben. Man hatte mir den Wink gegeben, nichts zu sagen, so zu tun, als würde ich kein Englisch sprechen. Ich war mir nicht sicher, warum, aber ich war entschlossen zu tun, was man mir empfohlen hatte, denn der Ratschlag hatte etwas Listiges von der Art einfallsreicher Verschlagenheit an sich, die den Machtlosen eigen ist. Sie werden dich nach deinem Namen fragen und dem deines Vaters und danach, was du in deinem Leben Gutes getan hast: Sag nichts. Als er zum zweiten Mal »Den Pass« sagte, reichte ich ihn rüber und zuckte in Erwartung von Beschimpfungen und Drohungen zusammen. Ich war Beamte gewöhnt, die dich wegen des geringsten Fehlverhaltens wütend anstarrten und anzischten, die mit dir spielten und dich demütigten, aus schierer Lust daran, dich ihre geheiligte Macht spüren zu lassen. Deshalb war ich darauf gefasst, dass der hamal der Einwanderungsbehörde hinter seinem kleinen erhöhten Tresen etwas aufschreiben, knurren oder den Kopf schütteln würde, langsam den Blick heben und mich mit dem Leuchten der Gewissheit in den Augen anstarren würde, mit dem die Glücklichen den Bittsteller betrachten. Er aber blickte mit einem Ausdruck unterdrückter Freude vom Durchblättern meines Undings von einem Pass hoch wie ein Angler, der gerade einen heftigen Ruck an der Angelschnur gespürt hat. Kein Einreisevisum. Dann griff er zum Telefonhörer und sprach einen Augenblick lang hinein. Jetzt lächelte er offen und bat mich, an der Seite zu warten.
Ich stand mit gesenktem Blick da und bemerkte deshalb nicht, wie ein Mann an mich herantrat und mich zu weiterer Befragung mitnahm. Er sprach mich mit Namen an und lächelte, als ich aufsah. Es war ein freundliches, welterfahrenes Lächeln, das mit einiger Zuversicht zu sagen schien: »Warum kommen Sie nicht einfach mit mir mit, damit wir dieses kleine Problem aus der Welt schaffen können?« Als er forsch vor mir herging, stellte ich fest, dass er Übergewicht hatte und ungesund aussah, und als wir in einem Befragungsraum ankamen, atmete er schwer und zerrte an seinem Hemd. Er setzte sich auf einen Stuhl und rutschte gleich unbehaglich darauf herum, und ich sah ihn als jemanden, der schwitzend in einer Hülle gefangen ist, die er nicht mag. Das ließ die Angst in mir aufsteigen, dass ihn seine üble Laune gegen mich einnehmen könnte, aber dann lächelte er erneut und verhielt sich höflich und gewinnend. Wir befanden uns in einem kleinen, fensterlosen Raum mit hartem Fußboden, einem Tisch zwischen uns und einer Bank, die sich an einer Wand entlangzog. Der Raum wurde von kalten, fluoreszierenden Leuchtbändern erhellt, die die zinngrauen Wände, aus meinen Augenwinkeln betrachtet, enger zusammenrücken ließen. Er teilte mir mit, dass er Kevin Edelman heiße, und zeigte dabei auf das Namensschild an seinem Jackett. Möge Gott dir Gesundheit schenken, Kevin Edelman. Er lächelte erneut. Er lächelte überhaupt viel, vielleicht weil er meine Anspannung sehen konnte, obwohl ich mir alle Mühe gab, sie zu verbergen, und er mich beruhigen wollte, oder weil es sich bei seiner Arbeit möglicherweise nicht vermeiden ließ, sich am Unbehagen derer zu weiden, die bei ihm landeten. Vor ihm lag ein gelber Block, und ein oder zwei Augenblicke lang schrieb er etwas darauf, übertrug den Namen aus meinem falschen Pass, bevor er wieder zu mir sprach.
»Darf ich bitte Ihr Ticket sehen?«
Ticket? Ja, natürlich.
»Ich sehe, Sie haben Gepäck«, sagte er und zeigte auf etwas. »Ihr Gepäckabholschein.«
Ich stellte mich dumm. Man mag noch das Wort »Ticket«verstehen können, wenn man kein Englisch spricht, aber »Gepäckabholschein«?Das schien mir doch ein bisschen gewagt.
»Ich werde Ihr Gepäck abholen lassen«, sagte er und legte das Ticket neben seinen Schreibblock. Dann lächelte er wieder, unterbrach sich darin, mehr zu diesem Thema zu sagen. Ein längliches Gesicht, ein wenig fleischig an den Schläfen, vor allem, wenn er lächelte.
Vielleicht lächelte er nur im Vorgefühl des zweifelhaften Vergnügens, in meinem Gepäck herumzustochern, und in der Gewissheit, dass ihm, was er dort zu Gesicht bekäme, sagen würde, was er wissen musste, mit oder ohne meine hilfreiche Beteiligung. Ich stelle mir vor, dass eine solche Untersuchung einige Lust bereiten kann, so als schaute man in ein Zimmer, bevor es für eine Besichtigung vorbereitet und seine wahrhaftige Gewöhnlichkeit in eine Art Spektakel verwandelt worden ist. Ich stelle mir auch das Behagen vor, einen garantierten Zugang zu den Geheimcodes zu besitzen, mit denen die Geheimnisse jener entschlüsselt werden können, die etwas zu verbergen haben. Eine Art Hermeneutik des Gepäcks, die sich anlässt wie das Verfolgen einer archäologischen Spur oder das Studium der Linien auf einer Seekarte. Ich blieb stumm und passte meinen Atemrhythmus dem seinen an, weil ich spüren wollte, wann Zorn in ihm aufzusteigen begann. Grund für die gewünschte Einreise in das Vereinigte Königreich? Sind Sie Tourist? Auf Urlaub? Irgendwelche Geldmittel? Haben Sie überhaupt Geld, Sir? Travellerschecks? Pfund Sterling? Dollars? Kennen Sie jemanden, der eine Bürgschaft übernehmen würde? Haben Sie eine Kontaktadresse? Gibt es jemanden, bei dem Sie während Ihres Aufenthaltes im Vereinigten Königreich zu bleiben hoffen? Ach, zur Hölle, verflucht noch mal, zur Hölle. Haben Sie Familie im Vereinigten Königreich? Sprechen Sie Englisch, Sir? Ich bedaure, aber Ihre Dokumente sind nicht in Ordnung, Sir, und ich werde Ihnen die Einreisegenehmigung verweigern müssen. Es sei denn, Sie können mir etwas über Ihre Lage sagen. Verfügen Sie über irgendwelche Unterlagen, die mir helfen könnten, Ihre Lage zu verstehen? Papiere, haben Sie irgendwelche Papiere?
Er verließ den Raum, und ich blieb gefasst und still sitzen, unterdrückte einen Seufzer der Erleichterung und zählte von hundertfünfundvierzig an rückwärts, denn bis zu dieser Zahl war ich gekommen, während er auf mich eingeredet hatte. Ich zwang mich dazu, mich nicht vorzubeugen und auf seinen Schreibblock zu schauen, für den Fall, dass er mein einfältiges Schweigen durchschaut hatte, und weil ich außerdem vermutete, dass mich jemand durch ein Guckloch beobachtete und nur auf einen so belastenden Schachzug wartete. Es muss die Aufregung des Augenblicks gewesen sein, die mich so denken ließ. Als ob es irgendjemanden gekümmert hätte, ob ich in der Nase bohrte oder Diamanten in meinen Eingeweiden versteckt hatte. Früher oder später würden sie sowieso alles herausbekommen, was sie wissen mussten. Sie besaßen Maschinen für all diese Sachen. Man hatte mich davor gewarnt. Und ihre Beamten waren ausgiebig darin geschult, die Lügen zu durchschauen, die Leute wie ich auftischten, und verfügten über einen reichen Erfahrungsschatz. Also blieb ich still sitzen und zählte schweigend vor mich hin, schloss dann und wann die Augen, um Verzweiflung, Nachdenklichkeit und eine Spur Resignation vorzugaukeln. Mach mit mir, was du willst, o Kevin.
Er kehrte mit der kleinen grünen Stofftasche zurück, die mein Gepäck enthielt, und stellte sie auf der Bank ab. »Bitte machen Sie das auf«, sagte er. Ich blickte erregt und verständnislos drein, wie ich hoffte, und wartete darauf, dass er weiter ausholte. Er starrte mich an und zeigte auf die Tasche, und so stand ich mit einem Lächeln der Erleichterung und des Verstehens und einem beschwichtigenden Nicken auf, um den Reißverschluss der Tasche aufzuziehen. Er nahm die einzelnen Gegenstände nacheinander heraus und legte sie behutsam auf die Bank, als packte er besonders kostbare Kleidungsstücke aus: zwei Hemden, blau das eine, das andere gelb, beide ausgeblichen, drei weiße T-Shirts, eine braune Hose, drei Unterhosen, einen kanzu, zwei sarunis, ein Handtuch und ein kleines Holzkästchen. Er seufzte, als er zu diesem letzten Gegenstand kam, drehte ihn interessiert und schnüffelte dann daran. »Mahagoni?«, fragte er. Ich gab natürlich keine Antwort. Mich berührten gerade die armseligen Erinnerungsstücke eines ganzen Lebens, die in diesem stickigen Raum auf der Bank ausgebreitet lagen. Es war nicht mein Leben, das auf dieser Bank ausgelegt wurde, sondern lediglich das, was ich als Zeichen für die Geschichte ausgewählt hatte, die ich zu vermitteln hoffte. Kevin Edelman öffnete das Kästchen und schrak angesichts des Inhalts überrascht zurück. Vielleicht hatte er Schmuck oder etwas Wertvolles erwartet. Drogen. »Was ist das?«, fragte er und beschnüffelte vorsichtig das geöffnete Kästchen. Das war gar nicht nötig, denn kaum dass er die Schachtel geöffnet hatte, erfüllte sich der Raum mit wunderbarem Duft. »Weihrauch«, meinte er. »Stimmt doch, oder?« Er schloss das Kästchen und stellte es auf die Bank. Seine müden Augen funkelten vor Vergnügen. Ausgefallene Beute aus der stinkenden Gluthitze irgendeines Bazars. Ich setzte mich seiner Anordnung gemäß auf den Stuhl und wartete, während er mit seinem Schreibblock zur Bank zurückging und die schmuddeligen Gegenstände notierte, die er dort abgelegt hatte.
Wieder am Tisch, schrieb er noch einen Augenblick weiter und hatte inzwischen zwei oder drei Blätter seines Schreibblocks ausgefüllt. Dann legte er seinen Stift weg, lehnte sich zurück und zuckte etwas zusammen, als sich die Stuhllehne in seine müden Schulterblätter grub. Er wirkte zufrieden mit sich, beinahe schon vergnügt. Ich sah, dass er kurz davor stand, das Urteil zu verkünden, und konnte nicht verhindern, dass Niedergeschlagenheit und Panik in mir aufwallten. »Mr. Shaaban, weder kenne ich Sie, noch weiß ich um die Gründe, die Sie hierhergeführt haben, oder um die Ausgaben, die Sie aufgewendet haben, und all das. Deshalb bedauere ich, was ich jetzt tun muss, denn ich fürchte, ich muss Ihnen die Einreise in das Vereinigte Königreich verwehren. Sie besitzen kein gültiges Einreisevisum, verfügen über keinerlei Geldmittel und haben niemanden, der für Sie bürgen könnte. Ich bezweifle, dass Sie verstehen können, was ich sage, aber ich bin verpflichtet, Ihnen das mitzuteilen, bevor ich Ihren Pass abstemple. Sobald ich Ihren Pass mit dem Vermerk versehen habe, dass Ihnen die Einreise verweigert wurde, bedeutet das, dass Sie beim nächsten Versuch, in das Vereinigte Königreich einzureisen, unweigerlich abgewiesen werden. Es sei denn, Ihre Papiere sind in Ordnung. Haben Sie verstanden, was ich gerade gesagt habe? Nein, ich glaube nicht. Es tut mir leid, aber wir müssen diesen Formalitäten trotzdem Genüge tun. Wir werden uns bemühen, jemanden zu finden, der Ihre Sprache spricht, damit man Ihnen das alles zu einem späteren Zeitpunkt erklärt. In der Zwischenzeit werden wir Sie in das nächste verfügbare Flugzeug setzen, zurück zum Bestimmungsort, von dem Sie kamen, und zwar mit derselben Fluglinie, die Sie hergebracht hat.« Damit blätterte er wieder in meinem Pass, suchte nach einer leeren Seite und griff dann nach dem kleinen Stempel, den er auf den Tisch gelegt hatte, als er vorhin zurückgekommen war.
»Flüchtling«, sagte ich. »Asyl.«
Er schaute hoch, und ich schlug die Augen nieder. Seine blickten wütend. »Sie sprechen also doch Englisch«, sagte er. »Mr. Shaaban, Sie wollen mich wohl verarschen.«
»Flüchtling«, wiederholte ich. »Asyl.« Ich schaute kurz auf, als ich das sagte, und wollte es gerade noch ein drittes Mal wiederholen, als Kevin Edelman mich unterbrach. Sein Gesicht war ein kleines bisschen dunkler geworden, und seine Atmung hatte sich verändert, war nicht mehr so leicht nachzumachen. Er atmete zweimal tief durch, sichtlich darum bemüht, sich zu beherrschen, obwohl er eigentlich am liebsten einen Hebel betätigt hätte, auf dass sich der Boden unter meinen Füßen zu einem luftigen und bodenlosen Fall öffne. Ich weiß das, weil ich mir genau dasselbe in meinem früheren Leben unzählige Male gewünscht habe.
»Mr. Shaaban, sprechen Sie Englisch?«, fragte er, während er seine Stimme wieder mäßigte, doch nun klang sie eher verschwitzt als ölig, war sozusagen amtshalber sanft, bemüht.
»Flüchtling«, sagte ich und tippte mir an die Brust. »Asyl.«
Er griente mich an, als ob ich ihn schikanierte, und schenkte mir einen langen Blick, den ich diesmal mit einem Lächeln erwiderte. Er seufzte matt, schüttelte dann langsam den Kopf und schmunzelte. Vielleicht belustigte ihn mein verständnisloses Lächeln. Sein Verhalten bewirkte, dass ich mir wie ein lästiger und stumpfsinniger Häftling vorkam, den er verhört und der ihn gerade bei einem belanglosen Wortspiel geärgert hatte. Ich ermahnte mich, allerdings unnötigerweise, mich für einen möglichen Überraschungsangriff zu wappnen. Unnötigerweise, weil er viele Möglichkeiten zur Auswahl hatte und ich nur eine einzige: dafür zu sorgen, dass Kevin Edelman nicht zornig wurde und eine grausame Tat in Erwägung zog. Es müssen der kleine Raum und die doppelzüngige Höflichkeit, mit der er mit mir sprach, gewesen sein, deretwegen ich mir wie ein Häftling vorkam, während wir beide, er wie ich, genau wussten, dass ich versuchte, mir Zugang zu verschaffen, und er, mir ebendiesen zu verwehren. Erschöpft blätterte er wieder in meinem Pass herum, und erneut kam ich mir wie ein Quälgeist vor, der vernünftigen Leuten unnötige Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten bereitete. Dann ließ er mich allein im Raum und ging hinaus, um sich zu beraten und zu prüfen.
Ich wusste bereits, was er herausfinden würde: Die britische Regierung hatte beschlossen, aus Gründen, die mir bis heute nicht ganz verständlich sind, dass Menschen, die da herkamen, wo ich herkam, Anspruch auf Asyl hatten, wenn sie behaupteten, ihr Leben sei in Gefahr. Die Briten wollten einem internationalen Publikum auseinandersetzen, dass sie unsere Regierung als Gefahr für die eigenen Bürger einstuften, was sie ebenso gut wie alle anderen seit langer Zeit wussten. Doch die Zeiten hatten sich geändert, und jetzt musste jedes aufgeblasene Mitglied der internationalen Gemeinschaft zeigen, dass man sich nicht länger von dem aufsässigen und ewig zankenden Lumpenpack, von dem es in jenen ausgedörrten Savannen nur so wimmelte, auf der Nase herumtanzen lassen wollte. Genug war genug. Was stellte unsere Regierung jetzt Schlimmeres an als das, was sie früher schon getan hatte? Sie manipulierte eine Wahl und fälschte unter den Augen der internationalen Beobachterdie Zahlen, während sie zuvor die Bürger des Landes lediglich eingesperrt, vergewaltigt, getötet oder anderweitig erniedrigt hatte. Wegen dieses verbrecherischen Verhaltens gewährte die britische Regierung jedem Asyl, der behauptete, dass sein Leben in Gefahr sei. Das war eine wohlfeile Art, strengstes Missfallen zu bekunden, denn wir waren ja nicht zu viele auf unserem kleinen Eiland vergleichsweise armer Menschen, von denen nur wenige das Geld für die Überfahrt würden aufbringen können. Ein paar Dutzend junge Leute schafften es, das Fahrgeld aufzutreiben, indem sie Eltern und Verwandte dazu zwangen, sich von heimlich gehorteten Schätzen zu trennen oder sich etwas zu borgen, und tatsächlich wurden sie bei ihrer Ankunft in London als Asylbewerber aufgenommen, die um ihr Leben zu fürchten hatten. Auch ich fürchtete um mein Leben, hatte schon jahrelang darum gefürchtet, aber erst vor Kurzem hatte sich meine Angst zu einer bedrohlichen Krise ausgewachsen. Als mir dann zu Ohren kam, dass die jungen Leute aufgenommen worden waren, beschloss ich, mich selbst auf diese Reise zu begeben.
Daher war mir klar, dass Kevin Edelman in ein paar Minuten mit einem anderen Stempel in der Hand zurückkommen und ich danach auf dem Weg in Gewahrsam oder irgendeine Unterkunft sein würde. Es sei denn, die britische Regierung hatte ihre Meinung geändert, während ich mich in der Luft befand, und beschlossen, dass der Spaß schon zu lange gewährt habe. Was nicht zutraf, denn Kevin Edelman kam ein paar Minuten später zurück und verzog amüsiert das Gesicht, sah aber auch geschlagen aus. Ich konnte erkennen, dass er mich schließlich doch nicht wieder in das Flugzeug setzen und dahin zurückschicken würde, woher ich gekommen war, an diesen anderen Ort, an dem die Unterdrückten irgendwie überleben. Fürs Erste war ich erleichtert.
»Mr. Shaaban, warum wollen Sie sich das antun, ein Mann in Ihrem Alter?«, fragte er und ließ sich plump auf den Stuhl sinken; betrübt und mit Sorgenfalten auf der Stirn ließ er sich gegen die Stuhllehne fallen und rieb sich an der Lehne langsam die Schultern. »Wie sehr ist Ihr Leben denn wirklich in Gefahr? Ist Ihnen eigentlich klar, was Sie da machen? Wer immer Sie dazu überredete, hat Ihnen keinen Gefallen getan, das will ich Ihnen sagen. Sie sprechen nicht einmal unsere Sprache, und wahrscheinlich lernen Sie die nie. Es kommt nur selten vor, dass alte Leute noch einmal eine neue Sprache lernen. Wussten Sie das? Es kann Jahre dauern, bis Ihr Antrag bearbeitet ist, und dann schickt man Sie vielleicht trotzdem zurück. Niemand wird Ihnen Arbeit geben. Sie werden einsam sein, unglücklich und arm, und wenn Sie krank werden, wird niemand da sein, der sich um Sie kümmert. Warum sind Sie nicht in Ihrem Heimatland geblieben? Dort hätten Sie in Frieden alt werden können. Das hier ist etwas für junge Männer, dieses Asyl-Spiel, denn es geht doch eigentlich nur darum, in Europa Arbeit und Wohlstand zu finden, oder? Da geht es doch nicht um Moral, sondern nur um Gier. Nicht um die Angst ums nackte Leben und den Wunsch nach Sicherheit, einfach nur um Gier. Mr. Shaaban, ein Mann in Ihrem Alter sollte eigentlich klüger sein.«
In welchem Alter braucht man angeblich keine Angst mehr um sein Leben zu haben? Oder darf sich nicht mehr wünschen, ohne Furcht leben zu können? Woher wollte er wissen, dass mein Leben weniger in Gefahr war als das der jungen Männer, die sie hereingelassen hatten? Und wieso war es unmoralisch, wenn man besser und sicherer leben wollte? Wieso sollte das Gier oder ein Spiel sein? Jedoch berührte mich seine Sorge, und ich wünschte mir, mein Schweigen brechen und ihm sagen zu können, dass er sich keine Gedanken machen sollte. Ich war schließlich nicht erst gestern auf die Welt gekommen und wusste, wie man klarkam. Bitte stempeln Sie meinen Pass ab, Sie freundlicher Sir, und schicken Sie mich an irgendeinen sicheren Ort der Verwahrung. Ich senkte die Augen für den Fall, dass ihre Wachheit ihm offenbarte, dass ich ihn verstand.
»Mr. Shaaban, schauen Sie sich doch an, und sehen Sie sich die Sachen an, die Sie mitgebracht haben«, fuhr er sichtlich enttäuscht fort und wies mit dem Arm in Richtung meiner irdischen Besitztümer. »Das ist alles, was Sie haben werden, wenn Sie hierbleiben. Was hoffen Sie hier zu finden? Ich will Ihnen etwas sagen. Meine Eltern waren auch Flüchtlinge, aus Rumänien. Ich würde Ihnen davon erzählen, wenn wir mehr Zeit hätten, aber was ich eigentlich meine, ist dies: Ich habe eine Vorstellung davon, was es heißt, sich selbst zu entwurzeln und fortzugehen, um an einem anderen Ort zu leben. Ich weiß, wie hart es ist, arm und ein Fremder zu sein, denn das haben meine Eltern ebenfalls durchgemacht, nachdem sie hier angekommen waren, und ich weiß auch um den Lohn. Meine Eltern aber sind Europäer, sie haben ein Recht darauf, sie gehören zur Familie. Mr. Shaaban, sehen Sie sich doch an. Es macht mich traurig, Ihnen das zu sagen, weil Sie mich nicht verstehen werden, und ich wünschte verdammt noch mal, Sie täten es. In Scharen kommen Leute wie Sie hierher, ohne jeden Gedanken daran, welchen Schaden sie anrichten. Sie gehören nicht hierher, Sie wertschätzen nicht dieselben Dinge wie wir. Sie haben nicht über Generationen hinweg für diese Dinge bezahlt, und wir wollen Sie hier nicht haben. Wir werden Ihnen das Leben schwer machen, Sie Demütigungen erleiden lassen, Ihnen vielleicht sogar mit Gewalt begegnen. Mr. Shaaban, warum wollen Sie sich das antun?«
O schmölze doch dies allzu feste Fleisch, zerging und löst in einen Tau sich auf! Es war mir nicht schwergefallen, meine Atemzüge, solange er redete, den seinen anzupassen. Bis zum Schluss nicht, denn die meiste Zeit blieb seine Stimme ruhig und sachlich, so als rezitiere er lediglich Vorschriften. Edelman, war das ein deutscher Name? Oder ein jüdischer? Oder ein erfundener? Ins Tal der Tränen, Jude, juhu. Wie dem auch sei, es handelte sich um den Namen eines der Besitzer Europas, der Europas Werte kannte und über Generationen hinweg für diese gezahlt hatte. Dabei hatte bereits die ganze Welt für Europas Werte gezahlt, hatte die meiste Zeit nur gezahlt und gezahlt, ohne sich ihrer erfreuen zu dürfen. Stellen Sie sich mich als eins dieser vielen Artefakte vor, die sich Europa einverleibt hat. Ich dachte daran, etwas in dieser Richtung zu sagen, aber ich ließ es natürlich bleiben. Ich war Asylbewerber, zum ersten Mal in Europa, zum ersten Mal auf einem Flughafen, allerdings nicht zum ersten Mal in einem Verhör. Ich kannte die Bedeutung des Schweigens, wusste um die Gefahr der Worte. Also behielt ich meine Gedanken für mich. Erinnern Sie sich an das endlos lange Verzeichnis von Artefakten, die nach Europa geschafft wurden, weil sie zu zerbrechlich und zart waren, um sie in den ungeschickten und achtlosen Händen der Eingeborenen lassen zu können? Auch ich bin zerbrechlich und kostbar, ein heiliges Werk, zu zart, um sie den Händen der Eingeborenen zu überlassen, also nehmen Sie mich besser auch zu sich. Ein Scherz, ein Scherz. Was Demütigungen und Gewalt angeht, so werde ich es wohl einfach darauf ankommen lassen müssen – zumal es nur wenige Orte gibt, an denen man Ersterem aus dem Weg gehen kann, und das Zweite kann einen aus dem Nichts überfallen. Wenn es darum geht, jemanden an seiner Seite zu haben, wenn man alt und bedürftig ist, so sollte man besser nicht zu stark auf diesen Trost hoffen. O Kevin, möge das Ruder deines Lebens immer den Kurs halten, und möge der Hagelsturm dich nie im Freien antreffen. Mögest du nie die Geduld mit diesem Bittsteller verlieren, und wärest du so freundlich, jetzt diesen Stempel in meinen Witz von einem Pass zu drücken und mir zu erlauben, die Werte der europäischen Menschengeschlechter zu beschnuppern, Alhamdulillah. Meine Blase bedarf dringend der Erleichterung. Ich traute mich nicht einmal, Letzteres zu sagen, obwohl es zu diesem Zeitpunkt der Wahrheit entsprach. Das Schweigen bürdet einem unerwartete Unannehmlichkeiten auf.
Er redete weiter, stirnrunzelnd und kopfschüttelnd, aber ich hörte ihm nicht mehr zu. Das ist etwas, das ich mir über die Jahre hinweg angeeignet habe, um mir ein bisschen Ruhe angesichts der plärrenden Lügen zu verschaffen, die ich in meinem früheren Leben zu erdulden hatte. Stattdessen starrte ich stumpfsinnig auf meinen Pass und erinnerte Kevin Edelman dadurch daran, dass der hier entkommen war, könnte er also bitte diesem Spiel ein Ende machen und unterzeichnen. Plötzlich hielt er inne, ließ enttäuscht von seiner wohlmeinenden Absicht ab, mich dazu zu überreden, wieder ins Flugzeug zu steigen und Europa seinen rechtmäßigen Besitzern zu überlassen, und wühlte sich, den anderen Stempel, den richtigen, in den Fingern, durch meinen Pass. Dann fiel ihm etwas ein, und das ließ ihn lächeln. Er ging erneut zu meiner Tasche und nahm das Holzkästchen heraus. Wie zuvor öffnete er es und schnüffelte. »Was ist das?«, fragte er mit strengem Nachdruck und sah mich finster an. »Was ist das, Mr. Shaaban? Ist das Weihrauch?« Er hielt mir das Kästchen hin, sog erneut tief den Duft ein und hielt es mir wieder hin. »Was ist das?«, fragte er beschwichtigend. »Der Geruch kommt mir bekannt vor. Es ist eine Art Weihrauch, stimmt’s?«
Vielleicht war er wirklich Jude. Ich starrte ihn stumm an und senkte den Blick. Ich hätte ihm sagen können, dass es sich um Udi handelte, und anschließend hätten wir uns nett darüber unterhalten können, wie es kam, dass er sich an diesen Duft erinnerte, ein feierlicher Brauch aus seiner Jugend vielleicht, als seine Eltern noch von ihm erwarteten, dass er an den Gebeten und heiligen Feiertagen teilnahm. Doch dann hätte er meinen Pass wieder nicht abgestempelt, hätte ganz genau wissen wollen, inwiefern mein Leben in Gefahr war, dort, auf meinem kleinen Fleckchen ausgedörrter Savanne; hätte mich vielleicht sogar in Ketten per Flugzeug zurückschicken lassen, weil ich vorgegeben hatte, kein Englisch zu sprechen. Also erklärte ich ihm nicht, dass es sich hier um Ud-al-qamari allerbester Qualität handelte, um den Rest einer Lieferung, die ich vor über dreißig Jahren erworben hatte und auf keinen Fall zurücklassen mochte, als ich diese Reise in ein neues Leben antrat. Als ich wieder aufschaute, wurde mir klar, dass er mir das Ud stehlen würde. »Wir werden das untersuchen müssen«, meinte er lächelnd und machte eine lange Pause, um zu sehen, ob ich ihn verstanden hatte. Dann nahm er das Kästchen mit zum Tisch. Er stellte es neben sich, neben seinen gelben Schreibblock, zerrte an seinem Hemd, um es sich bequemer zu machen, und fuhr fort zu schreiben.
Ud-al-qamari: Unerwartet und in den sonderbarsten Augenblicken steigt mir sein Duft als Erinnerung in die Nase wie der Nachhall einer Stimme oder die Erinnerungen an den Arm meiner Liebsten, wie er sich mir um den Nacken legt. Jedes Mal an Idd bereitete ich ein Räucherfässchen vor, mit dem ich dann durchs ganze Haus ging, Duftwolken in die entferntesten Winkel schwenkte und in Gedanken die Mühen durchging, die es mich gekostet hatte, in den Besitz solch schöner Dinge zu gelangen, mich daran ergötzte, wie viel Freude sie mir und meinen Liebsten schenkten – das Weihrauchfässchen in der einen Hand und einen mit Ud gefüllten Messingteller in der anderen. Das Holz der Aloe, Ud-al-qamari, das Holz des Mondes. Das war, wie ich glaubte, die Bedeutung dieser Worte, doch der Mann, von dem ich meine Lieferung bekam, hatte mir erklärt, dass die Übersetzung eigentlich eine Abwandlung des Wortes quimari – Khmer, Kambodscha – war, denn das sei eine der wenigen Gegenden in der Welt, in denen man die richtige Sorte Aloeholz finden konnte. Das Ud war ein Harz, das nur eine pilzbefallene Aloe erzeugte. Eine gesunde Aloe war nutzlos, die kranke Pflanze aber brachte diesen herrlichen Duft hervor. Wieder so eine kleine Ironie von Sie-wissen-schon-wem.
Der Mann, von dem ich das Ud-al-qamari bekommen hatte, war ein persischer Händler aus Bahrain, der mit dem Musim, dem Monsun, in unseren Teil der Welt gekommen war, zusammen mit Tausenden anderen Händlern aus Arabien, vom Golf, aus Indien und aus Sindh sowie vom Horn von Afrika. So hatten sie es schon jahrein, jahraus getan, seit mindestens tausend Jahren. In den letzten Monaten des Jahres wehen die Winde beständig über den Indischen Ozean und gegen die afrikanische Küste, vor der die Strömungen zuvorkommend für eine Meerenge zum Ankern sorgen. In den ersten Monaten des neuen Jahres drehen die Winde, wehen in die entgegengesetzte Richtung und beschleunigen die Heimreise der Kaufleute. Alles war so, als sei es genau so beabsichtigt gewesen, dass die Winde und Strömungen nur den Küstenstreifen berührten, der sich vom südlichen Somalia bis nach Sofala am nördlichen Ausgang jenes Sunds erstreckt, der als Kanal von Mosambik bekannt geworden ist. Südlich dieses Streifens wurden die Strömungen kalt und tückisch, und von Schiffen, die sich dorthin verirrt hatten, hörte man nie wieder. Südlich von Sofala lag eine undurchdringliche See aus seltsamen Nebeln und Strudeln mit einer Meile Durchmesser und riesigen, leuchtenden Stachelrochen, die in finsterer Nacht zur Wasseroberfläche aufstiegen, und monströsen Kalmaren, die den Horizont verfinsterten.
Jahrhundertelang unternahmen unerschrockene Seefahrer und Händler, die meisten von ihnen zweifellos arm und verroht, alljährlich diese Reise zu jenem Küstenstreifen an der östlichen Seite des Kontinents, der sich schon vor Urzeiten zu einer Spitze geformt hatte, um die Winde des Musim zu empfangen. Die Kaufleute brachten ihre Waren und ihren Gott mit und ihre Weltanschauung, ihre Geschichten und ihre Lieder und Gebete und eine flüchtige Ahnung von Gelehrsamkeit, der Krönung ihrer Bestrebungen. Und sie brachten ihre Begierden und ihre Habsucht, ihre Fantasien und Lügen und ihren Hass, ließen ein paar aus ihren Reihen zurück, manchmal für ein ganzes Leben, und nahmen mit, was sie kaufen, tauschen oder erbeuten konnten, wozu auch Menschen gehörten, die sie entweder kauften oder entführten und in ihren eigenen Landen als Arbeitskräfte und in die Entwürdigung verhökerten. Nach all der Zeit wussten die Menschen, die an dieser Küste lebten, kaum noch, wer sie eigentlich waren. Aber sie wussten genug, um an dem festzuhalten, was sie von jenen unterschied, die sie verachteten, sowohl aus ihren eigenen Reihen als auch jenen der hinterwäldlerischen Brut der menschlichen Rasse im Innern des Kontinents.
Dann brachen, unerwartet und verheerend, die Portugiesen, die den Kontinent umschifft hatten, aus den unbekannten und undurchdringlichen Meeren des Südens herein und bereiteten der mittelalterlichen Erdkunde mit Kanonenfeuer ein jähes Ende. Sie überzogen die Inseln, Häfen und Städte mit einem Sturm religiösen Wahns und rühmten sich ihrer Grausamkeit gegenüber den Einwohnern, die sie ausplünderten. Darauf folgten die Omanis, um sie zu vertreiben und im Namen des wahren Gottes die Macht zu übernehmen, und brachten das indische Geld mit. Ihnen folgten die Briten auf dem Fuße, wiederum gefolgt von den Deutschen und den Franzosen und wer sonst noch über das nötige Kleingeld verfügte.
Neue Landkarten wurden gezeichnet, richtige Atlanten, auf dass jeder Zentimeter genauestens verzeichnet war, und so wusste nun jeder, wer er war oder zumindest wem er gehörte. Diese Landkarten, wie sie alles verwandelten. Und so trug es sich zu, dass sich diese verstreuten kleinen Städte am Meer entlang der afrikanischen Küste mit der Zeit als Teile riesiger Gebiete wiederfanden, die sich Hunderte Meilen ins Innere des Kontinents ausdehnten, ihre Bewohner mit Leuten in einen Topf geworfen wurden, die sie weit unter sich dünkten und die ihrerseits, als die Zeit gekommen war, diesen Gunstbeweis umgehend erwiderten. Zu den vielen Entbehrungen, die nun über diese Städte am Meer kamen, zählte auch das Verbot des Musim-Handels. Nicht länger mehr brachten die letzten Monate des Jahres ganze Flotten von Segelschiffen, die im Hafen Planke an Planke lagen, während das Meer zwischen ihnen von ihrem Abfall ölig schimmerte; nicht länger drängten sich in den Straßen die Somalis oder Suri-Araber oder Sindhis, die kauften und verkauften und aus dem Nichts heraus unverständliche Schlägereien vom Zaun brachen, nachts im Freien lagerten, Tee kochten und fröhliche Lieder anstimmten oder sich in ihren schmutzigen Lumpen auf dem Boden ausstreckten und einander ungebärdig Zoten zubrüllten. In den ersten ein oder zwei Jahren des Verbots waren die Straßen und Plätze erfüllt von der Stille ihrer Abwesenheit während dieser letzten Monate des Jahres. Vor allem, als wir das Fehlen jener Dinge zu spüren bekamen, die sie für gewöhnlich mitbrachten: Ghee und Kautschuk, Stoffe und gehämmerten Flitterkram, Vieh und Pökelfisch, Datteln, Tabak, Parfum, Rosenwasser, Weihrauch und allen erdenklichen wunderlichen Kram. Wir vermissten die ungehobelte Fröhlichkeit, mit der sie die Stadt erfüllt hatten. Doch bald darauf vergaßen wir sie fast völlig, weil sie in dem neuen Leben, das wir in jenen frühen Jahren nach der Unabhängigkeit führten, nicht mehr vorstellbar waren. Aber wie dem auch sei, vielleicht wären sie ohnehin nicht mehr lange zu uns gekommen. Wer würde es schon auf sich nehmen, Hunderte von Meilen über den Ozean zu segeln, um uns Tuch und Tabak zu verkaufen, wenn er in den reichen Staaten am Golf ein Leben in Luxus führen konnte?
Dies ist die Geschichte des Kaufmanns, von dem ich das Ud erhielt. Ich werde sie auf diese Weise erzählen, weil ich nicht mehr sicher sein kann, wer mir überhaupt zuhört. Er hieß Hussein, war Perser und kam aus Bahrain, wie er sich gegenüber denjenigen zu betonen beeilte, die ihn für einen Araber oder Inder hielten. Er gehörte zu den wohlhabenderen Kaufleuten, war in den leichten, cremefarben bestickten kanzu des Persischen Golfs gekleidet, stets reinlich und wohlriechend und vollendet höflich, was man nicht von allen Händlern sagen konnte, die der Musim zu uns brachte. Seine Höflichkeit war wie ein Geschenk, wie ein besonderes Talent, eine Vervollkommnung der Umgangsformen und Sitten hin zu etwas Abstraktem und Poetischem. Er handelte mit Düften und Weihrauch, und, um die Wahrheit zu sagen, diese Kombination von Höflichkeit und Wohlstand mit Salben und Tinkturen ließ ihn aalglatt und heuchlerisch erscheinen. Aus irgendeinem Grund suchte er meine Freundschaft. Damit meine ich nicht, dass ich keine Ahnung hatte, warum er Freundschaft mit mir schließen wollte, aber Hussein war nicht der Mann, der so etwas herausposaunte, und ich möchte nicht anmaßend erscheinen, indem ich Mutmaßungen anstelle. Ich möchte mir nicht am Ende noch selber schmeicheln und so Husseins feinfühlige Kultivierung unserer Bekanntschaft in etwas Geschmackloses verwandeln.
Es war das Jahr des Musim 1960, und ich hatte mich gerade erst öffentlich als Geschäftsmann etabliert. Zuvor hatte ich ungefähr vier Jahre lang nebenher ein paar kleine Geschäfte gemacht, neben meiner Arbeit als Verwaltungsangestellter in der Direktion des Finanzministeriums. Die Briten sahen es aber nicht gern, wenn Angestellte ihrer Verwaltung nebenbei auch noch privat Unternehmen betrieben, schon gar nicht, wenn das irgendetwas mit Finanzdienstleistungen zu tun hatte, und so musste ich, als sich mir zufällig ein paar Möglichkeiten eröffneten, diese klammheimlich ergreifen. Dadurch war ich zu etwas Geld gekommen. Dann starb 1958 mein Vater und hinterließ mir genug, um das Unternehmen zu meiner Erwerbsquelle zu machen. Die Geschäftswelt ist grausam, gnadenlos und raubtierhaft, anfällig für Konflikte und Gerede. Als ich anfing, hatte ich davon keine Ahnung. Kurz darauf starb meine Stiefmutter. Ich habe beide, wie ich an geeigneter Stelle noch erzählen werde, mit aller gebotenen Würde und großem Zeremoniell beerdigt, entgegen dem, was böse Zungen behaupten. Als ich Hussein begegnete, war ich einunddreißig Jahre alt, hatte vor Kurzem erst meinen Vater verloren und unmittelbar darauf meine Stiefmutter, lebte allein in einem angenehmen Haus und wurde von vielen um das große Glück beneidet, das über mich gekommen war. Hinter meinem Rücken redete man schlecht über mich, was, wie ich glaubte, in einem winzigen Nest wie dem, in dem ich wohnte, ein unmissverständliches Anzeichen für wachsenden Einfluss darstellte. In meiner Eitelkeit verlor ich den Blick für das Unheil, das sich über mir zusammenbraute.
Viele Jahre vor diesen Ereignissen waren die Briten so freundlich gewesen, mich aus dem Haufen einheimischer Schuljungen herauszupicken, der begierig war, mehr von ihrer Art der Bildung zu erwerben, obwohl ich nicht glaube, dass uns klar war, worauf wir so scharf waren. Uns ging es um das Lernen, das war es, was wir schätzten, und man hatte uns anhand der Lehren des Propheten beigebracht, das Lernen stets hochzuhalten. Doch lag über dieser Art der Bildung für uns noch ein besonderer Zauber, der etwas damit zu tun hatte, Zugang zur modernen Welt zu erhalten. Ich glaube auch, dass wir die Briten heimlich bewunderten. Für die Unverfrorenheit ihrer Anwesenheit hier, so weit weg von zu Hause, dass sie mit solch scheinbarer Selbstsicherheit das Kommando übernommen hatten. Und auch dafür, dass sie so viel darüber wussten, wie die Dinge anzugehen waren, die wirklich zählten: Krankheiten heilen, Flugzeuge fliegen, Filme drehen. Vielleicht ist »bewundern«ein zu einfaches Wort, um zu beschreiben, was wir, wie ich glaube, damals empfanden, denn es war eher so, dass wir uns ihrer Herrschaft über unser ganzes Leben beugten, ein Unterwerfen im übertragenen wie im wörtlichen Sinne, ein Zurückweichen angesichts ihrer großspurigen Selbstsicherheit. In ihren Büchern las ich wenig schmeichelhafte Berichte über meine Geschichte, und eben weil sie so wenig schmeichelhaft waren, kamen sie mir wahrer vor als die Geschichten, die wir uns selbst erzählten. Ich las über die Krankheiten, die uns heimsuchten, über die Zukunft, die vor uns lag, über die Welt, in der wir lebten, und den Platz, den wir darin innehatten. Es war, als hätten sie uns neu erfunden, und das auf eine Weise, die wir wohl oder übel hinzunehmen hatten, so vollkommen und stimmig schien die Geschichte zu sein, die sie über uns erzählten. Ich glaube nicht, dass sie die Geschichte aus reinem Zynismus so erzählt haben, denn ich bin davon überzeugt, dass sie sie ebenfalls geglaubt haben. Es lag an der Art, wie sie über uns und von sich selbst dachten, und in dieser auf uns einstürmenden Wirklichkeit des Lebens gab es nur wenig, das uns zu diskutieren gestattet hätte, jedenfalls nicht, solang diese Geschichte noch den Reiz des Neuen hatte und unwidersprochen durchging. Die Geschichten über uns selbst, die aus der Zeit stammten, bevor sie das Kommando über uns übernahmen, kamen uns mittelalterlich und wirklichkeitsfremd vor, geheime und geheiligte Mythen, die liturgische Metaphern und überkommene Riten darstellten – eine andere Spielart des Wissens, die mit der ihren nicht mithalten konnte. So kommt es mir vor, wenn ich daran denke, wie es damals war, als ich noch Kind war und weder die Möglichkeit hatte, auf Ironie zurückzugreifen, noch Wissen über die umfassendere Geschichte der mannigfaltigen Welt besaß. Und in der Schule war keine oder nur sehr wenig Zeit für diese anderen Geschichten vorgesehen, da ging es lediglich um eine geordnete Anhäufung des echten Wissens, das sie uns brachten, in Büchern, die sie uns zugänglich machten, in einer Sprache, die sie uns lehrten.
Und dennoch ließen sie zu viele Leerstellen, die unbeachtet blieben. Es lag in der Natur der Sache, dass sie nichts dagegen unternehmen konnten, und so wurden im Laufe der Zeit klaffende Lücken in ihrer Geschichte offenbar. Sie zerfaserte zusehends und begann sich aufzulösen, und ein murrender Rückzug war unausweichlich. Aber das war noch nicht das Ende der Geschichten. Noch stand uns Suez bevor, die Unmenschlichkeiten im Kongo und in Uganda und weitere bittere Aderlässe an unbedeutenden Schauplätzen. Dadurch entstand der Anschein, als hätten uns die Briten im Vergleich zu den Grausamkeiten, die wir selbst über uns zu bringen vermochten, nur Gutes getan. Doch war ihr Gutes trotz allem von Ironie durchtränkt. Im Klassenzimmer erzählten sie uns vom Edelmut, der darin liege, sich der Tyrannei zu widersetzen, und verhängten anschließend für die Zeit zwischen Sonnenuntergang und Morgengrauen eine Ausgangssperre. Oder sie steckten die Verfasser von Flugblättern, in denen die Unabhängigkeit gefordert wurde, wegen Aufwiegelung ins Gefängnis. Egal, sie legten die Gräben trocken, verbesserten das Abwassersystem und brachten uns Impfstoffe und das Radio. Am Ende erschien uns ihr Abzug ziemlich plötzlich, überstürzt und irgendwie bockig.
Wie dem auch sei, in jenem Jahr wählten sie mich aus dem Haufen lernbegieriger Schüler aus, zusammen mit drei anderen, die auch Stipendien für das Makerere University College in Kampala bekamen, damals noch ein ganz anderer Ort als der, zu dem er inzwischen geworden ist. Ich war achtzehn Jahre alt, und im Nachhinein denke ich, welches Glück ich hatte, dass mir dort die Augen für eine andere Weltsicht geöffnet wurden und ich erkennen konnte, wie wir aus diesem Blickwinkel erschienen. Abgerissen und erbärmlich.
Hussein. Das Jahr 1960 bescherte uns einen gesegneten Musim: ruhige und stetige Winde, Dutzende reich beladene Schiffe, die sicher in den Hafen einliefen. Nicht ein Schiff, das auf dem Meer verloren ging, keines, das zur Umkehr gezwungen war. Auch die Ernte war in diesem Jahr reichlich ausgefallen, es wurde lebhaft gehandelt, und auch die heißblütigen Auseinandersetzungen zwischen den Schifffahrtsgesellschaften, die manchmal unter den ungehobelten Seeleuten ausgetragen wurden, blieben fast völlig aus. Es war Husseins dritter Musim, und eines Tages kam er in das neue Möbelgeschäft, das ich eröffnet hatte, um sich einige Sachen anzusehen, die ich ausgestellt hatte. Es war eigentlich kein neuer Laden, sondern das ehemalige Halwa-Geschäft meines Vaters, umgebaut, frisch gestrichen und mit neuer Beleuchtung versehen, um Möbel und andere schöne Dinge zu verkaufen. Trotz all meiner Bemühungen hing noch immer der Geruch von heißem Ghee im Laden, und in Momenten der Niedergeschlagenheit kam er mir nicht anders vor als die schmuddelige, dunkle Höhle, aus der heraus mein Vater Halwa auf kleinen Tellerchen verkauft hatte. Mir war aber bewusst, dass es sich anders verhielt, dass meine Verzagtheit lediglich ein Auswuchs meiner düsteren Stimmungen und meines Kleinmuts war und dass solche Momente der Niedergeschlagenheit unvermeidlich waren. Ich bemühte mich also, vernünftig zu sein. Ich wusste, dass der Laden schick und teuer wirkte, schon allein der ausgestellten Gegenstände wegen, die für sich sprachen. Ich habe mich schon immer für Möbel interessiert. Für Möbel und Landkarten. Wunderschöne, komplizierte Sachen. Ich beschäftigte zwei Möbeltischler, die ich in einem Schuppen hinter dem Laden untergebracht hatte, in dem sie auf Bestellung Möbel schreinerten: Kleiderschränke, Sofas, Betten, solche Dinge. Sie machten das vorzüglich, nach Entwürfen, mit denen sie sich auskannten, und mit Hölzern, die sie zu bearbeiten wussten. Das eigentliche Geld aber, und worin zudem meine unternehmerische Leidenschaft lag, machte ich mit dem Erwerb von Auktionspartien aus Haushaltsauflösungen, aus denen ich mir die wertvollen Gegenstände und die Antiquitäten herauspickte. Ein kleiner Glasschrank aus Sandelholz, hergestellt in Cochin oder Trivandrum, brachte weitaus mehr ein, an Befriedigung und Gewinn, als ein ganzer Schuppen voll neuer, geölter Monstrositäten aus Mahagoni mit billigen Glastüren, die trotz allem einen kleinen Gewinn abwarfen beim Verkauf an jene Kunden und Händler, die derlei Sachen bei mir erstanden. Wenn irgendwelche Restaurationsarbeiten erforderlich wurden, dann übernahm ich das selbst – zunächst war vieles ein Ausprobieren, da aber meine Kunden noch weniger Ahnung davon hatten als ich, kam niemand zu Schaden.
Meine Kunden? Sofern es um Antiquitäten und die auserlesenen Dinge ging, handelte es sich um europäische Touristen und die ortsansässigen britischen Staatsbürger unserer Kolonie. Außerdem gingen die Kreuzfahrtschiffe der Castle Line auf ihrer Fahrt von Südafrika nach Europa und zurück immer für einen Tag bei uns vor Anker. Es gab auch noch andere Schifffahrtslinien, die uns ansteuerten, die Castle-Line-Schiffe aber kamen zweimal wöchentlich, das eine auf nördlichem, das andere auf südlichem Kurs. Die Touristen gingen von Bord und wurden von zugelassenen Führern an die Hand genommen, die (gegen eine kleine Vermittlungsgebühr) viele von ihnen zu meinem Geschäft führten. Das waren die zahlungskräftigsten und willkommensten Kunden, auch wenn ich darüber hinaus ein wenig mit den ortsansässigen Kolonialbeamten und dem einen oder anderen Konsularbeamten anderer Nationen, Franzosen und Niederländer, um genau zu sein, Handel trieb. Einmal schickte der Statthalter des britischen Gouverneurs, der Herrscher über die Wogen höchstselbst, einen Vertreter, der sich einen Spiegel in einem silberbeschlagenen Melaka-Rahmen aus dem vergangenen Jahrhundert ansehen sollte. Der Preis lag jenseits seiner Möglichkeiten, bedauerlicherweise. Als ich den Preis erwähnte, verzog der entsandte Unterling seine roten Lippen und strich sich durch sein blondes Haar, außer sich vor Widerwillen, als ob ich zu viel verlangt hätte, aber ich nehme an, es lag einfach jenseits seiner Möglichkeiten. Er stampfte ein paarmal auf, blies seine erhitzten Backen auf und murmelte in einem fort: »Ungeheuerlich, ungeheuerlich.« Er wartete darauf, dass ich mich dem Recht des Admirals unterwarf, seinen Preis selbst festzulegen, ich aber lächelte nur verbindlich und hörte nicht mehr hin. Jeder, der Melaka kennt, hätte gleich gewusst, dass das Stück nicht einen Penny weniger wert war.
Es verhielt sich keineswegs so, dass meine Landsleute nicht in der Lage gewesen wären, die Schönheit dieser Gegenstände zu schätzen. Ich ordnete die schönsten als Ausstellungsstücke im Laden an, und die Leute kamen herein, um sie sich anzusehen und zu bewundern. Sie hätten aber niemals den Preis bezahlt, den ich für diese Gegenstände forderte. Sie konnten es einfach nicht. Sie hatten auch nicht dieses zwanghafte Bedürfnis an sich, das vielen europäischen Kunden eigen war – die schönen Dinge dieser Welt zu erwerben, um sie mit nach Hause zu nehmen und zu besitzen, als Beleg ihrer Kultiviertheit und vorurteilslosen Aufgeschlossenheit, als Trophäen ihrer Weltläufigkeit und der Eroberung ausgedörrter Steppen. Zu anderer Zeit hätte sich der Unterling des Vertreters der britischen Krone nicht vom Preis des silberbeschlagenen Melaka-Spiegels abschrecken lassen, schon gar nicht nach meiner Auskunft, dass es auf der Welt nur noch sehr wenige dieser Art gebe. Er hätte ihn zu dem von ihm festgesetzten Preis mitgenommen oder gar nichts dafür bezahlt, ganz nach dem Recht des Eroberers und in Anbetracht unseres unterschiedlichen Rangs auf der Werteskala des Weltlaufs. Etwas in dieser Art hatte sich Kevin Edelman mit meinem Kästchen Ud-al-qamari erlaubt. Was nicht heißt, dass ich das Verlangen nicht verstehen konnte.
Ich erkannte Hussein sofort, als er den Laden betrat. Eine groß gewachsene, unverwechselbare Gestalt, umgeben von einer Aura der Weltgewandtheit. In dem Augenblick, in dem er in das Geschäft kam, füllte sich mein Kopf mit Wörtern: Persien, Bahrain, Basra, Harun al Raschid, Sindbad und viele andere. Ich hatte noch nicht seine Bekanntschaft gemacht, war ihm aber schon auf der Straße und in der Moschee begegnet. Ich kannte sogar seinen Namen, weil die Leute von ihm als dem Händler sprachen, der im Jahr zuvor bei Rajab Shaaban Mahmud Quartier bezogen hatte, einem Angestellten im Public Works Department, ein Mann, mit dem ich in der Vergangenheit ein paar heikle Angelegenheiten zu regeln gehabt hatte. 1960 war er nicht wieder bei ihm eingezogen. Ein Zerwürfnis mit skandalträchtiger Note, wie die Gerüchte wissen wollten. Er lebte aber in der näheren Umgebung und war für seine Großzügigkeit bekannt. Als ich von seiner Freigebigkeit erfuhr, war mir klar, dass ihm die üblichen Drückeberger bereits wegen des einen oder anderen Almosens auf den Leib gerückt sein mussten, diese schamlosen Jammerlappen, denen es unsere Art, die Dinge anzugehen, erlaubt, sich ihren Lebensunterhalt mit Schwäche und Kriecherei zu erstreiten. Er sprach mich auf Arabisch an, entbot mir höfliche Grüße, erkundigte sich nach meiner Gesundheit, wünschte mir ertragreiche Geschäfte, was sich alles ein wenig übertrieben anhörte. Ich entschuldigte mich für mein Arabisch, das man bestenfalls als holperig bezeichnen konnte, und redete ihn in Swahili an. Er lächelte zerknirscht und sagte: »Ah suahil. Ninaweza kidogo kidogo tu.« Ich kann es nur ein ganz klein bisschen. Dann sprach er völlig überraschend Englisch mit mir. Das war deshalb überraschend, weil die Händler und Seeleute, die mit dem Musim zu uns kamen, in der Regel ungehobeltes und grobschlächtiges Gesindel waren, auch wenn das nicht heißen soll, dass sie nicht über eine eigene Art schicklicher Redlichkeit geboten. Natürlich sah Hussein weder aus wie sie, noch benahm er sich so, aber dennoch: Englisch bedeutete Schulbildung, und Menschen, die zur Schule gegangen waren, wurden normalerweise nicht Seeleute und Musim-Kaufleute, die in vollgestopften, engen und verwahrlosten Dhaus in der schmutzigen Gesellschaft der Herren Großmaul, Muskelprotz und Schlagetot reisten.
Er setzte sich auf den Stuhl, den ich ihm anbot, strich sich über seinen pechschwarzen Schnurrbart, lächelte und wartete darauf, dass ich ihn aufforderte, sein Begehr zu äußern. Er habe von meinem Laden gehört, erzählte er mir, und dass ich viele schöne Dinge hätte. Er sei auf der Suche nach einem Geschenk für einen Freund, etwas Feines und Apartes.
»Für die Familie eines Freundes«, berichtigte er sich.