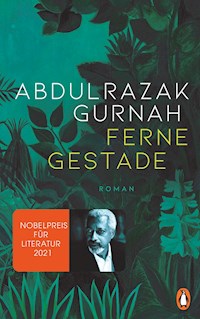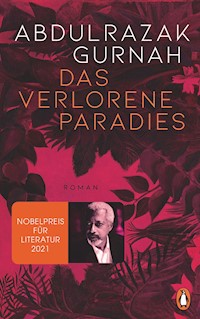11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Ein großes Werk.« NZZ – Einer der Höhepunkte im Romanwerk des Literaturnobelpreisträgers endlich wieder auf Deutsch!
Sansibar in den frühen 1950er-Jahren: Inmitten politischer Umwälzungen und Aufständen gegen die Kolonialherren wachsen die Geschwister Amin, Rashid und Farida auf. Amin, der Mittlere der Brüder, verliebt sich in Jamila, doch beider Leidenschaft zerbricht schon bald am Widerstand seiner Familie und Gerüchten um die Vergangenheit der jungen Frau. Es heißt, ein Fluch liege auf ihrer Verwandtschaft. Im Strudel der Revolution trennen sich die Lebenswege der Geschwister. Rashid beginnt ein Studium in London, das Schicksal von Amin und Jamila lässt ihn aber selbst in der Ferne nicht los. Er begibt sich auf eine Spurensuche, die ihn tief in die afrikanische Kolonialgeschichte führt – und bis zum Geheimnis um Jamilas Familie. Deren Großmutter hatte für eine verbotene Liebe zu einem britischen Orientalisten einst alles riskiert... »Die Abtrünnigen« zeigt Nobelpreisträger Abdulrazak Gurnah erneut als großartigen, politisch hellsichtigen Erzähler von Geschichten, wie wir sie noch nie zuvor gelesen haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 519
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
»Sansibar in den frühen 1950er-Jahren: Inmitten von politischen Umwälzungen und Aufständen gegen die Kolonialherren wachsen die Geschwister Amin, Rashid und Farida auf. Amin, der Mittlere der Brüder, verliebt sich in Jamila, doch ihre Leidenschaft zerbricht an Gerüchten um die Vergangenheit der jungen Frau und dem Widerstand seiner Familie. Es heißt, ein Fluch liege auf ihrer Verwandtschaft. Im Strudel der Revolution trennen sich die Lebenswege der Geschwister. Rashid beginnt ein Studium in London, das Schicksal von Amin und Jamila lässt ihn aber selbst in der Ferne nicht los. Er begibt sich auf eine Spurensuche, die ihn tief in die afrikanische Kolonialgeschichte führt – und bis zum Geheimnis um Jamilas Familie. Deren Großmutter hatte für eine verbotene Liebe zu einem britischen Orientalisten einst alles riskiert … »Die Abtrünnigen« zeigt Nobelpreisträger Abdulrazak Gurnah erneut als großartigen, politisch hellsichtigen Erzähler von Geschichten, wie wir sie noch nie zuvor gelesen haben.
Abdulrazak Gurnah (geb. 1948 im Sultanat Sansibar) wurde 2021 mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet. Er hat bislang zehn Romane veröffentlicht, darunter »Paradise« (1994; dt. »Das verlorene Paradies«; nominiert für den Booker Prize), »By the Sea« (2001; »Ferne Gestade«; nominiert für den Booker Prize und den Los Angeles Times Book Award), »Desertion« (2005; dt. »Die Abtrünnigen«; nominiert für den Commonwealth Writers’ Prize) und »Afterlives« (2020; dt. »Nachleben«; nominiert für den Walter Scott Prize und den Orwell Prize for Fiction). Gurnah ist Professor emeritus für englische und postkoloniale Literatur an der University of Kent. Er lebt in Canterbury. Seine Werke erscheinen auf Deutsch im Penguin Verlag.
»Wunderbar geschrieben und unterhaltsam … Das Werk eines Meisters.« The Guardian
»Eine genaue und zu Herzen gehende Analyse der Frage, wie Erinnerungen uns zugleich trösten und enttäuschen.« Sunday Times
»Ein fesselnder Roman über Verlassenwerden und Verlust.« Daily Telegraph
www.penguin-verlag.de
ABDULRAZAKGURNAH
DIE ABTRÜNNIGEN
ROMAN
Aus dem Englischen von Stefanie Schaffer-de Vries
Die Originalausgabe erschien 2005 unter dem Titel Desertion bei Bloomsbury, London.Diese Übersetzung wurde mit Mitteln des Auswärtigen Amtes unterstützt durch die Gesellschaft zur Förderung der Literatur aus Afrika, Asien und Lateinamerika e. V.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Wir danken Irmtraud Herms (Universität Leipzig), Jürgen Neuß (Freie Universität Berlin) und Andreas Pflitsch (Freie Universität Berlin) für ihre fachliche Unterstützung.
Copyright © der Originalausgabe 2005 by Abdulrazak Gurnah
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2023
Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Favoritbuero, München
Umschlagabbildung: Bridgeman Images
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-29443-4V001
www.penguin-verlag.de
ERSTER TEIL
1 HASSANALI
Es gab eine Geschichte darüber, wie er zum ersten Mal gesehen wurde. Tatsächlich gab es mehr als eine, aber mit der Zeit und durch das viele Weitererzählen vermischten sich Elemente der verschiedenen Geschichten zu einer. In allen tauchte er im Morgengrauen auf, wie eine Gestalt aus einem Mythos. In einer der Geschichten war er ein aufrechter Schatten, der sich so langsam bewegte, dass sein Näherkommen – dem millimeterweisen Heranrücken des Schicksals gleich – in diesem eigenartigen Unterwasserlicht kaum wahrnehmbar war. In einer anderen bewegte er sich überhaupt nicht, nicht das geringste Zittern oder Zucken war erkennbar, sondern er zeichnete sich nur undeutlich, mit funkelnden grauen Augen, am Rand der Stadt ab und wartete, dass jemand erscheinen möge, jemand, dessen unvermeidliches Schicksal es sein würde, ihn zu finden. Und als das tatsächlich geschah, glitt er auf ihn zu, um zu erfüllen, was niemand prophezeit hatte. Einer behauptete, ihn gehört zu haben, bevor er gesehen wurde, sein flehentliches, sehnsüchtiges Heulen in der dunkelsten Stunde der Nacht vernommen zu haben wie das Heulen eines Tieres aus einer Legende. Unbestritten jedenfalls war – obwohl die Geschichten im Grunde überhaupt außerhalb jeder Diskussion standen, denn im Hinblick auf das Ungewöhnliche seines Erscheinens waren sich alle einig –, dass es Hassanali, der Krämer, war, der ihn fand oder von ihm gefunden wurde.
Wie bei allem hatte das Schicksal auch bei seiner Ankunft die Hand im Spiel, aber Schicksal ist nicht dasselbe wie Zufall, und selbst die unerwartetsten Ereignisse erfüllen einen Plan. Das heißt, das Geschehen zeitigte später Folgen, die es kaum als Zufall erscheinen lassen konnten, dass ausgerechnet Hassanali den Mann fand. Hassanali war zu jener Zeit immer der Erste, der morgens an diesem Schauplatz unterwegs war. Er stand vorm Morgengrauen auf, um die Tore und Fenster der Moschee zu öffnen. Dann stellte er sich auf die Stufen, um die Menschen zum Gebet zu rufen, indem er seine Stimme in allen Winkeln des freien Platzes vor ihm erschallen ließ. »Salla, salla.«*Manchmal trug der Wind ähnliche Rufe von nahe gelegenen Moscheen heran, wo andere Rufer die Leute aus den Federn jagten. »As-salatu khayra min an-nawm.«Beten ist besser als schlafen. Wahrscheinlich stellte Hassanali sich vor, wie die Sünder sich, gereizt über die Störung, in ihren Betten herumdrehten, und empfand eine indignierte und selbstgerechte Befriedigung. Wenn er mit dem Rufen fertig war, kehrte er mit einem fedrigen Kasuarinenbesen, dessen lautlose Wirksamkeit ihm tiefe Freude bereitete, Staub und feinen Kies von den Stufen der Moschee.
Er hatte sich diese Aufgabe, die Moschee zu öffnen, die Stufen zu reinigen und die Menschen zum Gebet zu rufen, aus persönlichen Gründen selbst zugewiesen. Irgendjemand musste es tun, irgendjemand musste als Erster aufstehen, die Moschee aufschließen und den Adhanfür die Morgengebete übernehmen, und irgendjemand tat es auch immer aus persönlichen Gründen. Wenn derjenige erkrankte oder der Verantwortung müde wurde, gab es immer einen anderen, der sie übernahm. Sein Vorgänger hatte Sharif Mdogo geheißen und war im Kaskazivor zwei Jahren von so heftigem Fieber heimgesucht worden, dass er noch immer das Bett hüten musste. Es war ein wenig überraschend gewesen, dass ausgerechnet Hassanali sich freiwillig für die Aufgabe des Morgenrufers angeboten hatte, nicht zuletzt für Hassanali selbst. Er war nicht besonders eifrig, was die Moschee betraf, und es erforderte sehr viel Eifer, täglich im Morgengrauen aufzustehen und die Menschen aus dem Schlaf zu kommandieren. Sharif Mdogo war so ein Typ, einer, der gern in die Behaglichkeit der Menschen hineinplatzte und sie ordentlich durchrüttelte. Hassanali aber war von Natur aus ein ängstlicher Mensch, oder vielleicht hatte die Erfahrung ihn so gemacht, furchtsam und vorsichtig. Diese Pflichten zu noch beinah nachtschlafender Zeit quälten seine Nerven und störten seine Nächte, und er fürchtete sich vor der Dunkelheit, vor den Schatten und dem Huschen und Trippeln in den verlassenen Gassen. Doch zugleich waren genau dies die Gründe, weshalb er sich für die Aufgabe gemeldet hatte – um sich zu unterwerfen und Buße zu tun. Er hatte die Aufgabe zwei Jahre vor diesem anbrechenden Morgen übernommen, in dem Jahr, als seine Frau Malika hier eintraf. Es war eine Bitte um das Gedeihen seiner Ehe gewesen, und zugleich ein Gebet, dass der Kummer seiner Schwester enden möge.
Es war nur ein kurzer Spaziergang von seinem Laden über den freien Platz bis zur Moschee, doch wenn er sich zum morgendlichen Gebetsruf aufmachte, fühlte er sich verpflichtet, es seinem Vorgänger Sharif Mdogo gleichzutun. Er bog in die nahe gelegenen Gassen ein, schrie im Vorbeigehen mehr oder weniger in die Schlafzimmerfenster und brüllte die Leute aus dem Schlaf. Er hatte sich eine Route zurechtgelegt, mit der er den düsteren Schluchten und Höhlen auswich, in denen die schlimmsten und finstersten Gestalten lauerten und ihre üblen Streiche ausheckten, aber er meinte trotzdem immer, gespenstische Schatten in die dunkelsten Winkel der Gassen davonhuschen zu sehen, als seien sie auf der Flucht vor den Gebeten und heiligen Worten, mit denen er die schlummernden Gläubigen ermahnte. Diese Visionen waren so echt – der Schatten einer Monsterklaue an einer Wegbiegung, unzufriedene Geister, die irgendwo hinter ihm leise keuchten, grässliche Geschöpfe der Unterwelt, die aufleuchteten und wieder verblassten, bevor er sie noch richtig sehen konnte –, dass ihm trotz der morgendlichen Frische bei der Verrichtung seiner Aufgaben oft der Schweiß ausbrach. Eines Morgens, während einer solchen angsterfüllten, schweißtreibenden Runde, als die dunklen Gassen wie die Wände eines sich verengenden Tunnels auf ihn eindrängten, spürte er einen Luftstoß an seinem Arm und nahm aus dem Augenwinkel den Schatten eines dunklen Flügels wahr. Er begann zu laufen, und dann beschloss er, den Qualen ein Ende zu setzen. Er zog sich mit ein paar Schritten über den Platz auf die Stufen der Moschee zurück, um seinen Ruf zu tun. Zur Wiedergutmachung übernahm er auch noch die Arbeit des Stufenkehrens, obwohl der Imam ihm gesagt hatte, dass lediglich der Ruf von den Stufen erforderlich und Sharif Mdogo in der Verrichtung seiner Pflichten übereifrig gewesen sei.
Als Hassanali an diesem Morgen den Platz überquerte, sah er einen Schatten über dem Boden, der sich langsam in seine Richtung zu bewegen begann. Er blinzelte und schluckte vor Angst. Das war ja zu erwarten gewesen. Die Welt wimmelte von Toten, und diese graue Stunde war ihre Höhle. Seine Stimme wurde krächzend, seine heiligen Worte vertrockneten im Hals, sein Körper verließ ihn. Der Schatten näherte sich langsam, und in dem rasch heranrückenden Morgen glaubte Hassanali ein hartes, steinernes Licht in seinen Augen glitzern zu sehen. Diesen Augenblick hatte er in Gedanken schon oft erlebt, und er wusste, dass der Ghul ihn verschlingen würde, sobald er ihm den Rücken kehrte. In der Moschee wäre er sicher gewesen, denn sie ist ein Heiligtum, das kein böser Geist betreten kann, aber er war noch weit von ihr entfernt und hatte die Tore noch nicht geöffnet. Am Ende schloss er, von Panik übermannt, die Augen, murmelte immer wieder dieselben Bitten um Gottes Vergebung und ließ es zu, dass seine Knie unter ihm nachgaben. Er fügte sich in das, was kommen sollte.
Als er ganz langsam die Augen wieder öffnete und unter den Lidern hervorspähte wie unter einem leicht angehobenen Laken, unter dem er sich vor einem Albtraum verkrochen hatte, sah er den Schatten zusammengesunken in einigen Metern Entfernung auf dem Boden liegen, halb auf der Seite, ein Knie angezogen. Jetzt, im heller werdenden Licht, konnte er sehen, dass es kein Gespenst oder Schatten oder Ghulwar, sondern ein Mann mit aschfahlem Gesicht, dessen erschöpfte, weit geöffnete graue Augen nur wenige Meter von seinen entfernt waren. »Subhan Allah,wer bist du? Bist du ein Mensch oder ein Geist?«, fragte Hassanali zur Sicherheit. Der Mann seufzte und stöhnte zugleich und gab sich damit ohne Zweifel als menschliches Wesen zu erkennen.
So war er bei seiner Ankunft – erschöpft, verloren, der Körper ausgemergelt, Gesicht und Arme von Schnitten und Bissen übersät. Hassanali, auf den Knien im Staub, tastete nach des Mannes Atem, und als er ihn warm und kräftig auf der Handfläche spürte, lächelte er in sich hinein, als hätte er etwas Kluges vollbracht. Die Augen des Mannes standen offen, aber er blinzelte nicht, als Hassanali die Hand vor ihnen bewegte. Es wäre Hassanali lieber gewesen, er hätte geblinzelt. Er erhob sich vorsichtig, voll ungläubigen Staunens über das Drama, in das er hier verwickelt wurde, beugte sich noch einen Moment über das zu seinen Füßen stöhnende Bündel, dann eilte er los, um Hilfe zu holen. Inzwischen war der Morgen gekommen. Der exakte Augenblick größten Segens für das Morgengebet ging rasch vorbei – er war nur sehr kurz –, und Hassanali hatte die von ihm erwartete Aufgabe nicht erfüllt. Er fürchtete den Ärger derer, die sonst regelmäßig am frühen Morgen zum Gebet erschienen und nun beim Aufwachen bemerken würden, dass sie die Segnungen des Morgens verdöst hatten. Die meisten davon waren ältere Männer, die ihre Rechenschaftsberichte für den Fall einer plötzlichen Einberufung in Ordnung und auf dem letzten Stand halten mussten. Aber er hätte daran denken sollen, dass auch sie nicht mehr so gut schliefen, sondern sich die ganze Nacht quälten und den Morgen mit seinem erlösenden Ruf zum Gebet herbeisehnten. Während Hassanali sich also voller Sorge darüber, dass er seine Pflicht als Muadhinverabsäumt hatte, auf den Weg machte, um Hilfe zu holen, traten schon einige aus ihren Häusern, um herauszufinden, warum es an diesem Morgen keinen Gebetsruf gegeben hatte. Vielleicht waren manche sogar um Hassanalis Gesundheit besorgt oder fragten sich, ob ihm in der Nacht etwas zugestoßen sei. Es gab daher Zeugen für das erste Erscheinen des Mannes, Menschen, die sich um seinen Körper mit den weit aufgerissenen Augen scharten und ihn zusammengesunken wie einen Schatten auf dem offenen Platz vor der Moschee liegen sahen.
Hassanali kehrte mit zwei jungen Männern zurück, die er halb schlafend vor der Tür zum Kaffeehaus kauernd angetroffen hatte. Sie arbeiteten dort und warteten darauf, dass man ihnen aufschloss, an die letzten Augenblicke der Ruhe geklammert, bevor das Treiben des Tages begann, aber sie waren gleich bereit zu helfen, als Hassanali sie wach rüttelte. Alle waren hilfsbereit in den alten Tagen. Als sie, Hassanalis zunehmend wichtigtuerischen Schritten hinterhereilend, am Schauplatz eintrafen, fanden sie drei ältere Männer vor, die ein paar Schritte von dem Körper entfernt standen und ihn mit eingehendem Interesse betrachteten: Hamza, Ali Kipara und Jumaane. Sie waren die Getreuen bei der Morgenandacht, die immer direkt hinter dem Imam standen, und sie waren jeden Morgen die ersten Kunden im Kaffeehaus. Männer, die ihre besten Jahre schon lange hinter sich hatten, weise Männer, die erwarteten, dass niemand an ihrer bisherigen Lebensführung etwas zu tadeln hatte, Männer, die ihre Augen offen und auf die Welt gerichtet hielten, die an ihnen vorüberzog. Gewöhnlich rührten sie sich für niemanden außer für sich selbst und fanden, dass ihr Alter ihnen dazu das Recht gab. Sie waren also nicht bloß drei ältere Männer, weil alle wussten, wer sie waren, sondern sie waren alt, gemessen an ihrer Zeit und ihrem Ort, ihre Gebrechen waren Teil ihrer Würde, und ihr herrisches Gehabe war vielleicht ein Versuch, die in sie gesetzten Erwartungen zu erfüllen. Jedenfalls standen sie jetzt da, aus welchem Grund auch immer, heuchelten Gleichgültigkeit und ließen beiläufige Bemerkungen fallen, während die jungen Männer und Hassanali herumhetzten. Hassanali schloss die Moschee auf, und die jungen Männer holten den Charpai, auf welchen die Toten zum Waschen gelegt wurden. Hassanali zuckte zusammen, sagte aber nichts. Die jungen Männer hoben den stöhnenden Körper auf den Charpaiund machten sich daran, ihn wegzutragen.
Da kam es plötzlich zwischen Hassanali und Hamza zu einem kurzen Streit um die Frage, wohin der kranke Mann gebracht werden sollte. Hamza war trotz seines Alters ein beeindruckender Mann. Er hatte ein faltiges, knorriges Gesicht mit grauen Bartstoppeln und funkelnden Augen. Er war in längst vergangenen Zeiten ein reicher Simsim-Kaufmann gewesen, inzwischen war er einfach nur noch reich. Seine Söhne machten Geld für ihn mit einer Schlachterei in Mombasa. Er war empfindlich, was die ihm gebührende Ehrfurcht betraf, und legte Wert darauf, dass man selbst in Angelegenheiten von geringster Bedeutung sein Urteil einholte. Er ließ sich gerne als der inoffizielle Jamadardes Ortes behandeln. Ali Kipara war in der Blüte seiner Jahre ein Korbflechter gewesen und Jumaane ein Maler und Anstreicher, also wussten beide, was sich im Umgang mit demJamadarfür sie ziemte, und hielten sich daran, wenn es von ihnen gefordert wurde. Hamza begann sich gereizt und ungeduldig zu entfernen und forderte die Helfer auf, ihm zu folgen. Die moralische Verpflichtung gegenüber dem erschöpften Mann lag aber ganz offensichtlich bei Hassanali, der ihn gefunden hatte, es war an ihm, sich um ihn zu kümmern und ihm Gastfreundschaft zu gewähren. Hamza wusste das so gut wie alle anderen, aber vielleicht tat Hamza das, was er tat, um die Leute daran zu erinnern, dass er ein reicher Mann war und für ihn deshalb solche Akte der Barmherzigkeit eine Pflicht waren.
Jedenfalls sahen alle höflich über Hamza hinweg, sogar die beiden anderen Weisen, und der Mann wurde auf seinem Charpai zu Hassanalis Laden getragen, wie es sich gehörte. Die Tür zum angrenzenden Hof, die zugleich ins Haus führte, war zu schmal für den Charpai mit dem Mann darauf, weshalb die jungen Männer ihn herunterhoben, in den Hof trugen und auf eine Matte unter dem mit Stroh gedeckten Vordach legten.
Die drei zur Morgenandacht erschienenen Alten drängten sich ebenfalls in den Hof und warfen rasche Blicke um sich. Es gab nicht viel zu sehen, aber keiner von ihnen war je in Hassanalis Hof gewesen, und so konnten sie sich die Neugier selbst in diesem dramatischen Augenblick nicht verkneifen. Es war ein großer Hof, der sich über die ganze Länge des Hauses erstreckte. Es gab Pflanzen in Töpfen, zwei Fenster mit Vorhängen, die auf den Hof hinausgingen, eines zu jeder Seite des Innentors, eine erhöhte, gepflasterte Stelle zum Wäschewaschen, ein paar Seredanizum Kochen und an einem Ende des Hofes den Waschraum und den Abort – ein ganz gewöhnlicher Hof. Die kürzlich frisch geweißten Wände hätten ihnen auffallen können und auch die üppig wachsenden Topfpflanzen, darunter eine rote Rose, ein blühender Lavendel und eine stachlige Aloe.
Eine Minute lang stand die Gruppe von sechs Männern um den Körper herum, ohne dass ein Wort gesprochen wurde, als wären sie überrascht darüber, wie alles sich ergeben hatte. Einen Augenblick später wurden verschiedene Meinungen laut, was nun als Nächstes zu tun sei, die von einem nach dem anderen wie feierliche Schwüre vorgebracht wurden. »Wir sollten Mamake Zaituni rufen, die Heilerin. Und irgendwer sollte Beinbrecher holen. Und ich denke, es sollte sich auch jemand auf den Weg machen, um es sofort dem Imam zu sagen, damit er, wenn nötig, spezielle Gebete gegen Ansteckung oder Schlimmeres sprechen kann.« Das war Hamza, wie immer auf große Gesten aus. Hassanali nickte widerspruchslos zu allen Vorschlägen und komplimentierte die kleine Schar hinaus. Sie gingen widerwillig, aber sie hatten keine andere Wahl. Einzig das Drama des stöhnenden Mannes hatte ihnen die Anwesenheit in der privaten Sphäre dieses Hauses überhaupt erlaubt, und so brauchte Hassanali weiter nichts zu tun, als ganz sachte mit den ausgebreiteten Armen zu wedeln, damit alle sich der Hoftür zuwandten.
»Danke, ich danke euch allen. Würdet ihr bitte Mamake Zaituni sagen, sie soll kommen?«, sagte er und begab sich damit noch weiter in die Schuld seiner Nachbarn.
»Ganz gewiss«, sagte Hamza, der Kaufmann, mit seiner überheblichen Stimme und wies mit seinem Stock auf einen der jungen Männer. »Geh, geh, du, hier geht’s um ein Menschenleben.«
Noch im Weggehen wurden weitere Vorschläge unterbreitet. »Rühr ihn nicht an, bis Mamake Zaituni kommt.« »Ich werde ihn nicht anrühren.« »Beweg ihn nicht, bis Beinbrecher da ist.« »Ich werde ihn nicht bewegen.« »Wenn du Hilfe brauchst…« »Melde ich mich.« Hassanali schloss die Hoftür, ohne sie zu verriegeln – er wollte nicht zu ungastlich wirken –, und kehrte zu dem Mann auf der Matte unter dem Vordach zurück. Er war plötzlich beklommen, hatte Angst davor, mit ihm allein zu sein, als hätte er sich zu nahe an ein wildes Tier herangewagt. Wer konnte der Mann sein? Was für ein Mensch wanderte allein in der Wildnis herum? Es fiel ihm ein, dass er das zu dem Mann gesagt hatte, als dieser am Boden lag: Wer bist du? Der Lärm ihrer Ankunft hatte sicher seine Frau und seine Schwester geweckt, die wahrscheinlich schon hinter den Vorhängen an den Fenstern standen und es nicht erwarten konnten, herauszukommen und zu sehen, was los war. Plötzlich fürchtete er, eine Dummheit damit begangen zu haben, den kranken Fremden nach Hause zu bringen. Der Gedanke jagte ihm einen Angstschauder übers Brustbein.
Er betrachtete den Mann mit einem verwunderten Lächeln.
Was tat ein in der Wildnis verwundeter Fremder auf der Matte in seinem Hof? Es hätte ebenso gut ein fliegendes Pferd oder eine sprechende Taube sein können. Solche Dinge geschahen ihnen nicht. Er erinnerte sich an den Schrecken, mit dem er den Schatten bemerkt und für einen grauenerregenden Ghulgehalten hatte. Es gab viele Dinge, die ihn, einen erwachsenen Mann, ängstigten. Manchmal zeichnete sein Leben sich so bedrohlich vor ihm ab, dass er überall Schatten sah. Es hätte jede Art von hässlichem, bösartigem Etwas sein können in dieser unsicheren Zeit zwischen Licht und Dunkel, zwischen der realen und der untoten Welt, aber vielleicht hätte er sich nicht so auf den Boden werfen sollen, wie er es getan hatte. Wäre es ein Geist gewesen, er hätte gelächelt, bevor er seine Seele pulverisiert hätte. Hassanalis Lächeln galt ebenso seinem weichen schüchternen Ich wie dem Mann zu seinen Füßen. Denn dieser war kein Geist und um nichts hässlicher als der Nächstbeste. Doch sein Gesicht war blutleer und von zottigem, ungepflegtem, ergrauendem Haar umrahmt. Seine Augen waren immer noch offen, trübe und blicklos, obwohl Hassanali ein Blinzeln zu bemerken glaubte, während er hinsah. Der Atem des Mannes war flach, eher ein leises Schnaufen, und dahinter ein kaum hörbares Stöhnen. Seine Arme waren zerkratzt und von Dornen zerstochen. Der Kattunkittel, den er über Hose und Sandalen trug, war grau von Staub und Abnutzung, zerrissen und geflickt, schmierig und fleckig, vielleicht eher unterwegs erworben als mitgebracht von wo immer der Mann aufgebrochen war. Niemand würde in solchen Lumpen eine Reise antreten. Die Sandalen waren mit Stoffstreifen zusammengebunden, und um die Hüften hatte er wie einen Gürtel die Reste eines braunen Hemdes gebunden. Ein Streifen desselben Stoffes lag als Kopfband um seine Stirn. Hassanali lächelte über das Melodramatische seines Aufzugs, genau wie ein Abenteurer, der sich in der Wüste verirrt hat, oder wie ein Desperado. Der Gedanke verursachte ihm ein flaues Gefühl im Magen. Hatte er einen Banditen ins Haus gebracht, einen Marodeur, der sie alle umbringen würde? Aber nein, der Mann war halb tot, vielleicht selbst ein Opfer von Banditen.
»Wer ist das?«, fragte seine Schwester Rehana hinter ihm.
»Er ist verwundet«, sagte er und drehte sich um. Er bemerkte, dass er immer noch, ein wenig aufgeregt, lächelte.
Sie stand neben der Tür und hielt mit der linken Hand den Vorhang zur Seite. Sie war eben erst aufgewacht, das erkannte er an dem benommenen, schweren Blick ihrer Augen, ihrer rauen Stimme. Sie machte drei Schritte nach vorn und betrachtete den Mann prüfend. Seine offenen Augen leuchteten wie graue Kiesel in Salzwasser. Glommen. Dann sah er sie eindeutig blinzeln. Die zersprungenen Lippen öffneten sich mit einem Stöhnen. Rehana trat rasch zurück, und Hassanali konnte nur raten, was für eine verrückte Hoffnung ihr Herz einen kurzen Augenblick lang erfüllt hatte.
»Was hast du uns da mitgebracht, werter Herr und Gebieter?«, fragte sie hinter ihm mit ihrer spöttischen Stimme. Hassanali zuckte unwillkürlich zusammen. Ein Tag, der mit dieser Stimme begann, war oft lang und demütigend. Er schloss einen Moment ganz fest die Augen, um sich vorzubereiten.
»Er ist verwundet«, sagte er wieder und wandte sich ihr zu.
Ihre Mundwinkel waren verdrießlich nach unten gezogen, die Kiefer fest zusammengepresst. Er spürte, wie sein Körper sich vor Widerwillen anspannte. Er sah, wie sie beleidigt das Kinn ein wenig anhob, und ihm wurde klar, dass sie seine Gereiztheit bemerkt haben musste. Aber er hatte trotz des Zorns in ihren Augen auch den Schmerz darin gesehen, und so ließ er es zu, dass seine Züge sich entspannten und der Ausdruck des Unmuts aus seinem Gesicht wich. Vielleicht war sie zornig, weil sie gestört worden war. Sie schlief morgens gerne lange. Aber wirklich, da lag nun doch ein Häufchen Mann zu ihren Füßen, im Sterben vielleicht sogar, und alles, woran sie denken konnte, war ihr Schlaf. In diesem Augenblick drängte sich seine Frau Malika hinter Rehanas rechter Schulter hervor, schnappte erschrocken und voller Mitleid nach Luft, als sie den Mann sah, und ihre Hand flog zu ihrem offenen Mund. Er spürte, wie ihm ihre Gutherzigkeit wiederum ein Lächeln aufs Gesicht lockte.
»Warte!«, sagte Rehana und hielt Malika zurück, die an den Mann herantreten wollte. »Renn nicht gleich hinüber. Wer ist dieser Mann? Wo hast du ihn gefunden? Was ist los mit ihm?«
»Ich weiß nicht«, sagte Hassanali leise, mit der beschwichtigenden Stimme, mit der er zu Rehana sprach, wenn sie gereizt war, und die sie manchmal nur noch umso mehr reizte. Er wusste nicht, welchen Ton er sonst anschlagen sollte, wenn ihr etwas nicht gefiel, vor allem, wenn er ihre Fragen nicht beantworten konnte. Selbst wenn er eine Antwort für sie parat hatte, löste ihre Verachtung Zweifel in ihm aus und brachte ihn dazu, sich zu verstellen. Seine Unsicherheit in diesem Augenblick zeigte sogar ihm selbst, dass er wieder einmal zu leichtgläubig gewesen war. »Er ist von da draußen gekommen. Er ist verwundet.«
»Von wo draußen? Aus welcher Richtung? Wodurch verwundet? Was fehlt ihm?«, fragte Rehana mit einem Blick voller verächtlicher Ungläubigkeit. Hassanali kannte den Blick und hätte ihr gerne gesagt, wie hässlich er ihr Gesicht machte, das ansonsten hübsch und anziehend war. Aber er hatte es nie gelernt, ihr solche Dinge zu sagen, ohne alles noch schlimmer zu machen. »Was hast du uns da gebracht, du mit deinen Eskapaden? Da taucht ein kranker Mann von wer weiß wo, mit wer weiß welchem Leiden auf, und du bringst ihn geradewegs in unser Haus, damit wir alle an dem sterben können, woran er stirbt. Ein großer Unternehmer bist du, wahrlich. Ein echter Mann von Welt, muss ich schon sagen. Hast du ihn angefasst?«
»Nein«, sagte Hassanali überrascht, dass er es nicht getan hatte. Er sah zu seiner Frau Malika hinüber, und sie senkte den Blick. Sie sah so hübsch aus, so unkompliziert, so jung. Ihr Anblick löste eine Art Qual in ihm aus, etwas zwischen eifersüchtiger Angst um ihre Ergebenheit und einer Sehnsucht, ihr zu gefallen. »Die jungen Männer haben ihn aufgehoben und hierhergetragen. Aber du hast recht, ich habe nicht an Krankheit gedacht. Ich dachte, er sei verwundet. Wir sollten ihn besser nicht berühren, bis Mamake Zaituni ihn sich angesehen hat. Ich habe nach ihr geschickt. Malika, tu, was Rehana sagt, und halt dich von ihm fern.«
»Wie weise du auf einmal bist«, sagte Rehana sarkastisch und müde. Dann sah sie den Mann an, der dort lag, senkte die Stimme, wie um nicht unhöflich zu sein, und sagte so leise, dass es fast schon einem Flüstern gleichkam: »Du hast ihn auf die Essmatte gelegt. Was hast du dir dabei gedacht, einen kranken Fremden einfach so zu uns zu bringen, ohne zu wissen, was ihm fehlt? Er könnte sterben«, sagte sie, und ihre Stimme wurde noch leiser, »und dann werden seine Verwandten kommen und uns Vorwürfe machen.«
»Du kannst nicht von mir erwarten, dass ich einen leidenden Sohn Adams da draußen lasse, wenn wir ihm Güte und Fürsorge zukommen lassen können«, protestierte Hassanali.
»Oh, ich habe vergessen, dass du ein Mann Gottes bist«, sagte Rehana leichthin und lächelte sogar ein wenig. »Das nächste Mal bring ihn in die Moschee, da wird dann Gott für ihn sorgen. Wahrscheinlich sollten wir dankbar sein, dass du uns nicht einen stinkenden Wilden gebracht hast. Holt jemand Mamake Zaituni?«
Rehana behandelte ihn schon seit Jahren, als wäre er dumm. Es war nicht immer so gewesen. Erst als sie zur Frau herangewachsen war, hatte sie angefangen, mit ihm zu reden, als wäre er schwer von Begriff und unfähig, sich in der Welt zurechtzufinden. Es hatte ihn zuerst belustigt, Rehana, die Erwachsene spielend, im Bündnis mit ihrer Mutter, die mit dem Alter und der Witwenschaft reizbar geworden war. Inzwischen arbeitete er Tag und Nacht, um ihre Ehre zu schützen und ihre hungrigen Mäuler zu stopfen. Auch das war etwas, was er nie zu sagen wagte, nämlich, dass er schuftete und sie ihn zum Dank dafür unfähig schimpften im Angesicht der Welt. Rehana hatte sich mit der Zeit zu einer Frau voller Verachtung verhärtet, und Hassanali hatte sich wohl oder übel in ihre Verachtung geschickt. Er wusste nicht, was er sonst hätte tun sollen. Es war nicht nur die Zeit, die sie so höhnisch gemacht hatte. Nein, so war es nicht. Azad und Hassanali hatten auch ihren Teil dazu beigetragen. Manchmal durchwogte ihre Stimme seinen ganzen Körper, und seine Augen wurden wässrig vor Hilflosigkeit.
»Ja, es ist sie jemand holen gegangen«, sagte er. Er sah zu Malika hinüber, und sie warf ihm einen raschen Blick der Anerkennung zu, schaute aber gleich wieder weg. »Gibt es Kaffee?«, fragte er, um das Wort an sie zu richten und sich von Rehana abzuwenden.
Malika nickte. »Ich mach welchen«, sagte sie und ging in einem übertrieben vorsichtigen Bogen um den stöhnenden Körper herum zum Kohlenbecken.
In den trägen Augenblicken im Laden, wenn er es leid war, zum Zeitvertreib die Perlen seiner Gebetskette zu zupfen und zu beten, kam er nur schwer gegen die kleinen Wellen der Angst an, die aus dem Nichts aufstiegen, um ihm den Atem zu nehmen. Das Unvorhersehbare ängstigte ihn, auch wenn es nur um belanglose Kleinigkeiten ging. Kleine Probleme, mit denen er sich zu lange befasste, wurden in solchen Augenblicken groß und belastend, und eines davon war die Furcht, dass Malikas Achtung eines Tages ebenfalls in Verachtung umschlagen könnte.
Rehana setzte sich auf einen Hocker und lehnte sich mit einem Seufzer gegen die Wand, um auf Mamake Zaituni zu warten. Hassanali wandte sich kaum merklich von ihr ab und unterdrückte sein schlechtes Gewissen. Er ließ sich zu rasch die Schuld an etwas zuschieben. Er sollte sich diesen unausgesprochenen Bezichtigungen gegenüber weniger angreifbar machen. Er lehnte sich gegen den Pfosten, der das Vordach stützte, und blickte auf das graue Bündel Mensch hinunter, das er in sein Haus gebracht hatte. Er erinnerte sich an seine Freude darüber, dass er ihn da in seinem Hof hatte, und der Gedanke, dass Hamza versucht hatte, ihm den Mann zu stehlen, entlockte ihm ein Lächeln. Hamza konnte einer solchen Versuchung nicht widerstehen, immerzu musste er mit allen anderen wetteifern, immer musste er auftrumpfen. Hätte Hamza auch versucht, ihm den Fremden zu stehlen, wenn er ein stinkender Wilder gewesen wäre, wie Rehana gesagt hatte? Er glaubte es nicht. Hamza nahm den Mund stets ziemlich voll, wenn es um die Wilden ging, mit denen er in seinen jüngeren Jahren als reisender Händler zu tun gehabt hatte: wie unvorhersagbar ihr Zorn war, wie rücksichtslos ihre Habsucht, wie unkontrollierbar ihre Gier. Tiere. Hätte Hassanali ihn in diesem Fall nach Hause gebracht? Der Gedanke amüsierte ihn. Natürlich nicht, sie fürchteten sich alle vor den Wilden. Alle erzählten ununterbrochen Geschichten über sie. Niemand überlebte da draußen im offenen Land, außer den Raubtieren und den Wilden, die beide nichts fürchteten, und natürlich die fanatischen Somali und die abessinischen Habashiund ihre Verwandten, die ihren Verstand vor langer Zeit in endlosen Fehden verloren hatten. Er warf Rehana einen Blick zu und bemerkte, dass sie beobachtete, wie er vor sich hin grinste. Sie betrachtete ihn mit einem langsamen Kopfschütteln, ihre Augen waren jetzt groß und wach.
»Maskini«, sagte sie. Du Armer.
»Ich habe an Hamza gedacht«, sagte er. »Er wollte ihn in sein Haus bringen. Dieser alte Mann, immer will er überall der Erste sein.«
»Und du hast ihn daran gehindert, was?«, sagte sie mit sarkastischer Ehrfurcht in der Stimme.
In diesem Augenblick kam ein Ruf über die Hofmauer. Mamake Zaituni war gekommen. Als Hassanali die Tür öffnete, sah er, dass die alten Weisen sich auf dem Charpainiedergelassen hatten, um zu warten, was geschehen würde, und dass die beiden Jüngeren hinter Mamake Zaituni standen, wie um sie davor zu beschützen, dass ihr Böses geschah. Die Heilerin eilte an ihm vorbei, klein und unermüdlich, mit gedämpfter Stimme beständig Gebete vor sich hin murmelnd, ihren Lebensfaden herunterspulend. Hassanali hatte nicht damit gerechnet, dass die Menge draußen warten würde. Er verscheuchte sie mit einem Winken, das sich auf mehrfache Weise deuten ließ, sodass keiner Anstoß nehmen konnte, und schloss und verriegelte die Tür.
»Ist alles in Ordnung da drinnen?« Das war Hamza, der sich wie gewöhnlich über alle anderen hinweg Gehör verschaffte. Hassanali öffnete die Tür wieder und bedeutete ihnen höflich, leise zu sein, aber es freute ihn zu sehen, dass die drei Älteren bereits standen und die zwei jungen Männer den Charpaischon hochgehoben hatten und sich zum Gehen anschickten. Er winkte zum Abschied und schloss rasch die Tür.
»Hassanali, wann sperrst du den Laden auf?«, fragte Jumaane über die Mauer hinweg. Sie hätten ihn gerne so bald wie möglich da draußen gehabt, um zu erfahren, was drinnen vor sich ging.
»Ich komme, meine Brüder«, rief er zurück.
»Wir gehen beten«, rief Ali Kipara, vielleicht, um Hassanali dazu zu verlocken, sich ihnen anzuschließen.
Mamake Zaituni wechselte andeutungsweise Handküsse mit Rehana und Malika, doch sie gestattete keiner der beiden, ihre Hand wirklich zu berühren, sondern achtete vor allem darauf, ihnen ihrerseits die Hände zu küssen. Es war ein Trick der Bescheidenen, dem anderen die Hand zu küssen und die eigene wegzuziehen, bevor der Kuss erwidert werden konnte. Dass sie nie jemandem erlaubte, ihre Hand zu küssen, war ihre Art, selbst den Bescheidensten zu zeigen, wie bescheiden sie war, und alle sagten, dass dies ein Teil ihrer Heiligkeit sei und einer der Gründe, weshalb Gott ihr die Gabe des Heilens verliehen habe wie zuvor schon ihrem Vater. Weiter Gebete vor sich hin murmelnd, legte sie ihren Buibuiab und faltete ihn sorgfältig zusammen, als wäre er aus feinster, nach Sandelholz duftender Seide und nicht aus allerdünnster Baumwolle, die nach Holzfeuer und Fett roch. Ihr alter Baumwollschal war fest um ihren Kopf gebunden und fiel bis auf ihre Handgelenke herab, sodass nur ihre Hände und ihr scharf geschnittenes Gesicht zu sehen waren. Sie schlüpfte aus ihren Sandalen und stieg auf die Matte, dann ging sie um den Mann herum, ohne ihn zu berühren, dürr und gebeugt wie ein alter Raubvogel. Sie sprach ein Gebet, mit dem sie um Hilfe und Schutz gegen das Unbekannte bat. Dann forderte sie Rehana und Malika auf, ins Haus zu gehen, um dem unbekannten Mann Peinlichkeiten zu ersparen, wie sie sagte. Ihr Ton war scharf, gereizt, als wären die beiden Frauen auf irgendein ungehöriges Vergnügen aus, indem sie hier herumstanden. So war sie immer, energisch und bestimmt, und sie wusste stets genau, was sich schickte.
Rehana gab ein ungeduldiges Geräusch von sich, aber sie leistete keinen Widerstand. Die Kombination von Bescheidenheit und energischer Strenge machte es unmöglich, Mamake Zaituni etwas zu verweigern, und sie war diejenige, die immer geistesgegenwärtig genug war zu wissen, was am besten zu tun war. Ohne den Mann zu bewegen, riss sie den Kittel mit einer dünnen Klinge ein und schlitzte ihn dann vom Hals bis zu den Knöcheln auf. Der Mann hatte eine helle Haut und war Europäer. Sein Körper war dünn und knochig, und er sah schwach und eigenartig aus im heller werdenden Licht. Zuerst dachte Hassanali, er sei einer dieser hellhäutigen Araber aus dem Norden, von denen er gehört hatte, mit grauen Augen und goldenem Haar, aber als sie ihm die Sandalen und dann auch die Hose herunterzogen, sahen sie, dass er unbeschnitten war. Mzungu,sagte Mamake Zaituni zu sich selbst. Ein Europäer. Er hatte blaue Flecken und Kratzer, aber keine Wunden am Körper, weder vorne noch an den Seiten. Sein Bauch war seltsam blass und glatt, wirkte so kalt und tot, und Mamake Zaitunis knochige Hände schwebten zögernd darüber, wie mit einer Mischung aus Faszination und Furcht, dachte Hassanali, als würde sie ihn gerne aus bloßer Neugier berühren. Es waren dieselben unermüdlichen Hände, die den Teig für das Brot kneteten, das Mamake Zaituni jeden Tag buk und verkaufte, dieselben Hände, die ihn rollten und auf den Backstein legten, dann umdrehten und später herausholten, ohne sich dabei zu verbrennen. Dieselben Hände, die eine entzündete Niere massierten oder eine blutende Wade verbanden oder ohne Zögern in menschliche Qualen eintauchten. Doch jetzt schwebten sie unschlüssig über dem blassen Bauch des Mannes.
Sie drehten ihn auf die Seite. Er stöhnte und öffnete die Augen, und Hassanali rechnete damit, dass ein schlechter Geruch von ihm aufsteigen würde, aber er roch nur nach trockenem Fleisch und Staub, nach Lumpen, die zu lange in der Sonne gelegen hatten, und nach Reisen. Sein verhungertes Aussehen und der ihm anhaftende Geruch nach Staub und Sonne ließen darauf schließen, dass er schon einige Tage herumgeirrt sein musste. Auf der Rückseite seines Körpers waren weitere blaue Flecken und Kratzer und ein dunkelgrüner Schatten um seine rechte Schulter herum, aber keine Wunden, kein Blut. Sie legten ihn sachte wieder auf den Rücken, Mamake Zaituni bedeckte ihn mit dem zerrissenen Kittel und rief nach den Frauen. Sie betastete sein Gesicht, und er stöhnte wieder und öffnete benommen die Augen.
»Gebt ihm ein bisschen Honig in warmem Wasser«, sagte sie schneidend, wie es ihre Art war. »Ein Teil Honig, drei Teile Wasser in einer Kaffeetasse.« Sie warf Rehana einen Blick zu und schaute gleich wieder weg, ohne wirklichen Blickkontakt aufgenommen zu haben. Rehana erwiderte den Blick mit einem spöttischen Lächeln. Ich nicht, denkt sie wohl, stellte Hassanali sich vor. »Dann lasst ihn schlafen. Es fehlt ihm weiter nichts. Er ist erschöpft und durstig, so viel ist sicher. Er hat einen schlimmen Bluterguss um die Schulter herum, es könnte also etwas gebrochen oder ausgerenkt sein. Das soll sich Beinbrecher ansehen. Ich geh jetzt, um mein Brot fertigzubacken, die Leute werden schon darauf warten. Später bringe ich ihm ein wenig Suppe.«
»Hat er keine Krankheit?«, sagte Rehana fragend, ungläubig.
»Dafür sehe ich keine Anzeichen«, antwortete Mamake Zaituni. »Kein Fieber, kein Ausschlag, keine üblen Gerüche, kein Durchfall. Die Sonne hat ihn wahrscheinlich ausgetrocknet und schwindlig gemacht. Limemkausha na kumtia kizunzungu.Ich komme später wieder, wenn ihr ihm den Honig gegeben habt und wenn Beinbrecher ihn sich angesehen hat. Ich gehe jetzt zurück zu meinem Brot.«
Während Mamake Zaituni sich zum Gehen anschickte, rasselten die Frauen sich gegenseitig Weisungen herunter, und es schien, als brauchten sie Hassanali nun nicht mehr. Er ging ungern, denn er hoffte, dass der Mann sprechen oder ihn ansehen oder wenigstens in seine Richtung blicken würde. Es schien ihm nicht richtig, ihn anderen Menschen zu überlassen, nachdem doch er es gewesen war, der ihn gefunden hatte. Aber er konnte nicht sprechen, oder jedenfalls hatte er noch nicht gesprochen, als Hassanali schließlich ins Haus ging und sich daranmachte, seinen Laden aufzusperren.
»Ruft mich, wenn ihr Hilfe braucht«, sagte er. »Und vergiss meinen Kaffee nicht, Malika.«
»Ja, Herr«, sagte Malika und parodierte ihren Gehorsam mit einer spöttischen Gebärde.
Und so begab es sich, dass der Engländer Pearce eintraf und eine Sensation und ein Drama in Gang setzte, was ihm jedoch nie bewusst werden sollte.
Hassanali war ein kleiner Mann. Er betrachtete sich selbst als klein und ein wenig lächerlich in den Augen anderer, rund und übergewichtig. Wenn das Geplänkel losging, versuchte er stets, sich aus den Sticheleien und Späßen herauszuhalten, und blieb still, um Problemen aus dem Weg zu gehen. Er lebte in einem eigenartigen Zustand in sich gekehrter Schüchternheit, rechnete immer mit Spötteleien und zog sie auch unvermeidlich auf sich. Er konnte seine Ängstlichkeit nicht verbergen, und Menschen, die ihn schon sein Leben lang kannten, wussten um sein Problem und machten sich einen Spaß daraus. Sie sagten, es hätte etwas mit seinen Jinsizu tun, seinen Vorfahren. Die Inder sind feige, sagten sie, und hopsen herum wie nervöse Schmetterlinge. Sein Vater aber war nicht schüchtern gewesen. Er war in seiner Jugend sogar ein echter Heißsporn, der sang und tanzte und mit anderen Burschen durch die Straßen lief, und er war der Inder unter seinen Vorfahren. Es war Gott, der ihn so gemacht hatte, das hatte nichts mit seinen Vorfahren zu tun, und wer war er schon, sich deswegen mit Gott anzulegen. Alhamdulillah. Er hielt die Augen offen, um sich gegen mögliche Schwierigkeiten zu wappnen, und dachte, das sei das Beste, was er tun konnte. Im Laufe der Jahre lernte er, die Menschen, mit denen er lebte, einigermaßen einzuschätzen, obwohl ihn das nicht immer vor Problemen bewahrte. Er nahm ihren Spott gutmütig hin, tat, als erkenne er keine Bösartigkeit darin, bloß Übermut und eine raue Freundlichkeit. Und trotz seiner Schüchternheit erwarb er sich mit der Zeit auch eine leise Überlegenheit gegenüber seinen Kunden und Nachbarn. Er war ein kleiner Mann, ganz ohne Zweifel, aber er war ein kleiner, schlauer Mann. Er war Krämer, ein Beruf, der es zwingend verlangte, die Kunden zu überlisten, sie mehr bezahlen zu lassen, als sie gerne gezahlt hätten, ihnen weniger zu geben, als sie gerne bekommen hätten. Und er musste es unauffällig tun, nicht auf unverfrorene oder aggressive Weise. Wenn er von den Winkelzügen und Machenschaften der Großkaufleute hörte und den Profiten, die sie damit erzielten, ließ ihn der Gedanke an das Risiko vor panischer Angst und Neid zittern. So lachten sie also über ihn, und er ließ sie zahlen, wenn auch nur ein bisschen. Er sah darin ein Arrangement, das der Beruf mit sich brachte.
Manchmal dachte er, dass sie lachten, weil sie ihm die Freude über den kleinen Vorteil anmerken konnten, den er sich auf ihre Kosten verschaffte. Manchmal wünschte er sich, etwas anderes zu sein, ein Bäcker oder ein Tischler, etwas Nützliches. Aber das war er nicht, er war Krämer, wie so viele andere. Sein Vater war Krämer gewesen, und sein Sohn, sollte er dereinst einen haben, würde ebenfalls Krämer werden. Sie waren einfache Leute.
Als er den Laden an diesem Morgen öffnete, standen bereits drei Kunden da. Sie machten ihn nervös, obwohl einer davon bloß ein Kind war und die anderen die beiden jungen Männer, die den verletzten Europäer in sein Haus getragen hatten und jetzt auf seinen Dank warteten. »Wir haben die ganze Zeit auf dich gewartet«, sagten die jungen Männer, »und jetzt kommen wir sicher zu spät zur Arbeit.« Gewöhnlich konnte er sich mit dem Aufschließen seines Geschäfts Zeit lassen, wenn er vom Morgengebet zurückkehrte und noch niemand da war. Es war eine komplizierte Angelegenheit. Die Ladenfront bestand aus einer Reihe dicker Bretter, jedes zwei Handflächen breit, insgesamt achtzehn an der Zahl. Er entfernte die ersten zwei Bretter und bediente von dort das Kind. »Ein Schöpflöffel Gheeund grüß mir die Familie.« Dann gab er jedem der beiden jungen Männern zehn Anna. Sie nahmen die Münzen entgegen, aber sie rührten sich nicht von der Stelle, sondern blieben mit unterdrücktem Lächeln vor ihm stehen. Es waren gute junge Männer, Salim und Babu. Auch sie waren gekommen, um Besorgungen für ihre Mütter zu erledigen, wie der Junge, dem er einen Schöpflöffel Ghee verkauft hatte, und würden wohl für den Rest seines Lebens seine Kunden bleiben. Er gab jedem noch zehn Anna, und dann noch einmal zehn, bevor sie schließlich gingen, zufrieden damit, dass es ihnen gelungen war, ihn zur Großzügigkeit zu nötigen. Das lag daran, dass alle ihn für reicher hielten, als er war, und seine Sparsamkeit als Geiz betrachteten. Es war schlimm, für einen Geizhals gehalten zu werden, sich gegen Gottes Gebot zu versündigen, dass die Wohlhabenden sich den Bedürftigen gegenüber als großzügig erweisen sollen. Die Leute, die bei dem Krämer, der Tag und Nacht auf seinem Hintern über den Bergen von Gütern thronte, die sie begehrten, ihre paar Annasund Rupien ablieferten, gingen davon aus, dass er weiter nichts zu tun hatte, als das Geld zu zählen und zu horten. Das jedenfalls wurde von den Händlern behauptet. Dass sie wie die Armen lebten und ihren Reichtum in einem Loch im Hintergarten versteckten.
Hassanali nahm die restlichen sechzehn Bretter der Reihe nach heraus und stapelte sie vor dem Laden. Dann holte er das Verkaufspult, legte es auf die gestapelten Bretter, klappte es aus und platzierte in der gewohnten Weise seine Waren darauf. Zum Schluss platzierte er auch sich selbst inmitten der bunten Ansammlung von Gefäßen mit Öl und Gheeund Gewürzen, von Strohkörben mit Linsen, Bohnen und Datteln und Säcken mit Reis und Zucker. Das alles brauchte seine Zeit. Endlich war es geschafft, und seine Gedanken kehrten zurück zu dem Kaffee, den Malika ihm versprochen hatte, dazu vielleicht ein Gebäck oder ein Stück Brot. Sie kehrten zurück zu dem Mann, der unter dem Vordach in seinem Hof lag. Er verspürte einen Stich der Hilflosigkeit. Was war das für ein Mensch, der sein Zuhause verließ, um eine Tausende Meilen entfernte Wildnis zu durchstreifen? War das Mut oder eine Art Verrücktheit? Was gab es hier, das besser war als das, was er hinter sich gelassen hatte? Hassanali konnte sich nicht vorstellen, was in ihm den Wunsch auslösen könnte, so etwas zu tun. War er ein Idiot, einen fremden Mann ohne Stimme und ohne Namen mit seiner Schwester und seiner Frau allein im Haus zu lassen? Sollte er gewalttätig werden oder das Undenkbare versuchen, wäre Hassanalis Nachlässigkeit unverzeihlich. Er stellte sich an die Tür, die vom Laden ins Haus führte, und rief nach Malika, »schnell, schnell, komm jetzt«.
»Ich komm schon, ich bring dir deinen Kaffee«, rief sie zurück, und ihre Stimme klang gedämpft durch die Säcke und Kisten, die sich an den Wänden des Durchgangs zum Haus reihten.
»Jetzt komm«, rief er drängend, aber er fühlte sich schon beruhigter, als er ihre Stimme hörte. Sie klang nicht verängstigt, trotzdem wollte er, dass sie sich beeilte, um ihr zu sagen, dass sie vorsichtig sein sollte, um sie zu warnen vor der Welt. »Was tut sich?«, fragte er, als sie kam und ihm eine Kanne Kaffee und ein Hirsebrötchen brachte, das in ein Tuch gewickelt war. »Was tut sich da drinnen?«
»Nun, es hat sich herausgestellt, dass er ein Dämon ist, der die Gestalt eines Mannes angenommen hat«, sagte Malika, die mit unbedecktem Kopf in der Tür stand und Hassanali mit schreckensweiten Augen ansah. »Kaum hat Rehana ihm einen Schluck Honig mit Wasser gegeben, hat er sich in einen Rukhverwandelt, und jetzt hockt er auf dem Dach und wartet darauf, dass eine von uns tot umfällt, damit er ihre Seele stehlen kann.«
»Hör auf mit dem Unsinn«, sagte Hassanali, obwohl er es ganz gerne mochte, wenn Malika ihn neckte. »Er kann kein Rukhsein. Ich hab es dir schon gesagt, ein Rukhhat einen Namen, aber keinen Körper, also kann er nicht auf einem Dach hocken.« Außerdem sei der Rukhder unzerstörbare Geist, der den Körper nach dem Tod verlässt, und nicht einer, der Seelen stiehlt. Ihr Mzunguaber sei ein Körper ohne Namen und konnte daher nicht der Rukhsein. Sie kümmerte sich nicht darum, und nur, um ihn aufzuziehen, wiederholte sie die Dinge, die er ihr erklärt hatte, falsch. Sie neckte ihn gerne und viel, wenn sie allein waren. Eines ihrer geheimen Spiele bestand darin, dass Malika ihn ausschimpfte, während er sie mit Entschuldigungen und Zärtlichkeiten überschüttete. Sein Leben war anders geworden, seit sie bei ihm war.
»Was glaubst du denn dann, was geschieht?«, fragte sie. »Der Mzunguliegt stöhnend dort, nimmt einen Schluck, wenn Rehana ihm etwas gibt, und sabbert und rülpst wie ein Baby. Beinbrecher ist vor wenigen Minuten gekommen und sieht ihn sich jetzt an. Mach dir doch keine Sorgen wegen nichts.«
»Ich mache mir keine Sorgen wegen nichts«, antwortete er stirnrunzelnd und fühlte sich versucht, ihr zu sagen, dass er fast doppelt so alt war wie sie und dass sie ihm gegenüber mehr Respekt zeigen sollte. Aber er wollte nicht mehr Respekt, er wollte nur nicht, dass sie schon wieder davoneilte. »Ich wollte nur wissen, ob alles in Ordnung ist. Du hast lange gebraucht für den Kaffee, und wir wissen nicht, wer dieser Mann ist. Ich wusste nicht, was da drinnen vor sich geht.«
»Der Mann liegt dort und lebt kaum, mein Herr und Gebieter.«
Hassanali nickte. »Was sagt Beinbrecher?«, fragte er.
»Er hat noch nichts gesagt, und wenn er etwas sagt, wird er es wahrscheinlich nicht uns sagen«, antwortete Malika und fügte dann flüsternd hinzu: »Er kann einem richtig Angst machen, dieser alte Mann.«
»Pass auf dich auf«, sagte Hassanali und schickte sie mit einer Handbewegung fort. Er sah, dass sich ein Kunde näherte. »Und sag Beinbrecher, dass er zu mir kommen soll, bevor er irgendetwas unternimmt.«
Beinbrecher war der Mann, der gebrochene Knochen einrichtete, und er hatte sich diesen Namen und einen schrecklichen Ruf erworben, weil er den Knochen nach einem Bruch häufig falsch einrenkte. Oft musste er ihn hinterher noch einmal brechen, um zu versuchen, es wieder in Ordnung zu bringen. Manchmal war mehr als ein zweiter Versuch nötig, und Beinbrecher in die Klauen zu fallen, konnte zu einer kleinen Tragödie werden. Wenn ein Kind stürzte, zitterten die Eltern vor Angst, dass die Dienste Beinbrechers nötig werden könnten. Es gab sonst niemanden, der eine Ahnung davon hatte, wie man Knochen einrichtet. Hassanali hoffte für den armen Mzungu, dass er keinen gebrochenen Knochen hatte.
Der Gedanke, dass der Mzunguin seinem Haus war, gefiel Hassanali. Er hatte schon früher einmal einen gesehen, vor zwei oder drei Jahren, als er in der Stadt zum Meer hinuntergegangen war. Als Kind war er wie alle anderen zum Strand gegangen, aber damals hatte es keine Mzungusgegeben. Jetzt gab es niemanden, der auf den Laden aufgepasst hätte, und er kaufte seine Lagerbestände von Lieferanten, mit denen er schon seit vielen Jahren entsprechende Abmachungen hatte, also hatte er es nicht nötig, irgendjemand hinterherzurennen. Manchmal, wenn ein Nachbar oder eine bedeutende Persönlichkeit gestorben war, sperrte er den Laden zu und schloss sich der Prozession zum Friedhof an. Und im Ramadan war es sinnlos, den Laden tagsüber offen zu halten, wenn ohnehin keiner aus dem Haus ging. Seit Malika hier war, schloss er den Laden auch über Mittag und gönnte sich am Nachmittag eine kurze Rast. Aber abgesehen von diesen und vielleicht ein oder zwei ähnlichen Gelegenheiten hielt er den Laden vom Morgen, gleich nach dem Morgengebet, bis eine Stunde nach Sonnenuntergang offen und verließ kaum je aus irgendeinem Grund seinen Posten an der Kasse. Er hatte sogar seinen Körper darauf trainiert, dieser starren Selbstzucht zu gehorchen.
Es war am Tag des Iddgewesen, dass er zum Strand hinuntergelaufen war. An diesem Tag war es üblich, alle Geschäfte wenigstens für einen Teil des Tages zu schließen, und er war mit allen anderen in die Bucht gegangen, um sich das jährliche Bootsrennen anzusehen. Dort hatte er den Mzunguerblickt, der auf dem überdachten Podium inmitten der arabischen Hoheiten stand. Er war massig und groß, trug eine grüne Jacke, helle Hosen und einen dieser gepolsterten Hüte, von denen Hassanali schon gehört, aber vorher noch nie einen gesehen hatte. Er wusste, dass das der Mann war, den der Sultan von Sansibar herübergeschickt hatte, um die Plantagen zu leiten, und der ganz unerwartet die Sklaven freigelassen und so die Landbesitzer um ihren Reichtum gebracht hatte. Dieser Mzungudamals war so weit weg gewesen, als Hassanali ihn sah – nicht mehr als eine grüne Jacke und ein Hut, eher eine bunte Gestalt aus einer Geschichte als ein echter Mensch. Aber der jetzige war sein Gast und lag stöhnend dort drüben auf der Essmatte in seinem Hof.
Es war immer aufregend, Gäste zu haben, vor allem in den ersten paar Tagen. Alles war ein vergnügtes Durcheinander, und alle fanden es eine Weile sehr schön. Er genoss es. Aber mit diesem Gast war es etwas ganz anderes. Ein Europäer, ein Mzungu. Was sollten sie mit einem Europäer anfangen? Wo sollten sie ihn unterbringen? Er hätte ihn Hamza überlassen sollen. Hamza hatte leere Zimmer in seinem Haus und den Reichtum und die Einrichtung, um es dem Mzungubequem zu machen. Sie hatten nur zwei Zimmer, und Hassanali würde seines mit ihm teilen müssen. Nach allem, was er gehört hatte, würde der Europäer das Zimmer sicher für sich allein haben wollen, oder vielleicht sogar das ganze Haus. Was sollten sie ihm zum Essen vorsetzen? Wie sollten sie mit ihm sprechen? Wahrscheinlich war er Engländer oder Deutscher oder vielleicht ein Italiener. Hassanali sprach kein Wort von einer dieser Sprachen. Warum sollte er auch? Er war nur ein Krämer in einer verfallenen Stadt am Rand des zivilisierten Lebens. Vielleicht, überlegte er, während er die Körbe und Säcke in seinem Laden arrangierte, sollte er Hamza benachrichtigen und ihn bitten, den Engländer, oder was immer er war, abzuholen. Der Gedanke setzte sich in ihm fest, sein ängstliches Herz raste. Am besten, er ließ ihm gleich eine Nachricht zukommen. Bitte komm und hol den Engländer, ich habe keinen Raum in meinem bescheidenen Haus für einen solchen Gast. Aber was für ein Spaß das für die Leute wäre, wie sie ihn auslachen würden. Einen Knauserer und Geizhals würden sie ihn nennen und sagen, dass er einem verwundeten Fremden die Gastfreundschaft verweigert hatte, er, der in Wahrheit einen Schatz im Haus versteckt hätte, den üblichen Quatsch eben. Das kleine Sümmchen, das er heimlich beiseitegeschafft hatte, konnte man gewiss nicht Reichtum nennen.
Und schließlich war er es gewesen, der den Mann aus der Dunkelheit der Morgendämmerung hatte auftauchen sehen und für ein vom heraufziehenden Licht an Land geworfenes Gespenst gehalten hatte. Er war es gewesen, den der Blick der grauen, glänzenden Augen gesucht und verfolgt hatte. Es war eine Fügung Gottes gewesen, dass die Dinge geschehen waren, wie sie geschehen waren, und was Gott fügte, war kein Zufall. Diese Last war ihm auferlegt worden, vielleicht um ihn entsprechend einer Weisheit, in die er noch keine Einsicht hatte, zu prüfen oder zu bestrafen oder auf die Probe zu stellen. Wie konnte er auch nur daran denken, dem verwundeten Mann Gastfreundschaft und Beistand zu verweigern? Nachdem er sich so davon überzeugt hatte, dass es eine Beleidigung Gottes wäre, den Europäer abzugeben, spürte Hassanali, wie sein Körper sich wieder der stillen Erregung überließ, die er vorher beim Gedanken an den Engländer in seinem Haus empfunden hatte. Es war, als hätte er sich ein exotisches Haustier angeschafft und es beinahe wieder weggegeben, sich aber gerade noch rechtzeitig selbst zur Vernunft gebracht.
Der morgendliche Strom von Kunden begann langsam zu fließen, als Beinbrecher aus dem Haus trat. Er kam durch die Passage aus dem Hausinneren, die zugleich das Warenlager war.
Hassanali warf ihm einen raschen, misstrauischen Blick zu, um sich zu vergewissern, ob er auch nichts im Vorbeigehen hatte mitgehen lassen. Es war ein unbeabsichtigter Blick, ein gewohnheitsmäßiges Misstrauen. Sie beklauten ihn immer, alle. Wer hatte ihm erlaubt, diesen Weg zu nehmen?
»Yahya, wie geht es dir?«, sagte Hassanali. Niemand redete ihn mit »Beinbrecher« an, es sei denn, er konnte sehr schnell laufen oder fürchtete sich nicht vor einem zufälligen Knochenbruch. »Wie geht es unserem Gast?«
Beinbrecher war ein großer älterer Mann mit einem dicken Bauch, der aus seinem Kanzuhervorquoll. Geschichten über seine Kraft und seine Lust am Sex in jugendlichen Jahren waren Teil der Legende, die sich um ihn rankte, und selbst jetzt im Alter fiel es ihm schwer, nicht wie ein alter Krieger herumzustolzieren. Die eng sitzende dicke weiße Mütze, die er immer trug, gab seiner Erscheinung etwas Brutales und ließ seinen Kopf wie eine Kanonenkugel aussehen. Mit finsterem Blick, straff zurückgenommenen Schultern und vorgestrecktem Bauch, die Arme schwingend wie ein Soldat, schritt er durch die Straßen, und es war zum Lachen, wie gänzlich unbewusst es ihm war, was für eine komische Figur er machte. Die Leute nannten ihn Kapitän, um ihm zu schmeicheln. Und die, die über ihn lachten, taten es nur hinter seinem Rücken oder aus sicherer Entfernung, denn er stand in dem Ruf, ein verrückter und gefährlicher Mann zu sein. Er lebte allein in einem gemieteten Parterrezimmer mit einem Fenster zur Straße, und oft hörten Passanten und Nachbarn ihn nachts im Schlaf heiser und gequält stöhnen, doch aus Furcht vor seinen Zornanfällen wagte es keiner, ihn zu wecken.
Er war unter den ersten Baluchi-Soldaten gewesen, die der Sultan von Sansibar zur Bewachung der neuen Plantagen geschickt hatte. Die Al-Busaid-Sultane hatten aus irgendeinem Grund eine Vorliebe für Baluchi-Söldner und hatten sich ihrer von Anfang an seit der Eroberung der Küste bedient. Als Sultan Majid beschloss, das Land hinter dieser entlegenen Stadt in seinem Dominium neu zu beleben, schickte er also mit den Tausenden von Sklaven, die auf den Plantagen arbeiten sollten, ein Baluchi-Kontingent. Und dort auf den Plantagen erwarb Beinbrecher sich seinen Ruf als Knocheneinrenker. Hassanali schauderte beim Gedanken an die armen Sklaven, die seine ersten Patienten gewesen waren. Auch Hassanalis Kunden, die inzwischen die Geschichte von der Ankunft des Europäers kannten, warteten auf Beinbrechers Diagnose. Hassanali konnte sehen, wie sich die drei Weisen Hamza, Ali Kipara und Jumaane beim Anblick von Beinbrecher in seinem Laden in dem Kaffeehaus auf der anderen Seite des Platzes von ihrem Morgenkaffee erhoben. Auch sie wollten wissen, ob Beinbrechers furchterregende Dienste benötigt werden würden.
»Kapitän, ist es wahr, dass die Knochen von Europäern von selbst heilen?«, fragte ihn einer der Kunden, ein magerer junger Mann, der für jeden, der ihn bezahlte, Waren durch die Stadt karrte. Er kam jeden Morgen im Laden vorbei, um sich ein Stück Kautabak zu holen, das Hassanali ihm umsonst gab, um ihn für gelegentliche kleine Wege bei Laune zu halten, für die er ihn brauchte, und auch, weil er ihm leidtat. Soweit Hassanali wusste, hatte er keine Familie und kein Zuhause. Alles an ihm war hektisch und nervös, das spröde Grinsen, das schrille Lachen, die derben lauten Scherze. Zu viel Haschisch, sagten alle. Trotzdem lag nun ein Lächeln auf den Gesichtern, denn aus dem Ton der Frage war zu schließen, dass ihr gleich eine Unverschämtheit folgen und Beinbrecher die Fassung verlieren und Krach schlagen würde, oder Schlimmeres.
»Red nicht solchen Unsinn«, antwortete Beinbrecher milde und gab damit zu verstehen, dass dies ein zu wichtiger Augenblick für melodramatische Wutanfälle sei. »Wenn dazu überhaupt etwas zu sagen ist, dann so viel, dass die Europäer schwache Knochen haben wegen der Kälte und Feuchtigkeit in ihrem Land und weil sie das rohe Fett von Schweinen essen. Das weiß doch jeder.«
»Dann wäre es also ein Leichtes, Kapitän, ihm bei der Behandlung die Knochen wieder und wieder zu brechen«, sagte der junge Mann, hüpfte zur pantomimischen Darstellung von Beinbrechers chirurgischen Maßnahmen auf und ab und grunzte dazu.
Beinbrecher machte ein interessiertes Gesicht und betrachtete den mageren jungen Mann einen Moment mit hartem Blick. Dann wandte er sich widerwillig und langsam zu Hassanali um, der ihn gerade angesprochen hatte.
»Irgendwelche Brüche?«, fragte Hassanali.
»Nein, keine Brüche«, erwiderte Beinbrecher traurig und schüttelte den Kopf über die düstere Nachricht. »Ein paar schlimme Quetschungen und Prellungen. Ich habe ihm einen Umschlag um die Schulter gemacht und komme später wieder, um danach zu sehen. Du solltest ihn vielleicht in die Stadt zu den Arabern schicken. Sie werden sich um ihn kümmern, bis ein Schiff kommt. Oder sie bringen ihn zu einem Arzt nach Mombasa oder sonst wohin.«
»Ja«, sagte Hamza, der gerade zur rechten Zeit eingetroffen war, um die letzte Bemerkung zu hören. »Schick ihn zu den hohen Leuten in der Stadt. Du willst doch bestimmt nicht, dass ihm etwas geschieht, während er sich in deinem Haus aufhält.«
»Das ist sicher das Letzte, was du willst«, sagte Ali Kipara und hob mit Nachdruck den Finger.
»Er soll sich zuerst ausruhen«, antwortete Hassanali, der keine Lust hatte, sich jetzt schon von seinem Mzunguzu trennen.
Er maß ein Quart Reis in ein Stück Stoff, knüpfte es zu einem sauberen Bündel und reichte es Beinbrecher, der sein Honorar ohne ein Wort entgegennahm und zum Ausgang schritt. Ehe der magere junge Mann bemerkte, wie ihm geschah, hatte Beinbrecher ihn schon beim Kragen und drehte ihm gnadenlos das Ohr herum. »Du hast keine Manieren, du dreckiger, verseuchter Hurenbengel, du Sohn einer heulenden Wilden und Enkel einer vierbrüstigen Bestie«, knurrte er und drehte das Ohr des jungen Mannes noch weiter herum. »Du bist ein Affe, ein Pavian ohne Hirn, ein geifernder Hund. Was bist du?«, fragte Beinbrecher und drehte das Ohr noch ein weiteres, undenkbares Stück herum. Dann verließ er den Laden unter heulendem Gelächter und einem Erstickungsanfall ähnlichem Gegacker der Älteren, die Arme schwingend wie ein Soldat auf Parade, während der magere junge Mann sich sein schmerzendes Ohr hielt und ihm, weinend vor Zorn und Demütigung, dreckige Schimpfwörter nachrief.
Hassanali kümmerte sich um seine Kunden, und als der Andrang und das Geschwätz sich gelegt hatten, zerstreuten sich die Leute, um zu ihrer Arbeit zu gehen oder nach Hause zum Frühstück. Er wusste, dass die älteren Weisen im Laufe des Vormittags wiederkommen würden, um sich auf die Bank zu setzen, die er immer für sie vor den Laden stellte, sobald die Sonne hinter den nahen Häusern verschwand. Wenn sie dann später am Tag wieder auftauchten, würden sie davonspazieren, vielleicht zu einem anderen schattigen Fleckchen, oder sich wieder ins Kaffeehaus begeben, dann zur Moschee und dann, am späten Nachmittag, wieder zurück zu seinem Laden. In der Kühle des Nachmittags und Abends würde das Geplauder weniger kampflustig werden, die Geschichten länger und älter. So war es immer gewesen, seit den Tagen seines Vaters. Die Älteren selbst wechselten im Laufe der Zeit, kamen angeschlurft und schlurften wieder davon, wie es dem Gesetz des ewigen Wandels entsprach, aber die Bank war immer da, und es fehlte nie an Männern, die darauf saßen.