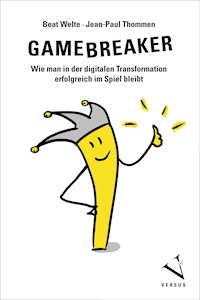Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Friedrich Reinhardt Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
In seinem 1. Fall jagt Li Rösti einem Bild nach, das aus einer Villa an der Zürcher Goldküste gestohlen wurde. Er ist nach einer gescheiterten akademischen Karriere im Family Office seines Vaters für diskrete Ermittlungen im Dienst der betuchten, oft exzentrischen und öffentlichkeitsscheuen Kundschaft zuständig. Der Fall des verschwundenen Bilds erscheint zunächst banal – nur ist nichts so, wie es anfangs scheint. Warum will der Villenbesitzer Alexander Wehrle den Diebstahl partout nicht bei der Polizei melden? Wie konnten die Diebe die ausgeklügelte Sicherheitsanlage überwinden? Und warum liessen sie ausgerechnet das wertloseste Bild der Kunstsammlung mitlaufen? Die Spannung steigt, als auch noch eine zwielichtige Galeristin ermordet wird, die das Bild mutmasslich begutachten sollte. Im Verlauf der Ermittlungen wird Rösti klar, dass er es mit einer gefährlichen Bande zu tun hat, die vor nichts zurückschreckt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 350
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BEAT WELTE
LI RÖSTIS ERSTER FALL
Friedrich Reinhardt Verlag
Alle Rechte vorbehalten
© 2024 Friedrich Reinhardt Verlag, Basel
Projektleitung: Alfred Rüdisühli
Korrektorat: Daniel Lüthi
Gestaltung: Siri Dettwiler
eISBN 978-3-7245-2715-2
ISBN der Printausgabe 978-3-7245-2706-0
Der Friedrich Reinhardt Verlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2021–2025 unterstützt.
www.reinhardt.ch
Für meine Ehefrau Halina
Er erwischte mich auf dem Höhepunkt. Obwohl der Abend noch jung war, versuchte Roli Bucher unseren Clubrekord zu brechen: sturzbetrunken ein Bierglas auf dem Kopf, zum ABBA-Song «Gimme! Gimme! Gimme!» tanzend. Umgeben von den johlenden Mitgliedern unseres Privatclubs «PoorUntamedYouth», kurz PUY. Ich hatte gerade eine Wette am Laufen. Gegen ihn.
Aber der personalisierte Klingelton meines Handys – der Walkürenritt von Richard Wagner – war unbarmherzig: Mein Erzeuger verlangte nach mir.
«Wo bist du?»
«Im Club.»
«Dann kannst du ja schnell im Office sein.»
Klick.
Von unserem Club auf dem Zürcher Sonnenberg zum Rennweg waren es zu dieser Tageszeit knapp zehn Minuten. Mit meinem Alfa Romeo Spider ging es sogar noch etwas schneller. Es war Dienstagabend und nicht viel los in der Stadt. Mein Vater ist der Mitgründer und CEO unseres Multi-Client Family Office, in der pompösen offiziellen Bezeichnung: Swiss Rennweg Capital Preservation Alliance. Zu Deutsch: Die Rennwegkapitalerhaltungsallianz, was noch bescheuerter tönt als das englische Original. Wobei «Capital Preservation» sehr ehrlich und «Alliance» hoffnungslos übertrieben war: In unseren überteuerten Bürofluchten am Zürcher Rennweg arbeiteten dreizehn lohnabhängige Schlaumeier, die alle Schliche des legalen (und manchmal halblegalen) Kapitalerhalts kannten und als Sahnehäubchen auch kunstfertige Verteidigungswälle gegen den Zugriff gieriger Steuervögte errichteten.
Obwohl ich der Sohn des grossen Vorsitzenden war, stand ich in der Hackordnung ganz unten und hatte keinen Parkplatz mit einem eigenen Namensschild in der Tiefgarage. Als aufrechter Schweizer hasste mein Vater Vetternwirtschaft – oder vielleicht sollte ich sagen: Söhnleinwirtschaft. Aber zu dieser Tageszeit waren alle «Masters of the Universe» schon ausgeflogen, und ich schnappte mir den Parkplatz, der dem Aufzug am nächsten lag.
Normalerweise musste ich mich auf dem Weg ins Allerheiligste an einem Vorzimmerdrachen vorbeimogeln. Frau Nadig erinnerte mich mit ihrem Trachtenlook immer an Schweizer Gardisten in Rom. Sie gab mir permanent und wenig subtil zu verstehen, dass ich nur geduldet war im Kreis der Finanzgenies, und blockte mich so von meinem Vater ab, als ob ich ein millionenschweres Sponsoring für irgendeine Miss-Schweiz-Wahl von ihm wollte. Doch heute war der Weg frei und ich trat unbehelligt in sein Büro.
Mein Vater thronte an seinem zweihundert Jahre alten, viel zu tiefen Pult aus Nussbaum mit ziemlich geschmacklosen Swiss-Ethno-Schnitzereien. Ihm gegenüber sass ein Mann mittleren Alters im dunklen Anzug und konservativer Krawatte. Er hatte kurz geschorene Haare, die seinen scharf geschnittenen, attraktiven Charakterkopf bestens zur Geltung brachten. Er mochte fünfzig Jahre alt sein, war schlank, fit mit einer hervorragenden Körperspannung. Tennis oder sehr viele Stunden im Holmes Place, einem angesagten Fitnessstudio in der Innenstadt, dachte ich. Er erinnerte mich an ein Bild des Schriftstellers Hermann Hesse, das ich einmal gesehen hatte. Ebensolche kantigen Züge, aber definitiv weniger intellektuelle Ausstrahlung. Trotzdem: Wenn er sich etwas Mühe gab, konnte er als Intellektueller durchgehen. Er hat sicher viel Erfolg bei Frauen, dachte ich. Die Ähnlichkeit mit Hesse war allerdings rein äusserlich.
«Werisndas?», entfuhr es ihm spontan, als er mich sah.
Natürlich wusste ich genau, dass dies nicht an meinen Balenciaga-Sneakers kombiniert mit einem Prada-Hemd mit digitalen Farbverlauf-Streifen lag, die so gar nicht in ein Umfeld passten, in dem dunkelblaue Anzüge mit diskreten Krawatten und schwarze Schuhe dominierten. Es lag an meinem ausserordentlich anziehenden, aber ebenso exotischen Gesicht: Gestatten, Li Rösti ist mein Name. So heisse ich wirklich, ob Sie es glauben oder nicht. Ich bin die höchst gelungene, aber für einige offenbar ebenso verstörende Kreuzung zwischen einer chinesischen Schönheit und einem konservativen, viele Schweizer Stereotype erfüllenden Chef eines Family Office, das sich um alle Belange – vor allem die finanziellen – der Reichen und Berühmten dieser Welt kümmert.
«Das ist mein Sohn», erwiderte mein Vater. «Er übernimmt in der Allianz die heiklen Aufgaben und sorgt für schnelle und diskrete Lösungen. Er hat eine Zulassung als Privatdetektiv und verfügt über beste Kontakte zur hiesigen Polizei. Gleichzeitig ist er immer verschwiegen und absolut loyal gegenüber unseren Kunden», pries mich mein Vater in einer Art und Weise an, die mich unwillkürlich an einen billigen Jakob auf dem Jahrmarkt denken liess. Mein Vater hatte die Ablehnung gespürt und instinktiv mit einer Lobrede auf mich reagiert, die Amerikaner als «overselling», also überverkaufen, bezeichnen würden.
«Aha», meinte der Besucher, offenbar nicht so ganz überzeugt von dieser Einführung. Er straffte sein Veston mit energischem Griff und setzte sich wieder hin.
«Die Sache ist die», meinte mein Vater umständlich. «Alexander Wehrle ist ein geschätzter Kunde unseres Unternehmens. Ihm wurde ein Bild gestohlen, und er möchte, dass wir es wiederbeschaffen.»
«Das scheint mir ein klarer Fall für die Polizei.»
«Auf gar keinen Fall», entfuhr es Wehrle, «unsere Stiftung kann sich absolut keine Schlagzeilen leisten. Und sei es nur die, dass dem Stiftungsratspräsidenten ein Bild gestohlen wurde.»
«Was stimmt denn nicht mit der Stiftung?», fragte ich frech, was prompt zum Saure-Gurken-Gesicht meines Vaters führte, das, ich schwöre es, seine Ohren leicht wackeln lässt.
«Mit unserer Stiftung stimmt alles», dröhnte Wehrle. «Sie fördert Projekte in den Bereichen Kunst, Kultur und Kulturerbe, die den interkulturellen Dialog fördern und den Erhalt von Kulturgütern unterstützen.»
«Das tönt wie aus einer Broschüre», entgegnete ich. «Wo ist der Haken?»
Vielleicht sollte ich an dieser Stelle erwähnen, dass ich in einigen Dingen das Beste aus den beiden Ethnien mitgenommen habe, die sich bei meiner Produktion gekreuzt haben. In einer Hinsicht aber auch das Schlechteste: Meine Alkoholtoleranz ist, wie bei Asiaten nicht unüblich, ausserordentlich gering. Schon ein Bier genügt, um die Hemmungen fallen und mich Dinge sagen zu lassen, die ich normalerweise etwas diplomatischer ausdrücken würde. Hinzu kam der Ärger wegen dem Wetteinsatz, den ich durch den Ruf ins Office verloren hatte. Ich war mir sicher, dass ich gewonnen hätte. Vor allem aber konnte ich den aufgeblasenen Kerl mit den Husky-blauen Augen nicht besonders gut leiden.
«Nun, die Stiftung ist in Ländern des ehemaligen Ostblocks tätig», gab mein ewiggestriger Erzeuger zu bedenken. «Polen, Ungarn, Rumänien …»
«Und auch Russland», liess Wehrle die Katze aus dem Sack. «Trotz der Spezialaktion von Russland gegen die Ukraine haben wir unsere Aktivitäten nicht eingestellt. Es handelt sich ja um alte Kulturgüter, herrgottnochmal, und nicht um Computerchips oder gar Waffen.»
Damit war mir zumindest halbwegs klar, weshalb die Wehrle Stiftung nicht in den Schlagzeilen sein wollte. Unternehmen und Organisationen, die ihre Aktivitäten in Russland nach dem Angriff auf die Ukraine nicht eingestellt hatten, wurden in den Medien regelmässig an den Pranger gestellt. Deshalb scheuten sie jede Art der Publizität.
Mit ein paar kurzen Sätzen setzte er mich über die Umstände des Diebstahls in Kenntnis. Die «Frühlingsklänge» des 1928 verstorbenen Malers Franz von Stuck stellen eine idyllische Szene im Frühling dar. Im Vordergrund des Bildes befinde sich eine junge Frau, gekleidet in ein fliessendes Gewand, auf einer Wiese. Sie habe die Augen geschlossen und scheine andächtig den Klängen der Natur zu lauschen. Ihr Gesicht strahle Ruhe und Gelassenheit aus, erklärte mir Wehrle in schwärmerischen Tönen, die ihn ein bisschen sympathischer erscheinen liessen.
«Um die Frau herum ist eine üppige Natur dargestellt. Frühlingsblumen, wie Tulpen und Narzissen, erblühen in leuchtenden Farben und schaffen einen farbenfrohen Rahmen. Im Hintergrund erstreckt sich ein Wald mit sanften grünen Hügeln, die in helles Sonnenlicht getaucht sind. Es ist ein grosses Bild mit einem schweren, barocken Rahmen.»
Vielleicht hatte dieser Wehrle doch mehr Ähnlichkeit mit Hermann Hesse? Nein, das kaufte ich ihm nicht ab. Seine Beschreibung tönte auswendig gelernt.
«Wie viel?», fragte ich, des Schwärmens überdrüssig.
«Was meinen Sie?»
«Wie viel ist das Bild wert?»
«Nicht viel. Ein paar Tausend Franken vielleicht», stiess Wehrle aus, «aber wie Sie vielleicht bemerkt haben: Es ist nicht der materielle Wert. Ich hänge sehr an diesem Bild – und ich muss es wiederhaben.»
Der letzte Satz war nicht etwa, wie das ganze Gespräch, in Zürichdeutsch gesprochen, sondern in Hochdeutsch. Eine dämliche Marotte von Wichtigtuern, um dem Gesagten Nachdruck zu verleihen.
«Haben Sie ein Foto vom Bild, das ich behalten kann?»
Er reichte mir ein Foto, das ein ziemlich grosses Bild zeigte, eingerahmt von einem wuchtigen, kostbar aussehenden Rahmen. Nicht mein Stil, dachte ich.
«Wann wurde es gestohlen?»
«Das muss zwischen Montagabend, also gestern, um sechzehn Uhr dreissig und heute Morgen etwa acht Uhr gewesen sein, als ich mein Büro betrat und den Diebstahl bemerkt habe. Ich war in dieser Zeit abwesend», fügte er hastig dazu.
«Das ist ja ein bemerkenswert kurzes Zeitfenster. Gibt es denn Spuren für einen Einbruch?»
«Nein. Ich kann Ihnen versichern, dass das Anwesen mit neuster Technologie geschützt ist. Wir sind Platinkunde bei der Sicherheitsfirma Zürich Fortress. Bewegungsmelder, Überwachungskameras, Alarmanlage an Türen und Fenster, direkte Verbindung zu deren Zentrale, das ganze Programm.»
«Ja, die haben wirklich einen guten Ruf. ‹Sicher wohnen wie in der guten alten Schweiz› ist ihr Slogan, was immer das heissen soll.»
«Ich habe Fortress sofort kontaktiert, als ich das Verschwinden heute Morgen bemerkt habe. Es ist kein Alarm erfolgt – und alle Sicherheitssysteme waren eingeschaltet. Die Spezialisten von Fortress waren heute Nachmittag vor Ort und haben alles überprüft. Die halten einen Einbruch für völlig ausgeschlossen – aber natürlich müssen die das sagen.»
«Hmmmmm. Wer hat alles Zugang zum Zimmer, in dem das Bild hängt? Wenn wir einen Einbruch ausschliessen, dann kommt nur ein Bewohner des Hauses infrage.»
«Wir sollten nicht voreilig sein und einen Einbruch ausschliessen. Ganz im Gegenteil: Ich bin überzeugt, dass hier ein Einbruch vorliegt. Wir haben nur noch nicht erkannt, wie die es angestellt haben, ohne Spuren zu hinterlassen. Es kann nämlich kein Bewohner des Hauses gewesen sein. Alle drei haben mein volles Vertrauen: Meine erwachsene Tochter, mein Privatsekretär und meine Haushälterin. Natürlich ist oft auch ein Gärtner auf dem Gelände, gelegentlich auch Handwerker. Aber die kommen im Allgemeinen nicht ins Haus, und wenn, dann sind sie nicht allein. Gestern war keiner von denen da.»
«Wenn Fortress einen Einbruch kategorisch ausschliesst und wenn wir auch den Heiligen Geist ausschliessen», dabei verzog mein Vater wieder das Gesicht, «dann muss es eine dieser drei Personen gewesen sein.»
«Es gibt gute Gründe, die dagegensprechen. Erstens sind sämtliche Hausbewohner über jeden Zweifel erhaben. Mein Privatsekretär Zurbrugg und Frau Gnägi, die Haushälterin, sind schon seit Jahren bei uns. Zweitens ist keiner von denen so dumm, ausgerechnet dieses Bild im Haus zu stehlen. Selbst meine Haushälterin weiss, dass es sehr viel wertvollere Bilder im Haus gibt. Wir haben einen Monet, der ganz in der Nähe hängt. Er ist Millionen wert. Warum sollte man ein wertloses Bild stehlen, wenn man genau so einfach ein kostbares Stück mitlaufen lassen könnte, das zudem sehr viel kleiner und handlicher ist?»
Ein Rätsel, musste ich zugeben, und wir machten einen Ortstermin für morgen früh um zehn Uhr ab, was mein Vater mit einem erleichterten Schnaufen quittierte.
Natürlich werden Sie sich fragen: Warum verschwendet ein junger, schöner, intelligenter, weltoffener, exotischer Halbasiate wie ich sein Leben als Mann für heikle Aufträge in einem Zürcher Family Office? Die ehrliche Antwort ist: Das frage ich mich auch. Ich habe die ersten zehn Jahre meines Lebens in Zürich verbracht, deshalb mein lupenreines Schweizerdeutsch, was allerdings einige Eidgenossen verwirrt, die sich einen «echten» Helvetier immer noch wie einen Schweizergardisten in Rom vorstellen. Danach zog ich für sechs Jahre mit meiner Mutter nach Hongkong, bis mich Umstände, auf die ich nicht näher eingehen möchte, zurück zu meinem Vater nach Zürich geführt haben.
Nach der Scheidung kaprizierte sich meine Mutter nicht darauf, die beträchtliche Apanage von meinem Vater standesgemäss zu verprassen. Sie legte im Gegenteil eine atemberaubende Karriere als weiblicher Immobilien-Tycoon in Hongkong hin. Damit hatte sie meinen Vater in finanzieller Hinsicht innert kürzester Zeit deutlich überholt und, zu seiner nicht geringen Frustration, zum nicht ganz so reichen Ex-Mann in der Schweiz gemacht. Immerhin schien der «Schweizer Bankster», wie meine Mutter ihren geschiedenen Mann oft bezeichnete, für eines gut: Er sollte mich auf den «rechten Weg» bringen, was zunächst leidlich – bis zur Matura – und dann gar nicht – an der Universität – geklappt hatte. Vor einem Jahr hatten meine Eltern in einer unheiligen Allianz meinem Lotterleben als «ewiger Student» ein Ende gemacht, indem sie meine Bezüge im zarten Alter von (fast) dreissig Jahren brutal gekappt haben. Aus diesem Grund war ich gezwungen, im ehemaligen Gärtnerhaus meines Vaters am Zürichberg einzuziehen – und meinen Lebensunterhalt als Lohnabhängiger im Family Office selbst zu bestreiten.
Die Idee für mein Betätigungsfeld hatte mein Vater. Wenn Sie ChatGPT oder eine andere Schwindelsoftware fragen, die vortäuscht, intelligent zu sein, dann wird Folgendes ausgespuckt zum Thema Multi-Client Family Office: Ein Multi-Client Family Office ist eine Form eines Family Office, das mehrere wohlhabende Familien oder einzelne Personen betreut. Im Gegensatz zu einem Single-Family Office, das sich ausschliesslich auf die Vermögensverwaltung einer einzigen Familie konzentriert, bietet ein Multi-Client Family Office Dienstleistungen für mehrere Kunden an.
Was Ihnen ChatGPT hingegen nicht sagt: Das ist nur die eine, die offizielle und ganz und gar nicht aufregende Seite der Medaille. Die ebenso wichtige: Viele der Reichen fürchten zwei Dinge wie der Teufel das Weihwasser aus der St. Josef-Kirche. Erstens ihr mühsam zusammengerafftes Vermögen zu verlieren, was im Fall der Kunden unseres Family Office durchschnittlich rund hundert Millionen Franken beträgt – womit sie, ganz nebenbei bemerkt, nicht zu den wirklich Reichen dieser Welt gehören. Und zweitens: auf der Titelseite des nationalen Boulevardblattes «Blick» zu stehen im Zusammenhang mit einer unappetitlichen Geschichte: Drogen, aussereheliche Eskapaden, zwanghaftes Pinkeln in der Öffentlichkeit und vieles mehr kommt mir da in den Sinn. Sie können mir glauben: Wo viel Geld ist, gibt es auch viele Dinge, die lieber im Dunkeln bleiben wollen. Genau das ist meine Existenzberechtigung im Office und, so darf ich ohne Übertreibung sagen, die absolute Garantie, dass es mich (oder einen wie mich) immer brauchen wird: Ich bin der Mann der diskreten Lösungen.
All das schoss mir durch den Kopf, als ich am Mittwochmorgen nach neun Uhr in meinen knallroten Alfa Romeo Spider Duetto stieg. Ich entriegelte das Verdeck, schob es nach hinten und befestigte es an einem Haken. Wenn Sie sich nun fragen: Da gibt es doch moderne Autos mit einer Automatik, warum fährt der so eine alte Schrottkiste – dann kennen Sie mich noch nicht. Ich bin zwar ein modebewusster Mensch, weigere mich aber, jede Neuigkeit gut zu finden, weil nicht alles Neue auch besser ist. Denn es gibt einige unerreichte ikonische Dinge, sei es bei Kleidern oder Autos. Ich gebe zu: Levis 501 trage ich nicht mehr, weil sie mich alt machen. Aber am Alfa Romeo Spider Duetto, den Dustin Hoffman im Film «The Graduate» gefahren hat, halte ich eisern fest. Er ist ein bisschen auffällig bei Verfolgungen, auch die Pannenhäufigkeit nimmt eher zu. Aber was gibt es Besseres, als sich die frische Luft an einem schönen Sommertag um die Nase streichen zu lassen und sich auf dem Weg zu einem Rendezvous mit Katharine Ross zu wähnen? Eben.
Wenn Sie meine Fixierung auf die Sechziger-Jahre hinsichtlich Autos, Filme und (teilweise) Musik irritiert, dann muss ich gestehen: Sie sind nicht alleine. Ich hatte einmal eine Psychologie-Studentin als Freundin, die diese Fixierung haarscharf als Flucht vor der Unsicherheit diagnostiziert hat: Die Unsicherheiten und Unvorhersehbarkeiten der heutigen Zeit hätten bei mir dazu geführt, dass ich mich auf diese vergangenen Epochen konzentriere, in der die Dinge vermeintlich einfacher oder klarer seien. Natürlich ist das kompletter Unsinn – ich finde die Sechziger einfach cool. Die Beziehung hat die Diagnose nicht lange überdauert.
Es war schon sehr warm für Juni. Schräg gegenüber sah ich den Uetliberg, den Hausberg von Zürich. Dahinter schienen die Alpen zum Greifen nah an diesem Morgen: Den Glärnisch glaubte ich zu erkennen, ein markanter Berg in den Glarner Alpen und einer der bekanntesten Gipfel in der Region. Mit seinem charakteristischen Doppelgipfel ist er an klaren Tagen vom Zürichberg aus gut sichtbar. Auch der Säntis, der höchste Berg des Alpsteingebirges, schien mir zuzuwinken. Wenn Sie nun denken, dass ich das im Buch «Zürich für Chinesen» gelesen habe, dann liegen Sie falsch. Mein Vater war als junger Mann ein begeistertes Mitglied des SAC, des Schweizer Alpen-Clubs. Kaum vorzustellen für mich, trotzdem ist es wahr: Um für sogenannte Hochtouren mitten in der Nacht bereit zu sein, musste er in muffigen, bakterienverseuchten Massenschlägen (mit garantiert mindestens einem Schnarcher!) in Militärdecken übernachten, um morgens um drei Uhr solche und andere Gipfel zu attackieren. Viele Ausländer sehen in solcherlei Aktivitäten masochistische Tendenzen, zumal sie oft von Menschen gehobenen Standes praktiziert werden, die sich durchaus ein Fünfsterne-Hotel leisten könnten. Aber wahrscheinlich handelte es sich bei meinem Vater um eine Reminiszenz aus dem Militärdienst, wo die Unterbringung ähnlich ist. Den haben alle Schweizer zu leisten, ich bin eine Ausnahme. Denn bei mir wurde bei der Aushebung, also der Rekrutierung, ein Herzgeräusch festgestellt. Das hat genügt: Ein Soldat mit festgestelltem Herzproblem, der auf einem der Gewaltmärsche tot umfällt, wäre ganz schlechte Public Relations für die Armee. Noch schlimmer wäre es aber, wenn er überlebte und die Militärversicherung ein Leben lang eine Rente ausrichten müsste.
Die Autofahrt vom Zürichberg nach Herrliberg führte zunächst vorbei an historischen Herrenhäusern im Jugendstil, typischerweise bewohnt von viel «altem Geld», und einigen architektonischen Scheusslichkeiten, typischerweise verbrochen von neuem Geld. Am See angekommen schnappte ich mir wie üblich meinen Starbucks Vanilla Latte, um dann umständlich das Bellevue zu umfahren und Richtung Zürichhorn an der Goldküste entlang bis nach Herrliberg zu gelangen.
Das kleine, an den Goldküsten-Hang gebaute Dörfchen ist für seine ruhige Atmosphäre, seine idyllische Umgebung und einige wirklich reiche Bewohner bekannt. Dabei gaukelt das Dorf mit seinen altehrwürdigen Riegelhäusern immer noch vor, bäuerlich und bodenständig zu sein. Ich liess mich aber nicht täuschen. Denn wenn ich etwas von meinem Vater gelernt hatte, dann das: Ich konnte Geld riechen.
Der Geruch des Geldes wurde stärker, je näher ich der Villa Wehrle kam. Das Eingangstor war zwar unscheinbar, aber solide, und war von einer zwei Meter hohen, undurchdringlichen Kirschlorbeer-Hecke eingesäumt, die den Blick auf das Grundstück verwehrte. Kurz fragte ich mich, ob das schmucklose, völlig unprätentiöse Entrée wirklich zur Villa des nicht ganz so unprätentiösen Herrn Wehrle führte. Aber nach meinem Klingeln glitt das Tor geräuschlos zur Seite. Entweder erwartete man mich, oder ich hatte eine Kamera übersehen.
Hinter dem Tor verbarg sich eine Villa, die ihresgleichen suchte, selbst in Herrliberg. Sie war im Landhausstil gebaut, und ich schätzte, dass es mindestens vierzehn Zimmer gab. Weil das offenbar nicht genügte, war ein moderner Anbau drangeklebt worden, der den Gesamteindruck deutlich störte. Ein Swimmingpool lud zum Schwimmen ein, sah aber seltsam unbenutzt aus. Etwas abseits stand der eindrückliche Fuhrpark, von sehr gross bis sehr sportlich, geschützt durch einen Carport. Wahrscheinlich dürfen die Ärmsten in Herrliberg keine Tiefgarage anlegen, dachte ich.
Vor dem Haupthaus wurde ich von einem Herrn mit Schmiss empfangen, den ich als etwas älter als Herrn Wehrle einschätzte. In Zürich, so hatte mir mein Vater versichert, gab es immer noch Studentenverbindungen, deren Mitglieder sich beim Fechten absichtlich eine Wunde – den Schmiss – an der Wange beibrachten. Völlig barbarisch, wenn Sie mich fragen – da die garstige Wunde, wie im Fall des betreffenden Herrn, ein Leben lang sichtbar bleibt. Da hat einer den Säbel allzu forsch geschwungen, dachte ich mir. Aber ansonsten war der Mittfünfziger straff, stramm und gut erhalten, etwas knorrig.
«Ich bin der Privatsekretär von Herrn Wehrle. Heinrich Zurbrugg mein Name», sagte er knapp, und fast hätte ich erwartet, dass er noch die Hacken zusammenschlug.
Er sah mich mit offensichtlicher Neugier und einer Prise Reserviertheit oder gar Ablehnung an, war aber offensichtlich von seinem Dienstherrn über mein asiatisches Aussehen vorgewarnt worden.
«Herr Wehrle erwartet Sie.»
An Bildern mit viel moderner Kunst vorbei führte mich Zurbrugg ins Büro von Wehrle, der mir erwartungsvoll entgegensah.
«Das Unmögliche erledige ich jeweils sofort, Wunder dauern etwas länger», entfuhr es mir spontan, was zu einem roten Kopf bei Wehrle und einem verächtlichen Schnauben bei Zurbrugg führte. Ich verstehe es, schnell Freunde zu machen.
«Ich habe keine Resultate erwartet, wohl aber Respekt und Anstand!», fuhr mich Wehrle an. Offenbar war meine vorlaute Art gestern ganz und gar nicht gut bei ihm angekommen. Ich zeigte mich pflichtschuldigst zerknirscht. «Ich erwarte auch keine Wunder, sondern nur, dass Sie mein Lieblingsbild wieder finden.» Er zeigte auf eine leere Stelle über seinem Pult. «Ohnehin ist mir nicht ganz klar, war Sie befähigt, das Bild wieder zu beschaffen. Ich habe gestern in der Hitze des Gefechts gar nicht nach Ihren Referenzen gefragt.»
«Ich kann keine Referenzen vorweisen. Aber Sie können auf die allerwichtigste Eigenschaft zählen», meinte ich.
«Und die wäre?»
«Meine Diskretion – und die Tatsache, dass nichts, was ich im Verlauf meiner Ermittlungen erfahre, je für Sie zum Problem wird. Solange ich nicht auf etwas Illegales stosse.» Dabei blickte ich ihm direkt in seine Husky-Augen.
«Das versteht sich von selbst», schnarrte Wehrle mich an und wandte sich ab. Zurbrugg sah mich finster an.
«War das Bild speziell gesichert?», fragte ich, nur um etwas zu fragen.
«Nein, und übrigens war es auch nicht speziell versichert, im Gegensatz zu einigen Bildern, die Sie beim Hereinkommen sicherlich bemerkt haben. Wie Sie sehen, hat es genau hier über meinem Pult gehangen.» Er zeigte auf eine leere Stelle an der Wand über seinem Pult.
«Wer hat Zugang zu diesem Zimmer?»
«Wie ich Ihnen gesagt habe: Herr Zurbrugg, meine Tochter und die Haushälterin.»
«Ich werde mit allen drei sprechen müssen.»
«Gewiss. Allerdings ist meine Tochter erst am Nachmittag wieder da. Mein Sekretär gibt Ihnen ihre Telefonnummer, dann können Sie etwas mit ihr abmachen. Er wird Ihnen ansonsten alles zeigen.»
Damit war ich entlassen.
«Ich hoffe, Sie sind so gut, wie Sie denken», meinte Zurbrugg finster, nachdem er mir das ganze Anwesen inklusive aller Sicherheitsvorkehrungen gezeigt hatte. Seine Begeisterung für mich hielt sich klar in Grenzen, zumal ich nicht einmal versucht hatte, ihm vorzumachen, ich sei ein Spezialist für Sicherheitstechnik. Zurbrugg referierte mit leuchtenden Augen über hochempfindliche Bewegungssensoren, Kameras, Zugangskontrollsysteme, verstärkte Türen und Fenster. Ich glaubte ihm unbesehen, dass die Villa Wehrle eine der bestgesicherten an der ganzen Goldküste war – und das will etwas heissen.
Gleich neben der Eingangstüre gab es einen Monitor, der mit zwei Überwachungskameras für das Tor verbunden war. Aus unterschiedlichen Perspektiven liess sich auf dem in der Mitte geteilten Monitor erkennen, wer Einlass begehrte. Dieser wurde über einen Knopf gleich daneben gewährt. Es war Zurbruggs Verantwortung, das Tor über diesen Knopf zu öffnen. Bei Abwesenheit übernahmen Frau Gnägi oder Herr Wehrle selbst diese Aufgabe.
Im Keller befand sich eine Sicherheitszentrale für das ganze Haus, die einen grossen Raum in Beschlag nahm. Beim Betreten des fensterlosen Raumes, der mit einer schweren, wahrscheinlich stahlverstärkten Türe gesichert war, wäre ich fast umgefallen. So hatte ich mir immer die Sicherheitszentrale einer Schweizer Bank vorgestellt. Mehrere Monitore waren mit den Überwachungskameras des Anwesens verbunden. Zwar gab es im Haus Wehrle niemanden, der diese Monitore systematisch und permanent überwachte, und es wurde auch nichts aufgezeichnet. Aber das Ganze war mit hochsensiblen Einbruchsmeldeanlagen, Zugangskontrollen und Brandmeldern verknüpft. Nach einem ausserordentlichen Ereignis wurde auf den Mobiltelefonen von Wehrle und Zurbrugg sofort ein Alarm ausgelöst, wie auch in der Zentrale von Fortress. Diese würde sich umgehend mit dem Haus Wehrle in Verbindung setzen. Der Sekretär hatte die Aufgabe, die Monitore im «Safe Room» zu überwachen und entweder Entwarnung zu geben oder Fortress gleichzeitig mit der Zürcher Kantonspolizei aufzubieten.
Nicht ohne Stolz wies Zurbrugg mich darauf hin, dass es sich nicht um ein gewöhnliches Zimmer, sondern um einen Panic Room handelte. Sollten trotz allem ungebetene Gäste ins Haus vordringen, könnten Wehrle und er sich in diesem Raum verschanzen. Wände und Türen seien verstärkt, ein Notstrom-Aggregat sorge für Elektrizität, und auch die Kommunikation zur Aussenwelt sei durch tief verlegte Glasfaserkabel jederzeit gewährleistet. Für Essen, Trinken und Zigarren rauchen sei gesorgt, meinte er, indem er auf zwei Sessel, Wasser in Glasflaschen und einige Dosen mit Etiketten von eklig aussehendem Survival-Food zeigte.
«Na, also gar so langsam ist unsere Polizei denn auch nicht», lächelte ich, «Sie haben sich hier ja auf eine wochenlange Belagerung eingestellt!»
«Man weiss nie, was kommt, Herr Wehrle und ich wollen auf alles vorbereitet sein!»
Seltsam, dachte ich, er spricht beharrlich immer nur von zwei potenziellen Nutzern des Panic Rooms. Die Tochter des Hauses und die Haushälterin sind offensichtlich weit weniger schützenswert.
«Ich habe ja schon viel gesehen – aber Ihre Anlage schlägt alles», musste ich zugeben «Nur: Wozu das Ganze? Ganz so wichtig sind Sie beide ja auch wieder nicht.»
«Auf uns hat es niemand abgesehen, aber wir wären Kollateralschäden. Sie müssen bedenken, dass hier enorme Kunstschätze lagern», meinte er etwas enttäuscht, dass ich nicht vor Begeisterung hüpfte ob all seiner Sicherheitsvorkehrungen. «Wir haben selbst einen kleinen Monet: Der ist Millionen wert.» Offenbar war man in der Villa Wehrle ganz besonders stolz auf diesen Monet. Umso erstaunlicher, dass die Diebe nicht den haben mitlaufen lassen, sondern einen alten, wertlosen Schinken, dachte ich.
Mittlerweile waren wir wieder vor der Villa angelangt, und ich atmete nach dem bedrückenden Panic Room wieder auf. Viel mehr als die vielen Sicherheitsspielzeuge faszinierte mich die einmalige Lage des Anwesens. Die Terrasse bot einen herrlichen Ausblick, die Alpen schienen von hier oben noch schöner und näher.
«Trotzdem muss jemand eingestiegen sein und das Bild entwendet haben.»
«Völlig ausgeschlossen», entfuhr es ihm, «ich selbst habe mit Fortress das Sicherheitskonzept entworfen, und ich habe die Implementierung persönlich überwacht. Hier kommt nichts rein, das grösser ist als eine Maus. Ins Haus schon gar nicht.»
Nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen! «Wenn das stimmt, dann muss jemand vom Haus das Bild geklaut haben», gab ich trocken zu bedenken. «Wo waren Sie, als das Bild verschwunden ist?»
«Herr Wehrle hat mir freigegeben», knurrte er. «Ich war auf unserem Segelboot. Herr Wehrle hat eine Hallberg-Rassy auf dem Bodensee, und Segeln ist meine Passion. Ich habe die Nacht auf der Yacht verbracht.» Ich glaubte mich zu erinnern, dass einer unserer Kunden einmal von diesen teuren schwedischen Yachten geschwärmt hatte. Allerdings war er auf der Hochsee mit denen unterwegs.
«Alleine?»
«Ja.»
«Also kann das niemand bezeugen?»
«Nein.»
«Wann haben Sie das Haus verlassen?»
«So genau weiss ich das nicht mehr – nach siebzehn Uhr, denke ich.»
«Dann hätten Sie das Bild also locker mitlaufen lassen können!»
«Werden Sie nicht frech – ich bin hier nicht verdächtig!»
«Da täuschen Sie sich. Jeder ist verdächtig, bis ich den Fall geklärt habe. Ich kann sogar sagen: Wenn es tatsächlich jemand vom Haus war, dann sind Sie der Hauptverdächtige!»
«Wie kommen Sie denn darauf?»
«Die Haushälterin und die Tochter wären mit dem Bild körperlich überfordert gewesen. Ich habe beide zwar noch nicht gesehen, aber ich gehe davon aus, dass sie keine Gewichtheberinnen sind. Herr Wehrle kann es nicht gewesen sein – er würde sich kaum selbst bestehlen. Es bleiben – Sie! Fall gelöst!»
Wütend funkelte mich Zurbrugg an und näherte sich meiner Nasenspitze bis auf drei Zentimeter.
«Hör mal zu, du reisfressende Missgeburt. Ich habe Ehre im Bauch, ich würde niemals etwas stehlen. Und jetzt hau ab!»
«Gerne, aber zunächst muss ich noch mit der Haushälterin sprechen.»
«Dann mach schnell und verschwinde – du lebst gefährlich!» Er funkelte mich an und stapfte wütend davon.
Nach einigen Irrungen und Wirrungen traf ich in der Küche auf Frau Gnägi. Ich hatte immer noch viel Adrenalin im Blut, denn der Hass und die Gewaltbereitschaft des Mannes mit Schmiss hatten mich überrascht. Sein ganzes Auftreten liess mich vermuten, dass ihm körperliche Auseinandersetzungen nicht fremd waren. Er war auch ohne Zögern auf mich losgegangen, was ich nicht gewohnt war. Viele Leute in der Schweiz nehmen automatisch an, in jedem Asiaten stecke ein kleiner Bruce Lee und halten sich mit Konfrontationen zurück. Nicht so Zurbrugg, der mich an einen aggressiven Pitbull erinnerte: pure Angriffslust. Tatsächlich hatte ich das Gefühl, dass er nah daran gewesen war, sich auf mich zu stürzen. Notiz an mich selbst: Vorsicht mit Zurbrugg.
Frau Gnägi war in gewissem Sinne das Gegenteil von ihm: gegen fünfzig, gutmütig, rundlich, nicht unattraktiv, aber etwas abgehärmt. Etwa so, wie ich mir als Kind Frau Holle vorgestellt hatte. Oder einfach eine gute Fee. Auch sie stand schon seit Jahrzehnten im Dienst von Wehrle. Sie hat ein schweres Los mit Wehrle und seinem Sekretär, dachte ich mitfühlend.
«Frau Gnägi, Sie wissen, wer ich bin?»
«Ja, Herr Wehrle hat mich verständigt. Sie sollen das Bild finden.»
«Genau. Sie wohnen hier im Haus?»
«Ja, das ist am einfachsten. So stehe ich rund um die Uhr zur Verfügung, wenn Herr Wehrle etwas braucht.»
«Einen solchen Einsatz rund um die Uhr würde die Gewerkschaft aber nicht billigen …»
«Die Gewerkschaft? Wir sind eher so etwas wie eine kleine Familie, und da hat es keinen Platz für Gewerkschaften. Oder haben Sie je gehört, dass sich eine Mutter bei einer Gewerkschaft beschweren kann, wenn sie vierundzwanzig Stunden im Einsatz steht für Mann und Kinder?»
«Tja, aber Sie sind nicht die Mutter … Gibt es denn eigentlich keine Frau Wehrle?»
«Die ist schon lange gestorben», meinte Frau Gnägi mit offensichtlichem Bedauern. «Sie war eine grossartige Frau!»
«Und die Tochter?»
«Was meinen Sie?»
«Stehen Sie auch für die Tochter vierundzwanzig Stunden im Einsatz?»
«Ach, wissen Sie, Freya führt ihr eigenes Leben. Sie wohnt zwar hier im Anbau, aber irgendwie gehört sie gar nicht zu uns. Sie isst nie mit uns, ich sehe sie auch kaum. Nur ab und zu, wenn sie mit ihrem gelben Flitzer das Haus verlässt.» Das kam mir bekannt vor.
«Und wo waren Sie, als das Bild abhandenkam?»
«Sie werden mich doch nicht verdächtigen?», fragte sie ängstlich.
«Jeder ist verdächtig, bis ich den Dieb gefunden habe.» Ich blickte sie prüfend an, aber als ich die Panik in ihren Augen sah, schob ich nach. «Na ja, ganz plastisch kann ich es mir nicht vorstellen, wie sich eine nette Dame wie Sie mit einem riesigen Bild in die Büsche schlägt.» Sie sah erleichtert aus. «Trotzdem muss ich Sie fragen: Wo waren Sie zur fraglichen Zeit?»
«Nun, am Tag habe ich natürlich den Haushalt gemacht, gekocht, eingekauft. Und weil ich wusste, dass Herr Wehrle erst am nächsten Tag zurück sein würde, bin ich zu meiner Freundin in der Stadt, wo ich auch übernachtet habe. Herr Wehrle legt Wert darauf, dass ich meinen Tapetenwechsel habe. Er hat sich danach erkundigt.»
«Dann haben Sie also keine Ahnung, wie das Bild gestohlen werden konnte?»
«Es ist mir ein Rätsel!»
«Könnte es sein, dass Sie es beim Putzen abgehängt und verlegt haben?», gab ich mich naiv.
«Wo denken Sie hin?» Sie sah mich erschrocken an. «Wir dürfen die Bilder natürlich nie berühren, geschweige denn abhängen.»
«Wir? Gibt es denn noch andere Leute, die für die Reinigung zuständig sind?»
«Ja, einmal im Monat kommt eine ganze Gruppe von Reinigungskräften von einem darauf spezialisierten Unternehmen.»
«Darauf spezialisiert?»
«Nun, in dieser Villa sind enorm teure Gemälde und Wertgegenstände. Da wollen Sie nicht, dass irgendeine Albanerin, die Sie nicht kennen, im Haus herumgeistert und nachher ihrer ganzen Sippe erzählt, was es zu klauen gibt», meinte sie politisch völlig unkorrekt. «Da sind wir an der Goldküste viel vorsichtiger. Wir geben den Auftrag einem spezialisierten Unternehmen, das nur Leute schickt, die einen einwandfreien Leumund haben. Die haben sehr klare Anweisungen, was sie zu tun und zu unterlassen haben. Sie unterschreiben, dass sie sofort wieder vergessen, was sie an Kunstschätzen im Haus gesehen haben.»
«Erstaunlich!»
«Ja, und sauteuer, das können Sie mir glauben. Und auch aufwendig für mich und Zurbrugg.»
«Warum?»
«Nun, wir schauen denen natürlich trotz allem genau auf die Finger und lassen sie nicht aus den Augen.»
Auf dem Weg in die Stadt liess ich das Erlebte vor meinem geistigen Auge nochmals Revue passieren. Irgendjemand hatte irgendetwas gesagt, das seltsam anmutete und nicht so ganz ins Bild passte. Aber so sehr ich mich bemühte: Ich fand nicht heraus, was es war.
Die Dynamik des Hauses Wehrle war mir noch nicht klar. Nach meinem Gespräch mit Frau Gnägi hatten mich Wehrle und Zurbrugg abgefangen. Wehrle hatte von seinem Privatsekretär erfahren, dass das Gespräch mit mir ruppig geendet hatte. Zurbrugg war von ihm gezwungen worden, sich bei mir zu entschuldigen, was dieser in einer Art tat, die mich darin bestätigte, dass dieser Mann gefährlich war. Er sagte zwar die richtigen Worte, aber seine Augen waren kalt.
Die Beziehung zwischen den beiden wirkte ambivalent. Der jüngere Mann, Wehrle, war zwar der Arbeitgeber von Zurbrugg. Aber wenn die beiden zusammen waren, schien er immer im Schatten seines älteren Untergebenen zu stehen. Die Autorität des Hausherrn schien angelernt – er spielte in einer Liga, die eigentlich zu hoch für ihn war. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass er zu den gehobenen Kreisen von Zürich Zugang fand. Vermutlich war er schlicht das Anhängsel seiner Frau gewesen. Ihr Tod hatte wohl auch seinen gesellschaftlichen Abstieg eingeläutet, was für ihn frustrierend gewesen sein musste. Ein anderes Kaliber war Zurbrugg: Er wirkte wie ein natürlicher Führer. Einer, der Dinge anpackt und zu Ende bringt, und einer, dem andere folgen. Er strahlte die selbstsichere Aggressivität eines Mannes aus, der schon vieles erlebt hatte und sich nicht scheute, seinen Willen durchzusetzen – auch mit Gewalt.
Auf dem Weg nach Zürich machte ich einen kleinen Umweg, um die Villa der kürzlich verstorbenen Tina Turner zu sehen. Vor dem Haus türmten sich Blumensträusse mit Kondolenzbekundungen auf. Ich hatte ihre Biografie «I, Tina» gelesen und war tief beeindruckt von der Frau. Auf Spotify wählte ich ihren Song «Simply the Best», der meine Stimmung immer wieder in stratosphärische Höhen katapultierte, und brauste mit meinem Spider Richtung Stadt. Ich hatte Glück und konnte in der Nähe des Restaurants parkieren.
Das «Kaufleuten» ist eine Mischung aus Club, Bar, Restaurant und Veranstaltungsort. In einer Zeit, die immer schnelllebiger wird, ist es schon verblüffend lange jener Ort, an dem sich die Schönen und Reichen und die es gerne sein wollen, zeigen. Obwohl solche Orte in Zürich üblicherweise schnell kontaminiert werden von Schickimickis, hatte das Kaufleuten seinen Stil behalten.
Mein Gesprächspartner war schon da. Dr. iur. Christoph Oertli, im zarten Alter von einunddreissig Jahren bereits Inspektor bei der Ermittlungsabteilung Gewaltkriminalität der Kantonspolizei Zürich. Ich hatte ihn angerufen und ihn in sehr allgemeinen Umschreibungen vom Verschwinden des Bildes unterrichtet.
«Hast du es dir überlegt?», begrüsste ich den ehemaligen Studienkollegen.
«Was denn?», tat er so, als ob er unseren schon etwas ausgeleierten Gag nicht verstünde.
«Ob du unserem einzigartigen, exklusiven, fantastischen Club beitreten möchtest?»
Damit meinte ich natürlich unseren Club «PoorUntamedYouth (PUY)», und keines meiner Adjektive war auch nur ein bisschen übertrieben. Unser Club hatte nur einen kleinen Nachteil: Er wurde als freigeistiger Gegenentwurf zum höchst elitären Club «RichRisingYouth (RRY)» gegründet. Weil wir «ungezähmten armen Jungen» die «reichen himmelstürmenden Jungen» mit unserem Namen so verärgert hatten, nahmen sie niemanden auf, der einmal bei uns war. PUY ist Pfui, heisst ein geflügeltes, aber natürlich höchst geschmack- und geistloses Witzchen der jungen Reichen. Da Oertli sein Jus-Studium im Gegensatz zu mir abgeschlossen hatte, wollte er offenbar ernsthaft Karriere machen und junge, reiche, einflussreiche Leute mit einer «shared passion for the good life» – so steht es auf der Webseite – kennenlernen. Vor allem eine sehr passionierte Frau.
«Kein Bock», schnaubte er, was mich vermuten liess, dass er schon wollte, aber genau wusste, dass es seiner Karriere nicht förderlich wäre.
Ich quittierte diese Halsstarrigkeit mit einem strafenden Blick.
«Was kann ich Ihnen bringen?»
Da wir beide die Speisekarte auswendig kannten, bestellten wir. Ich kam gleich zur Sache.
«Hast du etwas herausgefunden?»
«Du weisst doch, dass ich bei der ‹Gewalt› arbeite – wir befassen uns nicht mit Diebstählen. Das ist eher etwas für die von der Stadtpolizei», zierte er sich. «Ich denke ohnehin, dass der Diebstahl angezeigt werden sollte, wie es sich gehört!»
«Jetzt häng nicht den Polizisten raus! Ich habe dir doch schon gesagt: Es ist gar nicht so klar, womit wir es hier zu tun haben. Man verlegt Dinge schon mal. Oder jemand leiht sich etwas aus. Es gibt nicht den geringsten Hinweis, dass eingebrochen wurde. Im Übrigen gäbe es im Haus einen Monet zu stehlen – der hängt aber noch ganz munter vor sich hin. Du musst zugeben, dass das seltsam ist.»
«Ein Bild ‹verlegen›? Haha. Du meinst wohl eher ‹verhängen›.»
Er schaute mich an. «War das Bild denn nicht geschützt?»
«Doch, die ganze Villa wird von Zürich Fortress überwacht. Ich habe mir alles angesehen. Da kommt keine Maus rein. Genau deshalb denke ich ja: Es muss noch im Haus sein.»
«Fortress», sagte er nachdenklich. «Die sind auf dem absteigenden Ast.»
Ich schaute ihn fragend an. «Amtsgeheimnis», brummte er, «aber auch bei Sicherheitsfirmen arbeiten nur Menschen. Menschen erliegen manchmal Versuchungen.» Er sah mir vielsagend in die Augen.
Also ist vielleicht doch jemand eingestiegen, dank gütiger Mithilfe von Fortress. Der Dieb hat das grosse Bild über dem Pult des Hausherrn gesehen und haarscharf gefolgert, das Gemälde an solch prominentem Ort müsse wohl das kostbarste sein, da es ja auch ziemlich gross war und in einem protzigen Rahmen daherkam.
«Aber wenn es nur ‹verlegt› ist: Warum dann die Anfrage wegen potenziellen Hehlern?»
«Tja, weisst du, als Privatermittler muss ich allen Spuren nachgehen», äffte ich einen Standardsatz der Polizei nach.
Wir schwiegen beide nachdenklich. Wir bewegten uns in einer Grauzone, denn eigentlich hätte die Polizei von Amtes wegen aktiv werden müssen. Aber ich wusste ganz genau, dass die Kantonspolizei Zürich sehr viel Verständnis für öffentlichkeitsscheue Reiche hatte – bis zu einem gewissen Grad. «Komm schon, ich weiss doch, dass ihr alle miteinander sprecht. Die Schweiz ist ein Dorf, und Zürich eine Wohngemeinschaft, und in dieser Wohngemeinschaft kennt sich sicherlich jemand mit Hehlern aus. Du musst das nicht verlängern – ich zahle das Essen ohnehin.»
«Auf keinen Fall, wir zahlen schön getrennt. Compliance, mein Lieber, compliance!» Natürlich wusste ich genau, dass das so ablaufen würde – es sind schon ganz andere Kaliber bei Hexenjagden auf dem Altar der Compliance geopfert worden, weil sie sich haben einladen lassen. Oertli wollte mir offenbar helfen, aber ich machte mir wenig Illusionen über seine Motivation. Es waren nicht etwas meine Überredungskünste oder mein Charme. Sondern die gute Beziehung zu unserem Family Office. Das war für einen aufstrebenden jungen Beamten viel wert. Mein Vater war sehr gut vernetzt, Mitglied einer renommierten Zunft, die er als Zunftmeister schon einmal präsidiert hatte. In einer Stadt, in der jeder jeden kannte, bedeutete das viel Einfluss und Macht.
«Das darf aber auf keinen Fall zu mir zurückkommen», meinte er, was ich nicht einmal mit einer Antwort würdigte. «Also, wenn ich ein solches Bild in Zürich verkaufen wollte, für ein paar Tausend Franken, und sicher sein wollte, dass mich die Kunsthändlerin nicht nach der Herkunft fragt, dann würde ich bei der Ludmilla Kundera an der Heinrichstrasse anklopfen.»
«Warum gerade die?»
«Nun, die wirklich renommierten Galerien würden sich gemäss meiner Quelle mit solchen Kinkerlitzchen nicht abgeben. Ich behaupte nicht, dass die alle sauber sind. Aber wenn die ein Ding drehen, geht es eher um Geldwäsche, und da sind ein paar Tausend Franken gar nichts. Die Kundera hingegen steht immer einen Schritt vor der Pleite. Ein paar Tausend Franken können da den Unterschied machen zwischen Überleben und die Bilanz deponieren. Weil sie schon sehr lange im Geschäft ist, hat sie beste Beziehungen zu den zweit- oder drittbesten Adressen, die ein solches Bild vielleicht kaufen würden.»
«Dann werde ich ihr heute Nachmittag mal einen Besuch abstatten.»
Vom Kaufleuten sind es um den Hauptbahnhof herum und das Sihlquai hinauf nur etwa zehn Minuten mit dem Auto zur Galerie Kundera. Unterwegs rief ich Freya Wehrle an.
«Hallo?»
«Frau Wehrle. Hier spricht Li Rösti.»
«Ahhhh, der schöne Bruce Lee!», meinte sie kokett. «Nennen Sie mich Freya. Aber bitte keine blöden Bemerkungen wegen dem bescheuerten Vornamen.»
«Gerne, dann können Sie mich ‹Li› nennen, aber nur, wenn Sie sich Anspielungen zu Bruce Lee und unserem Bundesrat Albert Rösti verkneifen können.»
«Touché!»
«Wann kann ich mit Ihnen sprechen? Es geht um das verschwundene Bild.»
«Tja, ich weiss nur, dass ich nichts weiss. Aber da Frau Gnägi so von Ihnen geschwärmt hat, könnten wir uns um siebzehn Uhr hier in der Gruselgrotte treffen.» Immer noch die kokette Schiene – das konnte heiter werden.
«Okay. Ich werde dort sein.»
Völlig überraschend fand ich schnell einen Parkplatz in der Heinrichstrasse und musste nur ein paar Schritte gehen bis zur Galerie Kundera. Durch ein grosses Schaufenster sah ich einige Bilder an der Wand hängen, die sich wohl abstrakt expressionistisch geben wollten – moderne Kunst. Die müssten mir sehr viel bezahlen, dass ich das in meinem Gärtnerhäuschen aufhängen würde, schoss es mir durch den Kopf. Vor allem aber hatten die Bilder nicht die geringste Ähnlichkeit mit dem eher bodenständigen vermissten Bild Franz von Stucks. Ich trat ein und sah im hinteren Teil der Galerie, etwas versteckt durch einen Wandvorsprung, eine ältere Frau mit feuerrotem Haar, die mich beim Näherkommen an das geflügelte Wort erinnerte: «Ich habe gelebt – und man sieht es!»
«Welcome in our gallery!», rief sie affektiert und förmlich zugleich. Ich wendete den Kopf, um mich zu vergewissern, ob ich gemeint war, was sie bemerkte und nickte. Sie meinte wirklich mich und vermutete offenbar, einen reichen chinesischen Kunstenthusiasten vor sich zu haben, der sich leicht über den Tisch ziehen liess.
«Si chönd Züritütsch met mir rede», lächelte ich sie höflich an.
«Oh», sagte sie beschämt und etwas enttäuscht zugleich.
Ich entschied mich für die Frontalattacke. «Ich interessiere mich für Franz von Stuck!»
«Wer ist das?», sah sie mich fragend an.
«Der Maler – Franz von Stuck. Ich möchte gerne ein Bild von ihm erwerben.»
«Noch nie von ihm gehört. Wie kommen Sie gerade auf mich?»
«Nun, ich habe gehört, dass Sie auch Kunstwerke vermitteln. Ausserdem habe ich gehört, dass Sie nicht nur eine schöne Frau sind, sondern auch Vieles möglich machen können.» Okay, eine etwas lahme Schmeichelei, Sie haben recht. Aber ich habe mir sagen lassen, dass ältere Frauen, die einmal sehr schön gewesen waren, nach nichts mehr lechzen als nach Komplimenten, die vielleicht in einer längst vergangenen Zeit mehr gewesen waren, als leere Schmeicheleien.
Sie durchschaute mich sofort. «Das Gesäusel können Sie sich sparen», schnappte sie. «Wer hat Sie zu mir geschickt?»
«Ein Freund.»
«Dann können Sie Ihrem ‹Freund› sagen, dass Sie bei mir an der falschen Adresse sind.» Sie war noch immer eingeschnappt.