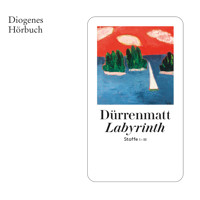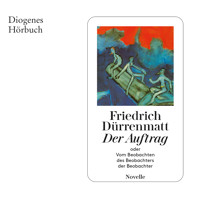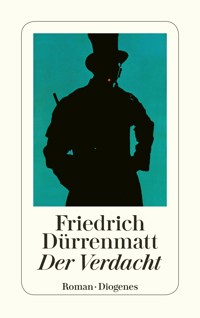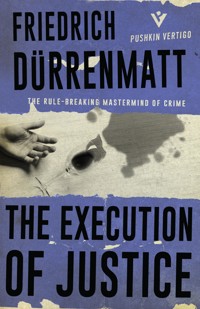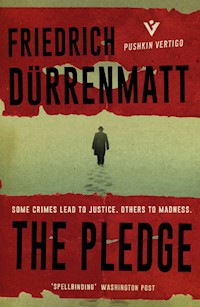7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Kommissär Matthäi
- Sprache: Deutsch
»...die Stimme vom Himmel hat es so gewollt, das Mädchen hatte wieder ein rotes Röcklein an und gelbe Zöpfe.« Dürrenmatts Klassiker behandelt ein Thema von trauriger Aktualität: Sexualverbrechen an Kindern. Verfilmt unter dem Titel ›Es geschah am hellichten Tag‹ mit Gert Fröbe und Heinz Rühmann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 207
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Friedrich Dürrenmatt
Das Versprechen | Aufenthalt in einer kleinen Stadt
Requiem auf den Kriminalroman | Grotesken
Diogenes
Das Versprechen
Requiem auf den Kriminalroman 1957 [/1958]
1
Im März dieses Jahres hatte ich vor der Andreas-Dahinden-Gesellschaft in Chur über die Kunst, Kriminalromane zu schreiben, einen Vortrag zu halten. Ich traf mit dem Zug erst beim Einnachten ein, bei tiefliegenden Wolken und tristem Schneegestöber, dazu war alles vereist. Die Veranstaltung fand im Saale des Kaufmännischen Vereins statt. Publikum war nur spärlich vorhanden, da gleichzeitig in der Aula des Gymnasiums Emil Staiger über den späten Goethe las. Weder ich noch sonst jemand kam in Stimmung, und mehrere Einheimische verließen den Saal, bevor ich den Vortrag beendet hatte. Nach einem kurzen Zusammensein mit einigen Mitgliedern des Vorstandes, mit zwei, drei Gymnasiallehrern, die auch lieber beim späten Goethe gewesen wären, sowie einer wohltätigen Dame, die den Verband der Ostschweizerischen Hausangestellten ehrenhalber betreute, zog ich mich nach quittiertem Honorar und Reisespesen ins Hotel ›Steinbock‹ nahe beim Bahnhof zurück, wo man mich einlogiert hatte. Doch auch hier Trostlosigkeit. Außer einer deutschen Wirtschaftszeitung und einer alten ›Weltwoche‹ war keine Lektüre aufzutreiben, die Stille des Hotels unmenschlich, an Schlaf nicht zu denken, weil die Angst hochkam, dann nicht mehr zu erwachen. Die Nacht zeitlos, gespenstisch. Draußen hatte es zu schneien aufgehört, alles war ohne Bewegung, die Straßenlampen schwankten nicht mehr, kein Windstoß, kein Churer, kein Tier, nichts, nur vom Bahnhof her hallte es einmal himmelweit. Ich ging zur Bar, um noch einen Whisky zu trinken. Außer der älteren Bardame fand ich dort noch einen Herrn, der sich mir vorstellte, kaum daß ich Platz genommen hatte. Es war Dr. H., der ehemalige Kommandant der Kantonspolizei Zürich, ein großer und schwerer Mann, altmodisch, mit einer goldenen Uhrkette quer über der Weste, wie man dies heute nur noch selten sieht. Trotz seines Alters waren seine borstigen Haare noch schwarz, der Schnurrbart buschig. Er saß an der Bar auf einem der hohen Stühle, trank Rotwein, rauchte eine Bahianos und redete die Bardame mit Vornamen an. Seine Stimme war laut und seine Gesten waren lebhaft, ein unzimperlicher Mensch, der mich gleicherweise anzog wie abschreckte. Als es schon gegen drei ging und zum ersten Johnnie Walker vier weitere gekommen waren, erbot er sich, mich am nächsten Morgen mit seinem Opel Kapitän nach Zürich zu schaffen. Da ich die Gegend um Chur und überhaupt diesen Teil der Schweiz nur flüchtig kannte, nahm ich die Einladung an. Dr. H. war als Mitglied einer eidgenössischen Kommission nach Graubünden gekommen und hatte, da ihn das Wetter an der Rückfahrt hinderte, ebenfalls meinen Vortrag besucht, ließ sich jedoch nicht darüber aus, nur daß er einmal meinte: »Sie tragen ziemlich ungeschickt vor.«
Am nächsten Morgen machten wir uns auf den Weg. Ich hatte in der Dämmerung – um noch etwas schlafen zu können – zwei Medomin genommen und war wie gelähmt. Es war immer noch nicht recht hell, obgleich schon lange Tag. Irgendwo glänzte ein Stück metallener Himmel. Sonst schoben sich nur Wolken dahin, lastend, träge, noch voll Schnee; der Winter schien diesen Teil des Landes nicht verlassen zu wollen. Die Stadt war von Bergen eingekesselt, die jedoch nichts Majestätisches aufwiesen, sondern eher Erdaufschüttungen glichen, als wäre ein unermeßliches Grab ausgehoben worden. Chur selbst offenbar steinig, grau, mit großen Verwaltungsgebäuden. Es kam mir unglaubhaft vor, daß hier Wein wuchs. Wir versuchten, in die Altstadt einzudringen, doch verirrte sich der schwere Wagen, wir gerieten in enge Sackgassen und Einbahnstraßen, schwierige Rückzugsmanöver waren nötig, um aus dem Gewirr der Häuser hinauszukommen; dazu war das Pflaster vereist, so daß wir froh waren, die Stadt endlich hinter uns zu wissen, obgleich ich nun eigentlich nichts von diesem alten Bischofssitz gesehen hatte. Es war wie eine Flucht. Ich döste vor mich hin, bleiern und müde; schattenhaft schob sich in den tiefliegenden Wolken ein verschneites Tal an uns vorbei, starr vor Kälte. Ich weiß nicht, wie lange. Dann fuhren wir gegen ein größeres Dorf, vielleicht Städtchen, vorsichtig, bis auf einmal alles in der Sonne lag, in einem so mächtigen und blendenden Licht, daß die Schneeflächen zu tauen anfingen. Ein weißer Bodennebel stieg auf, der sich merkwürdig über den Schneefeldern ausmachte und mir den Anblick des Tales aufs neue entzog. Es ging wie in einem bösen Traume zu, wie verhext, als sollte ich dieses Land, diese Berge nie kennenlernen. Wieder kam die Müdigkeit, dazu das unangenehme Geprassel von Kies, mit dem man die Straße bestreut hatte; auch gerieten wir bei einer Brücke leicht ins Rutschen; dann ein Militärtransport; die Scheibe wurde so schmutzig, daß die Wischer sie nicht mehr reinigen konnten. H. saß mürrisch neben mir am Steuer, in sich versunken, auf die schwierige Straße konzentriert. Ich bereute, die Einladung angenommen zu haben, verwünschte den Whisky und das Medomin. Doch nach und nach wurde es besser. Das Tal war wieder sichtbar, auch menschlicher. Überall Höfe, hie und da kleine Industrien, alles reinlich und karg, die Straße nun ohne Schnee und Eis, nur glänzend vor Nässe, doch sicher, so daß eine anständigere Geschwindigkeit möglich wurde. Die Berge hatten Platz gemacht, beengten nicht mehr, und bei einer Tankstelle hielten wir.
Das Haus machte gleich einen sonderbaren Eindruck, vielleicht weil es sich von seiner properen schweizerischen Umgebung abhob. Es war erbärmlich, troff von Nässe; Bäche flössen an ihm nieder. Zur Hälfte war das Haus aus Stein, zur Hälfte eine Scheune, deren Holzwand längs der Straße mit Plakaten beklebt war, seit langem offenbar, denn es hatten sich ganze Schichten übereinandergeklebter Plakate gebildet: Burrus Tabake auch in modernen Pfeifen, Trinkt Canada Dry, Sport Mint, Vitamine, Lindt Milchschokolade usw. An der Breitwand stand riesenhaft: Pneu Pirelli. Die beiden Tanksäulen befanden sich vor der steinernen Hälfte des Hauses auf einem unebenen, schlecht gepflasterten Platz; alles machte einen verkommenen Eindruck, trotz der Sonne, die jetzt beinahe stechend, bösartig schien.
»Steigen wir aus«, sagte der ehemalige Kommandant, und ich gehorchte, ohne zu begreifen, was er vorhatte, doch froh, an die frische Luft zu kommen.
Neben der offenen Haustüre saß ein alter Mann auf einer Steinbank. Er war unrasiert und ungewaschen, trug einen hellen Kittel, der schmuddelig und verfleckt war, und dazu dunkle, speckig schimmernde Hosen, die einmal zu einem Smoking gehört hatten. An den Füßen alte Pantoffeln. Er stierte vor sich hin, verblödet, und ich roch schon von weitem den Schnaps. Absinth. Um die Steinbank herum war das Pflaster mit Zigarettenstummeln bedeckt, die im Schmelzwasser schwammen.
»Grüß Gott«, sagte der Kommandant, auf einmal verlegen, wie mir schien. »Füllen Sie bitte auf. Super. Und reinigen Sie auch die Scheiben.« Dann wandte er sich zu mir. »Gehen wir hinein.«
Erst jetzt bemerkte ich über dem einzigen sichtbaren Fenster ein Wirtshausschild, eine rote Blechscheibe, und über der Tür war zu lesen: ›Zur Rose‹. Wir betraten einen schmutzigen Korridor. Gestank von Schnaps und Bier. Der Kommandant ging voran, öffnete eine Holztüre, offenbar kannte er sich aus. Die Gaststube war armselig und dunkel, einige rohe Tische und Bänke, an den Wänden Filmstars, aus Illustrierten herausgeschnitten und an die Mauer geklebt; der österreichische Rundfunk gab einen Marktbericht für Tirol durch, und hinter der Theke stand kaum erkennbar eine hagere Frau. Sie trug einen Morgenrock, rauchte eine Zigarette und spülte die Gläser.
»Zwei Kaffee-Creme«, bestellte der Kommandant.
Die Frau begann zu hantieren, und aus dem Nebenzimmer kam eine schlampige Kellnerin, die ich auf etwa dreißig schätzte.
»Sie ist sechzehn«, brummte der Kommandant.
Das Mädchen servierte. Es trug einen schwarzen Rock und eine weiße, halb offene Bluse, unter der es nichts anhatte; die Haut war ungewaschen. Die Haare waren blond, wie wohl auch einmal die der Frau hinter der Theke, und ungekämmt.
»Danke, Annemarie«, sagte der Kommandant und legte das Geld auf den Tisch. Auch das Mädchen antwortete nicht, bedankte sich nicht einmal. Wir tranken schweigend. Der Kaffee war entsetzlich. Der Kommandant zündete sich eine Bahianos an. Der österreichische Rundfunk war zum Wasserstand übergewechselt und das Mädchen ins Nebenzimmer gelatscht, in welchem wir etwas Weißliches schimmern sahen, offenbar ein ungemachtes Bett.
»Gehen wir«, meinte der Kommandant.
Draußen zahlte er nach einem Blick auf die Tanksäule. Der Alte hatte Benzin nachgefüllt und auch die Scheiben gereinigt.
»Das nächste Mal«, sagte der Kommandant zum Abschied, und wieder fiel mir seine Hilflosigkeit auf; doch antwortete der Alte auch jetzt nichts, sondern saß schon wieder auf seiner Bank und stierte vor sich hin, verblödet, erloschen. Als wir den Opel Kapitän erreicht hatten und uns noch einmal umwandten, ballte der Alte seine Hände zu Fäusten, schüttelte sie und flüsterte, die Worte ruckweise hervorstoßend, das Gesicht verklärt von einem unermeßlichen Glauben: »Ich warte, ich warte, er wird kommen, er wird kommen.«
2
»Um ehrlich zu sein«, begann Dr. H. später, als wir uns anschickten, über den Kerenzerpaß zu kommen – die Straße war aufs neue vereist, und unter uns lag der Walensee, gleißend, kalt, abweisend; auch hatte sich die bleierne Müdigkeit des Medomins wieder eingestellt, die Erinnerung an den Rauchgeschmack des Whiskys, das Gefühl, in einem Traum endlos sinnlos dahinzugleiten –, »um ehrlich zu sein, ich habe nie viel von Kriminalromanen gehalten und bedaure, daß auch Sie sich damit abgeben. Zeitverschwendung. Was Sie gestern in Ihrem Vortrag ausführten, läßt sich zwar hören; seit die Politiker auf eine so sträfliche Weise versagen – und ich muß es ja wissen, bin selbst einer, Nationalrat, wie Ihnen bekannt sein dürfte (es war mir nicht bekannt, ich hörte seine Stimme wie von ferne, verschanzt hinter meiner Müdigkeit, doch aufmerksam wie ein Tier im Bau) –, hoffen die Leute eben, daß wenigstens die Polizei die Welt zu ordnen verstehe, wenn ich mir auch keine lausigere Hoffnung vorstellen kann. Doch wird leider in all diesen Kriminalgeschichten ein noch ganz anderer Schwindel getrieben. Damit meine ich nicht einmal den Umstand, daß eure Verbrecher ihre Strafe finden. Denn dieses schöne Märchen ist wohl moralisch notwendig. Es gehört zu den staatserhaltenden Lügen, wie etwa auch der fromme Spruch, das Verbrechen lohne sich nicht – wobei man doch nur die menschliche Gesellschaft zu betrachten braucht, um die Wahrheit über diesen Punkt zu erfahren –, all dies will ich durchgehen lassen, und sei es auch nur aus Geschäftsprinzip, denn jedes Publikum und jeder Steuerzahler hat ein Anrecht auf seine Helden und sein Happy-End, und dies zu liefern sind wir von der Polizei und ihr von der Schriftstellerei gleicherweise verpflichtet. Nein, ich ärgere mich vielmehr über die Handlung in euren Romanen. Hier wird der Schwindel zu toll und zu unverschämt. Ihr baut eure Handlungen logisch auf; wie bei einem Schachspiel geht es zu, hier der Verbrecher, hier das Opfer, hier der Mitwisser, hier der Nutznießer; es genügt, daß der Detektiv die Regeln kennt und die Partie wiederholt, und schon hat er den Verbrecher gestellt, der Gerechtigkeit zum Siege verholfen. Diese Fiktion macht mich wütend. Der Wirklichkeit ist mit Logik nur zum Teil beizukommen. Dabei, zugegeben, sind gerade wir von der Polizei gezwungen, ebenfalls logisch vorzugehen, wissenschaftlich; doch die Störfaktoren, die uns ins Spiel pfuschen, sind so häufig, daß allzu oft nur das reine Berufsglück und der Zufall zu unseren Gunsten entscheiden. Oder zu unseren Ungunsten. Doch in euren Romanen spielt der Zufall keine Rolle, und wenn etwas nach Zufall aussieht, ist es gleich Schicksal und Fügung gewesen; die Wahrheit wird seit jeher von euch Schriftstellern den dramaturgischen Regeln zum Fräße hingeworfen. Schickt diese Regeln endlich zum Teufel. Ein Geschehen kann schon allein deshalb nicht wie eine Rechnung aufgehen, weil wir nie alle notwendigen Faktoren kennen, sondern nur einige wenige, meistens recht nebensächliche. Auch spielt das Zufällige, Unberechenbare, Inkommensurable eine zu große Rolle. Unsere Gesetze fußen nur auf Wahrscheinlichkeit, auf Statistik, nicht auf Kausalität, treffen nur im allgemeinen zu, nicht im besonderen. Der Einzelne steht außerhalb der Berechnung. Unsere kriminalistischen Mittel sind unzulänglich, und je mehr wir sie ausbauen, desto unzulänglicher werden sie im Grunde. Doch ihr von der Schriftstellerei kümmert euch nicht darum. Ihr versucht nicht, euch mit einer Realität herumzuschlagen, die sich uns immer wieder entzieht, sondern ihr stellt eine Welt auf, die zu bewältigen ist. Diese Welt mag vollkommen sein, möglich, aber sie ist eine Lüge. Laßt die Vollkommenheit fahren, wollt ihr weiterkommen, zu den Dingen, zu der Wirklichkeit, wie es sich für Männer schickt, sonst bleibt ihr sitzen, mit nutzlosen Stilübungen beschäftigt. Doch nun zur Sache.
Sie haben wohl diesen Morgen über Verschiedenes gestaunt. Vorerst über meine Rede, denke ich; ein ehemaliger Kommandant der Kantonspolizei Zürich sollte wohl gemäßigtere Ansichten pflegen, aber ich bin alt und mache mir nichts mehr vor. Ich weiß, wie fragwürdig wir alle dastehen, wie wenig wir vermögen, wie leicht wir uns irren, aber auch, daß wir eben trotzdem handeln müssen, selbst wenn wir Gefahr laufen, falsch zu handeln.
Dann werden Sie sich auch gewundert haben, weshalb ich vorhin bei dieser erbärmlichen Tankstelle haltmachte, und ich will es Ihnen gleich gestehen: Das traurige, versoffene Wrack, das uns mit Benzin bediente, war mein fähigster Mann. Ich habe, weiß Gott, etwas von meinem Beruf verstanden, aber Matthäi war ein Genie, und das in einem größeren Maße als einer eurer Detektive.
Die Geschichte hat sich vor nun bald neun Jahren ereignet«, fuhr H. fort, nachdem er einen Lastwagen der Shell-Kompanie überholt hatte. »Matthäi war einer meiner Kommissäre, oder besser, einer meiner Oberleutnants, denn wir führen bei der Kantonspolizei militärische Rangbezeichnungen. Er war Jurist wie ich. Er hatte als Basler in Basel doktoriert und wurde, zuerst in gewissen Kreisen, die mit ihm ›beruflich‹ in Berührung kamen, dann aber auch bei uns ›Matthäi am Letzten‹ genannt. Er war ein einsamer Mensch, stets sorgfältig gekleidet, unpersönlich, formell, beziehungslos, der weder rauchte noch trank, aber hart und unbarmherzig sein Metier beherrschte, ebenso verhaßt wie erfolgreich. Ich bin nie recht klug aus ihm geworden. Ich war wohl der einzige, der ihn mochte – weil ich klare Menschen überhaupt liebe, wenn mir auch seine Humorlosigkeit oft auf die Nerven ging. Sein Verstand war überragend, doch durch das allzu solide Gefüge unseres Landes gefühllos geworden. Er war ein Mann der Organisation, der den Polizei-Apparat wie einen Rechenschieber handhabte. Verheiratet war er nicht, sprach überhaupt nie von seinem Privatleben und hatte wohl auch keines. Er hatte nichts im Kopf als seinen Beruf, den er als ein Kriminalist von Format, doch ohne Leidenschaft ausübte. So hartnäkkig und unermüdlich er auch vorging, seine Tätigkeit schien ihn zu langweilen, bis er eben in einen Fall verwickelt wurde, der ihn plötzlich leidenschaftlich werden ließ.
Dabei stand Dr. Matthäi gerade damals auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Es hatte mit ihm beim Departement einige Schwierigkeiten gegeben. Der Regierungsrat mußte damals langsam an meine Pensionierung denken und somit auch an meinen Nachfolger. Eigentlich wäre nur Matthäi in Frage gekommen. Doch stellten sich der zukünftigen Wahl Hindernisse entgegen, die nicht zu übersehen waren. Nicht nur, daß er keiner Partei angehörte, auch die Mannschaft hätte wohl Schwierigkeiten gemacht. Anderseits bestanden aber oben wiederum Hemmungen, einen so tüchtigen Beamten zu übergehen; weshalb denn die Bitte des jordanischen Staates an die Eidgenossenschaft, nach Amman einen Fachmann zu schicken, mit dem Auftrag, die dortige Polizei zu reorganisieren, wie gerufen kam: Matthäi wurde von Zürich vorgeschlagen und sowohl von Bern als auch von Amman akzeptiert. Alles atmete erleichtert auf. Auch ihn freute die Wahl, nicht nur beruflich. Er war damals fünfzigjährig – etwas Wüstensonne tat gut; er freute sich auf die Abreise, auf den Flug über Alpen und Mittelmeer, dachte wohl überhaupt an einen endgültigen Abschied, deutete er doch an, daß er nachher zu seiner Schwester in Dänemark ziehen wolle, die dort als Witwe lebte – und war eben mit der Liquidierung seines Schreibtisches im Gebäude der Kantonspolizei in der Kasernenstraße beschäftigt, als der Anruf kam.«
3
»Matthäi wurde nur mit Mühe aus dem verworrenen Bericht klug«, setzte der Kommandant seine Erzählung fort. »Es war einer seiner alten ›Kunden‹, der aus Mägendorf anrief, aus einem kleinen Nest in der Nähe von Zürich, ein Hausierer namens von Gunten. Matthäi hatte eigentlich keine Lust, sich noch an seinem letzten Nachmittag in der Kasernenstraße mit dem Fall zu befassen, war doch das Flugbillett schon gelöst und der Abflug in drei Tagen fällig. Aber ich war abwesend, auf einer Konferenz der Polizeikommandanten, und erst gegen Abend aus Bern zurück zu erwarten. Richtiges Handeln war notwendig, Unerfahrenheit konnte alles vereiteln. Matthäi ließ sich mit dem Polizeiposten Mägendorf verbinden. Es war gegen Ende April, draußen rauschten Regengüsse nieder, der Föhnsturm hatte nun auch die Stadt erreicht, doch wich die unangenehme, bösartige Wärme nicht, welche die Menschen kaum atmen ließ.
Der Polizist Riesen meldete sich.
›Regnet es in Mägendorf auch?‹ fragte Matthäi vorerst unmutig, obgleich die Antwort zu erraten war, und sein Gesicht wurde noch düsterer. Dann gab er die Anweisung, den Hausierer im ›Hirschen‹ unauffällig zu bewachen.
Matthäi hängte auf.
›Etwas passiert?‹ fragte Feller neugierig, der seinem Chef beim Packen half. Es galt, eine ganze Bibliothek fortzuschaffen, die sich nach und nach angesammelt hatte.
›Auch in Mägendorf regnet es‹, antwortete der Kommissär, ›alarmieren Sie das Überfallkommando.‹
›Mord?‹
›Regen ist eine Schweinerei‹, murmelte Matthäi anstelle einer Antwort, gleichgültig gegen den beleidigten Feller.
Bevor er jedoch zum Staatsanwalt und zu Leutnant Henzi in den Wagen stieg, die ungeduldig warteten, blätterte er in von Guntens Akten. Der Mann war vorbestraft. Sittlichkeitsdelikt an einer Vierzehnjährigen.«
4
»Doch schon der Befehl, den Hausierer zu überwachen, erwies sich als ein Fehler, der in keiner Weise vorauszusehen war. Mägendorf stellte ein kleines Gemeinwesen dar. Die meisten waren Bauern, wenn auch einige in den Fabriken unten im Tal arbeiteten oder in der nahen Ziegelei. Zwar gab es einige Städter, die hier draußen wohnten, zwei, drei Architekten, einen klassizistischen Bildhauer, doch spielten sie im Dorf keine Rolle. Alles kannte sich, und die meisten waren miteinander verwandt. Mit der Stadt lag das Dorf im Konflikt, wenn auch nicht offiziell, so doch heimlich; denn die Wälder, die Mägendorf umgaben, gehörten der Stadt, eine Tatsache, die kein richtiger Mägendorfer je zur Kenntnis genommen, was der Forstverwaltung einst viele Sorgen gemacht hatte. Sie war es denn gewesen, die vor Jahren für Mägendorf einen Polizeiposten gefordert und erlangt hatte, wozu noch der Umstand gekommen war, daß an den Sonntagen die Städter das Dörfchen in Strömen annektierten und der ›Hirschen‹ auch nachts viele anlockte. Dies alles erwogen, mußte der stationierte Polizeimann sein Handwerk verstehen, doch war anderseits dem Dorfe menschlicherweise auch entgegenzukommen. Diese Einsicht war dem Polizeisoldaten Wegmüller, den man ins Dorf beorderte, bald aufgegangen. Er stammte aus einer Bauernfamilie, trank viel und hielt seine Mägendorfer souverän im Zaum, mit so vielen Konzessionen freilich, daß ich eigentlich hätte einschreiten sollen, doch sah ich in ihm – auch etwas durch den Personalmangel gezwungen – das kleinere Übel. Ich hatte Ruhe und ließ Wegmüller in Ruhe. Doch hatten seine Stellvertreter – wenn er in den Ferien war – nichts zu lachen. Sie machten in den Augen der Mägendorfer alles falsch. Wenn auch die Wildereien und Holzdiebstähle in den städtischen Forstgebieten und die Raufereien im Dorfe seit der Hochkonjunktur längst zur Legende gehörten, der traditionelle Trotz gegen die Staatsgewalt glomm unter der Bevölkerung weiter. Besonders Riesen hatte es diesmal schwer. Er war ein einfältiger Bursche, schnell beleidigt und humorlos, den ständigen Witzeleien der Mägendorfer nicht gewachsen und eigentlich auch für normalere Gegenden zu sensibel. Er machte sich aus Furcht vor der Bevölkerung unsichtbar, hatte er die täglichen Dienstgänge und Kontrollen hinter sich gebracht. Unter diesen Umständen mußte es sich als unmöglich erweisen, den Hausierer unauffällig zu beobachten. Das Erscheinen des Polizisten im ›Hirschen‹, den er sonst ängstlich mied, kam von vornherein einer Staatsaktion gleich. Riesen setzte sich denn auch so demonstrativ dem Hausierer gegenüber, daß die Bauern neugierig verstummten.
›Kaffee?‹ fragte der Wirt.
›Nichts‹, antwortete der Polizist, ›ich bin dienstlich hier.‹
Die Bauern starrten neugierig auf den Hausierer.
›Was hat er denn gemacht?‹ fragte ein alter Mann.
›Das geht Sie nichts an.‹
Die Gaststube war niedrig, verqualmt, eine Höhle aus Holz, die Wärme drückend, doch machte der Wirt kein Licht. Die Bauern saßen an einem langen Tisch, vielleicht vor Weißwein, vielleicht vor Bier, nur als Schatten vor den silbrigen Fensterscheiben sichtbar, an denen es niedertropfte, niederfloß. Irgendwo das Klappern von Tischfußball. Irgendwo das Klingeln und Rollen eines amerikanischen Spielautomaten.
Von Gunten trank einen Kirsch. Er fürchtete sich. Ersaß zusammengekauert im Winkel, den rechten Arm auf den Henkel seines Korbes gestützt, und wartete. Es schien ihm, als säße er schon stundenlang hier. Alles war dumpf und still, doch drohend. In den Fensterscheiben wurde es heller, der Regen ließ nach, und plötzlich war die Sonne wieder da. Nur der Wind heulte noch und rüttelte am Gemäuer. Von Gunten war froh, als draußen endlich die Wagen vorfuhren.
›Kommen Sie‹, sagte Riesen und erhob sich. Die beiden traten hinaus. Vor der Wirtschaft wartete eine dunkle Limousine und der große Wagen des Überfallkommandos; die Sanität folgte. Der Dorfplatz lag in der grellen Sonne. Am Brunnen standen zwei Kinder, fünf- oder sechsjährig, ein Mädchen und ein Bub, das Mädchen mit einer Puppe unter dem Arm. Der Knabe mit einer kleinen Geißel.
›Setzen Sie sich neben den Chauffeur, von Gunten!‹ rief Matthäi zum Fenster der Limousine hinaus, und dann, nachdem der Hausierer aufatmend, als wäre er nun in Sicherheit, Platz genommen und Riesen den andern Wagen bestiegen hatte: ›So, nun zeigen Sie uns, was Sie im Walde gefunden haben.‹«
5
»Sie gingen durchs nasse Gras, da der Weg zum Walde ein einziger schlammiger Tümpel war, und umgaben kurz darauf den kleinen Leichnam, den sie zwischen Büschen, nicht weit vom Waldrand entfernt, im Laub fanden. Die Männer schwiegen. Von den tosenden Bäumen fielen immer noch große silberne Tropfen, glitzerten wie Diamanten. Der Staatsanwalt warf die Brissago weg, trat verlegen darauf. Henzi wagte nicht hinzuschauen. Matthäi sagte: ›Ein Polizeibeamter blickt nie weg, Henzi.‹
Die Männer bauten ihre Apparate auf.
›Es wird schwierig sein, nach diesem Regen Spuren zu finden‹, sagte Matthäi.
Plötzlich standen der Bub und das Mädchen mitten unter den Männern, starrten hin, das Mädchen immer noch mit der Puppe im Arm und der Knabe immer noch mit seiner Geißel.
›Führt die Kinder weg.‹
Ein Polizist brachte die beiden an der Hand auf die Straße zurück. Dort blieben die Kinder stehen.
Vom Dorfe her kamen die ersten Leute, der Hirschenwirt schon von weitem an der weißen Schürze erkennbar.
›Sperrt ab‹, befahl der Kommissär. Einige stellten Posten auf. Andere suchten die nächste Umgebung ab. Dann zuckten die ersten Blitzlichter.
›Kennen Sie das Mädchen, Riesen?‹
›Nein, Herr Kommissär.‹
›Haben Sie es im Dorfe schon gesehen?‹
›Ich glaube, Herr Kommissär.‹
›Ist das Mädchen photographiert worden?‹
›Wir nehmen noch zwei Bilder von oben auf.‹
Matthäi wartete.
›Spuren?‹
›Nichts. Alles verschlammt.‹
›Bei den Knöpfen nachgesehen? Fingerabdrücke?‹
›Aussichtslos nach diesem Wolkenbruch.‹
Dann bückte sich Matthäi vorsichtig. ›Mit einem Rasiermesser‹, stellte er fest, las das herumliegende Gebäck zusammen und tat es vorsichtig ins Körbchen zurück.
›Brezeln.‹
Es wurde gemeldet, einer vom Dorfe wolle sie sprechen. Matthäi stand auf. Der Staatsanwalt blickte zum Waldrand. Dort stand ein Mann mit weißen Haaren, einen Schirm über den linken Unterarm gehängt. Henzi lehnte sich an eine Buche. Er war bleich. Der Hausierer saß auf seinem Korb und beteuerte leise immer wieder: ›Ganz zufällig bin ich vorbeigekommen, ganz zufällig!‹
›Bringen Sie den Mann her.‹
Der weißhaarige Mann kam durchs Gebüsch, erstarrte.
›Mein Gott‹, murmelte er nur, ›mein Gott.‹
›Darf ich um Ihren Namen bitten?‹ fragte Matthäi.
›Ich bin der Lehrer Luginbühl‹, antwortete der weißhaarige Mann leise und schaute weg.
›Kennen Sie dieses Mädchen?‹
›Das Gritli Moser.‹
›Wo wohnen die Eltern?‹
›Im Moosbach.‹
›Weit vom Dorf?‹
›Eine Viertelstunde.‹
Matthäi schaute hin. Er war der einzige, der den Blick wagte. Niemand sagte ein Wort.
›Wie ist das gekommen?‹ fragte der Lehrer.
›Ein Sexualverbrechen‹, antwortete Matthäi. ›Ging das Kind zu Ihnen in die Schule?‹
›Zu Fräulein Krumm. In die dritte Klasse.‹
›Haben Mosers noch mehr Kinder?‹
›Gritli war das einzige.‹
›Jemand muß es den Eltern sagen.‹
Die Männer schwiegen wieder.
›Sie, Herr Lehrer?‹ fragte Matthäi.
Luginbühl antwortete lange nichts. ›Halten Sie mich nicht für feige‹, sagte er endlich zögernd, ›aber ich möchte es nicht tun. Ich kann es nicht‹, fügte er leise hinzu.
›Verstehe‹, sagte Matthäi. ›Der Herr Pfarrer?‹
›In der Stadt.‹
›Gut‹, antwortete Matthäi darauf ruhig. ›Sie können gehen, Herr Luginbühl.‹
Der Lehrer ging zur Straße zurück. Dort hatten sich immer mehr von Mägendorf her angesammelt.
Matthäi blickte zu Henzi hinüber, der immer noch an der Buche lehnte. ›Bitte nicht, Kommissär‹, sagte Henzi leise. Auch der Staatsanwalt schüttelte den Kopf. Matthäi blickte noch einmal hin und dann zum roten Röcklein, das zerrissen im Gebüsch lag, durchtränkt von Blut und Regen.
›Dann werde ich gehen‹, sagte er und hob den Korb mit den Brezeln auf.«
6
»›Im Moosbach‹ lag in einer kleinen moorartigen Niederung bei Mägendorf. Matthäi hatte den Dienstwagen im Dorfe verlassen und ging zu Fuß. Er wollte Zeit gewinnen. Schon von weitem sah er das Haus. Er blieb stehen und wandte sich um. Er hatte Schritte gehört. Der kleine Bub und das Mädchen waren wieder da, mit gerötetem Gesicht. Sie mußten Abkürzungen benützt haben, anders war ihre erneute Gegenwart nicht zu erklären.
Matthäi ging weiter. Das Haus war niedrig, weiße Mauern mit dunklen Balken, darüber ein Schindeldach. Hinter dem Haus Obstbäume und im Garten schwarze Erde. Vor dem Hause hackte ein Mann Holz. Er blickte auf und bemerkte den herankommenden Kommissär.
›Was wünschen Sie?‹ sagte der Mann.