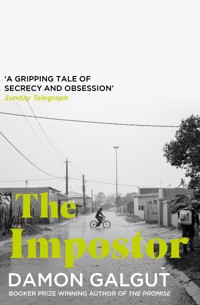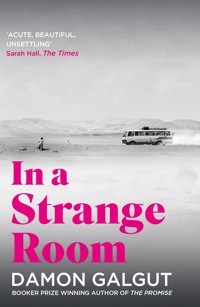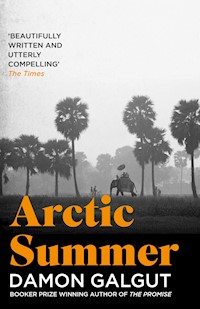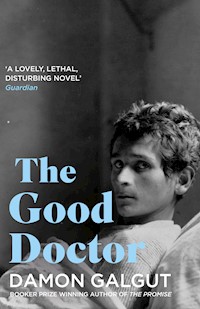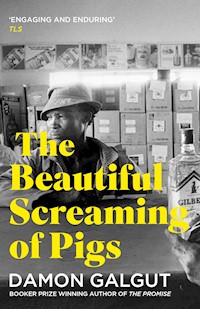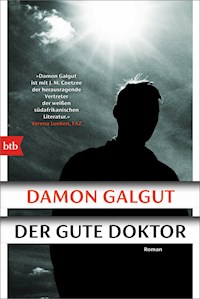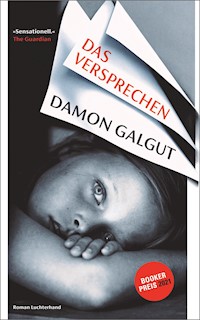
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Das Versprechen« erzählt vom zunehmenden Zerfall einer weißen südafrikanischen Familie, die auf einer Farm außerhalb Pretorias lebt. Die Swarts versammeln sich zur Beerdigung ihrer Mutter Rachel, die mit vierzig an Krebs stirbt. Die jüngere Generation, Anton und Amor, verabscheuen alles, wofür die Familie steht – nicht zuletzt das gescheiterte Versprechen an die schwarze Frau, die ihr ganzes Leben für sie gearbeitet hat. Nach jahrelangem Dienst wurde Salome ein eigenes Haus, eigenes Land versprochen ... doch irgendwie bleibt dieses Versprechen mit jedem Jahrzehnt, das vergeht, unerfüllt.
Mit großer erzählerischer Kraft und nah an den Personen schildert Damon Galgut eine Familiengeschichte, die sich über dreißig Jahre des politischen Umbruchs in Südafrika erstreckt – von der Apartheid bis hin zur Demokratie. Während sich das Land von den alten tiefen Spaltungen zu einer neuen, gerechteren Gesellschaft hin bewegt, schwebt über allem die Frage: Wie viel Verbitterung, wie viel Erneuerung, wie viel Hoffnung bleiben?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 420
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Ausgezeichnet mit dem Booker Prize 2021
»Das Versprechen« erzählt vom zunehmenden Zerfall einer weißen südafrikanischen Familie, die auf einer Farm außerhalb Pretorias lebt. Die Swarts versammeln sich zur Beerdigung ihrer Mutter Rachel, die mit vierzig an Krebs stirbt. Die jüngere Generation, Anton und Amor, verabscheuen alles, wofür die Familie steht - nicht zuletzt das gescheiterte Versprechen an die schwarze Frau, die ihr ganzes Leben für sie gearbeitet hat. Nach jahrelangem Dienst wurde Salome ein eigenes Haus, eigenes Land versprochen … doch irgendwie bleibt dieses Versprechen mit jedem Jahrzehnt, das vergeht, unerfüllt.
Mit großer erzählerischer Kraft und nah an den Personen schildert Damon Galgut eine Familiengeschichte, die sich über dreißig Jahre des politischen Umbruchs in Südafrika erstreckt - von der Apartheid bis hin zur Demokratie. Während sich das Land von den alten tiefen Spaltungen zu einer neuen, gerechteren Gesellschaft hin bewegt, schwebt über allem die Frage: Wie viel Verbitterung, wie viel Erneuerung, wie viel Hoffnung bleiben?
»Ein meisterhafter, bewegender Roman.« Times Literary Supplement
»Gibt es in dieser Welt wahre Gerechtigkeit? Die Art und Weise, wie sich der Roman mit dieser Frage auseinandersetzt, macht ihn zu einem Meisterwerk.« Chigozie Obioma
»Umwerfend … Galgut schreibt über Schicksal und Verlust, über drei Geschwister und ihr Land, ein gebrochenes Versprechen. Die Geschichte besitzt eine unglaubliche Tiefe, als wären die Figuren im Laufe der Zeit mit zärtlicher Sorgfalt erdacht worden.« Colm Tóibín
Damon Galgut
Das Versprechen
Roman
Aus dem südafrikanischen Englisch von Thomas Mohr
Luchterhand
Die englische Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel »The Promise« bei Chatto & Windus, London.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2021 Damon Galgut
Copyright © der deutschen Ausgabe 2021
Luchterhand Literaturverlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung buxdesign / München
unter Verwendung eines Fotos Linelle Deunk/Lumen © Linelle Deunk, courtesy of Kahmann Gallery, Amsterdam, und nach einem Entwurf von © Suzanne Dean, Penguin Random House UK.
Autorenfoto: © Michaela Verity
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
Alle Rechte vorbehalten.
ISBN 978-3-641-27184-8V001
www.luchterhand-literaturverlag.de
www.facebook.com/luchterhandverlag
www.twitter.com/luchterhandlit
Heute Morgen begegnete ich einer Frau mit einer goldenen Nase. Sie saß mit einem Affen im Arm in einem Cadillac. Ihr Chauffeur hielt an, und sie fragte mich: »Sind Sie Fellini?« Und mit klirrender Stimme fuhr sie fort: »Warum gibt es in Ihren Filmen nicht einen einzigen normalen Menschen?«
FEDERICO FELLINI
Antonio und Petruchio für Agenterei, Kocherei und Reiserei
MA
ALSDERBLECHKASTEN ihren Namen sagt, weiß Amor, dass es passiert ist. Den ganzen Tag schon ist sie angespannt, nervös, quält sie ein leichter Kopfschmerz, als habe sie im Traum eine Warnung erhalten, an die sie sich nicht erinnern kann. Irgendein Zeichen oder Bild, dicht unter der Oberfläche. Schwelende Unruhe. Dumpfes Unbehagen.
Doch als sie es endlich ausgesprochen hört, glaubt sie erst einmal kein Wort. Sie schließt die Augen und schüttelt den Kopf. Nein, nein. Was ihre Tante ihr da gerade mitgeteilt hat, kann unmöglich wahr sein. Niemand ist tot. Das ist nur ein Wort, weiter nichts. Sie betrachtet dieses Wort, das auf dem Schreibtisch liegt wie ein Insekt auf dem Rücken, ohne Erklärung.
Ort des Geschehens ist Miss Starkeys Büro, wohin die Lautsprecherstimme sie zitiert hat. Amor hat so lange auf diesen Augenblick gewartet, hat ihn sich so viele Male vorgestellt, dass er ihr längst wie eine Tatsache vorkam. Doch jetzt, wo er tatsächlich da ist, scheint er weit weg und wie im Traum. Es ist nicht passiert, nicht wirklich. Und schon gar nicht ihrer Ma, die immer, ewig leben wird.
Es tut mir leid, wiederholt Miss Starkey und versteckt ihre großen Zähne hinter schmalen, zusammengepressten Lippen. Einige der anderen Mädchen haben gesagt, Miss Starkey wäre lesbisch, aber es fällt schwer, sie sich beim Sex vorzustellen, egal mit wem. Oder vielleicht fand sie es beim ersten Mal so eklig, dass ihr die Lust daran vergangen ist. Dieses Leid müssen wir alle ertragen, setzt sie mit ernster Stimme hinzu, während Tannie Marina sich mit zitternden Fingern und einem Papiertaschentuch die Augen tupft, obwohl sie immer auf Ma hinabgeschaut hat und es sie einen Dreck interessiert, dass sie tot ist, auch wenn das so gar nicht stimmt.
Ihre Tante geht mit ihr nach unten und wartet, während Amor im Wohnheim ihren Koffer packt. Seit sieben Monaten ist sie hier und wartet darauf, dass passiert, was nicht passiert sein kann, und sie hat sie von der ersten Sekunde an gehasst, diese langen, kalten Räume mit dem Linoleumfußboden, doch jetzt, wo sie fortgehen muss, würde sie am liebsten bleiben. Am liebsten würde sie sich ins Bett legen, einschlafen und nie, nie wieder aufwachen. Wie Ma? Nein, nicht wie Ma, denn Ma schläft ja nicht.
Langsam räumt sie ihre Sachen in den Koffer und trägt ihn nach unten vor den Eingang des Schulhauptgebäudes, wo ihre Tante steht und in den Fischteich starrt. Das ist aber ein fetter Brocken, sagt sie und zeigt mit dem Finger ins Wasser, hast du schon mal einen so großen Goldfisch gesehen? Und Amor sagt Nein, obwohl sie gar nicht sehen kann, auf welchen Fisch ihre Tante zeigt, und das alles sowieso nicht echt ist.
Als sie in den Cressida steigt, ist das auch nicht echt, und als sie die gewundene Schulauffahrt hinunterschweben, ist der Blick aus dem Fenster wie ein Traum. Die Jacarandabäume stehen in voller Blüte, und die violetten Blätter leuchten grell und fremd. Ihre Stimme klingt wie ein Echo, als würde jemand anders sprechen, und als sie beim Haupttor rechts statt wie sonst links abbiegen, hört sie sich fragen, wohin sie eigentlich fahren.
Zu uns, sagt ihre Tante. Onkel Ockie abholen. Ich war furchtbar in Eile gestern Abend, als es, nun ja, als es passiert ist.
(Es ist nicht passiert.)
Tannie Marina schielt zur Seite mit kleinen, mascaraumrandeten Augen, doch das Mädchen zeigt noch immer keine Reaktion. Die Enttäuschung der älteren Frau liegt förmlich in der Luft, wie ein verstohlener Furz. Sie hätte Amor auch von Lexington abholen lassen können, aber stattdessen ist sie persönlich gekommen, weil sie, wie jeder weiß, immer hilft, wenn Not am Mann ist. Hinter ihrem runden, mit Schminke zugekleisterten Gesicht ist sie ganz versessen auf Drama, Klatsch und billiges Spektakel. Blutvergießen und Verrat im Fernsehen, gut und schön, aber jetzt bietet ihr das Leben eine echte, aufregende Gelegenheit. Die schreckliche Nachricht, überbracht nicht etwa privat, sondern vor der Direktorin! Aber ihre Nichte, dieser nichtsnutzige Plumpsack, hat kaum ein Wort gesagt. Wirklich, irgendetwas stimmt nicht mit dem Kind, das ist Marina schon des Öfteren aufgefallen. Sie schiebt es auf den Blitz. Ag, shame, es ist ein Jammer, aber seitdem ist das Mädchen nicht mehr wie früher.
Iss welche von den rusks, sagt ihre Tante schroff. Sie liegen auf dem Rücksitz.
Amor will aber keine rusks. Sie hat keinen Appetit. Tannie Marina backt ständig irgendwelche Sachen und will einen damit füttern. Ihre Schwester Astrid sagt, das macht sie nur, damit sie nicht als Einzige so fett ist, und es stimmt, ihre Tante hat zwei Kochbücher mit Teatime-Leckereien veröffentlicht, die bei einer bestimmten Sorte älterer weißer Frauen recht beliebt sind, wie man allenthalben deutlich sieht.
Na ja, sinniert Tannie Marina, wenigstens kann man mit der Kleinen vernünftig sprechen. Sie unterbricht einen nicht, gibt keine Widerworte und scheint tatsächlich die Ohren aufzusperren, wenn man etwas sagt, so, wie es sich gehört. Die Fahrt von der Schule zum Haus der Laubschers in Menlo Park dauert eigentlich nicht allzu lange, doch heute zieht sie sich hin, und Tannie Marina spricht die ganze Zeit Afrikaans, sehr gefühlsbetont, mit leiser, vertrauensvoller Stimme, durchsetzt mit Verkleinerungs- und Verniedlichungsformen, auch wenn ihre Motive alles andere als wohlwollend sind. Es geht um das übliche Thema, dass Ma die ganze Familie verraten hat, als sie zu einer anderen Religion gewechselt ist. Korrigiere, zu ihrer alten Religion. Zum Judentum! Ihre Tante hält mit ihrer Meinung zu dieser Angelegenheit nicht hinterm Berg, seit Ma vor einem halben Jahr so krank geworden ist, aber was kann Amor daran schon ändern? Sie ist doch noch ein Kind, hat keine Macht, und überhaupt, was spricht dagegen, zu seiner alten Religion zurückzukehren, wenn man denn möchte?
Sie versucht, nicht hinzuhören und sich auf etwas anderes zu konzentrieren. Am Steuer trägt ihre Tante kleine weiße Golfhandschuhe, vermutlich Vornehmtuerei, vielleicht aber auch nur aus Angst vor Keimen und Bazillen, und so richtet Amor den Blick auf die farblosen Konturen von Tannie Marinas Händen, die sich um das Lenkrad schließen. Wenn sie sich auf die Hände konzentrieren kann, auf ihre Form, mit ihren kurzen Stummelfingern, braucht sie sich nicht anzuhören, was der Mund über diesen Händen von sich gibt, und dann ist es auch nicht wahr. Das Einzige, was wahr ist, sind die Hände und ich, die ich auf diese Hände starre.
… Mal ehrlich, deine Mutter ist von der Niederländisch-reformierten doch nur wieder zu diesem Judenverein übergetreten, um meinem kleinen Bruder eins auszuwischen … Damit sie nicht auf der Farm beerdigt wird, neben ihrem Mann, das ist doch der eigentliche Grund … Es gibt einen richtigen Weg und einen falschen, und ich sage das nur ungern, aber deine Mutter hat den falschen eingeschlagen … Na ja, so oder so, seufzt Tannie Marina, als sie vor dem Haus halten, wollen wir hoffen, dass Gott ihr vergibt und sie endlich ihren Frieden findet.
Sie stellen den Wagen in der Auffahrt ab, unter dem Sonnenverdeck mit den wunderschönen grünen, violetten und orangefarbenen Streifen. Dahinter eine Miniaturausgabe des weißen Südafrika, der blechbedachte Vorortbungalow aus rötlichem Backstein, ringsherum wie ein Burggraben der verdorrte Garten. Ein Klettergerüst, das auf dem großen braunen Rasen etwas verloren wirkt. Ein betoniertes Vogelbad, ein Spielhaus und eine Reifenschaukel. Wo vielleicht auch du aufgewachsen bist. Wo alles angefangen hat.
Amor folgt ihrer Tante, nicht auf Bodenhöhe, sondern ein paar Zentimeter darüber, eine taumelige Handbreit zwischen ihr und der Welt, zur Küchentür. Drinnen mixt sich Oom Ockie eine Brandy-Cola, seine zweite an diesem Vormittag. Er war bis vor Kurzem technischer Zeichner im Ministerium für Wasserwirtschaft, und seit er Rentner ist, verlaufen seine Tage ereignislos. Als seine Frau hereinplatzt, nimmt er reumütig Haltung an und lutscht an seinem nikotingelben Schnurrbart. Obwohl er stundenlang Zeit hatte, sich ordentlich anzuziehen, trägt er noch immer Jogginghose, Golfhemd und Flipflops. Ein klobiger Mann mit lichtem Haupthaar, das er sich mit Pomade quer über den Schädel kämmt. Pflichtschuldig drückt er Amor an seine klamme Brust, was beiden furchtbar peinlich ist.
Das mit deiner Mutter tut mir leid, sagt er.
Ach, schon gut, sagt Amor und fängt auf der Stelle an zu weinen. Wollen die Leute sie etwa den ganzen Tag bedauern, weil ihre Mutter jetzt dieses Wort ist? Sie fühlt sich hässlich, wenn sie weint, wie eine aufplatzende Tomate, und will nichts wie weg, bloß weg aus diesem grässlichen Kabuff mit dem Parkettfußboden, dem kläffenden Malteser-Pudel und den Blicken ihrer Tante und ihres Onkels, die sich wie Nägel in sie bohren.
Sie hastet vorbei an Oom Ockies düsterem Aquarium, den Flur entlang, dessen Wände mit Strukturputz versehen sind, wie er in diesen Breiten derzeit sehr en vogue ist, ins Bad. Wie sie sich die Tränen abwäscht, muss hier nicht näher beschrieben werden, es sei jedoch erwähnt, dass Amor, nach wie vor schluchzend und schniefend, die Tür des Arzneischränkchens öffnet, um einen Blick hineinzuwerfen, was sie in fremden Häusern immer tut. Manchmal gibt es dort Interessantes zu entdecken, doch in diesen Fächern stehen nur deprimierende Dinge wie Gebisshaftcreme und Hämorrhoidensalbe. Dann schämt sie sich ihrer Neugier und muss zur Strafe die Gegenstände in jedem Fach erst zählen und anschließend in eine ansprechendere Ordnung bringen. Dann dämmert ihr, dass ihre Tante das bemerken wird, und sie stellt das ursprüngliche Durcheinander wieder her.
Auf dem Weg zurück über den Flur macht Amor vor der offenen Zimmertür ihres Cousins Wessel halt. Er ist der jüngste und dickste von Tannie Marinas Sprösslingen und der einzige, der noch bei seinen Eltern wohnt. Er ist schon vierundzwanzig, aber seit er seinen Wehrdienst abgeleistet hat, hockt er nur noch zu Hause herum und beschäftigt sich mit seiner Briefmarkensammlung. Anscheinend hat er Angst davor, auf eigenen Füßen zu stehen. Er hat Depressionen, sagt sein Vater, und seine Mutter meint, er habe seinen Weg noch nicht gefunden. Pa hingegen ist der Ansicht, sein Neffe sei schlicht und einfach faul und verwöhnt, und man müsse ihn zur Arbeit zwingen.
Amor kann ihren Cousin nicht leiden, schon gar nicht in diesem Augenblick, weil er so große, klumpige Hände hat und einen Topfschnitt und weil er das S so komisch spricht. Er würde ihr ohnehin nicht in die Augen schauen, doch jetzt bemerkt er sie kaum, denn sein Briefmarkenalbum liegt aufgeschlagen auf seinem Schoß, und durch eine Lupe betrachtet er eines der Lieblingsstücke seiner Sammlung, den Dreiersatz zum Gedenken an Dr. Verwoerd, der ein paar Monate nach der Ermordung dieses großen Mannes herausgekommen war.
Was machst du hier?
Deine Mutter hat mich von der Schule abgeholt. Sie wollte nur noch rasch deinen Vater und ein paar Lebensmittel ins Auto laden.
Aha. Und jetzt fährst du nach Hause?
Ja.
Das mit deiner Mutter tut mir leid, sagt er und sieht sie schließlich doch an. Sie kann einfach nicht anders, sie fängt von Neuem an zu weinen und muss sich die Tränen mit dem Ärmel abwischen. Doch er widmet sich schon wieder seinen Marken.
Bist du sehr traurig?, fragt er geistesabwesend, ohne sie anzusehen.
Sie schüttelt den Kopf. In diesem Moment ist es die Wahrheit, sie empfindet gar nichts, nur Leere.
Hast du sie liebgehabt?
Na klar, sagt sie. Doch selbst bei dieser Frage rührt sich nichts in ihr. Was sie zweifeln lässt, ob sie die Wahrheit sagt.
Eine halbe Stunde später hockt sie im Fond von Ockies altem Valiant. Ihr Onkel sitzt in seiner Kirchenmontur, braune Hose, gelbes Hemd und blankgeputzte Schuhe, und mit abstehenden Ohren am Steuer, und der Rauch seiner Zigarette wabert über die Windschutzscheibe. Neben ihm seine Frau, die sich frischgemacht und mit Je t’aime eingesprüht und einen Beutel voller Backutensilien aus der Küche mitgenommen hat. Gerade fahren sie an dem Friedhof am Westrand der Stadt vorbei, wo eine kleine Menschenmenge um eine Erdgrube versammelt steht, und nicht weit von hier ist der jüdische Friedhof, wo schon bald, nein, besser nicht dran denken und die Gräber nicht beachten, dabei ist das Schild für den Heldenacker nicht zu übersehen, aber wer sind eigentlich die Helden, das wird einem nie erklärt, ist Ma jetzt auch ein Held, nein, auch da lieber nicht dran denken, und dann versinkt dein Blick in diesem schrecklichen Meer aus Zement und Autowaschstraßen und schmutzig grauen Wohnblocks auf der anderen Straßenseite. Wenn ihr die übliche Strecke nehmt, werdet ihr die Stadt bald hinter euch lassen, doch heute geht das nicht, denn diese Straße führt vorbei an Atteridgeville, und im Township gibt es Unruhen. In allen Townships gibt es Unruhen, überall reden die Leute darüber, hinter vorgehaltener Hand, und obwohl der Ausnahmezustand wie eine dunkle Wolke über dem Land hängt, die Nachrichten zensiert werden und die Atmosphäre insgesamt leicht angespannt, leicht aufgeladen ist, lassen sich diese Stimmen nicht zum Schweigen bringen, sind sie immer da, im Hintergrund, wie ein statisches Rauschen. Aber wem gehören sie, diese Stimmen, und warum können wir sie jetzt nicht hören? Schhh, ihr werdet sie hören, wenn ihr nur aufpasst, wenn ihr die Ohren spitzt.
… Wir sind der letzte Außenposten auf diesem Kontinent … Wenn Südafrika scheitert, knallen in Moskau die Champagnerkorken … Eins steht fest, Mehrheitsregierung bedeutet Kommunismus …
Ockie macht das Radio aus. Er hat keine Lust auf Politikergequatsche und genießt lieber die schöne Aussicht. Er stellt sich vor, wie er auf einem Ochsenkarren gemächlich ins Landesinnere rollt, so wie einst seine Voortrekker-Vorfahren. Ja, nicht jeder hat hochfliegende Träume. Ockie, der verwegene Pionier, der über die Ebene dahingleitet. Draußen zieht eine braun-gelbe Landschaft vorbei, trocken, wo sie nicht gerade von einem Fluss durchschnitten wird, unter dem endlos weiten Highveld-Himmel Die Farm, wie sie sie nennen, obwohl sie mit einer echten Farm nicht das Geringste gemein hat, ein Pferd und ein paar Kühe und eine Handvoll Hühner und Schafe, liegt dort draußen zwischen den flachen Hügeln und Tälern, auf halbem Weg zum Hartbeespoort-Stausee.
Ein Stück abseits, hinter einem Zaun, sieht er eine Gruppe von Männern mit einem Metallsuchgerät, die schwarzen Jungs beim Ausheben von Erdlöchern zuschauen. Das ganze Tal gehörte einst Paul Kruger, und hartnäckig halten sich Gerüchte, wonach irgendwo unter diesen Steinen zwei Millionen Pfund in Gold aus dem Burenkrieg verborgen liegen. Und so graben sie, hier, nein, dort, auf der Jagd nach den Reichtümern der Vergangenheit. Es ist die reine Habgier, doch selbst dabei wird ihm ganz wehmütig und warm ums Herz. Meine Leute sind ein tapferer, zählebiger Haufen, sie haben die Briten überdauert, und sie werden auch die Kaffern überdauern. Die Afrikaaner sind ein besonderes Volk, davon ist er fest überzeugt. Er versteht nicht, weshalb Manie ausgerechnet Rachel heiraten musste. Öl und Wasser vertragen sich nicht. Man sieht es an ihren Kindern, Versager, alle miteinander.
Zumindest in dieser Hinsicht sind seine Frau und er sich einig. Marina konnte ihre Schwägerin von Anfang an nicht leiden. Alles sprach gegen die Verbindung. Warum konnte ihr Bruder nicht einfach seinesgleichen heiraten? Ich habe einen Fehler gemacht, hatte er gesagt, und für seine Fehler muss man büßen. Manie war schon immer dickköpfig und dumm. Den Wünschen seiner Familie zuwiderhandeln, und das wegen so einer, eitel und stolz, die ihn am Ende natürlich hatte sitzenlassen. Wegen Sex. Weil er die Pfoten einfach nicht von anderen Weibern lassen konnte. Für Sex hatte Marina noch nie allzu viel übrig, außer das eine Mal in Sun City, mit dem Mechaniker, aber aieee, sei still, fang bloß nicht wieder davon an. Mit meinem Bruder ging es vom ersten Tag an bergab, kaum hatte er angefangen, sich zu rasieren, verwandelte er sich auch schon in einen kleinen Bock, der herumhurte und Unruhe stiftete, bis zu dem Unfall, der alles auf den Kopf stellte. Der Unfall ist jetzt irgendwo da draußen und leistet seinen Wehrdienst ab. Sie haben ihm heute früh eine Nachricht geschickt, er wird erst morgen zu Hause sein.
Anton kommt erst morgen, sagt sie zu Amor und zieht sich im Schminkspiegel die Lippen nach.
Sie nähern sich dem Abzweig von der falschen Seite, und Amor muss aussteigen, um das Tor zu öffnen und hinter dem Wagen wieder zuzumachen. Dann rumpeln sie über eine holprige Lehmpiste, aus der hier und da spitze Steine ragen, die metallisch über den Unterboden schrappen. Das Geräusch klingt überlaut in Amors Ohren, geht ihr durch Mark und Bein. Ihre Kopfschmerzen sind schlimmer geworden. Als sie sich auf offener Straße befanden, konnte sie sich einreden, sie sei irgendwo im Nirgendwo, sich einfach treiben lassen. Jetzt jedoch sagen ihr sämtliche Sinne, dass sie gleich da sind. Sie will nicht zurück nach Hause, denn wenn sie erst einmal dort ist, steht unwiderruflich fest, dass etwas passiert ist, dass sich in ihrem Leben etwas verändert hat, das sich nicht mehr rückgängig machen lässt. Sie will nicht, dass die Straße tut, was sie tut, unter den Strommasten hindurch zum koppie führen, sie will nicht, dass sie die Anhöhe erklimmt, sie will es nicht sehen, das Haus in der Senke auf der anderen Seite. Aber da ist es, und sie sieht es.
Sie hat es eigentlich noch nie leiden können. Eine komische Hütte war das, schon damals, als ihr Großvater es gekauft hatte, wer baute schon in diesem Stil hier draußen im Busch? Aber dann war Oupa im Stausee ertrunken, und Pa hatte es geerbt und im Lauf der Jahre um immer neue Anbauten und Nebengebäude erweitert, ohne jedes Formgefühl bzw. im traditionellen Stil, wie er das nannte. Ein völlig planloses Unterfangen, das Ma zufolge einzig und allein dazu diente, das ursprüngliche Art déco zu übertünchen, das er irgendwie unmännlich fand. Ach, Unsinn, sagte Pa, ich bin da ganz pragmatisch. Es soll schließlich wie eine Farm aussehen und nicht wie ein Fantasiegebilde. Und was ist daraus geworden? Ein Frankensteinmonster von einem Haus, mit vierundzwanzig Außentüren, die nachts abgeschlossen werden müssen, ein Mischmasch aller nur erdenklichen Stilarten. Mitten ins Veld geklotzt, steht es da wie ein Betrunkener in bunt zusammengewürfelten Kleidern.
Trotzdem, denkt Tannie Marina, es gehört uns. Vergiss das Haus, denk an das Land. Nutzloser Boden, voller Steine, mit dem sich nichts anfangen lässt. Aber es gehört unserer Familie, niemandem sonst, und das bedeutet Macht.
Immerhin, sagt sie laut zu Ockie, ist die Frau endlich weg vom Fenster.
Da, o Gott, fällt ihr die Kleine auf dem Rücksitz ein. Du musst aufpassen, was du sagst, Marina, besonders in den nächsten paar Tagen, bis die Beerdigung vorbei ist. Sprich Englisch, das hält dich im Zaum.
Versteh mich nicht falsch, sagt sie zu Amor. Ich habe deine Mutter immer respektiert.
(Nein, hast du nicht.) Aber das spricht Amor nicht laut aus. Stocksteif sitzt sie im Fond des Wagens, der schließlich und endlich zum Stehen kommt. Ockie muss auf halber Höhe der Auffahrt parken, da vor dem Haus zu viele andere Autos stehen, hauptsächlich unbekannte Autos, was machen die hier? Der Sog, der das Loch, das ihre Mutter hinterlassen hat, auf die Menschen und den Fortgang der Ereignisse ausübt, ist schon jetzt immens. Als sie aussteigt und sich die Tür mit einem dumpfen Schlag hinter ihr schließt, fällt ihr Blick auf einen bestimmten Wagen, lang und dunkel, und die Last der Welt wird ihr noch schwerer. Wer ist der Fahrer dieses Autos, und warum steht es vor unserem Haus?
Ich hab den Juden gesagt, sie sollen sie noch nicht mitnehmen, verkündet Tannie Marina. Damit du dich von deiner Mutter verabschieden kannst.
Was Amor zunächst nicht versteht. Knirsch knirsch knirsch macht der Kies. Durch die Vorderfenster sieht sie die vielen Leute im Wohnzimmer, ein dichter Nebel von Menschen, und mittendrin sitzt ihr Vater, vornübergebeugt in einem Sessel. Er weint, denkt sie, dann kommt ihr stattdessen der Gedanke: Nein, er betet. Weinen oder beten, das ist bei Pa inzwischen schwer zu unterscheiden.
Dann versteht sie es doch und denkt: Ich kann da nicht reingehen. Drinnen wartet der Fahrer dieses dunklen Wagens, damit ich mich von meiner Mutter verabschieden kann, aber ich kann unmöglich durch diese Tür gehen. Wenn ich durch diese Tür gehe, wird es wahr, und mein Leben wird nie wieder dasselbe sein. Also wartet sie draußen, während Marina mit ihren Tüten voller Backzutaten und Ockie im Schlepp breitbeinig die Treppe hinauftrampelt. Amor lässt ihren Koffer stehen und flitzt um das Haus herum, vorbei am Blitzableiter und den Gasflaschen in ihrer betonierten Mauernische und über die Terrasse, wo Schäferhund Tojo schlafend in der Sonne liegt und sich die pflaumenblauen Eier wärmen lässt, quer über den Rasen, vorbei an Vogelbad und Kapokbaum, vorbei an den Stallungen und den Gesindehäusern, im Laufschritt in Richtung koppie.
Wo ist sie? Sie war doch direkt hinter uns.
Marina kann es nicht fassen. Was hat dieses dumme Ding denn nun schon wieder angestellt?
Ja, bekräftigt Ockie eilfertig, und gleich noch einmal: Ja.
Ag, die kommt schon wieder. Marina ist nicht besonders nachsichtig gestimmt. Sollen diese Leute die arme Frau eben mitnehmen. Das Kind hat seine Gelegenheit gehabt.
Mervyn Glass, der Fahrer des langen Wagens, sitzt schon seit zwei Stunden mit seiner Kippa auf dem Kopf in der Küche und wartet auf die Anweisung der herrschsüchtigen Frau, der Schwester des Hinterbliebenen, die ihm jetzt das Startsignal gibt. Diese Familie ist wirklich schwierig, er kommt nicht recht dahinter, was hier vor sich geht, auch wenn er sich den Anschein gibt, als würde ihn das überhaupt nicht interessieren. Das Warten in andächtigem Schweigen ist ein wesentlicher Teil seiner Arbeit, und er hat die Fähigkeit entwickelt, äußerste Gemütsruhe zu simulieren, obwohl er nichts dergleichen verspürt. In seinem tiefsten Innern ist Mervyn Glass ein ungestümer Mann.
Jetzt springt er auf. Er und sein Gehilfe machen sich daran, die sterblichen Überreste der Verstorbenen aus dem Schlafzimmer im ersten Stock hinunter ins Parterre zu schaffen. Was nicht ohne eine Trage, einen Leichensack und ein letztes Wehklagen des Ehemanns abgeht, der sich an seine tote Frau klammert und sie anfleht, nicht von ihm zu gehen, als ob sie ihn aus eigenen Stücken verließe und man sie noch umstimmen könnte. Mervyn hat all das schon tausendmal erlebt, auch die kuriose Sogwirkung, die eine Leiche entfaltet, mit der sie die Leute anzieht. Schon morgen wird sich das geändert haben, der Leichnam wird lange fort und seine dauerhafte Absenz von Plänen, Terminen, Erinnerungen und dem Lauf der Dinge überlagert sein. Jawohl, schon. Das Verschwinden beginnt sofort und hört in gewissem Sinne niemals auf.
Aber noch ist er da, der Leichnam, in seiner ganzen grauenhaften Fleischigkeit, das Ding, das alle Anwesenden, selbst diejenigen, denen die tote Frau gleichgültig war, und die gibt es immer, daran gemahnt, dass eines Tages auch sie dort liegen werden, genau wie die Verstorbene, gänzlich entleert, eine bloße Hülle, die sich nicht einmal mehr betrachten kann. Der Geist schreckt vor seiner eigenen Absenz zurück, kann sich selbst nicht als nicht-denkend denken, das kälteste Nichts.
Zum Glück ist sie nicht schwer, die Krankheit hat sie ausgehöhlt, und so ist es kein Problem, sie hinunter ins Parterre, um die enge Kurve am Fuß der Treppe und über den Flur in die Küche zu befördern. Durch den Hintereingang, befiehlt die herrschsüchtige Schwester, außen um das Haus herum, nicht an den Gästen vorbei. Falls die Trauergemeinde diesen endgültigen Abschied überhaupt bemerkt, dann allenfalls in Form der Startgeräusche des langen Wagens vor dem Haus, der Singsang des Motors eine abschwellende Schwingung der Luft.
Dann ist Rachel fort, ein für alle Mal. Sie ist vor zwanzig Jahren als schwangere Braut hierhergekommen und hat diesen Ort ihr Lebtag nicht mehr verlassen, aber sie wird nie wieder zur Haustür hereinspazieren.
Im Haus ist eine gewisse unausgesprochene Furcht verflogen, auch wenn die Leute nicht recht wissen, weshalb, und es nur vereinzelt in Worte fassen. Dabei sind es in den meisten Fällen Worte, die die Furcht vertreiben: Soll ich dir noch eine Tasse Tee holen? Möchtest du vielleicht meine rusks probieren?
Es ist selbstredend Marina, die da spricht, sie ist geübt darin, ölige Phrasen auf allzu hoch schlagende Wogen zu gießen. Während sie mit ihrer Halskette spielt.
Nein, ich habe keinen Hunger.
Und das ist Manie, ihr sehr viel jüngerer Bruder, der in ihren Augen wie eine Eule aussieht, wie die Babyeule, die sie als kleines Mädchen einmal gefunden und aufgepäppelt hat.
Na komm, trink wenigstens ein Schlückchen Tee. Du bist ja völlig ausgetrocknet von der ganzen Heulerei.
Ach bitte bitte bitte, sagt er mit einer Vehemenz, die sich wie Wut anhört, dabei spricht er vielleicht gar nicht mit ihr.
Was ist aus der Eule geworden? Nichts Gutes, scheint die Erinnerung ihr zu sagen, aber hundertprozentig sicher ist sie sich da nicht.
Ich trinke nie wieder Tee, sagt er.
Ag was, sagt sie gereizt, red keinen Quatsch.
Sie begreift nicht, warum der Tod seiner Frau ihn so schwer getroffen hat, sie lag doch seit einem halben Jahr im Sterben, er hatte ewig Zeit, sich auf den heutigen Tag vorzubereiten. Aber Manie scheint sich regelrecht aufzulösen, wie der Saum seines Pullovers, sie hat ihn an dem Faden herumzupfen sehen.
Lass das, sagt sie. Zieh aus, das Ding, ich nähe es dir.
Stumm gehorcht er. Sie nimmt das Kleidungsstück entgegen und macht sich auf die Suche nach Nadel und Faden. Falls Rachel so etwas überhaupt im Haus hat. Hatte. Die stumme Korrektur ist wohltuend, wie das Einrasten eines steifen Gelenks. Von nun an ist Rachel buchstäblich Vergangenheit.
Manie zittert ohne seinen Pulli, dabei ist es ein warmer Frühlingstag. Ob er je wieder auftauen wird? Zu ihren Lebzeiten hat er Rachel nie so dringend gebraucht wie jetzt, und ihr Fehlen hinterlässt nichts als stählerne Kälte. Sie wusste genau, womit sie mich im Innersten treffen konnte, wo sie ihre kleinen Messer ansetzen musste. Hass und Liebe ließen sich manchmal nur schwer unterscheiden, so nahe standen wir uns. Zwei ineinander verschlungene Bäume mit schicksalhaft verwachsenen Wurzeln. Wer würde da nicht ausbrechen wollen? Aber nur Gott kann über mich richten, denn nur er weiß davon! Vergib mir, Herr, ich wollte sagen, Rachel, mein Fleisch ist schwächer als das der meisten anderen.
Schon wieder am Flennen. Marina sieht zu ihm hinüber. In einer Schublade hat sie tatsächlich Nähzeug gefunden und es sich in einer Ecke bequem gemacht, von wo aus sie das Geschehen im Auge behalten und sich zugleich in aller Öffentlichkeit nützlich machen kann. Nähen und backen, sie hat praktische Hände. Dennoch lenkt der Anblick ihres Mannes, der mit einem frischen Drink in der Hand an ihr vorbeigeht, sie so sehr ab, dass sie sich in den Finger sticht.
Und da, aus heiterem Himmel, fällt es ihr wieder ein, was aus der Eule geworden ist. Ag, shame. Die weißen Federn, blutverklebt.
Hey, ich sehe alles, ruft sie Ockie hinterher.
Doch der ist schon aus dem Zimmer, sein Schnurrbart schmeckt nach Brandy, und denkt: Halt’s Maul, was bildest du dir eigentlich ein? Er hat einen Moment lang vergessen, weshalb er hier ist, und fragt einen Mann im Wohnzimmer: Amüsieren Sie sich gut?
Was?, sagt der Mann.
Aber Ockie hat sich schon wieder gesammelt und wippt auf den Fersen. Nun ja, unter den gegebenen Umständen, sagt er.
Der Mann, mit dem er spricht, ist ein angehender Pfarrer der Niederländisch-reformierten Kirche. Er ist groß und schlank, mit ausgeprägtem Adamsapfel, dieser angehende Pfarrer, und hat, was niemand weiß, im Lauf des zurückliegenden Jahres seinen Glauben fast vollständig verloren. Er hat das Gefühl, durch eine dornige Wildnis zu taumeln, weshalb er ständig lächelt. Als Ockie das Wort an ihn richtet, lächelt er gerade in sich hinein, während er über ebendiese Frage nachsinnt, was es heißt, an nichts und niemanden mehr zu glauben, und schrickt schuldbewusst zusammen, als er angesprochen wird.
Amor kann die beiden sehen, ihren Onkel und den kleingläubigen Dominee, durch die gläserne Schiebetür im Wohnzimmer. Vom Gipfel des koppie kann sie die ganze Front des Hauses sehen, sämtliche Fenster, weswegen sie so gern hier sitzt, auch wenn sie das ohne Begleitung eigentlich nicht soll. Es war noch nie so voll im Erdgeschoss, zahllose Gestalten, die sich wie Puppen durch ein Puppenhaus bewegen. Doch nicht ihnen gilt ihr Augenmerk. Sondern einem Fenster im ersten Stock, dem dritten von links, und sie denkt: Sie ist da drin. Wenn ich jetzt den Hügel hinunterlaufe und die Treppe hinaufgehe, ist sie in ihrem Zimmer und wartet auf mich. Wie immer.
Und sie kann jemanden sehen, der sich durchs Zimmer bewegt. Eine Frau, die geschäftig hin und her läuft. Wenn sie die Augen halb schließt, kann Amor sich einreden, dass es tatsächlich ihre Mutter ist, ihr Körper ist wieder kräftig und gesund, und sie räumt die Medikamente von ihrem Nachttisch. Die braucht sie ja jetzt nicht mehr. Ma geht es wieder besser, die Zeit ist zurückgedreht, die Welt wieder heil. So einfach geht das.
Aber sie weiß, dass das nur Einbildung und die Person im Zimmer nicht ihre Ma ist. Es ist natürlich Salome, die schon seit immer und ewig hier auf der Farm ist, zumindest kommt es einem so vor. Mein Großvater hat immer gesagt: Ach, Salome, die hab ich beim Kauf gratis dazubekommen.
Aber schauen wir doch etwas näher hin, während sie das Bett abzieht. Eine stämmige, stabil gebaute Frau in einem aufgetragenen Kleid, das Ma ihr vor Jahren überlassen hat. Ein Kopftuch über das Haar gezogen. Sie ist barfuß, und ihre Fußsohlen sind rissig und schwarz vor Schmutz. Auch ihre Hände sind voller Narben, die Spuren und Hinterlassenschaften unzähliger Kollisionen. Angeblich genauso alt wie Ma, vierzig, sieht aber älter aus. Schwer zu schätzen. Ihr Gesicht verrät nicht viel, sie trägt ihr Leben wie eine Maske, wie ein Götzenbild.
Aber ein paar Dinge weiß man eben doch, weil man sie selbst gesehen hat. Ebenso teilnahmslos, wie Salome scheuert und schrubbt, das Haus in Ordnung hält und die Kleider der Leute wäscht, die darin wohnen, hat sie in der Schlussphase von deren Krankheit auch Ma gepflegt, hat sie an- und ausgezogen, mit heißem Wasser und einem lappie gesäubert, ihr beim Toilettengang geholfen, ja hat ihr sogar den Arsch abgeputzt, nachdem sie die Bettpfanne benutzt hatte, Blut und Scheiße und Eiter und Pisse aufgewischt, all die Arbeiten erledigt, die ihre eigenen Verwandten nicht erledigen wollten, zu eklig oder zu intim: Soll Salome das machen, dafür wird sie schließlich bezahlt. Sie war bei Ma, als sie gestorben ist, saß gleich da an ihrem Bett, obwohl niemand sie zu sehen scheint, sie ist offenkundig unsichtbar. Und auch was Salome empfindet, ist unsichtbar. Sie hat gesagt bekommen: Räum auf, wasch das Bettzeug, und sie gehorcht, sie räumt auf, sie wäscht das Bettzeug.
Aber Amor kann sie durchs Fenster sehen, also ist sie wohl doch nicht unsichtbar. Ihr kommt eine Erinnerung, die sie erst jetzt richtig begreift, an einen Nachmittag vor kaum zwei Wochen, in demselben Zimmer, mit Ma und Pa. Sie hatten völlig vergessen, dass ich da saß, in der Ecke. Sie sahen mich nicht, ich war wie eine Schwarze für sie.
(Versprichst du es mir, Manie?
Sie klammert sich fest, streckt ihre Skeletthände nach ihm, wie im Horrorfilm.
Ja, ist gut.
Ich will, dass sie etwas bekommt. Nach allem, was sie für mich getan hat.
Verstehe, sagt er.
Versprich es mir. Sag es.
Ich versprech’s, sagt Pa mit erstickter Stimme.)
Sie hat das Bild immer noch vor Augen, ihre Eltern ineinander verschlungen wie Jesus und seine Mutter, zu einem schrecklichen, traurigen Knoten aus Jammer und Tränen. Ihre Stimmen hoch droben und weit weg, und so kommen die Worte jetzt erst bei ihr an. Doch endlich versteht sie, über wen sie gesprochen haben. Natürlich. Logisch. Dumme Nuss.
Sie sitzt an ihrem Lieblingsplatz, zwischen den Steinen, am Fuß des verbrannten Baumes. Wo ich saß, als der Blitz einschlug, wo ich fast gestorben wäre. Peng, fiel weißes Feuer vom Himmel. Als hätte Gott mit dem Finger auf dich gezeigt, sagt Pa, aber woher will er das wissen, er war ja nicht dabei. Der Zorn des Herrn ist wie eine Flamme der Rache. Nur bin ich nicht verbrannt, nicht wie der Baum. Bloß meine Füße.
Zwei Monate Krankenhaus, zur Genesung. Ihre Sohlen sind immer noch empfindlich, und ein kleiner Zeh fehlt. Sie berührt die Stelle, betastet die Narbe. Eines Tages, sagt sie laut. Eines Tages werde ich … Aber der Gedanke bricht mittendrin ab, und was sie eines Tages tun wird, hängt in der Luft, unausgesprochen.
Jetzt steigt jemand von der anderen Seite den Hügel hinauf. Eine menschliche Gestalt kommt näher, gewinnt langsam Kontur, Alter, Hautfarbe und Geschlecht, streift eines nach dem anderen über wie Kleidungsstücke, bis sie schließlich einen schwarzen Jungen vor sich sieht, dreizehn Jahre alt wie sie, in zerfetzten Hosen und löchrigem T-Shirt, mit kaputten takkies an den Füßen.
Der Stoff klebt an seiner schweißnassen Haut. Er zupft ihn mit den Fingern los.
Hallo, Lukas, sagt sie.
Na, Amor, howzit. Wie läuft’s?
Erst muss er mit seinem Stock einmal auf die Erde schlagen. Dann setzt er sich auf einen Stein. Nicht das erste Mal, dass sie sich hier oben begegnen. Kinder, die bald keine Kinder mehr sein werden.
Das mit deiner Mommy tut mir leid, sagt er.
Fast fängt sie schon wieder an zu weinen, tut es dann aber doch nicht. Wenn er das Wort sagt, geht es in Ordnung, denn Lukas’ Vater ist auch tot, verunglückt in einer Goldmine bei Johannesburg, als Lukas noch ganz klein war. Irgendetwas verbindet die beiden. Die Erinnerung von vorhin sprudelt beinahe aus ihr heraus, sie muss ihm unbedingt davon erzählen.
Es gehört jetzt euch, das Haus, sagt sie.
Er sieht sie an, verständnislos.
Meine Mutter hat meinem Vater das Versprechen abgenommen, es deiner Mutter zu schenken. Und ein Christ steht zu seinem Wort.
Er blickt den Hügel hinab zur anderen Seite, wo er wohnt, in dem windschiefen kleinen Haus. Das Lombard-Haus, wie es alle nennen, dabei ist die alte Mrs. Lombard schon vor Jahren gestorben, lange bevor Amors Großvater es gekauft hat, damit diese indische Familie nicht dort einziehen konnte, und stattdessen Salome darin hat wohnen lassen. Manche Namen bleiben hängen, andere nicht.
Unser Haus?
Es gehört jetzt euch.
Er blinzelt, nach wie vor verwirrt. Es war immer schon ihr Haus. Er ist dort geboren, er schläft dort, wovon redet das weiße Mädchen? Gelangweilt spuckt er auf die Erde und steht auf. Sie sieht, wie lang und kräftig seine Beine geworden sind, die drahtigen Haare an seinen Schenkeln. Riechen kann sie ihn auch, den Gestank von Schweiß. All das ist neu, aber vielleicht sieht sie ihn auch nur neu, mit frischen Augen, und schon schämt sie sich, noch bevor sie merkt, dass er sie anstarrt.
Was?, sagt sie und beugt sich vor, die Arme auf den Knien.
Nichts.
Er springt auf ihren Stein, hockt sich neben sie. Sein nacktes Bein dicht an ihrem, sie spürt die Wärme und die piksenden Haare, zieht das Knie weg.
Argh, macht sie. Wäschst du dich eigentlich nie?
Eilig steht er auf und springt auf den anderen Stein zurück. Jetzt tut es ihr leid, dass sie ihn verjagt hat, aber sie weiß nicht, was sie sagen soll. Er hebt seinen Stock auf und schlägt damit ein paarmal auf den Boden.
Na denn, sagt er.
Okay.
Er geht den Hügel wieder hinunter, denselben Weg, den er gekommen ist, drischt mit dem Stock auf die weißen Gräserspitzen ein, bohrt ihn in Termitenhügel. Beweist der Welt, dass es ihn gibt.
Sie sieht ihm nach, bis er verschwindet, und ist erleichtert, weil das große schwarze Auto weg ist und auch die große Schwermut, die auf ihr gelastet hat. Dann wandert sie die andere Seite des koppie hinunter, bleibt hier und da stehen, um einen Stein oder ein Blatt zu betrachten, hinunter zu ihrem Haus oder, besser, dem Haus, das sie für das ihre hält. Als sie zur Hintertür hereinkommt, sind hundertdreiunddreißig Minuten und zweiundzwanzig Sekunden vergangen, seit sie weggelaufen ist. Vier Autos, darunter auch das lange schwarze, sind verschwunden, dafür ist ein neues hinzugekommen. Das Telefon hat achtzehn Mal geklingelt, die Türglocke zweimal, einmal weil jemand Blumen geschickt hat, die tatsächlich den Weg hierher gefunden haben. Zweiundzwanzig Tassen Tee, sechs Becher Kaffee, drei Gläser Erfrischungsgetränke und sechs Brandy-Cola wurden getrunken. Die Toiletten im Erdgeschoss, die ein solches Verkehrsaufkommen nicht gewohnt sind, wurden insgesamt siebenundzwanzig Mal benutzt und haben im Zuge dessen neun Komma acht Liter Urin, fünf Komma zwei Liter Scheiße, den erbrochenen Inhalt eines Magens und fünf Milliliter Sperma abgeführt. Zahlen über Zahlen über Zahlen, aber was soll die ganze Rechnerei? In jedem Menschenleben gibt es von allem nur eins.
Als sie in die Küche schleicht, hört sie leises Stimmengewirr, obwohl es in diesem Teil des Hauses still ist. Sie steigt die Treppe in den ersten Stock hinauf. Den Flur entlang zu ihrem Zimmer. Auf dem Weg dorthin muss sie an der Tür von Mas Zimmer vorbei, das jetzt leer ist, weil Salome das Bettzeug wäscht, und obwohl sie weiß, dass, was nicht passiert ist, hier passiert ist, muss sie, wie unter Zwang, hineingehen.
Kleines Mädchen betrachtet die Sachen seiner Mutter. Sie kennt alles in- und auswendig, sie weiß, wie viele Schritte es sind von der Tür bis zum Bett, wo sich der Lichtschalter befindet, das orangefarbene Wirbelmuster des Teppichs wie ein einsetzender Kopfschmerz etc. pp. Aus den Augenwinkeln glaubt sie, Mas Gesicht im Spiegel erkennen zu können, doch als sie hinsieht, ist es nicht mehr da. Stattdessen kann sie ihre Mutter riechen oder ein Geruchsgemisch, das sie sich als ihre Mutter denkt, dabei handelt es sich in Wirklichkeit um Spuren jüngerer Ereignisse, darunter Kotze, Räucherwerk, Blut, Parfüm und eine dunkle Basisnote, vielleicht der Geruch der Krankheit selbst. Von den Wänden ausgeatmet, hängt er in der Luft.
Sie ist nicht mehr da.
Die Stimme ihrer Schwester Astrid, die sie irgendwie geortet hat und ihr gefolgt ist.
Sie haben sie mitgenommen.
Ich weiß. Ich hab’s gesehen.
Das Bett ist abgezogen, und auf der nackten Matratze prangt ein undefinierbarer Fleck. Beide starren auf den tiefroten dunklen Umriss, als handele es sich um die Karte eines neuen Kontinents, faszinierend und furchteinflößend.
Ich war bei ihr, als sie gestorben ist, sagt Astrid schließlich, und ihre Stimme bebt, weil sie die Unwahrheit sagt. Sie war nicht bei ihrer Mutter, als die gestorben ist. Sie war hinter den Ställen und hat sich mit Dean de Wet unterhalten, dem Jungen aus Rustenburg, der manchmal auf der Farm aushilft und die Ställe ausmistet. Deans Vater ist vor ein paar Jahren gestorben, und er hat Astrid in der Sterbephase ihrer Mutter begleitet. Er ist ein einfacher, aufrichtiger Junge, und sie genießt sein Interesse, Teil einer größeren männlichen Aufmerksamkeit, für die sie zunehmend empfänglich wird. Und so waren die einzigen beiden Personen, die an Rachel Swarts Bett wachten, als deren Zeit gekommen war, ihr Ehemann alias Pa oder Manie und die kleine Schwarze, wie heißt sie noch gleich, Salome, die aber, logischerweise, nicht zählt.
Ich hätte dabei sein sollen. Denkt Astrid. Dass sie stattdessen mit Dean geflirtet hat, verstärkt ihre Schuldgefühle noch. Sie glaubt, zu Unrecht, dass ihre jüngere Schwester die Wahrheit über sie weiß. Nicht nur diese Wahrheit, auch andere. Zum Beispiel, dass sie vor einer halben Stunde ihr Mittagessen erbrochen hat, wie sie es regelmäßig tut, um schlank zu bleiben. Sie neigt zu paranoiden Ängsten wie diesen und hat bisweilen den Verdacht, dass die Menschen um sie herum heimlich ihre Gedanken lesen oder dass das Leben eine raffinierte Inszenierung ist, in der alle anderen eine Rolle spielen und nur sie nicht. Astrid ist ein ängstlicher Mensch. Sie hat unter anderem Angst vor der Dunkelheit, vor Armut, vor Gewittern, vor dem Dickwerden, vor Erdbeben, Flutwellen, Krokodilen, vor den Schwarzen, vor der Zukunft, vor der Auflösung der geordneten Strukturen der Gesellschaft. Davor, nicht geliebt zu werden. Davor, dass es vielleicht schon immer so gewesen ist.
Aber jetzt weint Amor wieder, weil Astrid dieses Wort gesagt hat, als ob es eine Tatsache wäre, und das ist es nicht, das ist es nicht, auch wenn das Haus voller Menschen ist, die hier eigentlich nichts zu suchen haben und sie sonst auch nicht besuchen kommen, jedenfalls nicht alle auf einmal.
Wir sollten uns fertig machen, sagt Astrid ungeduldig. Du musst unbedingt raus aus dieser Uniform.
Fertig machen wofür?
Astrid hat darauf keine Antwort, und das ärgert sie.
Wo warst du denn? Alle haben dich gesucht.
Auf dem koppie.
Du weißt doch, dass du da nicht allein raufgehen darfst. Und was machst du hier drin? In ihrem Zimmer?
Ich habe mich nur umgesehen.
Wonach?
Ich weiß nicht.
Das ist die Wahrheit, sie weiß es nicht, sie hat sich nur ein wenig umgesehen, weiter nichts.
Zieh dich um, versucht Astrid es im Befehlston der Erwachsenen, jetzt, wo eine Stelle frei geworden ist.
Ich lasse mich doch von dir nicht herumkommandieren, sagt Amor, geht aber trotzdem, nur um Astrid zu entkommen, die sich, kaum dass sie allein im Zimmer ist, das Armband schnappt, das sie auf dem Nachttisch hat liegen sehen, eine hübsche kleine Kette aus blauen und weißen Perlen. Sie hat es an ihrer Mutter gesehen und zur Probe schon einmal angelegt. Jetzt streift sie es von Neuem über ihr Handgelenk, spürt, wie es sich ihrem Puls anpasst. Sie kommt mit sich überein, dass es schon immer ihr gehört hat.
Ich bin nicht schön. Denkt Amor, nicht zum ersten Mal, als sie sich im Spiegel hinter ihrer Schranktür betrachtet. Sie trägt nur noch ihre Unterwäsche, zu der auch ein kleiner, erst kürzlich erworbener BH gehört, das Gefühl von knospendem Fleisch ist noch neu und verwirrend. Ihre Hüften sind breiter geworden, und dieses Mehr erscheint ihr zu viel, übertrieben, obszön. Sie verabscheut ihren Bauch und ihre Schenkel, ebenso wie ihre hängenden Schultern. Sie verabscheut ihren ganzen Körper, wie so viele von euch, und zwar mit typisch jugendlichem Furor, und der scheint heute noch unbändiger als sonst, noch intensiver.
In solchen Momenten der Selbstbesinnung liegt eine hellsichtige Spannung in der Luft. In letzter Zeit ist es ein paarmal vorgekommen, dass sie wusste, nur eine Millisekunde im Voraus, dass ein Bild von der Wand fallen, ein Fenster auffliegen, ein Bleistift über den Schreibtisch rollen würde. Heute schaut sie an ihrem Spiegelbild vorbei, in der sicheren Gewissheit, dass sich der flammgeschwärzte Schildkrötenpanzer, der auf dem Nachttisch liegt, gleich in die Luft erheben wird. Sie sieht zu, wie er sich erhebt. Als würde sie ihn mit Blicken tragen, beobachtet sie, wie er sich in aller Ruhe zur Zimmermitte hin bewegt. Dann lässt sie ihn fallen, oder wirft ihn vielleicht sogar zu Boden, denn er schlägt ziemlich hart auf und bricht entzwei.
Der Schildkrötenpanzer ist oder vielmehr war einer der ganz wenigen Gegenstände, die sie gesammelt, draußen im Veld aufgesammelt hat. Ein seltsam geformter Stein, ein winziger Mangustenschädel, eine lange weiße Feder. Davon abgesehen ist das Zimmer bar der sonst üblichen Gegenstände und Anhaltspunkte, es ist weiter nichts darin als das schmale Bett mit seiner Decke, der Nachttisch mit der Lampe, der Schrank und die Kommode, der Holzfußboden ohne Teppich oder sonstigen Belag. Auch die Wände sind kahl. Wenn das Mädchen sich nicht darin aufhält, ist das Zimmer wie ein leeres Blatt, fast keine Spuren oder Anhaltspunkte, die etwas über sie aussagen, was vielleicht doch etwas über sie aussagt.
Als sie wenig später die Treppe hinuntersteigt, hält sie ein Stück des Schildkrötenpanzers in der Hand. Es ist noch immer alles voller Leute, und sie richtet den Blick starr geradeaus und geht auf die Gestalt ihres Vaters zu, der noch immer zusammengesunken in seinem Sessel sitzt.
Wo warst du?, sagt Pa. Wir haben uns schreckliche Sorgen gemacht.
Auf dem koppie.
Amor. Du weißt doch genau, dass du da nicht allein raufsteigen sollst. Was machst du eigentlich immer da oben?
Ich wollte sie nicht sehen. Da bin ich weggelaufen.
Was hast du denn da in der Hand?
Sie reicht ihm die knorrige Panzerscherbe, kann sich in ihrem benommenen Zustand aber nicht recht entsinnen, worum es sich eigentlich handelt oder woher die Scherbe kommt. Sieht aus wie ein riesiger alter Zehennagel, ist ja widerlich, igitt. Das hat sie da draußen gefunden. Sie hat ja ständig irgendwelchen ekligen Krimskrams aus der Natur angeschleppt. Fast wirft er ihn weg, aber der Impuls vergeht, und er hält ihn wie sie, in der schlaffen Hand.
Komm her.
Mit einem Mal ist er von einer großen Zärtlichkeit für sie erfüllt, tiefgehend und sentimental zugleich. So wehrlos, ein schlichtes Gemüt. Mein Kind, mein kleines Kind. Er zieht sie an sich, und plötzlich werden sie zurückkatapultiert in einen ähnlichen Moment vor sieben Jahren, in das blendende Weiß kurz nach dem Blitzeinschlag, die traumähnlichen, halb wachen Nachwehen des Unfalls. Ich trage Amor den koppie hinunter. Rette sie. Rette sie, Herr, und ich werde auf immer dein sein. Für Manie war es wie Moses’ Abstieg vom Berg Sinai, es war der Nachmittag, an dem der Heilige Geist ihn berührte und sein Leben veränderte. Amor hat ihn anders in Erinnerung, als den Geruch von verbranntem Fleisch, wie beim braaivleis, beim Grillen, Opfergestank im Mittelpunkt der Welt.
Der koppie. Lukas. Das Gespräch. Deshalb ist sie heruntergekommen, um darüber mit ihm zu sprechen, und sie macht sich los und stößt ihn von sich und mit ihm den Geruch von Schweiß und Trauer und Deospray der Marke Brut.
Du wirst dein Versprechen halten, sagt sie. Keiner von beiden weiß so recht, ob es eine Aussage oder eine Frage ist.
Welches Versprechen?
Du weißt schon. Worum Ma dich gebeten hat.
Pa ist müde, wie ein Sack, aus dem der Sand rinnt. Ja, sagt er vage, wenn ich einmal ein Versprechen gegeben habe, halte ich es auch.
Sicher?
Wenn ich’s dir doch sage. Er zieht ein Taschentuch aus der Jackentasche und schnäuzt sich die Nase, dann schaut er hinein und nimmt das Resultat in Augenschein. Steckt es wieder ein. Worum geht es hier eigentlich?, sagt er.
(Salomes Haus.) Aber auch Amor schwinden die Kräfte, und sie sinkt abermals an seine Brust. Sie sagt etwas, doch er versteht kein Wort.
Was hast du gesagt?
Ich will nicht zurück ins Internat. Da ist es schrecklich.
Er denkt darüber nach. Du musst nicht zurück ins Internat, sagt er. Das war nur vorübergehend, solange Ma … solange Ma krank war.
Dann muss ich nicht zurück?
Nein.
Nie mehr?
Nie mehr. Versprochen.
Jetzt fühlt sie sich versunken und weit weg, wie in einer heißen, stillen, unterirdischen Höhle. Unstet ist das Herz. Der Nachmittag steuert auf sein langes blassgelbes Ende zu. Meine Mutter ist heute Morgen gestorben. Bald wird es morgen sein.
Manie wird ihrer Anhänglichkeit überdrüssig und muss den unschönen Drang bezwingen, sie von sich zu stoßen. Er hat sich von Anfang an gefragt, ohne konkreten Grund, ob Amor tatsächlich sein Kind ist. Sie war ein Nachzügler, nicht geplant, gezeugt in der schwierigsten Phase seiner Ehe, auf halber Strecke, als er und seine Frau anfingen, getrennt zu schlafen. Es war nicht mehr viel Liebe im Spiel, und doch fiel Amors Geburt genau in diese Zeit.
Aber wo auch immer sie herkommt, sie ist ohne Zweifel Teil des himmlischen Plans. Fest steht, dass er durch sie bekehrt worden ist, dass er sich dem Heiligen Geist erst öffnen konnte, als der Herr sie ihnen fast genommen hätte. Bald darauf, in einem Moment tiefen Gebets, hatte er verstanden, was er tun musste, um sich zu läutern. Er, Herman Albertus Swart, musste seiner Frau seine Verfehlungen beichten und sie um Vergebung bitten, und so hatte er Rachel alles erzählt, auch die Sache mit dem Glücksspiel und den Prostituierten, er hatte sich nackt und bloß gemacht, doch statt aufzuklaren, hatte der Himmel ihrer Ehe sich verdüstert, statt ihm zu verzeihen, hatte sie den Stab über ihn gebrochen und ihn für ungenügend befunden, statt ihm ins Tal des Lichts zu folgen, hatte sie sich in die andere Richtung gewandt, zurück zu ihrem eigenen Volk. Die Wege des Herrn sind uns auf ewig unergründlich!
Er dreht sich im Sessel um und nimmt Amors Gesicht in beide Hände, wendet es zu sich, betrachtet ihre Züge, sucht nach einem Zeichen, das nur von seinem Leib, aus seinen Zellen stammen kann. Er tut das nicht zum ersten Mal. Sie starrt ihn aus ihren dunklen Sternenaugen an, erschrocken.
Er will vermutlich gerade etwas zu ihr sagen, wird durch Dominee Simmers jedoch, zum Glück, daran gehindert. Der brave Pastor ist schon fast den ganzen Tag hier, um einem wichtigen Mitglied seiner Gemeinde mit Gebet und Rat zur Seite zu stehen. In den Jahren der Suche und des Strebens, seit Manie vom Feuer Gottes berührt ward und sich endlich der Wahrheit zuwandte, war Alwyn Simmers stets sein Hirte und Begleiter. Die Strenge seiner Kirche ist der Stecken und Stab, die mich aufrecht halten.