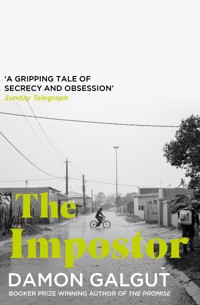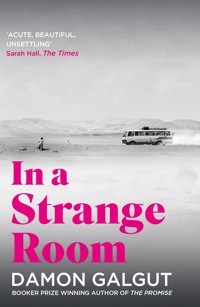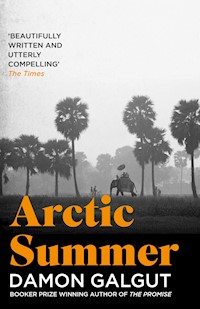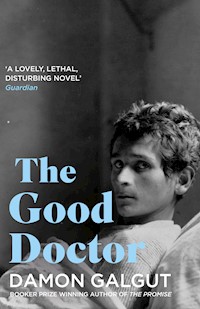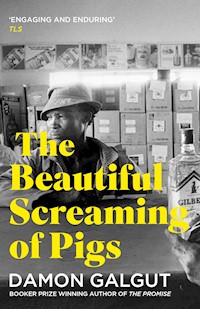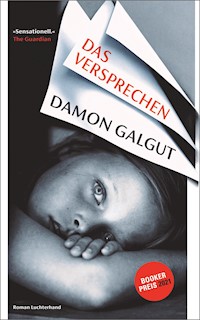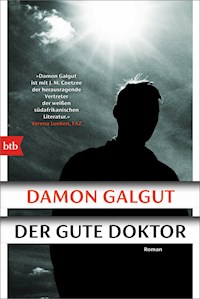
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Booker-Preisträger 2021 Damon Galgut (»Das Versprechen«) erzählt eine intensive Geschichte über eine Freundschaft, die von Verrat überschattet wird. Ein großer Roman über die Hoffnungen und Enttäuschungen Südafrikas nach der Apartheid. »Damon Galgut ist die starke, frische Stimme der südafrikanischen Literatur.« The Observer
In einem halb verlassenen Krankenhaus tief in den ehemaligen Homelands von Südafrika fristet Frank Eloff ein ereignisloses Dasein. Als der junge Arzt Laurence Waters auftaucht, um hier sein freiwilliges Jahr zu absolvieren, begegnet ihm Frank sofort mit Misstrauen. Laurence ist das komplette Gegenteil von Frank: jung, optimistisch und beseelt von einem naiven Idealismus, der nie an der Realität getestet wurde. Er erkennt nicht, dass an diesem gottverlassenen Ort unter der friedlichen Oberfläche tödliche Spannungen brodeln – und beschwört eine Katastrophe herauf …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 332
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Zum Buch
Booker-Preisträger Damon Galgut erzählt eine intensive Geschichte über eine Freundschaft, die von Verrat überschattet wird. Ein großer Roman über die Hoffnungen und Enttäuschungen Südafrikas nach der Apartheid.
In einem halb verlassenen Krankenhaus tief in den ehemaligen Homelands von Südafrika fristet Frank Eloff ein ereignisloses Dasein. Als der junge Arzt Laurence Waters auftaucht, um hier sein freiwilliges Jahr zu absolvieren, begegnet ihm Frank sofort mit Misstrauen. Laurence ist das komplette Gegenteil von Frank: jung, optimistisch und beseelt von einem naiven Idealismus, der nie in der Realität getestet wurde. Er erkennt nicht, dass an diesem gottverlassenen Ort unter der friedlichen Oberfläche tödliche Spannungen brodeln – und beschwört eine Katastrophe herauf …
»Damon Galgut ist die starke, frische Stimme der südafrikanischen Literatur.« The Observer
Zum Autor
DAMON GALGUT, 1963 in Pretoria geboren, zählt zu den renommiertesten Autoren Südafrikas. Sein jüngster Roman »Das Versprechen« wurde mit dem Booker Prize 2021 ausgezeichnet, einem der bedeutendsten internationalen Literaturpreise. Bereits zwei Mal stand Galgut mit »Der gute Doktor« (2005) und »In fremden Räumen« (2010) auf der Shortlist für diesen Preis. Auch seine Romane »Der Betrüger« und »Arktischer Sommer« wurden für zahlreiche Literaturpreise nominiert. Sein literarisches Werk erscheint in sechzehn Sprachen. Damon Galgut lebt in Kapstadt.
Damon Galgut
Der gute Doktor
Roman
Aus dem südafrikanischen Englisch von Thomas Mohr
Die Originalausgabe erschien 2003 unter dem Titel »The Good Doctor« bei Atlantic Books Ltd., London.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Neuausgabe August 2022
Copyright © der Originalausgabe 2003 Damon Galgut
Copyright © der deutschen Ausgabe 2022 btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Zuerst erschienen im Wilhelm Goldmann Verlag, München 2005
Coverdesign: Buxdesign | Ruth Botzenhardt unter Verwendung eines Motivs von © plainpicture/Bildhuset/Johan Strindberg
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
Alle Rechte vorbehalten.
ISBN 978-3-641-29888-3V001
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag
Hunderte von Werst öder, eintöniger, verbrannter Steppe können einen nicht so in Trübsinn stürzen wie ein Mensch, der dasitzt, redet, und niemand weiß, wann er geht.
ANTONTSCHECHOW
ANMERKUNG DES AUTORS
Die Homelands Südafrikas waren verarmte und unterentwickelte Landstriche, die das Apartheidregime den verschiedenen schwarzen »Nationen« zur »Selbstbestimmung« überließ.
1
ALSICHIHNDASERSTEMal sah, dachte ich: Der macht’s nicht lange.
Ich saß spätnachmittags im Ärztezimmer, da stand er plötzlich in der Tür. Er hatte eine Reisetasche in der Hand und trug leger Jeans und ein braunes Hemd unter seinem weißen Kittel. Er wirkte jung, verloren und leicht verwirrt, aber das war nicht der Grund, weshalb mir dieser Gedanke kam. Es lag an etwas anderem, und es stand ihm förmlich ins Gesicht geschrieben.
»Hallo …?«, sagte er. »Ist das hier das Krankenhaus ?«
Seine Stimme war erstaunlich tief für einen so großen, dünnen Mann.
»Kommen Sie rein«, sagte ich. »Stellen Sie Ihre Tasche ab.«
Er kam herein, doch statt die Tasche abzustellen, presste er sie an sich und betrachtete die rosa Wände, die leeren Stühle, den staubbedeckten Schreibtisch in der Ecke und die welken Topfpflanzen, die ihre Köpfe hängen ließen. Er glaubte wohl, es müsse sich um einen Irrtum handeln. Er tat mir leid.
»Ich bin Frank Eloff«, sagte ich.
»Laurence Waters.«
»Ich weiß.«
»Ach ja …?«
Es schien ihn zu erstaunen, dass er erwartet wurde, dabei schickte er schon seit Tagen Faxe, die seine Ankunft avisierten.
»Wir teilen uns ein Zimmer«, erklärte ich ihm. »Ich zeige es Ihnen.«
Das Zimmer lag in einem anderen Flügel. Wir mussten die Grünfläche gleich neben dem Parkplatz überqueren. Obwohl er denselben Weg gekommen sein musste, betrachtete er den Pfad durch das hohe Gras und die zerzausten Bäume, die schwer an ihren Blättern trugen, als sähe er sie zum ersten Mal.
Wir gingen den langen Flur entlang zum Zimmer. Bis heute hatte ich allein darin gewohnt. Zwei Betten, ein Schrank, ein kleiner Teppich, ein Druck als Wandschmuck, ein Spiegel, ein grünes Sofa, ein niedriger Couchtisch aus Furnierholz, eine Lampe. Die Standardeinrichtung. Die wenigen bewohnten Zimmer sahen alle gleich aus, wie in einem tristen, trostlosen Hotel. Allein im Arrangement der Möbelstücke zeigte sich eine Spur Individualität, obgleich ich mir bis vor zwei Tagen, als das andere Bett hinzugekommen war, nicht die Mühe gemacht hatte, etwas umzustellen. Ich hatte auch nichts hinzugefügt. Das schäbige, schmucklose Mobiliar war völlig unpersönlich. Vor diesem neutralen Hintergrund hätte selbst eine Tischdecke verräterisch gewirkt.
»Sie schlafen da drüben«, sagte ich. »Im Schrank ist noch Platz. Hier ist das Bad.«
»Hmm. Ja. Ist gut.« Doch seine Tasche stellte er immer noch nicht ab.
Ich hatte erst vor zwei Wochen erfahren, dass ich mein Zimmer mit ihm teilen musste. Dr. Ngema hatte mich zu sich zitiert. Ich war zwar nicht sonderlich erfreut, sagte aber auch nicht Nein. Und freundete mich, zu meinem größten Erstaunen, im Lauf der Zeit mit dem Gedanken an. Es war vielleicht doch gar nicht so schlecht. Ein bisschen Gesellschaft konnte weiß Gott nicht schaden, und gesetzt den Fall, wir kamen miteinander aus, würde sich mein Leben dadurch eventuell auf angenehme Weise ändern. Und so sah ich seiner Ankunft mit Vorfreude und Neugierde entgegen. Um ihm das Gefühl zu geben, willkommen zu sein, schob ich das neue Bett unters Fenster und bezog es frisch. Ich räumte ein paar Schrankfächer leer. Ich fegte und putzte, was ich sonst nur selten tat.
Aber jetzt, wo er hier stand, erkannte ich an seinem Blick, dass meine Bemühungen fruchtlos geblieben waren. Das Zimmer war hässlich und kahl. Und Laurence Waters sah ganz anders aus als das Bild, das ich mir von ihm gemacht hatte. Ich weiß nicht, was ich mir vorgestellt hatte, aber gewiss nicht diesen unscheinbaren, beigehäutigen jungen Mann, fast noch ein Kind, der endlich seine Tasche abstellte.
Er nahm seine Brille ab und polierte sie mit seinem Ärmel. Dann setzte er sie wieder auf und sagte müde: »Ich verstehe das nicht.«
»Was ?«
»Das alles hier.«
»Das Krankenhaus ?«
»Nicht nur das Krankenhaus. Ich meine …« Er machte eine weit ausholende Bewegung. Er meinte die Stadt draußen vor den Mauern rings um das Krankenhaus.
»Sie wollten doch unbedingt hierher.«
»Aber da wusste ich noch nicht, wie es hier ist. Warum ?«, fragte er mit jähem Nachdruck. »Ich verstehe das nicht.«
»Darüber reden wir später. Ich bin im Dienst, ich muss wieder an die Arbeit.«
»Und ich muss Dr. Ngema sprechen«, entgegnete er schroff. »Sie erwartet mich.«
»Machen Sie sich deswegen mal keine Sorgen. Das hat Zeit bis morgen früh. Nur keine Eile.«
»Und was soll ich jetzt tun ?«
»Was Sie wollen. Auspacken, sich einrichten. Sie können natürlich auch mitkommen und mir Gesellschaft leisten. Ich habe in zwei Stunden Dienstschluss.«
Ich ließ ihn allein und ging zurück ins Ärztezimmer. Er war bestürzt und niedergeschlagen. Ich konnte das gut nachvollziehen. Mir war es ebenso ergangen, als ich hierhergekommen war. Man hatte bestimmte Erwartungen, und dann kam alles ganz anders.
Man erwartete ein modernes Krankenhaus – klein, aber fein, von reger Betriebsamkeit erfüllt – in einem belebten Ort in der Provinz. Dies war immerhin die Hauptstadt eines früheren Homelands, also erwartete man – ungeachtet der Moral der Politik, der sie ihren Aufstieg verdankte – Beamte, Händler, Menschen überall, ein einziges Kommen und Gehen. Wenn man von der Grenzstraße abbog und stattdessen eine der kleineren Zufahrtstraßen nahm, sah die Stadt, von weitem, eigentlich immer noch aus wie erwartet. Die Hauptstraße führte ins Zentrum, wo der Brunnen und die Statue standen, mit den Fensterfronten, Gehsteigen und Straßenlaternen und all den anderen Häusern und Gebäuden. Alles wirkte sauber, ordentlich und adrett. Hier ließ es sich aushalten.
Doch wenn man schließlich da war, sah man, wie es wirklich war, das erste Anzeichen nichts weiter als ein störendes Detail: ein Riss, der sich durch eine sonst makellose Mauer zog, oder die zerbrochenen Fensterscheiben eines Bürogebäudes. Oder der Umstand, dass der Brunnen trocken war und voller Sand. Und man hielt inne, schaute sich – erfüllt von einer dunklen Ahnung – um, und mit einem Mal stand einem alles klar vor Augen. Das Unkraut in den Fugen zwischen den Gehsteigplatten und Ziegelsteinen, das Gras, das hier und da die Fahrbahn überwucherte, die durchgebrannten Lampen und leer stehenden Ladenlokale hinter kahlen Schaufenstern, der Schimmel, die Feuchtigkeit, die blätternde Farbe, die Stockflecken überall, der schleichende Verfall von Bauten, hier im Kleinen, dort im Großen. Und plötzlich wusste man nicht mehr, wohin man geraten war.
Und nirgends gab es Menschen. Das fiel einem als Letztes auf, und plötzlich wurde einem klar, dass dies der eigentliche Grund war für das dumpfe, ungute Gefühl, das einen von Anfang an beschlichen hatte: Die Stadt war verlassen. Zwar rollte dann und wann ein Auto langsam eine Seitenstraße entlang, stand hier ein Uniformierter auf dem Gehsteig, krauchte da eine Gestalt über ein verwildertes Grundstück, aber im Großen und Ganzen war die Stadt verlassen. Unbewohnt. Keine Menschenmassen, kein Kommen und Gehen.
Eine Geisterstadt.
»Als ob hier etwas Schreckliches passiert wäre«, sagte Laurence. »So kommt es einem vor.«
»Ja, aber das stimmt nicht. Ganz im Gegenteil. Hier ist noch nie etwas passiert. Und hier wird auch nie etwas passieren. Genau da liegt das Problem.«
»Und warum …?«
»Warum was ?«
»Nichts. Bloß warum.«
Er wollte sagen: Warum gibt es sie dann überhaupt ? Und das war die eigentliche Frage. Diese Stadt war nicht auf natürlichem Wege und aus den üblichen Gründen entstanden, aus denen sich Menschen irgendwo ansiedeln, wie zum Beispiel ein Fluss in trockener Umgebung, eine Goldader oder ein historisches Ereignis. Diese Stadt war am Reißbrett entworfen worden, von bösen Bürokraten aus der Großstadt, die vermutlich niemals hier gewesen waren. Das ist unser Homeland, sagten sie, und zeichneten die Grenzen in eine Karte ein, und wo soll nun die Hauptstadt hin ? Warum nicht gleich hier in die Mitte ? Sie machten ein Kreuz mit rotem Filzstift, und alle waren hochzufrieden, schickten nach den Staatsarchitekten und beauftragten sie mit den Plänen für die neue Stadt.
Laurence Waters’ Verwirrung war also keineswegs ungewöhnlich. Ich kannte sie aus eigener Erfahrung. Und deshalb wusste ich auch, dass sie vorübergehen würde. In ein oder zwei Wochen würde sie anderen Gefühlen weichen: Verdrossenheit, zum Beispiel, oder Unmut, Zorn. Der sich früher oder später wiederum in Resignation verwandeln würde. Und nach zwei, drei Monaten würde Laurence, genau wie wir anderen, seine Strafe still erdulden und insgeheim Fluchtpläne schmieden.
»Aber wo sind sie alle ?«, fragte er, eher an die Decke als an mich gerichtet.
»Wer ?«
»Die Menschen.«
»Da draußen«, sagte ich. »Wo sie leben.«
Das war Stunden später, abends in meinem oder, besser, unserem Zimmer. Ich hatte eben das Licht ausgemacht und versuchte zu schlafen, als seine Stimme aus der Dunkelheit kam.
»Und warum leben sie da draußen ? Warum sind sie nicht hier ?«
»Was haben wir ihnen hier denn schon zu bieten ?«
»Alles. Auf der Fahrt hierher habe ich das Land gesehen. Da draußen gibt es nichts. Keine Hotels, keine Geschäfte, keine Restaurants, keine Kinos … Nichts.«
»Das brauchen sie alles nicht.«
»Und das Krankenhaus ? Brauchen sie das etwa auch nicht ?«
Ich stützte mich auf einen Ellbogen. Er rauchte eine Zigarette, die Spitze glomm bei jedem Zug rot auf. Er lag auf dem Rücken und starrte an die Decke.
»Laurence«, sagte ich. »Ich will Ihnen etwas verraten. Das hier ist kein Krankenhaus. Sondern ein Witz. Erinnern Sie sich an die letzte Stadt, durch die Sie auf der Fahrt hierhergekommen sind, eine knappe Stunde entfernt ? Da steht das richtige Krankenhaus. Da gehen die Leute hin, wenn sie krank sind. Und nicht hierher. Hier gibt es nichts. Hier sind Sie falsch.«
»Das glaube ich nicht.«
»Wenn ich es Ihnen sage.«
Die rote Glut hing einen Moment lang reglos in der Luft, glomm auf, erlosch, glomm auf, erlosch. »Aber die Menschen verletzen sich und werden krank. Brauchen sie denn keine Hilfe ?«
»Was, glauben Sie, bedeutet ihnen diese Stadt ? Hier hatte die Armee ihr Hauptquartier. Hier lebte ihr Marionettendiktator. Sie hassen diese Stadt.«
»Sie reden von Politik«, sagte er. »Aber das ist doch alles längst vorbei. Es spielt keine Rolle mehr.«
»Was vorbei ist, ist noch lange nicht vergessen.«
»Das ist mir egal. Ich bin Arzt.«
Ich lag da und beobachtete ihn eine Weile. Nach ein paar Minuten drückte er die Zigarette auf dem Fenstersims aus und warf die Kippe hinaus. Dann murmelte er ein oder zwei Wörter, die ich nicht verstand, gestikulierte, seufzte und war im Nu eingeschlafen. Die Spannung wich aus seinem Körper, und sein Atem ging regelmäßig.
Aber ich konnte nicht schlafen. Es war Jahre her, dass ich zuletzt mit einem anderen Menschen im selben Zimmer übernachtet hatte. Und ich dachte – absurderweise, denn er bedeutete mir nichts – an eine längst vergangene Zeit, als mir die Vorstellung, dass jemand im Dunkeln dicht neben mir schlief, Beruhigung und Trost gewesen war. Ich hatte mir nichts Schöneres vorstellen können. Und jetzt machte mich dieser andere atmende Körper hellhörig, nervös und irgendwie auch wütend, so dass es Stunden dauerte, bis die Müdigkeit mich übermannte und ich endlich die Augen schließen konnte.
2
WIRWARENLANGENURZUsiebt gewesen: Tehogo und das Küchenpersonal, Dr. Ngema, die Santanders und ich. Früher war das anders. Bei meiner Ankunft hatten noch eine indische Ärztin und ein Weißer aus Kapstadt hier gearbeitet. Die Frau ging kurz darauf fort, und der Mann heiratete und zog ins Ausland. Damals hatten wir auch vier oder fünf Pfleger und Schwestern, die inzwischen jedoch, mit Ausnahme Tehogos, allesamt versetzt oder entlassen worden waren. Für die wenigen Notfälle, die wir zu behandeln hatten, waren wir einfach zu viele. Wenn jemand uns verließ, wurde er nicht ersetzt; die dadurch entstandene Lücke wurde lediglich notdürftig geschlossen und gesichert, als Bastion gegen den endgültigen Zusammenbruch.
Insofern war es mir ein Rätsel, was Laurence bei uns wollte. Ich kam beim besten Willen nicht dahinter. Als Dr. Ngema mir erzählte, dass ein junger Arzt seinen Sozialdienst bei uns absolvieren werde, hielt ich das zunächst für einen Scherz. Ich hatte vom Sozialdienst – einem neuen staatlichen Programm zur personellen Aufstockung sämtlicher Krankenhäuser des Landes – gehört. Aber dafür waren wir eigentlich viel zu unbedeutend.
»Warum ?«, fragte ich. »Wir brauchen niemanden.«
»Ich weiß«, sagte sie. »Ich habe auch niemanden angefordert. Er wollte zu uns.«
»Im Ernst ? Aber warum ?«
»Keine Ahnung.« Sie starrte ratlos auf ein Fax, das sie bekommen hatte. »Uns bleibt nichts anderes übrig, Frank. Wir müssen ihn irgendwo unterbringen.«
»Na und ?«, entgegnete ich achselzuckend. »Das ist nicht mein Problem.«
Seufzend blickte Dr. Ngema auf. »Ich fürchte, doch«, sagte sie. »Ich muss ihn in Ihrem Zimmer einquartieren.«
»Was ?«
So etwas hatte es noch nie gegeben. Sie bemerkte meine bestürzte Miene.
»Es ist doch nur vorübergehend, Frank. Wenn die Santanders fortgehen, kann er ihr Zimmer haben.«
»Aber … es steht doch ein ganzes Stockwerk leer. Warum kann er denn nicht da einziehen ?«
»Weil die Zimmer nicht möbliert sind. Das Einzige, was ich zu bieten habe, ist ein Bett. Weder Tische noch Stühle … Und irgendwo muss er schließlich sitzen. Bitte, Frank. Es ist nicht schön, ich weiß. Aber einer muss in den sauren Apfel beißen.«
»Und warum ausgerechnet ich ?«
»Wer denn sonst, Frank ?«
Das war als rhetorische Frage gemeint. Aber es gab noch ein zweites Zimmer, am Ende des Flurs, über das sie hätte verfügen können.
»Tehogo«, sagte ich.
»Frank. Sie wissen doch, dass das nicht geht.«
»Warum nicht ?«
Sie rutschte auf ihrem Stuhl verlegen hin und her und erhob kaum merklich die Stimme. »Frank. Frank. Was soll ich denn machen ? Bitte. Ich lasse mir was einfallen, Ehrenwort. Aber ich kann ihn ja wohl schlecht auf die Straße setzen.«
»Das brauchen Sie ja auch nicht. Sie könnten sich das Zimmer doch teilen.«
»Aber … Tehogo ist kein Arzt, Sie schon. Und ich halte es für sinnvoller, wenn zwei Ärzte sich ein Zimmer teilen.«
Was sie eigentlich sagen wollte, blieb unausgesprochen. Es ging nämlich keineswegs darum, dass Laurence Waters und ich Ärzte waren. Es hatte vielmehr damit zu tun, dass wir beide weiß waren und deshalb zusammen in ein Zimmer gehörten.
Als der Wecker mich am nächsten Morgen aus dem Schlaf riss, saß Laurence bereits angezogen auf der Kante seines Bettes und rauchte eine Zigarette.
»Ich möchte Dr. Ngema sprechen«, sagte er ohne Umschweife.
»Die werden Sie schon noch früh genug kennen lernen. Keine Panik.«
»Ich gehe besser rüber in ihr Dienstzimmer. Sie brauchen mich nicht hinzubringen. Ich finde den Weg auch allein.«
»Es ist sechs Uhr morgens, sie ist noch nicht da. Nur die Ruhe, junger Mann, entspannen Sie sich. Warum gehen Sie nicht erst mal unter die Dusche ?«
»Ich habe schon geduscht.«
Der Badezimmerfußboden stand unter Wasser, er hatte sein nasses Badetuch über die Tür gehängt. Im Waschbecken klebten Bartstoppeln und Rasierschaum. Meine Laune sank, als ich hinter ihm aufräumte, und erreichte ihren Tiefpunkt, als ich die Tür aufmachte und feststellen musste, dass das Zimmer völlig verraucht war. Er lief ziellos auf und ab und paffte dabei nachdenklich vor sich hin. Als ich hustete, drückte er die Zigarette wie am Abend zuvor auf dem Fenstersims aus und warf die Kippe hinaus.
»Würden Sie das bitte lassen ? Das gibt ja überall Brandflecke.«
»Hier ist kein Aschenbecher. Ich habe überall nachgesehen.«
»Den müssen Sie sich schon selbst besorgen. Ich rauche nicht.«
»Eine ekelhafte Angewohnheit, ich weiß, ich sollte dringend aufhören.« Er blickte fieberhaft um sich und sank dann aufs Bett. »Sind Sie so weit ?«
»Ich bin noch nicht angezogen, Laurence. Warum hetzen Sie eigentlich so ? Es gibt wahrhaftig keinen Grund zur Eile.« »Ach nein ?«
Ich zog mich langsam an und beobachtete ihn. Er sah nur alle paar Sekunden zu mir herüber und wandte dann sofort wieder den Blick, gefesselt von irgendeinem nebensächlichen Detail, zumeist draußen vor dem Fenster. Er wirkte aus unerfindlichen Gründen zerstreut und angespannt, ein Zustand, der mir mit der Zeit immer vertrauter wurde, den ich an jenem ersten Tag jedoch als seltsam und beunruhigend empfand.
Schließlich war ich fertig. »Na schön«, sagte ich. »Gehen wir. Aber, Laurence … Ihr weißer Kittel. So etwas tragen wir hier eigentlich nicht.«
Er zögerte einen Augenblick, zog ihn aber nicht aus. Ich schloss ab, und wir gingen den Fußweg unter dem schweren Blätterbaldachin entlang, während das Licht ringsum greller wurde. Ich spürte, wie sehr es ihn zum Haupthaus, zu Dienst und Dienstzimmer drängte, doch ich führte ihn über einen Nebenweg zum Frühstücksraum. Der Speisesaal befand sich, wie auch die Küche und die inzwischen nahezu verlassenen Unterkünfte des Koch- und Reinigungspersonals, im dritten Gebäude des Krankenhauses. Eine Hälfte des langen Saales diente als Aufenthaltsraum, in der anderen stand ein großer, rechteckiger Tisch mit einer schmuddeligen Decke darauf.
Ich machte Laurence mit Jorge und Claudia Santander bekannt; sie starrten ihn entgeistert an.
»Sie sind … neu ?«, fragte Jorge.
»Ja, Sozialdienst. Ein Jahr.«
»Entschuldige«, sagte Claudia, »was für ein Dienst ?«
»Das ist ein staatliches Programm«, erklärte ich. »Alle frischgebackenen Ärzte müssen es absolvieren. Wenn sie ihre Ausbildung beendet haben.«
»Aha. Aha.« Trotzdem schauten sie ihn verblüfft an. Sie hatten viele gehen, aber noch nie jemanden kommen sehen.
Schweigen trat ein. Zwar hatte ich mich in Gegenwart der Santanders noch nie recht wohl gefühlt, doch Laurence, der während des gesamten Frühstücks zappelte und seinen Toast auf dem Teller hin und her schob, ohne ihn zu essen, machte alles noch viel schlimmer. Er versuchte halbherzig, ein Gespräch in Gang zu bringen, und dann sprach niemand mehr ein Wort. Nur noch das Klappern der Teller, das Klirren des Bestecks und das Gelächter aus der Küche waren zu hören, bis die Santanders schließlich aufstanden und gingen.
Er und ich blieben allein zurück und starrten zur anderen Hälfte des langen Saals, wo eine Tischtennisplatte, ein Schwarzweißfernseher und ein Regal mit alten Zeitschriften und Brettspielen standen.
Ich glaube, allmählich schwante ihm, wohin es ihn verschlagen hatte. Seine manische Ruhelosigkeit war mit einem Mal wie weggeblasen. Als er aufgegessen hatte, zündete er sich die nächste Zigarette an, doch statt daran zu ziehen, stierte er bloß in die Ferne, während der Rauch langsam zur Decke stieg.
Später gingen wir zusammen ins Haupthaus hinüber. Obwohl Claudia Santander Dienst hatte und eigentlich auch Tehogo hätte da sein müssen, war das Ärztezimmer leer. Wir tranken schweigend eine Tasse Kaffee und warteten auf Dr. Ngema. Ich hatte Jahre meines Lebens damit verbracht, hier zu sitzen und bittersaures Koffein zu schlürfen. Eine kaputte Uhr hing stumm an der Wand. Die Zeiger standen bis in alle Ewigkeit auf zehn vor drei. Die Dartscheibe an der Tür war das Einzige, was seit meiner Ankunft hinzugekommen war. Ich hatte sie eines Sonntags aus dem Aufenthaltsraum geholt, um mir ein paar öde Stunden zu vertreiben. Aber nachdem man mit dem Pfeil soundso oft auf die Scheibe geworfen hatte, verlor die Sache rasch ihren Reiz.
Dr. Ngema kam pünktlich um neun. Sie machte ihren täglichen Rundgang durch die Station. Das ließ sie sich nicht nehmen, selbst wenn wir – wie an den meisten Tagen – keinen einzigen Patienten hatten. Es gab immer etwas zu besprechen, und sei es noch so nebensächlich und belanglos, wie etwa Fragen zum Tagesablauf oder zum allgemeinen Procedere. Heute hatten wir zufällig gleich zwei Patienten.
In der Tür blieb sie stehen, und ihr Blick wanderte unwillkürlich zu Laurence’ blendend weißem Kittel. Er war aufgestanden und streckte ihr lächelnd die Hand hin.
»Ich bin Laurence Waters.«
Sie schüttelte ihm verwirrt die Hand. »Ach ja«, sagte sie, »richtig. Wann sind Sie angekommen ?«
»Gestern. Gestern Abend. Ich wollte mich Ihnen auch gleich vorstellen, aber Frank meinte …«
»Es war schon ziemlich spät«, fuhr ich dazwischen. »Deshalb habe ich ihm geraten, bis heute zu warten.«
»Ja«, sagte Dr. Ngema. »Ja.« Sie nickte energisch.
Schweigen. Laurence stand mit einem breiten, erwartungsfrohen Grinsen und glänzenden Augen da und brannte offenbar darauf, dass endlich etwas passierte. Alles andere – seine Ankunft, die Warterei, unsere Gespräche – war nur die Ouvertüre gewesen. Er hatte die Chefin kennen gelernt, und nun erwartete ihn ein sinnvolles Leben mit Rechten und Pflichten.
Doch Dr. Ngema sah sich stirnrunzelnd um. »Wo ist Tehogo ?«, fragte sie.
»Keine Ahnung. Noch nicht da.«
»Aha. Na, dann … Gehen wir ?«
Ich ging neben, Laurence hinter ihr. Unsere Schritte hallten gewichtig durch die leeren Räume. Beide Patienten lagen im ersten Krankensaal, der als einziger noch in Betrieb war. Er lag zwei Türen weiter auf demselben Flur. Der erste Raum, an dem man auf dem Weg dorthin vorbeikam, war die Chirurgie, wo sämtliche Untersuchungen und Operationen durchgeführt wurden. Sie war verschlossen. Die nächste Tür rechts führte in den Krankensaal. Er sah aus wie ein ganz normales Zimmer in einem ganz normalen Krankenhaus. Je eine Reihe Betten links und rechts, Vorhänge, fahles Neonlicht.
Wir versammelten uns um das Bett des ersten Patienten, eines jungen Mannes Anfang zwanzig, der illegal zu Fuß ins Land gekommen war. Da wir uns in Grenznähe befanden, bekamen wir solche Fälle häufiger herein: Menschen, die ohne Geld oder Nahrung weite Strecken zurückgelegt hatten. Der Grenzübertritt war gefährlich. Dieser junge Mann hatte es zwar geschafft, dabei aber einen schlimmen Sonnenbrand davongetragen. Er war völlig dehydriert, und seine Füße waren blutig. Er wurde intravenös versorgt und schien sich gut zu erholen. Er sprach kein Wort und starrte uns aus großen, angsterfüllten Augen an.
»Sein Blutdruck liegt bei hundertdreißig zu achtzig. Wann hat Tehogo sein Krankenblatt ausgefüllt ?«
»Keine Ahnung.«
»Er muss die Uhrzeit mit eintragen. Und zwar leserlich. Würden Sie ihm das bitte sagen ? Frank, er hat ein wenig erhöhte Temperatur. Aber er kann schon wieder Wasser lassen. Was schlagen Sie vor ?«
»Versuchen wir es morgen früh mit fester Nahrung.«
»Sehr gut. Würden Sie das bitte auch an Tehogo weitergeben ?«
»Wird gemacht.«
»Wann, glauben Sie, können wir ihn entlassen ?«
»Er erholt sich gut«, sagte ich. »Übermorgen.«
Dr. Ngema nickte. Obwohl wir nicht befreundet waren – sie hatte keine Freunde –, fragte sie mich vor den anderen stets nach meiner Meinung. Wir hatten ein so genanntes »gutes Arbeitsverhältnis«.
Nun traten wir ans Bett des anderen Patienten, einer Frau, die vor einigen Tagen von ihrem Mann mit großen Schmerzen eingeliefert worden war. Es war der Blinddarm, er drohte durchzubrechen, und Dr. Ngema hatte sofort operiert. Appendizitis war ein Notfall ganz nach unserem Geschmack: leicht zu diagnostizieren und einfach zu behandeln, im Rahmen unserer Möglichkeiten.
Die meisten Eingriffe wurden von Dr. Ngema persönlich vorgenommen, obwohl ihre Hand bisweilen merklich zitterte und ihre Sehkraft sehr zu wünschen übrigließ. Aus ganz eigennützigen Gründen war ich bestrebt, so viele OPs wie möglich durchzuführen, musste mich zumeist jedoch mit kleineren Eingriffen zufriedengeben. Das wurmte mich, aber da ich mir meinen Unmut unter keinen Umständen anmerken lassen durfte, schluckte ich meinen Ärger immer wieder hinunter.
Zum Beispiel heute Morgen. Ich sah sofort, dass mit dieser Patientin etwas nicht stimmte – sie war schwach, und eine rasche Untersuchung ergab einen geblähten Unterleib –, doch war dies weder die Zeit noch der Ort für übertriebene Offenheit. Dr. Ngema reagierte empfindlich auf Kritik, aber das war nicht das einzige Problem. Wenn etwas nicht in Ordnung war, mussten wir die Patientin in die große Klinik in der nächsten Stadt bringen, die materiell und personell zwar weitaus besser ausgestattet war als wir, aber auch eine gute Stunde entfernt lag. In Extremfällen, in denen wir wirklich nichts mehr machen konnten, waren wir verpflichtet, die Patienten weiterzugeben, was wir jedoch tunlichst zu vermeiden suchten, weil sich die ohnehin begrenzten Mittel, die wir vom Staat bekamen, nur schwer rechtfertigen ließen, wenn uns ein Fehler unterlief.
»Wir sollten sie noch ein paar Tage dabehalten«, sagte ich.
»Zur Beobachtung.«
Dr. Ngema nickte schwerfällig. »Ist gut.«
»Er suppt«, sagte Laurence.
Wir sahen ihn an.
»Der Stumpf suppt«, sagte er. »Sehen Sie hier. Das Abdomen ist aufgebläht. Und reagiert auf Druck mit Schmerzen. Das geht nicht lange gut.«
Wir schwiegen, und der keuchende Atem der Frau im Bett erfüllte die Stille.
»Laurence«, rief ich ihn mit scharfer Stimme zur Ordnung, doch mehr als sein Name wollte mir nicht über die Lippen. Er hatte Recht, und das wussten wir, und dass er es ausgesprochen hatte, genügte, um uns zu beschämen.
»Ja«, sagte Dr. Ngema schließlich. »Ja. Das ist wohl nicht zu übersehen.«
»Was soll ich tun ?«, fragte ich.
»Bringen Sie sie in die Stadt. Ich übernehme so lange Ihren Bereitschaftsdienst. Es ist besser, wenn wir …, ja. Ja. So machen wir’s.«
Sie sprach ruhig und beherrscht, aber die Stimmung war alles andere als heiter. Als sie auf dem Absatz kehrtmachte und in ihr Dienstzimmer zurückging, setzte ich mich nicht neben sie, wie sonst, sondern hinkte einen Schritt hinterher.
Laurence nahm meinen gewohnten Platz ein.
»Dr. Ngema«, sagte er. »Kann ich Sie einen Moment sprechen ? Ich möchte wissen, was von mir erwartet wird.«
»Wie meinen Sie das ?«
»Was sind meine Aufgaben ?«, fragte er voller Tatendrang. »Ich möchte mich gern so schnell wie möglich nützlich machen, wissen Sie.«
Sie gab ihm zunächst keine Antwort, aber an der Tür zu ihrem Dienstzimmer drehte sie sich zu ihm um. »Sie fahren mit Frank«, sagte sie. »Vielleicht lernen Sie etwas dabei.«
»Ist gut.«
»Ja«, sagte sie. »Frank ist ein sehr erfahrener Arzt. Und von Menschen mit Erfahrung … kann man sehr viel lernen.«
So scharfe Worte hatte ich von ihr noch nie gehört, doch er schien das gar nicht zu bemerken. Er folgte mir wie ein Hündchen ins Ärztezimmer, wo Tehogo an seinem Schreibtisch saß und mit finsterem Blick auf die Maserung der Platte starrte.
»Ich bringe die Blinddarmpatientin in die Klinik«, sagte ich. »Und Tehogo, du musst die Zeiten ins Krankenblatt eintragen. Der andere Patient, der junge Mann, bekommt ab morgen feste Nahrung.«
»Ist gut«, antwortete Tehogo, ohne aufzublicken. Es gelang ihm, das so zu sagen, als würde er mir gnädig seine Erlaubnis erteilen. Obwohl ihn normalerweise nichts aus der Fassung bringen, geschweige denn überraschen konnte, schien er im ersten Augenblick erschrocken, als mein neuer Mitbewohner mit ausgestreckter Hand auf ihn zustürzte.
»Hallo«, sagte er. »Freut mich. Ich heiße Laurence Waters.«
Ich beschäftigte mich mit Routinearbeiten, und es war bereits später Vormittag, als wir endlich aufbrachen. Das Krankenhaus verfügte über einen museumsreifen Rettungswagen, obwohl uns der Fahrer längst verlassen hatte. Wenn der Rettungswagen ausrückte, musste sich einer der Ärzte als Chauffeur verdingen. Wir schoben die Frau auf einer Trage hinten rein, und ich setzte mich ans Steuer. Ich hatte eigentlich erwartet, dass Laurence mir Gesellschaft leisten würde, aber nein, er zwängte sich neben die Patientin und starrte sie gebannt an, wie eine Eule ihre Beute.
»Lassen Sie ihr Raum zum Atmen«, sagte ich. »Die arme Frau kriegt ja Platzangst.«
»Entschuldigung. Entschuldigung.« Verlegen rückte er von ihr ab, und ich betrachtete sein breites Gesicht im Spiegel. Er schien ständig die Stirn zu runzeln, als würde ihn seit Ewigkeiten eine ungelöste Frage quälen.
Wortlos ließ ich den Motor warm laufen und setzte den Wagen auf die Straße. Langsam zog die Stadt vorüber, in all ihrer imposanten Leere und Verlassenheit. Dann bogen wir auf eine kleine Landstraße, die durch den dichten Busch zur Hauptstraße führte. Die flirrende Hitze ließ die Blätter verschwimmen, so dass sie wie eine undurchdringliche Laubwand wirkten. Der Weg schlängelte sich zwischen Höhenrücken und flachen Hügeln hindurch. Es war eine Landschaft der Extreme, wo sich trockenes braunes Gras und sattgrünes Buschwerk abwechselten.
Als ich hierherkam, liebte ich diese Landschaft, ihre Leben spendende Fruchtbarkeit. Hier gab es keine kahlen Stellen. Alles war mit Trieben, Dornen und Blättern bewachsen; überall verliefen winzige, von Tieren oder Insekten angelegte Pfade. Die Farben und Gerüche waren überwältigend. Ich verbrachte jede freie Minute mit Wanderungen durch den Busch. Ich wollte das grüne Herz der Dinge erkunden. Doch nach einer Weile offenbarte dieses zauberhafte Wunder der Natur eine andere, verborgene Seite. Die Hitze und die schiere Lebendigkeit des Waldes wurden unerträglich. Hier ließ sich nichts bewahren, blieb nichts, wie es war. Metall fing an zu rosten, Gewebe zerfiel, die leuchtendste Farbe verblasste. Hatte man eine kleine Lichtung angelegt, so war sie nach zwei Wochen verschwunden.
Als wir zur Hauptstraße kamen, veränderte sich die Landschaft: Der Busch lichtete sich, und links und rechts erschienen Dörfer – Ansammlungen von bunt bemalten Hütten mit kegelförmigen Strohdächern. Der Boden war festgestampft und flach. Spielende Kinder, schuftende Männer und dösende Greise sahen uns nach. Die Frauen auf den kargen Gemüsefeldern richteten sich mühsam auf, die Hacke in der Hand.
Nach einer halben Stunde gelangten wir zu einem Höhenzug, wo die Straße unvermittelt anstieg. Er markierte die natürliche Grenze des einstigen Homelands und den Beginn profitabler Industrie: Riesige Pinienplantagen warfen ihren Schatten über das Land. Von oben konnte man kurz auf die Ebene hinunterblicken, die wir hinter uns gelassen hatten, ein sanft wogendes Meer von stockfleckiger Bronze, bevor das weite Grasland anfing.
Die Stadt, in der die große Klinik stand, lag gleich hinter dem Höhenzug: eine Abzweigung, eine Nebenstraße, und schon waren wir da. Selbst in der Mittagshitze, wenn die umliegenden Straßen träge in der Sonne schmorten, herrschte rings um den Eingang reger Betrieb – Autos fuhren vor, Menschen kamen und gingen. Obwohl die Patientin streng genommen gar kein Notfall war, lieferte ich sie in der Notaufnahme ab. Dort arbeitete ein Arzt, den ich von vielen früheren Besuchen kannte, ein nassforscher junger Mann namens du Toit, der kaum älter war als Laurence. Er hatte heute Dienst; ich hatte uns telefonisch angekündigt, damit er die entsprechenden Formulare fertig machen konnte. Er empfing mich mit einem unverschämten Grinsen.
»Schon wieder einer, um den wir uns kümmern dürfen«, sagte er. »Was ist los ? Habt ihr sie allein nicht totgekriegt ?«
»Das wollten wir euch überlassen.«
»Wenn du einen richtigen Job suchst, weißt du ja, an wen du dich wenden musst. Wie lange willst du eigentlich noch in diesem öden Kaff rumhängen ?«
»So lange wie nötig«, sagte ich, setzte zum x-ten Mal meinen Namen unter das ewig gleiche Formular und sah der Frau nach, die von einem Pfleger davongeschoben wurde. Immer wenn ich einen Patienten brachte, lieferten du Toit und ich uns eine Variation dieses scherzhaften Wortgeplänkels.
Er musterte Laurence interessiert. »Du bist neu«, sagte er. »Ich dachte, bei euch wird nur entlassen und nicht eingestellt.«
»Ich absolviere hier meinen Sozialdienst«, sagte Laurence. »Ein Jahr.«
Du Toit schnaubte. »Schöne Scheiße. Pech gehabt, was ?«
»Nein, nein. Ich bin freiwillig hier.«
»Wer’s glaubt, wird selig. Keine Sorge, ein Jahr geht schnell vorbei.« Er klopfte Laurence auf die Schulter und wandte sich an mich. »Mittagessen ?«
»Nein, danke, wir müssen zurück. Ich habe Bereitschaft. Nächstes Mal.«
Als wir wieder draußen waren, sagte Laurence: »Er gefällt mir nicht.«
»Er ist in Ordnung.«
»Er ist ordinär. Völlig von sich eingenommen. Ein richtiger Arzt ist der jedenfalls nicht, das sieht man auf den ersten Blick.«
Kurz vor dem Gipfel des Höhenzugs hielt ich bei einem Rasthaus.
»Was jetzt ?«, fragte Laurence.
»Ich wollte etwas zu Mittag essen. Haben Sie keinen Hunger ?«
»Ich dachte, wir sind im Dienst. Sehen Sie ?«, sagte er augenzwinkernd. »Mit dem Kerl wollten Sie nicht zu Mittagessen. Im Grunde können Sie ihn nämlich auch nicht leiden.«
Wir setzten uns an einen Tisch, aßen und verfolgten das Kommen und Gehen der Gäste. Die Straße diente vor allem dem grenzüberschreitenden Lastwagenverkehr, und die Fahrer machten hier oft Halt, um einen Happen zu essen. Die Männer waren mir sympathisch. Die quälende Selbstbespiegelung, der sich Ärzte häufig hingaben, war ihnen fremd. Ihr Leben war die Straße.
»Soso«, sagte Laurence plötzlich. »Das war also das andere Krankenhaus, wo alle hingehen.«
Ich nickte schwerfällig. »Genau.«
»Und dorthin fließen auch die ganzen Mittel, Material und Personal und so ?«
»Genau.«
»Aber warum ?«
»Warum ? Eine Laune der Geschichte. Vor ein paar Jahren gab es eine Linie auf einer Karte, ziemlich genau da, wo wir jetzt sitzen. Auf der einen Seite lag das Homeland, auf der anderen ein billiger Abklatsch des weißen Traums, wo das ganze Geld …«
»Ja, ja, ich weiß«, fuhr er unwirsch dazwischen. »Aber die Linie auf der Karte ist verschwunden. Warum werden wir nicht alle gleich behandelt?«
Ich zuckte die Achseln. »Ich weiß nicht, Laurence. Es ist nicht genug Geld für alle da. Da muss man Prioritäten setzen.«
»Und weil die ganz oben auf der so genannten Prioritätenliste stehen, gehen wir leer aus.«
»So ähnlich. Sie möchten unseren Laden dichtmachen.«
»Aber. Aber.« Eine steile Kummerfalte erschien auf seiner Stirn. »Aber das ist doch schon wieder Politik.«
»Alles ist Politik, Laurence. In dem Moment, wo zwei Leute zusammen in einem Zimmer sitzen, kommt die Politik ins Spiel. So ist das nun mal.«
Dieser Gedanke brachte ihn zum Schweigen. Er sprach erst wieder, als wir gingen. Plötzlich wollte er fahren.
»Was ?«
»Mir ist einfach danach. Kommen Sie, Frank, überlassen Sie mir das Steuer. Ich möchte mal sehen, wie das so ist.«
Ich warf ihm den Schlüssel zu. Noch bevor wir den Parkplatz verlassen hatten, spürte ich, dass er ein vorsichtiger Fahrer war; langsam und beherrscht, ganz im Gegensatz zu seiner Sprechweise und seinem Verhalten. Aber das war nur einer der vielen Widersprüche an Laurence, einer der vielen kleinen Mängel und Schönheitsfehler, die nicht so recht zusammenpassen wollten.
Inzwischen war es früher Nachmittag. Der Fuß des Höhenzuges lag bereits im Zwielicht; als wir wieder an die Sonne kamen, warf alles lange, schmale Schatten. Die Straße erstreckte sich pfeilgerade bis zum Horizont, zur Grenze. Nach zwanzig Minuten Fahrt sagte ich: »Halten Sie mal an.«
Der Impuls schien wie aus dem Nichts zu kommen, doch heute weiß ich, dass ich ihn schon am frühen Morgen in mir gespürt hatte. Wenn nicht früher.
»Hä ?«
»Da vorn, bei den Bäumen.«
Am Straßenrand wuchs eine Hand voll Fieberbäume, in deren Schatten eine winzige Holzhütte stand. Dahinter waren, über eine kleine Anhöhe hinweg, die Dächer eines Dorfes zu sehen.
»Aber wozu ?«
»Nur auf einen Sprung.«
Da entdeckte er das Schild und las laut: »›Souvenirs und Kunsthandwerk‹.«
»Mal sehen, was es gibt.«
Vor der Hütte stand ein zweiter Wagen. Ein amerikanisches Pärchen kam, laut und übertrieben freundlich, mit zwei holzgeschnitzten Giraffen aus dem improvisierten kleinen Laden. Die Verkäuferin stand lächelnd in der Tür. Als sie mich sah, verschwand das Lächeln, kehrte jedoch gleich darauf, etwas gezwungener jetzt, zurück.
»Schöne Ferien«, rief sie den Amerikanern nach.
Sie war Anfang dreißig. Schmal, aber kräftig, mit breitem, offenem Gesicht. Barfuß, in einem zerrissenen roten Kleid.
Wir gingen an ihr vorbei und betraten die dämmrige Hütte. Primitive Regale mit Kunsthandwerk säumten die Wände – holzgeschnitzte Tierfiguren, Perlenstickereien, Flechtmatten und -körbe, Drahtspielzeug. Afrika light, endlos kopiert und touristengerecht aufbereitet. Einem handbemalten Schild voller Rechtschreibfehler entnahmen wir, dass die Arbeiten allesamt von Leuten aus den Dörfern dieses Distrikts stammten. Wir sahen uns um, ließen den Blick über die Regale schweifen. In der Hütte herrschte eine Bullenhitze.
»Es ist alles so …«, begann Laurence.
»So was ?«
»So ärmlich.«
Der Wagen draußen fuhr davon, und die Frau kam wieder herein und rieb sich die Oberarme. »Hallo«, sagte sie, an niemand Bestimmten gerichtet.
»Guten Tag«, sagte ich.
»Sie wollen etwas kaufen ?«
»Wir schauen uns nur ein wenig um.«
Laurence blickte mit gequälter Miene um sich. »Ist das Ihr Laden ?«, fragte er.
»Nein. Ich hier nur arbeiten.«
»Wer ist der Besitzer ?«
Sie streckte die Hand aus und wies zur Tür. Auf irgendjemanden dort draußen.
»Sehr schön.«
Sie nickte lächelnd. »Ja, ja«, sagte sie. »Willkommen.«
»Ich möchte Ihnen etwas kaufen, Frank.« Laurence hielt einen grob geschnitzten Fisch hoch.
»Fünfundzwanzig Rand«, sagte sie.
»Zum Dank dafür, dass Sie mich heute mitgenommen haben. Es hat mir großen Spaß gemacht.«
»Aber ich bitte Sie. Das ist wirklich nicht nötig. Bitte.«
»Lassen Sie mir doch die Freude.«
»Zwanzig«, sagte sie.
»Ich gebe Ihnen fünfundzwanzig.« Er zählte ihr das Geld in die Hand. »Danke. Ihr Laden ist wirklich wunderschön. Wie heißen Sie ?«
»Maria.«
»Sie haben einen schönen Laden, Maria.«
Das erste Mal, seit wir hereingekommen waren, sah sie mir direkt ins Gesicht und sagte: »Sie hatten zu sehr viel zu tun.«
Ich antwortete wie auf eine Frage. »Ähm, ja, ja, genau.«
Ich setzte den Wagen aus dem Schatten der Fieberbäume auf die Straße zurück. Der Fisch lag plump auf meinem Schoß. Im Licht des Spätnachmittags sah der Höhenzug aus wie eine dunkle, im Brechen erstarrte Welle.
»Sie waren schon mal hier«, sagte er.
»Ja, gleich an meinem ersten Tag. Auf dem Weg zum Krankenhaus.«
»Aber das ist Jahre her.«
»Ja.«
Er kurbelte das Fenster herunter, und warme Luft umhüllte uns. Wir rasten durch den frühen Abend, und es war, als lägen all die Orte, an denen wir heute gewesen waren, wahllos hinter uns verstreut, wie Punkte auf einer Karte, die nur wir entziffern konnten. Hinter uns lag ein guter, irgendwie schwereloser Tag, deshalb traf es mich wie ein Faustschlag in den Magen, als er mir plötzlich, ganz beiläufig, die Frage stellte: »Haben Sie mit der Frau geschlafen ?«
»Was ?«
»Die Frau in dem Laden. Haben Sie …?«
»Schon gut, ich habe verstanden. Nein. Nein. Wie kommen Sie darauf ?«
»Ich weiß auch nicht, nur so ein Gefühl.«
»Trotzdem, nein.«
»Sind Sie jetzt beleidigt ?«
»Nein, nur … überrascht.«
»Tut mir leid. Wenn mir etwas durch den Kopf geht, muss ich es auch aussprechen. Ich kann einfach nicht anders.«
Der Rest der Fahrt verlief schweigend. Als wir zurückkamen, brach bereits die Dämmerung herein – der Tag war vorbei, meine Schicht zu Ende. Ich ließ das Ärztezimmer links liegen, hatte aber auch keine Lust, im Zimmer herumzuhocken. Es gab nichts zu tun, und ich war unruhig, unternehmungslustig.
Da Laurence nicht zu Abend essen wollte – nein, danke, er habe keinen Hunger –, ging ich allein in den Speisesaal. Aber auch ich hatte eigentlich keinen rechten Appetit, und so fand ich mich bald darauf im Aufenthaltsraum vor dem Fernseher wieder. Sinnlose Bilder huschten stumm über den Schirm, und ich saß da und ließ einen Tischtennisball von einer Hand zur anderen wandern. Unzufriedenheit rumorte in mir. Alte Fragen, die zu stellen ich mir abgewöhnt hatte, kehrten schlagartig zurück. Alte Sehnsüchte und Wünsche. Das Stillsitzen fiel mir schwer, und nach ein oder zwei Stunden ließ ich den Ball fallen und davonrollen. Ich ging auf den Parkplatz hinaus. Das Licht in unserem Zimmer brannte, ging jedoch urplötzlich aus, als ich hinüberblickte.