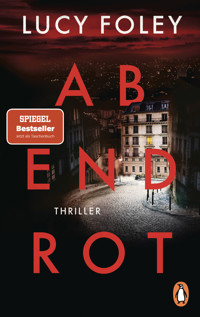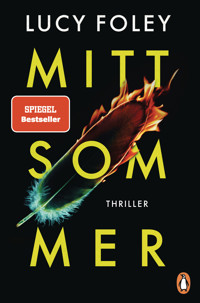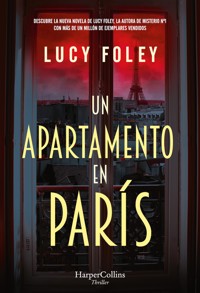9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ligurien, 1953. Vor der schillernden Kulisse der italienischen Riviera spielt diese mitreißende Geschichte zweier Menschen – Hal und Stella –, deren Wege sich in Rom in einer schicksalhaften Nacht kreuzen. Ein Jahr später begegnen sie sich wieder, diesmal jedoch unter Umständen, die ihnen zum Verhängnis werden könnten …
Als Hal und Stella sich auf einer Yacht auf einer Reise entlang der ligurischen Küste inmitten einer Schar illustrer Gäste zufällig wiedersehen, kommen sie nicht voneinander los. Doch nicht nur Stellas Ehemann, der skrupellose amerikanische Investor Frank Truss, auch Stellas eigene Vergangenheit stehen ihrem gemeinsamen Glück im Weg. Sie versuchen, gegen ihre Gefühle anzukämpfen, jedoch erfolglos, und die Spannungen an Bord nehmen immer mehr zu. Und so beschließen sie, allen Widerständen zum Trotz, alles auf eine Karte zu setzen.
Große Emotionen, schicksalhafte Lebensgeschichten und prächtige Bilder verweben sich zu einem üppigen und bittersüßen Schmöker, der das Lebensgefühl des Dolce Vita in all seiner Sinnlichkeit heraufbeschwört.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 526
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Rom, 1953. Hal, ein englischer Journalist, hat sich nach dem Krieg nach Italien abgesetzt. Eines Nachts trifft er dort die geheimnisvolle Stella, die ihm wie ein kurzer Moment des absoluten Glücks erscheint. Doch so unverhofft sie in sein Leben tritt, so schnell ist sie am nächsten Morgen wieder verschwunden.
Ein Jahr später begegnen sie sich wieder, an Bord eines Schiffs, das die ligurische Küste entlang nach Cannes unterwegs ist, auf Einladung einer Contessa, deren Film dort gezeigt wird. Hal soll über die Reise berichten, merkt jedoch schnell, dass ihm der Auftrag zum Verhängnis wird. Unter der illustren Schar der Gäste sind nämlich auch Frank Truss, ein unberechenbarer und skrupelloser amerikanischer Geschäftsmann, und dessen Ehefrau – die, zu Hals Bestürzung, niemand anderes ist als jene rätselhafte Stella. Weder Hal noch Stella können ihre Gefühle füreinander verleugnen. Doch die Stimmung an Bord wird immer angespannter, und je näher sie dem Ziel ihrer Reise kommen, desto auswegloser scheint ihre Situation …
Große Emotionen, schicksalhafte Lebensgeschichten und prächtige Bilder verweben sich zu einem üppigen, bittersüßen Schmöker, der das Lebensgefühl des Dolce Vita in all seiner Sinnlichkeit heraufbeschwört.
Lucy Foley, 1986 in Sussex geboren, hat Englische Literatur in Durham studiert und ihren Masterabschluss in Moderner Literatur an der Universität in London gemacht. Sie arbeitete einige Jahre als Lektorin im Verlag und schrieb währenddessen ihren ersten Roman, Die Stunde der Liebenden (it 4479).
Lucy Foley
DasVERSPRECHENeinesSOMMERS
Roman
Aus dem Englischenvon Christel Dormagen
Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel The Invitation bei HarperCollinsPublishers, London. All rights reserved.
eBook Insel Verlag Berlin 2017
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des insel taschenbuchs 4578.
Copyright © Lost and Found Books Ltd 2016
© der deutschen Ausgabe Insel Verlag Berlin 2017
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlagfoto: Colin Anderson, mauritius images, Mittenwald
Umschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg
Für meine geliebten Eltern, Sue und Patrick Foley – die Stifterin von Freundschaften und den Geschichtsforscher
Prolog
Essaouira, Marokko, 1955
Essaouira wirkt wie das Ende der Welt. Von Marrakesch braucht man mehrere Stunden mit dem Bus oder dem Auto, auf einer Strecke, die einen heftig durchrüttelt und mehr einer Piste als einer Straße gleicht. Dort angekommen, steht man dann dem gewaltigen, windgepeitschten Atlantik gegenüber. Furchteinflößend und grau wie eine alte Gouvernante.
Die Stadt wird vom Meer beherrscht: ein langgestrecktes, in salzige Gischt gehülltes, windumtostes Band aus Weiß und Blau. Von der Dachterrasse meines Hauses sieht man die weiten Boulevards, die die Souks umschließen. Dazu die schmaleren, gewundenen Wege, die sie durchziehen wie ein Netz aus pulsierenden Adern, mit ihren verwegen aufgetürmten Warenbergen am Rand. Doch der hiesige Markt ist längst nicht so turbulent wie der in Marrakesch, wo die Händler ununterbrochen brüllen und feilschen. Das mag auch daran liegen, dass das Tempo hier insgesamt langsamer ist als dort – oder, genauer gesagt, als an jedem anderen Ort, den ich kenne.
Außer mir gibt es hier noch einige andere westliche Ausländer. Die meisten sind in gewisser Hinsicht Exilierte; die Gründe dafür sind allerdings sehr unterschiedlich und lassen sich kaum generalisieren: der Druck durch McCarthy, Bankrott, zerbrochene Ehen. Der lange Schatten der Bombe.
Von der anderen Seite meiner Terrasse geht der Blick direkt auf den Atlantik. Ich bin gern dort oben und beobachte, wie die blau gestrichenen Fischerboote in den ersten Morgenstunden hinausfahren, um dann, beladen mit dem Tagesfang, in der Dämmerung wieder heimzukehren. Das verleiht dem Tag einen Rhythmus. Ich kenne die Launen des Ozeans inzwischen fast so gut wie jene Fischer, und von denen gibt es eine Menge. Ich beobachte auch gern, wie Wetterfronten aus der Ferne heranziehen, das Nahen eines gelegentlichen Gewitters.
Manchmal ertappe ich mich dabei, wie ich in Panik gerate, weil ich mich nicht mehr an ihr Gesicht erinnere. Ich habe das Gefühl, sie entgleitet mir. Dann beschwöre ich Details herauf, die mir noch lebhaft in Erinnerung sind. Den Duft ihrer von der Sonne gewärmten Haut, ein Geruch wie reifer Weizen. Oder den Ausdruck ihrer Augen, als sie mir von all dem erzählte, was sie verloren hat.
An den seltenen windstillen Tagen male ich mir häufig aus, wie sie aus der Tiefe auftaucht, wie eine Venus, die auf den Schaumkronen zu mir getragen wird. Vielleicht nicht unbedingt getragen, das war nicht ihre Art. Vielmehr kommt sie herausgeschritten und schüttelt sich das Meerwasser aus ihrem feucht glänzenden Haar. Zum Glück ist das hier das falsche Meer. Hätte ich die letzten Jahre damit verbracht, auf das Meer hinauszustarren, das unseres war, wäre ich verrückt geworden.
Manchmal überlege ich, ob ich nicht vielleicht tatsächlich ein bisschen verrückt geworden bin. Das Majoun, für das ich inzwischen eine Schwäche habe, ist sicherlich nicht gerade förderlich. Hin und wieder habe ich Halluzinationen, wenn ich es nehme, und bin dann fest überzeugt, dass das, was ich gerade sehe, real ist. Manchmal kommen solche Halluzinationen noch Tage oder sogar eine Woche später. Immerhin beeinträchtigt es nicht das Schreiben. Vielleicht hilft es sogar.
Jener Frühling damals war der Anfang von allem. Die Sonne, das Meer, der Zauber, der über allem lag, der Vorbote eines großen Sommers. Davor hatte ich mich halb schlafend durchs Leben treiben lassen. Davor hatte ich nicht gewusst, wozu ein menschliches Herz fähig ist.
Ich kann mich an all das mit erstaunlicher Klarheit erinnern.
Und obwohl ich weiß, dass ich dies hier jetzt tun muss, weil es sonst nie geschieht, kann ich nicht leugnen, dass ich mich davor fürchte, in jene Zeit zurückzukehren. Denn das, was damals geschehen ist, war ganz allein meine Schuld.
ERSTER TEIL
1
Rom, November 1951
Jetzt ist die Zeit, in der die Stadt am schönsten ist. Die Menschenmassen des Sommers und des Herbstes sind fort, die Luft hat eine neue Frische, und das Licht ist von jenem blassen Gold, das es nur in dieser Jahreszeit gibt.
Wenn die Stadt so ist, macht es Hal nichts aus, arm zu sein. An solch einem Ort zu leben, ist allein schon eine Art von Reichtum. Er ist selbstgenügsam. Er hat eine Arbeit und nachts einen Platz zum Schlafen. Zwar nur ein kleines möbliertes Zimmer im ärmeren Teil von Trastevere, aber es reicht, um Heim genannt zu werden. Das Leben hier ist so anders als in England, dass er sich genauso gut auf einem anderen Planeten befinden könnte. Aber ihm ist es nur recht so.
Hal ist jetzt seit fünf Jahren hier. Sein Vater glaubt, er mache nichts aus sich. Wenn sein Sohn schon etwas so Unbedeutendes wie Journalist sein müsse, hätte er wenigstens weiter für eine seriöse englische Zeitung arbeiten sollen. Und was ist er? Ein Freiberufler, der launige Stückchen für ein Lokalblättchen schreibt. Seine Mutter hat mehr Verständnis. Immerhin ist Rom die Stadt, in der sie geboren wurde. Von ihr hat er auch Italienisch gelernt. Die Hälfte der Geschichten, die sie ihm in seiner Kindheit vorgelesen hat, war in ihrer Muttersprache. Jetzt benutzt er das Italienische so regelmäßig, dass es ihm allmählich wie seine erste Sprache vorkommt; das Englische hat er hinter sich gelassen, zusammen mit seinem alten Leben.
Als er im Café ankommt, wartet Fede schon auf ihn und trinkt offensichtlich bereits seinen zweiten Espresso. Er grinst.
»Hal! Mir gefällt dieses Lokal. Jetzt weiß ich, warum du so gern hierherkommst. So viele schöne Frauen.«
Mit einem Nicken weist er hinüber zu einer Gruppe in der Ecke. Keines der Mädchen kann viel älter als achtzehn sein, aber sie haben sich aufgetakelt wie die Filmstars, die sie zweifellos bewundern: Rouge auf den Wangen, enge Gürtel um die Taillen. Eine zieht etwas unsicher an einer Zigarette und bläst in einer Geste, die sie wohl von einem Foto abgeschaut hat, eine dünne Rauchwolke über die Schulter, während ihre Freundin die Konturen ihrer Lippen sorgfältig mit rotem Lippenstift nachzieht. Diese Mädchen sind die Erbinnen einer neuen Zeit, des Aufschwungs, sie modellieren sich nach den Filmstars und Mannequins, die die Seiten der neuen Hochglanzillustrierten füllen. Sie scheinen einer völlig anderen Gattung anzugehören als die schwarz gekleideten Matronen, die in Trastevere ihre Wäsche aufhängen oder in die Kirche laufen und vermutlich genauso aussehen wie ihre Ahninnen aus vergangenen Jahrhunderten. Das ist Rom, das ist Italien durch und durch: das Moderne und das Zeitlose existieren auf spektakuläre Art seltsam befremdlich nebeneinander.
»Das sind keine Frauen«, sagt er zu Fede, während er beobachtet, wie das Trio plötzlich in Lachen ausbricht. »Das sind Mädchen. Schuleschwänzende Mädchen.«
»Genauso mag ich sie. Zart wie das köstlichste vitello.« Fede drückt die Luft zwischen Daumen und Zeigefinger zusammen. »Sieh mal, sie macht dir schöne Augen.«
Hal blickt vorsichtig hinüber. Fede hat recht – eine von ihnen schaut ihn an. Unumwunden, sogar ihr Blick ist modern in seiner Kühnheit. Sie ist schön, so wie neue, unbeschädigte Dinge schön sind. Hal kann es sehen, immerhin, aber er kann es nicht fühlen. So geht es ihm inzwischen mit aller Schönheit.
Er wendet seinen Blick ab. »Idiot«, sagt er frotzelnd zu Fede. »Warum gebe ich mich überhaupt mit dir ab.«
Fede zieht eine Augenbraue hoch. »Weil wir uns gegenseitig unterstützen. Deshalb.«
Hal kippt seinen Espresso hinunter. »Und? Hast du was für mich?«
Fede wirft die Hände in die Luft. »Im Moment nichts, mein Freund. Um diese Jahreszeit tut sich nicht viel.«
Hals größte, interessanteste Interviews kamen bisher alle über Fede, der im neuen Kulturinstitut der Stadt arbeitet. Hal kann seine Enttäuschung kaum verbergen. An der Prominenten-Front ist momentan wenig zu holen. Sein Redakteur vom Tiber hat ihm klar zu verstehen gegeben, dass ein weiteres Stückchen aus der Reihe »Ausländer in der Stadt« nicht reichen wird – und er kann es sich nicht leisten, seinen Job zu verlieren.
»Aber …«, sagt Fede nachdenklich, »es gibt eine Party.«
»Eine Party?«
»Eine Contessa gibt eine für ihre reichen Freunde. Um Gelder für einen Film einzuwerben, soweit ich weiß. Ich habe eine Einladung, kann aber nicht hingehen. Sie ist nächsten Monat – und da muss ich in Apulien sein, wegen Weihnachten, du verstehst.« Er wirft Hal einen Blick von der Seite zu. »Falls du nicht ebenfalls zu deiner Familie musst?«
An einem Abend, an dem er zu viel getrunken hatte, hatte Hal den Fehler gemacht, von Suze und von der Verlobung zu erzählen. Seitdem interessiert Fede sich beinahe aufdringlich für Hals früheres Leben in England.
»Nein«, erwidert Hal. »Ich bleibe hier.« Er weiß, dass vor allem seine Mutter enttäuscht sein wird. Aber er fürchtet sich vor ihrer Sorge um ihn und erst recht vor den spitzen Fragen seines Vaters, wann er denn endlich gedenke, etwas aus seinem Leben zu machen.
»Also gut. Dann, finde ich, solltest du für mich hingehen.«
Das könnte interessant sein, denkt Hal. »Und wie komme ich rein?«
»Na ja«, sagt Fede geduldig, »du musst einfach so tun, als wärst du ich. Ich finde, wir sehen gar nicht so verschieden aus.«
Hal unterlässt es lieber, auf das Offensichtliche hinzuweisen. Fede ist fünfzehn Zentimeter kleiner als er, hat eine krumme Nase und braune statt blaue Augen. Die einzige Ähnlichkeit besteht in ihrem dunklen Haar.
»Denk doch nur an all die reichen Frauen auf der Suche nach einem kleinen Abenteuer.« Fede zwinkert. »Glaub mir, amico, das ist das beste Weihnachtsgeschenk, das ich dir machen kann.«
Er fischt eine Karte aus seiner Tasche. Hal nimmt sie, dreht und wendet sie in der Hand, studiert die geprägten Goldbuchstaben. Warum eigentlich nicht? Was hat er schon zu verlieren?
Dezember
Er geht die ganze Strecke von seiner Wohnung zu Fuß. Er läuft gern durch die Stadt: Überall gibt es immer etwas Neues zu entdecken. Alles scheint sich zu bewegen, zu wachsen, jede Ecke eröffnet den Blick auf andere Lebensweisen, andere Zeiten. Es gibt so viele Überlagerungen von Geschichte, Momente, in denen die Grenze zwischen Gegenwart und Vergangenheit papierdünn zu sein scheint. Er könnte sie wegziehen, und eine ganz und gar andere Ära käme zum Vorschein: das antike Rom, das Mittelalter, die Renaissance. Dieser mahnende Hinweis darauf, dass die Gegenwart und sein eigener Platz in ihr genauso vergänglich sind, hat etwas sehr Eindrückliches. Angesichts von so vielen Jahrhunderten wird die eigene Vergangenheit ziemlich unbedeutend.
Dabei gibt es eine noch nicht sehr lang zurückliegende Zeit, die aus den Gesprächen und den eigenen Gedanken herausgehalten werden muss. Der Krieg hat Demütigungen und Tragödien gebracht, Mühsal und Armut. Jetzt verlangt es die Menschen nach Wohlstand, sie wollen neue Kleider, Essen auf den Tisch, Dinge. In England ist es dasselbe. Es gab den Jubel über den Sieg, den strahlenden Empfang der zurückkehrenden Helden. Und dann das große Vergessen.
Die angegebene Adresse liegt hinter dem Forum Romanum, und Hal geht direkt daran entlang. Um diese Tageszeit sind die Steine bloße Silhouetten, vom weichenden Licht der Stadt sanft beleuchtet. So wirken sie sogar noch älter: als hätten die allerersten Menschen sie errichtet.
Das Gebäude entpuppt sich als ein mittelalterlicher Turm aus rotem Backstein, der die umstehenden Häuser um mehrere Stockwerke überragt. Er hat ihn schon früher gesehen und gerätselt, was sich dahinter wohl verbirgt. Er hatte eine Botschaft vermutet, ein staatliches Ministerium, sogar den Tempel einer seltsamen Sekte. Niemals hätte er gedacht, dass es sich um ein privates Wohnhaus handeln könnte.
Fackeln brennen in Halterungen am Eingang, und Hal sieht, wie schimmernde Fahrzeuge eines nach dem anderen wie Prozessionsraupen vorfahren, denen Gäste in Abendrobe entströmen. Darauf ist er nicht vorbereitet. Sein Anzug ist zwar von guter Qualität, aber alt und abgetragen, an den Ellbogen des Jacketts leicht durchgescheuert und an den Hosentaschen ausgefranst. Außerdem hat Hal abgenommen, seit er ihn zuletzt getragen hat, wegen der schmalen Kost aus Kaffee und dem gelegentlichen belegten Brot. Er kann es sich nicht leisten, ordentlich zu essen. Als er den Anzug früher trug, war er um Brust und Schultern viel breiter. Jetzt kommt er sich fast vor wie ein Junge in den Kleidern seines Vaters.
Den ganzen Tag hat es nach Regen ausgesehen, aber das ist schon seit mehreren grau verhangenen Tagen so, ohne dass ein Tropfen fiel, deshalb hat er weder Schirm noch Regenmantel für nötig gehalten. Doch wie ein schlechter Witz öffnet der Himmel ausgerechnet jetzt, etwa zwanzig Meter vor dem Eingang, seine Schleusen. Ohne Vorankündigung, nur das plötzlich hereinbrechende Chaos eines Platzregens, der in einer Art Wolke auf ihn zurast. Sofort sind seine Haare, sein Hemd und sein Anzug klitschnass. Wenn er vorher schon leicht heruntergekommen gewirkt hat, muss er jetzt wie ein Wesen aussehen, das aus dem Tiber gekrochen ist. Er flucht. Eine Frau, die aus einem der eleganten Wagen gestiegen ist, wirft einen alarmierten Blick in seine Richtung und eilt ins Innere des Gebäudes.
Im Eingang spürt er, wie der Blick des Empfangsportiers ihn scharf taxiert und für ungenügend befindet.
»Cognome, per favore?«
»Fiori.«
Der Mann blickt auf seine Liste, runzelt die Stirn. »E nome?«
»Federico.«
Noch bevor der Mann ihn wieder ansieht, weiß Hal, dass es nicht funktioniert hat.
»Das sind Sie nicht«, erklärt der Portier mit sichtlichem Vergnügen. »Ich kenne den Mann. Er arbeitet für das Ministerium. Es ist mein Job, mir Gesichter zu merken. Sie sind nicht Fiori.«
Hal zögert und überlegt, ob es sich lohnt, eine Diskussion mit dem Mann anzufangen, wenn der so sicher ist, dass er Federico vom Sehen kennt … Aber einen Versuch ist es wert.
»Ma, ho un invito …« Er angelt die Karte aus seiner Tasche.
Der Mann schüttelt schon den Kopf, bevor er die Einladung gesehen hat. Hal tritt einen Schritt zurück. Erst jetzt, wo er abgewiesen werden soll, merkt er, wie sehr er sich auf den Abend gefreut hat. Nicht nur wegen der Aussicht auf neue Kontakte, sondern auch, weil er sich Einblick in eine andere Seite der Stadt erhofft hat – in das Leben, das er manchmal hinter Wagenfenstern und den Scheiben besserer Restaurants erspäht. Der Gedanke an seine kalte, dunkle Wohnung deprimiert ihn. Der lange Weg zurück durch nasse Straßen. Er hätte wissen müssen, dass Fedes Plan nicht klappen würde.
Er redet sich ein, dass er eigentlich gar nicht hingehen wollte. Er hat den Einblick in diese bessere Gesellschaft nicht nötig: Es ist nicht das Leben, dessentwegen er nach Rom gekommen ist. Und doch ist da seit jeher etwas in ihm, etwas, worauf er nicht unbedingt stolz ist, das ihn aber immer schon an solchen Festen angezogen hat. Er erinnert sich an die Gartenfeste, die seine Mutter in Sussex veranstaltet hat: Auf dem Rasen wimmelte es von Gästen, Lichter spiegelten sich im dunklen Wasser des Hafens dahinter. Ein Teil davon zu sein, ein Glas mit verdünntem Punsch in der Hand, hatte ihm das Gefühl gegeben, eine andere, erwachsene Welt betreten zu haben. Komisch, dass man seine Kindheit damit verbringt, sich halb aus ihr herauszusehnen.
»Was gibt es für ein Problem?«
Neben den Mann im Eingang ist eine Frau getreten. Sie trägt eine smaragdgrüne Robe, vom Stil her fast mittelalterlich, dazu eine silbrige Stola um die Schultern. Sie ist entschieden älter, vielleicht Mitte siebzig, ihr Gesicht unglaublich faltig. Doch sie hat das Auftreten einer Königin. Ihr Haar ist sehr dunkel, und sollte sie dabei nachgeholfen haben, so ist es nicht zu erkennen.
Der Portier wendet sich an sie, triumphierend, aber unterwürfig. »Dieser Mann, Contessa, ist nicht der, für den er sich ausgibt.«
Hal spürt ihren Blick. Ihre Augen sind erstaunlich, stellt er fest, wie flüssige Bronze. Sie mustert ihn eine Weile wortlos.
»Jemand hat einmal zu mir gesagt«, erklärt sie, »dass eine Party nur dann zu einem Ereignis wird, wenn zumindest ein ungebetener Gast zugegen ist.« Sie zieht die Augenbrauen hoch und sieht ihn mit einem undurchdringlichen Ausdruck an. »Sind Sie ein ungebetener Gast?«
Er zögert, überlegt, was er antworten soll. Ist das ein Trick? Soll er auf seiner Lüge beharren oder die Wahrheit bekennen? Er schwankt.
»Nun«, sagt sie plötzlich, »immerhin sehen Sie schon einmal interessant aus. Kommen Sie, wir suchen uns etwas zu trinken.« Sie dreht sich um, und jetzt sieht er, dass ihre Pelzstola bis hinunter zum Boden reicht.
Er folgt ihr die geschwungene Treppe hinauf, die mit weiteren Wandleuchten illuminiert und in weiches Gold getaucht ist. Sie kommen an mehreren geschlossenen Türen vorbei, fast wie der Held im Märchen. Das Gewand, die jahrhundertealten Ziegel, die Flammen der Fackeln: Das moderne Rom scheint plötzlich in weiter Ferne. Von oben sind die Geräusche einer Party zu hören, Stimmen und Musik, aber nur verzerrt, wie von Wasser geschluckt.
Sie ruft ihm über die Schulter zu: »Sie sind kein Italiener, oder?«
»Nein«, erwidert er. Halbitaliener – doch das sagt er nicht. Je weniger man sagt, desto weniger wird man gefragt. Das ist die eine eiserne Regel, an die er sich in seinem Leben hält.
»Noch interessanter. Wissen Sie, woran ich es erraten habe? Nicht an Ihrem Italienisch, sollte ich hinzufügen – es ist fast perfekt.«
»Nein.«
»An Ihrem Anzug natürlich. Bei maßgeschneiderter Kleidung irre ich mich nie. Er ist englisch, nicht wahr?«
»Ja, das stimmt.« Sein Vater hatte ihn von seinem Schneider für ihn anfertigen lassen.
»Hervorragend. Ich irre mich ungern. Und nun verraten Sie mir, warum Sie hier sind.«
»Mein Freund hatte eine Einladung. Er dachte, es würde mir gefallen, an seiner Stelle zu kommen.«
»Nein, Caro. Ich meinte, warum sind Sie in Rom?«
»Ach so. Wegen der Arbeit.«
»Die Menschen kommen nicht nur wegen der Arbeit nach Rom. Es ist immer noch etwas anderes, was sie hierherbringt: Liebe, Flucht, die Hoffnung auf ein neues Leben. Was ist es?«
Hal hält ihrem Blick stand, solange er kann, dann schaut er weg. Eine Sekunde lang hatte er das Gefühl, sie könne direkt in ihn hineinsehen, als sei er ihr ausgeliefert. Er begreift plötzlich, dass er nicht weiterkommen wird, wenn er nicht ihre Fragen beantwortet. Ihm fällt der Mythos der Sphinx ein, die den Thebanern Rätsel aufgab und alle verschlang, die falsche Antworten gaben.
»Flucht«, gibt er zu.
Er hatte sich damals eingeredet, Rom werde ein neuer Anfang sein, aber es war eher darum gegangen, das alte Leben hinter sich zu lassen. England war von zu vielen Gespenstern bevölkert. Der Mann, der er vor dem Krieg gewesen war, hatte auch dazu gehört – das Gespenst seines einstigen Glücks. Und die Gespenster all derer, die nicht nach Hause gekommen waren. Wie sein Freund Morris. Auch Rom ist voller Gespenster, seit Jahrhunderten. Wahrscheinlich findet sich hier eine größere Dichte an toten Seelen als an jedem anderen Ort der Welt: Nicht umsonst nennt man Rom die Ewige Stadt. Aber entscheidend ist für ihn, dass es nicht seine Gespenster sind.
Sie nickt bedächtig. Und er fragt sich, ob der Tausch damit vollzogen ist, ob er ihr gegeben hat, was sein Eintritt als Gegengabe verlangt. Doch nein, ihre Fragen waren noch nicht versiegt.
»Und was tun Sie hier?«
»Ich bin Journalist.« Kaum hat er das gesagt, denkt er, er hätte lügen sollen. Menschen in ihrer Position sind mitunter sehr empfindlich, was ihr Privatleben angeht. Sie scheint jedoch nicht irritiert zu sein.
»Und wie heißen Sie?«
»Hal Jacobs. Ich glaube nicht, dass Sie –«
Doch sie kneift die Augen zusammen und sieht ihn an, als versuche sie, sich an etwas zu erinnern. Schließlich scheint es ihr zu dämmern. »Rezensionen«, sagt sie triumphierend. »Filmkritiken.«
Hal ist einigermaßen verwundert. Niemand liest diese Kolumne – das sei ja eben das Problem, wie sein Redakteur vom Tiber gesagt hatte.
»Ja, stimmt. Vor ein, zwei Jahren habe ich solche Kritiken geschrieben.«
»Sie waren brillant«, erklärt sie. »Molto, molto acuto.«
»Vielen Dank«, sagt er überrascht.
»Einmal haben Sie über Giacomo Gasparis Film La Elegia geschrieben. All die italienischen Kritiker damals haben seine Intention überhaupt nicht begriffen, sie haben sich gefragt, wieso da jemand wieder den Krieg zum Thema machen muss, ausgerechnet jene Zeit der Schande. Und dann kam ein Engländer daher – Sie –, der es absolut verstanden hat. Sie haben sehr überzeugend argumentiert.«
La Elegia. Die Elegie. Hal erinnert sich noch so genau an den Film, als wäre er in sein Gedächtnis eingebrannt.
»Nachdem ich das gelesen hatte«, sagt sie, »dachte ich: Ich muss alles von diesem Mann lesen, was er über Filme schreibt. Sie haben gesehen, was andere nicht sahen. Aber Sie haben aufgehört!«
Hal zuckt die Achseln. »Mein Redakteur fand meinen Stil … zu akademisch, nicht für unsere Leserschaft geeignet.«
Die Kolumne war durch die Rubrik einer Kummerkastentante ersetzt worden: »Gina risponde …« Römische Hausfrauen, die fragten, wie ihre Wäsche noch weißer wurde, einsame Männer, die wissen wollten, wie sich ein kahl werdender Schädel verbergen ließ, junge Frauen, die unbedingt in der Hauptstadt arbeiten wollten und fragten, ob Rom wirklich so unmoralisch und gefährlich sei, wie ihre Eltern behaupteten.
Die Contessa schüttelt energisch den Kopf, als empöre sie sich über ein großes Unrecht. »Aber wieso arbeiten Sie überhaupt bei einem Blatt wie …«, sie scheint nach dem Namen zu suchen.
»Dem Tiber?«
»Ja. Sie sollten für eine überregionale Zeitschrift schreiben.«
Es muss schön sein, denkt Hal, in einer Welt zu leben, in der die Dinge so einfach sind. Als brauchte man einfach nur ins Büro einer der großen Zeitschriften zu marschieren und einen Job zu verlangen. Dabei hatte es durchaus Vorstellungsgespräche gegeben. Nur hatte sich nie etwas daraus ergeben. Und seine Arbeit für den Tiber reicht gerade so für Miete und Essen.
»Ich arbeite dort, weil sie mich haben wollen.«
»Ich frage mich, ob die überhaupt wissen, was für ein Glück sie haben.« Sie blickt ihn nachdenklich an. »Wenn mein Film fertig ist, werden Sie ja vielleicht eine Kritik darüber schreiben. Natürlich nur eine gute.«
Jetzt fällt ihm wieder ein, dass Fede irgendetwas von einem Film gesagt hatte. »Wann wird er denn gedreht?«
»Sobald ich es mir leisten kann. Deshalb habe ich diese Party veranstaltet – ich möchte versuchen, auch andere davon zu überzeugen, dass er unbedingt gemacht werden muss.«
»Aha?«
»Ich werde all meinen Charme einsetzen müssen.« Plötzlich lächelt sie. »Meinen Sie, das gelingt mir?«
Hal mustert sie einen Moment. Sie besitzt es tatsächlich, jenes Charisma, mit dem verglichen der bloße Charme von Jugend oder Schönheit wie eine Wolke am Himmel verfliegt.
»Ich glaube, ja.«
Sie lacht. »Ich bin froh, Sie auf meiner Party zu haben, Hal Jacobs.« Und dann winkt sie ihm mit einer beringten Hand. »Folgen Sie mir bitte.«
Sie erreichen das Ende der Treppe und eine offen stehende Tür, die den Blick auf eine dicht gedrängte Menge freigibt. Als Hal den Raum betritt, ist sein erster Eindruck, dass hier nur Menschen von außergewöhnlicher Schönheit versammelt sind. Doch schnell stellt er fest, dass es sich um eine Illusion handelt. Inmitten all der blendenden Schönheit lauert ebenso viel Hässlichkeit. Aber die prächtigen Kleider und der kostbare Schmuck und selbst die Luft – eine Mischung aus Parfüm und Wein und teuren Zigaretten – tun ihr Bestes, um die Mängel zu verbergen.
Als die Contessa sich unter die Menge mischt, richtet sich die gesammelte Energie des Raums auf sie. Köpfe wenden sich ihr zu, und mehrere Gäste bewegen sich, wie von unsichtbaren Drähten gezogen, in ihre Richtung. Sie dreht sich zu Hal um.
»Ich fürchte, ich werde jetzt arbeiten müssen.«
»Selbstverständlich. Bitte kümmern Sie sich um Ihre eigentlichen Gäste.«
Sie lächelt. »Hal Jacobs«, sagt sie. »Das werde ich mir merken.« Und bevor er fragen kann, was genau sie damit meint, zwinkert sie. »Genießen Sie meine Party.« Dann wendet sie sich ab und wird sofort von der Menge verschluckt und ist nicht mehr zu sehen.
Hal wandert durch das Gedränge, nimmt von einem Kellner einen Kelch Prosecco entgegen und nippt im Weitergehen daran. Was ihn besonders überrascht, sind die vielen verschiedenen Nationalitäten. Noch vor wenigen Jahren war er als Engländer hier eine Seltenheit. Urlauber durften nur eine geringe Menge Geld aus ihrem Heimatland ausführen. Also blieben die meisten zu Hause. Jetzt kommen sie wieder – und vielleicht in größerer Anzahl als zuvor. Er ist sich nicht sicher, wie er das findet.
Was die Menge über die Nationalitäten hinweg verbindet, ist dasselbe, was ihm anfangs den Eindruck von allgemeiner Schönheit vermittelt hat. Alle Anwesenden entsprechen einem bestimmten Typ.
Er versucht, Blickkontakt mit einzelnen Gästen aufzunehmen, an denen er vorbeikommt, doch die Augen mustern ihn jedes Mal nur kurz und gleiten dann weiter zu wichtigeren Angeboten. Mehrmals schließt er sich einer Gruppe an, versucht, sich an der Unterhaltung zu beteiligen. Er braucht einfach einen ersten Einstieg, dann weiß er, dass alles Weitere sich fügen wird. Doch der will nicht gelingen. Meistens wird er ignoriert, und zwar auf verschiedenste Weise: Jemand stellt sich ihm in den Weg, ein Kommentar, den er zu machen versucht, wird überhört, oder die Gruppe zerstreut sich schlicht, und er bleibt allein zurück. Anfangs weiß Hal nicht, ob das absichtlich geschieht. Doch einige Male wird er ziemlich eindeutig mit frostiger Miene geschnitten. Einmal dreht ein Mann sich um und starrt ihn entsetzlich finster an, und Hal ist so verwirrt über den Hass, der ihm da entgegenschlägt, dass er zurückweicht. Offensichtlich mag diese Szene keine Außenseiter. Er ist der Kuckuck im Nest, und das wissen sie. Eigentlich ist Hal es gewohnt, dass er Frauen auffällt, auch wenn er nicht so anmaßend ist, es zuzugeben. Aber in der Hinsicht hatte er schon immer Glück. Hier allerdings sieht ihn keine ein zweites Mal an. Hier wird nach mehr als gutem Aussehen Ausschau gehalten, und das hat er nicht. Er ist nicht einmal unsichtbar.
Irgendwann hat er genug von den wiederholten Demütigungen, dem Lärm und dem Gedränge von erhitzten Körpern; er kämpft sich zu den Türen am anderen Ende des Raums vor, die zum Notausgang führen. Er wird draußen sein Glas austrinken, eine Zigarette rauchen und dann nach drinnen zurückkehren und, beflügelt vom Alkohol, einen weiteren Versuch unternehmen. Er wird hier nicht mit leeren Händen weggehen; er braucht nur etwas Zeit, um sich zu sammeln.
Draußen entdeckt er eine Feuerleiter, die nach oben führt, direkt auf das Dach des Turms. Neugierig klettert er hinauf. Zu seiner Überraschung landet er mitten in einem Dachgarten. Unter ihm erstreckt sich Rom, wogt in seiner hell erleuchteten Herrlichkeit in alle Richtungen. Er kann die schwarze Lücke des Forum Romanum erkennen, einige der antiken Steine schimmern schwach im Licht der Laternen; dann den marmornen Bombast des Altare della Patria mit seinen geflügelten Reitern, die sich wie Scherenschnitte vor dem Sternenhimmel abzeichnen. Schließlich, etwas weiter weg, die anmutige Kuppel von Sankt Peter und weitere Kuppeln und Kirchtürme, die er nicht kennt. Ein Netz aus Straßen im Laternenlicht, einige von wimmelnden ameisenartigen Wesen bevölkert, andere verlassen und still, wie im Schlaf. So hat er Rom noch nie gesehen.
Einen schwindelnden Augenblick lang hat er das Gefühl, über allem zu schweben. Dann wird der Boden unter ihm wieder fest; er schaut sich um. Es gibt Palmen und Büsche hier oben, und es riecht nach regennasser Erde. Er sucht nach dem Wort für diesen Geruch: Petrichor.
Er hört ein sanftes Rauschen und entdeckt einen Brunnen mit einer offenbar nackten steinernen Karyatide, die Wasser aus ihrem Krug gießt. In der Nähe krächzt ein Vogel und erhebt sich mit mächtigem Flügelschlag hoch in die Nacht. Er sieht dem schwarzen, überraschend großen Wesen hinterher. Ein Papagei? Ein Adler? Ein Phönix? Hier scheint alles möglich.
Offenbar ist er völlig allein. Die Chancen, die das Gewimmel unten bietet, sind für die anderen Gäste eindeutig zu verlockend, um verpasst zu werden. Er blickt in Richtung Trastevere. Irgendwo da unten hat er seit seiner Ankunft in der Stadt jede Nacht geschlafen, ohne auch nur zu ahnen, was für Wunder nur wenige Meilen entfernt existieren.
»Hallo.«
Hal erschrickt und dreht sich zu der Stimme um. Es ist, als habe die Dunkelheit zu ihm gesprochen. Doch als er genauer hinschaut, kann er sie erkennen – zuerst das sehr hellblonde Haar, das in dem schwachen Licht glänzt, dann den schimmernden Stoff ihres Kleides. Jetzt sieht er auch das Ende einer Zigarette aufglimmen, als sie inhaliert. Er ist seltsam irritiert, dass sie bis eben noch nicht da war und dann so plötzlich erschienen ist wie ein geflügeltes Zauberwesen.
»Entschuldigung«, sagt sie und beugt sich vor, sodass ihr Gesicht vom Licht aus dem Turminneren erfasst wird. Er hält den Atem an. Irgendwie hat er schon an der Stimme erkannt, dass sie schön sein würde; doch auf das, was sich ihm offenbart, ist er nicht vorbereitet. Eigenartig nur, dass er mit einem Mal eine gewisse Kälte verspürt.
Sie hat sich wieder zurückgelehnt, und sofort ertappt er sich bei dem Wunsch, einen erneuten Blick auf ihr Gesicht zu werfen. Den Tonfall kann er nicht ganz einordnen. Amerikanisch, aber da ist noch etwas anderes. Vielleicht klingt es so, denkt er, wenn man ein Leben lang in diesen exklusiven Kreisen gelebt hat.
»Ich bin Hal«, sagt er, um das Schweigen zu füllen.
»Hallo, Hal«, sagt sie. Dann erscheint ein schlanker weißer Arm, und er sieht das Funkeln von Diamanten an dem zarten Handgelenk. »Ich bin Stella.«
Er nimmt ihre Hand und findet sie überraschend warm.
Dann steht sie auf und stellt sich neben ihn ans Geländer. Jetzt nimmt er auch ihren Duft wahr: rauchig, komplex – ein bestimmtes Parfüm und dazu eine ihr eigene, ganz besondere Note.
»Sehen Sie doch«, sagt sie und blickt hinaus auf die Stadt, beugt sich hungrig vornüber. »Würden Sie sich nicht wünschen, einzutauchen und sich treiben zu lassen?«, fragt sie. Sie sieht wirklich so aus, denkt er, als könne sie sich gleich über die Kante in die Nacht stürzen und wie eine weiße Feder durch die Schwärze taumeln.
Eine Weile blicken sie schweigend hinunter. Die Geräusche des nächtlichen Roms treiben zu ihnen hinauf: das Hupen eines Wagens, das Lachen einer Frau, rieselnde Musik in großer Ferne.
»Kennen Sie die Stadt?«, fragt er.
»Wir haben eine Führung gemacht … das Kolosseum, die Sixtinische Kapelle, das Pantheon …«
Das »wir« in ihrem Satz trifft ihn so heftig, dass er zuerst gar nicht begreift, was sie sagt. Sie redet immer noch weiter, zählt die Sehenswürdigkeiten an ihren Fingern auf: »St. Peter, die Spanische Treppe …«
»Nun, da haben Sie die Touristenroute abgearbeitet«, meint er, als er sich wieder gefangen hat.
Sie runzelt die Stirn. »Sie halten nichts davon?«
»Darum geht es nicht«, erwidert er. »Es sind ohne Frage Wunderwerke. Aber diese Stadt hat mehr zu bieten als das.«
»Sie kennen Rom gut?«
»Ich lebe hier.«
»Wahrscheinlich gibt es wirklich eine Seite der Stadt, die ich niemals zu sehen bekomme.« Das sagt sie mit einer merkwürdigen Art von Traurigkeit, als könne sie diesen Verlust tatsächlich fühlen.
»Ja«, sagt er, »wahrscheinlich. Was ich besonders finde, würden Sie nie in einem Führer finden.«
»Zum Beispiel?«
»Nun, zum Beispiel, dass man das Forum am besten nachts besichtigt, wenn niemand sonst da ist. Und ich kenne eine Bar, wo sie den besten Jazz außerhalb von New Orleans spielen. Aber wahrscheinlich sind Sie in der Hinsicht sehr verwöhnt, als Amerikanerin.«
»Nein«, erwidert sie. »Ich habe, glaube ich, noch nie Jazz gehört. Nicht live. Was sonst noch?«
»Ein Garten … fast vollständig hinter einer hohen Mauer verborgen, ein geheimer Ort. Außer man weiß, wie man da hineinkommt.« Er unterbricht sich. Er klingt wie ein Angeber. Das ist gar nicht seine Art.
»Würden Sie mir etwas von alldem zeigen?« Sie sagt es hastig, als habe es sie Mut gekostet, das zu fragen.
Er ist überrascht. »Ja, wenn Sie möchten.«
»Jetzt?«
»Warum nicht?«
Er weiß, dass es keine gute Idee ist. Er sollte lieber wieder hinuntergehen und sich mit den Großen und Wichtigen bekannt machen. Es könnte seine einzige Chance sein, Zugang zu diesen Leuten zu bekommen, irgendwie Verbindung zu ihnen aufzunehmen. Außerdem hat diese Situation hier draußen etwas, das ihm gefährlich vorkommt. Er hat die vergangenen zwei Jahre sehr gut auf sich aufgepasst, hat innerhalb selbst gesetzter Grenzen gelebt. Er sollte sich höflich zurückziehen. Nur dass er es einfach nicht fertigbringt.
»Also gut.«
Sie weiß gar nichts über mich, denkt er, und doch geht sie mit mir, einem völlig Fremden, hinaus in die Nacht einer unbekannten Stadt.
»Müssen Sie irgendjemandem Bescheid sagen?«, fragt er, weil ihm das »wir« wieder einfällt.
»Nein«, sagt sie, »ich bin allein.«
Sie klettern die Leiter hinunter und begeben sich in den warmen Nebel aus Zigarettenrauch, in das Gedränge der Leiber. Sie zieht bewundernde Blicke auf sich, von Männern ebenso wie von Frauen.
In der Nähe der Tür entdeckt er die Contessa, die ihn anschaut. Er glaubt zu sehen, dass sie rasch zu Stella blickt und dann wieder zu ihm. Sie runzelt ganz kurz die Stirn, als versuche sie, etwas zu begreifen. Dann wendet sie sich wieder ihren Gästen zu.
Draußen auf der Straße schimmern ihr helles Haupt und ihre Kleidung in der Dunkelheit, als zögen sie alles Licht auf sich. Sie schirmt ihr Gesicht mit einer Hand ab, als die Scheinwerfer eines herannahenden Autos sie attackieren. Der Fahrer verrenkt den Kopf, um durchs Fenster einen Blick auf sie zu erhaschen. In seinen Augen liegt Gier, und Hal empfindet beinahe so etwas wie Hass auf ihn, diesen völlig unbekannten Menschen.
Sie wendet sich zu ihm, erwartet, dass er die Richtung vorgibt. Plötzlich fürchtet er, dass nichts, was er im Programm hat, genügen könnte.
Sie spazieren durch das Forum, wo die dunklen Steine dastehen wie Wächter. Er weist auf die Überreste des Saturntempels, von dem nur noch die Säulenrippen der Vorderseite des Porticus existieren. Die Basilica Iulia. Er zeigt ihr – und er ist dankbar für das Mondlicht – ein Detail, das ihn seit jeher am meisten fasziniert: die Markierungen, die gelangweilte Zuhörer der Antike während der Gerichtsverfahren in die Steine geritzt und als eine Art Spielfeld benutzt hatten. Stella scheint sich für alles zu interessieren, doch plötzlich merkt er, dass sie zittert und sich fester in ihren Umhang hüllt.
»Ist Ihnen kalt?«
»Nein.« Sie blickt ihn von der Seite an. »Wäre es Ihnen recht, wenn wir woanders hingingen?«
»Natürlich – wieso? Gefällt es Ihnen hier nicht?«
»Doch … nein. Also schon, aber diese Stille – sie macht etwas mit einem.« Sie holt ein Blechdöschen und ein Feuerzeug aus ihrem kleinen Pompadour und nimmt sich eine Zigarette; er sieht, dass ihre Finger zittern, als sie versucht, sie anzuzünden.
»Kommen Sie.« Er nimmt ihr das Feuerzeug aus der Hand und gibt ihr Feuer.
»Danke.«
»Wohin würden Sie denn gern gehen?«
»Das ist mir egal. Irgendwohin. Wo es anders ist.«
Er führt sie in eine Bar an einem Platz, den kaum jemand kennt.
Das Lokal ist voll, selbst zu dieser Stunde. Sie tritt vor ihm ins warme Innere. Er folgt ihr und sieht die Blicke der anderen Gäste: begehrlich, neidisch, anerkennend. Mit ihrer Aufmachung und ihrem hellblonden Haar könnte sie ein Filmstar sein. Aber keine Monroe. Ihre Anziehungskraft ist weniger unmittelbar, sie liegt eher in ihrer Distanziertheit.
Kaum dass sie sich gesetzt hat, ist schon der Kellner da und erwartet ihre Bestellung.
»Was nehmen Sie denn?«, fragt sie.
»Oh, ich habe an ein Bier gedacht. Aber bestellen Sie bitte, was Sie mögen.« Wenn er das billige Bier nimmt, denkt er, kann er es sich leisten, ihr ein, zwei etwas teurere Getränke zu bezahlen. Doch zu seiner Überraschung sagt sie: »Ich nehme dasselbe.«
In der Ecke spielt ein kleines Jazztrio – Kontrabass, Saxophon, Trompete – ein so ruppiges, leidenschaftliches Stück, dass man die Vibrationen in der eigenen Brust fühlen kann. Er beobachtet, wie sie zuhört, den Kopf schräg gelegt, die Augen halb geschlossen.
Als das Bier serviert wird und sie einen Schluck davon nimmt, passt das, angesichts ihrer Garderobe und des Diamantenarmbands, für ihn so wenig zusammen, dass er lächeln muss. Sie blickt ihn an und lächelt ebenfalls.
»Was ist?«
»Sie sehen aus, als sollten Sie Champagner trinken.«
»Den hasse ich«, sagt sie. »Ich habe mich nie für ihn erwärmen können.« Sie nimmt noch einen Schluck. »Aber das hier mag ich.«
»Schön. Es ist italienisch. Ich trinke es immer hier.« Was er nicht sagt: Weil es das Einzige ist, was ich mir leisten kann.
»Seit wann leben Sie in Rom? Schon eine Weile?«
»Ja«, erwidert er. »Seit einigen Jahren.«
»Und wo waren Sie davor?«
»In London.«
»Und warum sind Sie hierhergekommen?«
Was hatte die Contessa gesagt? Es ist immer noch etwas anderes … Liebe, Flucht, die Hoffnung auf ein neues Leben.
»Ich kam hierher, um zu schreiben«, sagt er und ist überrascht über sich selbst. Das hat er noch niemandem gestanden, nicht einmal Fede. Warum hat er es jetzt gesagt, ausgerechnet zu einer Fremden? Aber vielleicht ist es gerade das – weil sie eine Fremde ist?
»Um was zu schreiben?«
»Einen Roman vermutlich.« Als Nächstes wird er zugeben müssen, dass er, abgesehen von einem ersten Absatz, noch gar nichts geschrieben hat. Er muss ihr Interesse von sich weglenken. »Und Sie«, sagt er leise, »machen Sie hier Urlaub?«
»Ja.« Er wartet darauf, dass noch etwas kommt: wie lang sie bleiben wird, wo sie abgestiegen ist, wer sie begleitet – er erinnert sich an das »wir«. Eines hat er gelernt: Wenn man nur lang genug wartet, fühlt der andere sich unbehaglich oder gelangweilt und füllt die Lücke. Doch sie sagt nichts. Sie ist zu gut für dieses Spiel, denkt er. Alles, was er von ihr weiß, außer ihrem Vornamen, ist ihre Nationalität. Und selbst die ist fraglich, weil da dieser Akzent ist, diese leichte Unebenheit, die irgendetwas Verborgenes verrät.
»Und wo sind Sie zu Hause?«, fragt er.
»Zu Hause?« Für eine Sekunde scheint sie aus der Fassung gebracht.
»Ja. Woher kommen Sie?«
Komisch, aber die Frage stimmt sie offenbar nachdenklich. Das passt zu seiner Vorstellung von einem ätherischen Wesen, das aus dem Nichts auftaucht und jeden Augenblick wieder in der Dunkelheit verschwinden kann.
»Ich lebe in New York«, sagt sie.
»Und ist dies Ihre erste Reise nach Europa?«
»O nein. Aber ich habe –« Sie unterbricht sich. Und sagt dann mit sorgfältig abgewägten Worten: »Ich war schon länger nicht mehr in Europa.«
Wahrscheinlich der Krieg, denkt er. Die Amerikaner haben einige Zeit gebraucht, bis sie wieder hierherkamen.
Sie nimmt noch einen Schluck. Dabei fällt ihm etwas auf, das er bisher noch nicht bemerkt hat. Und es versetzt ihm einen kleinen Schock. An ihrer linken Hand fehlen zwei Finger: der kleine und der Ringfinger. Die Verletzung ist eindeutig alt, die Haut über den Knöcheln geschlossen, aber durch Narbengewebe entstellt. Diese brutale Lücke ist seltsam, weil die junge Frau ansonsten so vollkommen und makellos scheint. Unverhofft stellt sie die Flasche hin und sieht seinen Blick.
»Ein Unfall«, sagt sie, »als ich klein war.«
»Tat es sehr weh?«
»Wissen Sie was«, sagt sie, »das habe ich vergessen.«
Nein, das hat sie nicht, denkt er, während er sie beobachtet. Und es hat ihr schrecklich wehgetan. In diesem Augenblick begreift er zum ersten Mal Fedes Neugier, was seine eigene Vergangenheit angeht. Ihre Zurückhaltung ist quälend.
Nun blickt sie auf die Uhr, und er ahnt, was als Nächstes kommen wird. »Es ist schon spät«, sagt sie.
»Ich habe Ihnen noch nicht den Garten gezeigt«, erwidert er, bevor sie erklären kann, dass sie jetzt gehen muss. Er hat keine Ahnung, was er ihr jetzt zeigen könnte. Aber das ist egal. Wichtig ist allein, dass sie nicht geht. Dass der Abend mit seinem seltsamen Zauber noch nicht zu Ende ist. Der Gedanke an seine dunkle, leere kleine Wohnung ist plötzlich mehr als unattraktiv – er macht ihm beinahe Angst.
Zu seiner Erleichterung ist sie einverstanden. Er zeigt ihr den Eingang zu dem Garten, eine schmale Tür in einer unauffälligen alten Ziegelmauer. Fede hat ihm von diesem Ort erzählt. Niemand weiß, wem der Garten gehört, erklärt er ihr jetzt, und wer sich darum kümmert. Es wüssten so wenige, dass er ein wahres Refugium sei.
In dem Garten wachsen Clementinen- und Orangenbäume, die jetzt voller reifer Früchte hängen. Zwischen ihnen stehen Statuen: Putten, mit Efeu bewachsene gesichtslose Göttinnen, einige so dicht umwunden, dass sie aussehen, als hätte das Efeu sie halb verschlungen. Und dann, an der hinteren Mauer, das eigentlich Besondere. Ein prächtiges Fresko mit Obstbäumen, wie ein Spiegelbild des Gartens, und dazu blasse Nachtigallen und ein mitternachtsblauer Himmel. Nur wenige Einzelheiten sind im Mondlicht zu erkennen, aber er hört, wie sie bei dem Anblick die Luft anhält. Mit einem Mal hätte er Lust, sie tagsüber hierherzuführen, damit sie die Farben sehen kann. Der Hintergrund des Freskos ist von einem Blau, das ganz besonders antik aussieht, als ob es nicht zu dieser heutigen Welt gehörte; die Farbe scheint sich in der Vergangenheit verloren zu haben. Fede behauptet, das Fresko sei original römisch, könnte also durchaus alt sein. Es könnte auch eine mittelalterliche Imitation der Antike sein, aber immer noch älter als die Altertümer manch anderer Städte.
Er zeigt auf den echten Clementinenbaum. »Möchten Sie eine?«
»Ja, gern.«
Als er ihr die Frucht reicht, berühren ihre Finger sich für einen Moment, und auf seiner Haut fühlt es sich an wie ein Brandzeichen. Und das ändert alles für ihn. Er hat diese spezielle Art der Erregung schon so lange nicht mehr gespürt und gedacht, er werde es wohl auch nie mehr. Und jetzt hier … bei ihr, bei einer Frau, die er gerade erst kennengelernt hat? Das ergibt keinen Sinn.
Er sieht zu, wie sie die Schale in einem einzigen langen Strang abpellt. »Das ist mir noch nie gelungen.«
Zum ersten Mal lächelt sie.
Das Fruchtfleisch ist kühl von der Luft und unglaublich süß. Und als er zusieht, wie sie ihre Clementine isst, würde er gern den Saft auf ihrem Mund kosten. Bei dem Gedanken wird ihm wieder ganz heiß. Er merkt, dass sie ihn beobachtet. Und er dankt Gott, dass sie nicht wissen kann, was er denkt.
»Wo sind wir eigentlich?«, fragt sie. »Ich habe die Orientierung verloren.«
»Auf dem Aventin. Es ist einer meiner Lieblingsorte.« Er hat so etwas Erhabenes, Abgeschiedenes. »Das Forum ist da hinten.« Er zeigt in die Richtung. »Und da drüben, auf der anderen Seite des Flusses, da lebe ich – in Trastevere.«
»Und wie ist es da?«
»An einigen Ecken ziemlich schön – aber da wohne ich leider nicht. Trastevere hat … Charakter, glaube ich. Manchmal sind die Straßen so schmal, dass man das Gefühl hat, die Hausmauern würden sich tatsächlich auf einen zubewegen. In gewisser Weise leben da die echten Menschen. Da ist das echte Rom. Damit meine ich Leute, die sich nicht eine Villa auf dem Aventin oder eine Wohnung in der Nähe der Spanischen Treppe leisten können.« Wieder springt ihm das Funkeln der Diamanten ins Auge. Wahrscheinlich gehört sie zu dem kleinen Club von Menschen, die das können.
»Ich würde es gerne sehen.«
»Wirklich?«
Sie nickt.
Und als sie durch die Straßen gehen, sieht er, wie sie alles in sich aufnimmt: die Enge der kopfsteingepflasterten Gassen, die Häuser mit den geschlossenen Fensterläden und den über der Straße aufgespannten Wäscheleinen, die Katze, die durch die Schatten schleicht. Der kürzlich niedergegangene Regen glänzt auf dem Boden wie verschüttete Tinte.
»Das gefällt mir.« Es kann nicht ihr Ernst sein. »Und wo wohnen Sie nun?«
»Zufällig nicht weit von hier.«
»Würden Sie es mir zeigen?«
Vielleicht missversteht er sie … und doch glaubt er es nicht. Alles, was ihm einfällt, ist: »Sind Sie sicher?«
Ganz kurz scheint sie zu schwanken. Doch dann fasst sie sich. »Ja.«
Er hat den deutlichen Eindruck, dass sie eine Art Wette mit sich selbst eingegangen ist. Er kann nicht glauben, dass so etwas für sie normal ist. Und doch liegt über dem ganzen Abend eine Art Zauber – ein Abend, an dem »normal« nicht mehr existiert.
»Die Wohnung ist sehr klein«, sagt er. Er nimmt nie jemanden mit dorthin: Es handelt sich im Grunde um eine Bruchbude. »Vielleicht sollten wir woanders hingehen?« Er überlegt. In ein Hotel? Nicht in ihr Hotel, aber vielleicht ein anderes, anonymes …
»Nein«, sagt sie. »Nehmen Sie mich mit zu sich.«
Erneut kommen ihm Zweifel. Sie scheint – wie soll er es formulieren? – ein wenig angespannt. Ihr selbstbewusstes Verhalten kann ihn nicht täuschen. Vielleicht wäre es das Vernünftigste, wie ein Gentleman vorzuschlagen, sie zu ihrem Hotel zu begleiten, und sich an der Rezeption zu verabschieden. Aber das übersteigt sein Vermögen. Er ist so voller Verlangen, schon halb benommen davon. Dieser fühlende Teil in ihm, der so lange nicht existent war, ist wieder zum Leben erwacht.
Sie reden nicht miteinander, als er sie durch die wenigen Straßen bis zu seiner Wohnung führt, und sie gehen mit zwei Schritten Abstand hintereinander, als würde eine unsichtbare Macht es ihnen diktieren.
Seine Wohnung ist in einem schlimmeren Zustand, als er wahrhaben wollte: Die Espressokanne hat einen sirupartigen Fleck auf dem kleinen Tisch hinterlassen; das Bett ist kaum gemacht. Mit einem Mal sieht er das Zimmer mit neuen Augen. Es ist fast leer und trotzdem unordentlich. Die nackte Glühbirne, die Stange mit der wenigen Kleidung, der Müll seines Lebens, der sich überall stapelt. Er hat hier seit Jahren so gelebt wie jemand, der eine Woche in einem Hotelzimmer verbringt.
Aber sie ist eher fasziniert als entsetzt. Er sieht, dass sie zu dem provisorischen Schreibtisch mit der tragbaren Underwood-Schreibmaschine will. In der nicht eine Seite des Romans steckt, sondern der Anfang eines Artikels für den Tiber, ein grauenhaft unkomisches Stück über einen Engländer, der das Prinzip des Risottos zu ergründen versucht. Stellen Sie sich einen Reisbrei vor, aber … Sie wird die Seite sehen und begreifen, dass der Roman ein Hirngespinst ist. Sie wird ihn bemitleidenswert finden. Er stellt sich ihr in den Weg.
»Möchten Sie …« Er blickt zur Espressokanne und überlegt, wie schnell er sie saubermachen und erhitzen kann, »… vielleicht einen Kaffee?«
»Nein, vielen Dank. Ob Sie vielleicht –«
»Was?«
»Etwas Stärkeres hätten?«
Er schenkt ihnen beiden ein Glas Whisky ein, erklärt, dass er keinen Kühlschrank hat. Das macht ihr nichts. Er sieht, wie sie ruhig ihr Glas trinkt. Sie setzt es ab, leer, und sieht ihn an.
Er blickt zurück, kann kaum atmen, als ihre Hände an ihren Halsausschnitt fassen und beginnen, die Knöpfe zu öffnen. Ihre Bewegungen wirken sicher, ihr Blick ist fest, doch dann sieht er, dass ihre Finger so heftig zittern, dass jeder Knopf einen kleinen Kampf bedeutet. Was ihn sie nur umso heftiger begehren lässt.
»Das habe ich noch nie gemacht«, sagt sie, als bedürfte es einer Erklärung.
»Ich auch nicht.« Das stimmt nicht ganz – er ist schon öfter mit einer Frau gleich am ersten Abend im Bett gelandet. Aber irgendwie nicht so. Noch nie ist er so mit allen Sinnen bei der Sache gewesen.
Sie schüttelt das Kleid von den Schultern, und jetzt steht sie vor ihm, nackt bis zur Taille. Er sieht, wie weich ihre Haut ist; an manchen Stellen hat eine ausländische Sonne sie braun gebrannt, an anderen ist sie milchweiß. Er sieht die kleine, straffe Einbuchtung ihres Bauchnabels, die dunklen Brustwarzen.
Er entledigt sich, so schnell er kann, seiner Kleider, und sie geht rückwärts zu dem unordentlichen Bett, ohne ihn aus den Augen zu lassen.
Ihm wird bewusst, und fast belustigt es ihn, dass sie sich noch gar nicht geküsst haben und doch hier voreinander stehen, zwei nackte Fremde. Es bedarf nur einer Kleinigkeit, diesen Moment zu zerstören, ihn ins Lächerliche kippen zu lassen. Aber sein Kopf ist zu voll, als dass er das Ganze begreifen könnte. Und dann streckt sie den Arm aus, und er geht auf sie zu und fühlt ihre Hände an seinem Körper, sie wandern an ihm nach unten, und sein Kopf wird völlig leer.
Später schenkt er ihnen beiden noch ein Glas ein. Sie liegt im Bett, hat das Laken über sich gezogen und beobachtet ihn. Er kommt mit den Gläsern zu ihr, und sie trinken schweigend. Er fragt sich, ob auch ihr, ebenso wie ihm, die Seltsamkeit der Situation, die Tatsache, dass sie nichts voneinander wissen, bewusst ist.
»Schreiben Sie dort?«
Er folgt ihrem Blick zu dem provisorischen Schreibtisch mit der Schreibmaschine und begreift, dass das, was sie wahrscheinlich sieht, ein romantisches Bild ist – ein falsches. Und vielleicht ist es dem Whisky, vielleicht auch seiner Ahnung geschuldet, dass sie einander wohl nie mehr wiedersehen werden, jedenfalls hat er plötzlich das dringende Bedürfnis nach Ehrlichkeit.
»Ich muss ein Geständnis machen. Ich bin kein Schriftsteller. Ich dachte einmal, ich wäre einer.«
Sie hat den Kopf auf dem Kissen gedreht und sieht ihn interessiert an.
»Eine Kurzgeschichtensammlung von mir ist veröffentlicht worden. Keine große Sache – aber es war immerhin etwas.«
Das war 1938, er war gerade fertig mit dem Studium. Es war ein sehr kleiner Verlag, und die Auflage hatte nur ein paar hundert Exemplare. Und dennoch, da war er: ein veröffentlichter Autor, und das mit einundzwanzig. Die einzige Rezension war positiv, wenn auch nicht überschwänglich gewesen. Das reichte. Er würde Zeit haben, sein Schreiben zu vervollkommnen. Sein ganzes Leben lag vor ihm. Seine Mutter war überglücklich gewesen. Sein Vater, ein Brigadegeneral, ein Held des Ersten Weltkriegs, war … nun, ein wenig amüsiert. Schön für Hal, dass er dieses Hobby hatte, bevor er sich nun ans Eigentliche machen und einen richtigen Beruf ergreifen würde, um als Mann seinem Leben Ehre zu machen. Hal wusste jedoch, dass er sein Leben lang nichts anderes tun wollte als schreiben. Er fürchtete sich davor, weil er es sich so schrecklich wünschte.
»Ich kann nicht mehr schreiben«, sagt er. »Ich habe die Fähigkeit dazu verloren.«
Zuerst kommt keine Antwort, und er glaubt schon, sie sei eingeschlafen.
»Was ist geschehen?«, fragt sie dann.
»Der Krieg«, erwidert er, weil das heutzutage ein akzeptiertes Klischee ist. Aber auch, weil der Krieg tatsächlich etwas in ihm verändert hat. Jedes Mal, wenn er seitdem zu schreiben versucht hat, überkam ihn das Gefühl, die Wörter hätten eine bestimmte Färbung, so als wären sie vom Krieg infiziert. Als ließe sich aus jedem Satz lesen: Dieser Mann ist ein Feigling, ein Hochstapler.
Aber er wird sie nicht wiedersehen, also kann er es ihr auch erzählen. »Jemand ist gestorben«, sagt er, »ein Freund. Er hat auch geschrieben. Danach hatte ich das Gefühl, ich hätte es nicht verdient, weiter zu schreiben … wenn er es nie mehr kann.« Welch eine Befreiung, es laut auszusprechen.
Sie bittet ihn nicht, genauer zu werden, und er ist erleichtert, weil er merkt, dass er kurz davor ist, ihr alles zu erzählen, und es womöglich bedauern würde.
»Sie haben Ihre Fähigkeit nicht verloren. Wenn man einmal ein Schriftsteller ist, dann steckt es für immer irgendwo in einem.«
»Wieso sagen Sie das?«
»Mein Vater war einer.«
»Kann ich von ihm gehört haben?«
»Nein«, sagt sie. »Nein, ich glaube nicht.«
»Erzählen Sie von ihm.« Doch es kommt keine Antwort, und er sieht, dass sie die Augen geschlossen hat.
2
Als er an jenem Morgen zusah, wie sie sich zum Gehen fertigmachte, vibrierte sein Körper noch von der Erinnerung an das Erlebte. In dem gnadenlos hellen Licht des frühen Morgens hatte er mit Erstaunen bemerkt, dass sie ein wenig älter war, als er gedacht hatte: einige Jahre vielleicht.
Sie war blass, unruhig, verändert. Sie hatte ihn kaum angesehen, auch nicht, als er mit ihr redete, sie fragte, ob er ihr vielleicht etwas besorgen, sie zu ihrem Hotel begleiten solle. Als sie sich hinsetzte und ihre Strümpfe hochrollte, zerriss sie sich die eine Ferse, vor lauter Eile, fortzukommen.
Das Letzte, was sie vor ihrem Aufbruch sagte, war: »Sie werden doch …«
»Was?«
»Sie werden doch niemandem davon erzählen?«
»Nein. Und Sie?«
»Nein.« Das hatte sie mit einigem Nachdruck gesagt, und er hatte sich gefragt, ob er beleidigt sein sollte.
Dann war sie gegangen, und seine Wohnung war wieder so eng, unordentlich und schäbig wie vorher. Er hatte in den zerwühlten Laken gelegen und noch die Wärme der frischen Erinnerung auf der Haut gefühlt.
Inzwischen ist sie bestimmt längst wieder in Amerika. Mit Sicherheit nicht mehr in Rom. Aber in seiner Fantasie sieht er sie immer noch vor sich. Durch das Fenster eines Cafés, in den Gärten der Villa Borghese, beim Einkaufen auf dem Campo de' Fiori.
Die wenigen geflüsterten Sätze kurz vorm Einschlafen waren das offenste Gespräch, das er seit Langem mit jemandem geführt hatte. Zuletzt vielleicht vor dem Krieg. Das war auch eines der Probleme mit Suze gewesen. Jedes Mal, wenn er zu reden versucht hatte, schien es ihr unangenehm zu sein oder, noch schlimmer, sie war gelangweilt – und er hatte nichts mehr sagen mögen. Deshalb war es ihm nie gelungen, ihr zu erzählen, was er getan hatte; ihr seine Schuld zu gestehen. Vielleicht hatte sie erraten, dass es da etwas gab, was sie nicht wissen und deshalb so entschieden auch nicht hatte hören wollen. Sie wollte in ihm den sehen, den alle in ihm sahen, den heimgekehrten Helden. Wenn man lebend und heil zurückgekehrt war, hatte man einen »guten Krieg« gehabt; man war heldenmütig. Das, was er ihr hätte erzählen wollen, passte nicht in dieses Bild.
Stella. Er merkt, dass er gar nicht nach ihrem Nachnamen gefragt hat. Allerdings bezweifelt er, dass sie ihn verraten hätte. Ohnehin hat er das Gefühl, dass sie etwas ganz Entscheidendes zurückgehalten hat, als ob sie eigentlich eine ganz andere sei. Sie hatte ihn fasziniert, diese Verschlossenheit, weil er darin etwas von sich selbst wiedererkannte. Und dann, in seiner Wohnung, hatte sie sich plötzlich geöffnet und er dachte, sie hätte ihm einen kurzen Blick auf jene verborgene Person offenbart.
Er würde so gern wieder mit ihr reden, sie noch einmal sehen. Aber zweifellos verdankte sich der ganz spezielle Zauber der Begegnung eben der Tatsache, dass sie Fremde füreinander waren.
Er kann sich nicht einmal mehr an ihr Gesicht erinnern. Ist sie wirklich so schön gewesen? Gewöhnlich hat er ein gutes Gedächtnis für Details. Er weiß noch, was sie getragen hat, aber sobald er zu ihrem Gesicht kommt, ist da nur ein blinder Fleck, als ob er zu lange in eine Lampe gestarrt hätte.
Eines steht allerdings fest, eine unbestreitbare Tatsache. Zum ersten Mal seit Jahren, Jahren der Schlaflosigkeit oder des unruhigen, gestörten Schlafs, hat er eine ganze traumlose Nacht durchgeschlafen.
Hal erfährt von Fede, dass die Contessa das Geld für ihren Film zusammen hat. Er sagt, es sei ein amerikanischer Industrieller, der sich offenbar gern mit Kultur schmücken wolle. Die Dreharbeiten hätten wohl gerade begonnen, irgendwo an der Küste und in der Nähe von Rom. Allerdings nicht in Cinecittà, sondern in einem kleinen Studio, das der Contessa selbst gehöre. Mit einem interessanten Namen: Il mondo illuminato. Die erleuchtete Welt.
Aus einer Laune heraus macht er eines Morgens einen Umweg zu dem Ort, wo die Party stattgefunden hatte. Aber das Gebäude ist komplett verrammelt und sieht fast so aus, als würde es für die nächsten fünfhundert Jahre auch so bleiben. Vielleicht sollte er sich darüber nicht wundern. Ihm war die ganze Nacht eigentlich nicht real vorgekommen.
3
März 1953
Ein früher Frühlingstag, es ist fast warm. Hal läuft am Fluss entlang zur Arbeit, und das vom Wasser reflektierte Licht blendet so, dass er die Augen zusammenkneifen muss. Die Stadt sieht, bekränzt mit Gold, herrlich wie immer aus, und doch hat er, ebenfalls wie immer, das Gefühl, er betrachte sie durch eine Glasscheibe; wie aus Distanz. Vielleicht wird es Zeit, sich wieder zu bewegen, denkt er. Vielleicht hätte er sich von vornherein weiter fort wagen sollen, hinaus aus Europa. Nach Amerika. Australien. Aber das Geld: Das ist das eigentliche Hindernis. Nordafrika könnte eher machbar sein. Irgendein Ort, wo er unerreichbar wäre, von sehr wenig leben und einen letzten Versuch mit dem elenden Schreiben unternehmen könnte. Den Kriegsroman verfassen, der das Ganze irgendwie begreiflich machen würde. Das Problem ist allerdings, dass man zuerst selbst etwas begriffen haben muss, ehe man es zu Papier bringt.
Als er das Büro betritt, hält Arlo, der Bürobote, ihn auf.
»Eine Frau hat angerufen und nach Ihnen gefragt.«
»Ach. Und wie war ihr Name?«
»Ähm.« Arlo guckt auf seinen Zettel. »Kein Name.« Und dann, entschuldigend: »Sie hat gesagt, sie sei eine Freundin – ich habe vergessen zu fragen.«
»Und wo finde ich sie?«
»Sie wohnt in einem Hotel …« Arlo sucht nach dem Namen, runzelt die Stirn, als er ihn findet. »The Hassler.«
Er überlegt. Sie könnte es sein, denkt er. Denn ihm fällt niemand anderes ein, der sich einen Aufenthalt im Hassler leisten kann. Eine erwartungsvolle Erregung packt ihn.
»Hier entlang, Sir.«
Hal folgt dem Mann in den Salon. Sein erster Gedanke ist, dass genau dieses Ambiente seinem Vater, dem Brigadegeneral, gefallen würde. Denn es erinnert ihn sehr stark an den Kavallerie-und-Garde-Club, wo sein Vater stets abzusteigen pflegte, wenn er nach London fuhr. Durch die Fenster sieht man die menschenüberlaufene Spanische Treppe. Der Raum ist nicht besonders voll und gut zu überblicken, doch er sucht vergeblich nach einem blonden Schopf.
Der Kellner führt ihn an einen Tisch in der gegenüberliegenden Ecke. Als er die ältere Person sieht, die dort mit dem Rücken zu ihm sitzt, will Hal dem Mann schon erklären, es handle sich um einen Irrtum. Das könne nicht die Frau sein, die er treffen wolle. Doch dann dreht sie sich um.
»Ah.« Sie lächelt und zieht eine Augenbraue hoch. »Sie sind also gekommen, das freut mich sehr. Ich wusste nicht, ob Sie auch an Treffen interessiert sein würden, die nicht Sie arrangiert haben.«
»Contessa.« Er nimmt ihr gegenüber Platz.
»Ich dachte, ich halte meine Einladung möglichst rätselhaft, damit Sie neugierig werden.«
»Das ist Ihnen in der Tat gelungen.«
»Haben Sie erraten, dass sie von mir kam?«
»Ähm – nein.«
Sie mustert ihn kurz und lächelt. »Sie hofften, es sei jemand anderes?«
»Überhaupt nicht.«
»Nun«, sagt sie. »Ich habe ein Angebot für Sie.«
»Ach ja?«
Ihr Lächeln wird breiter. »Aha. Nun sind Sie doch interessiert!«
»Und worum handelt es sich genau?« Als wäre er in der Position, irgendetwas abzulehnen. Aber er ist schon zu lange der Sohn seines Vaters, um nicht zu wissen, wie man sich bei Geschäften verhält.
Bevor sie antworten kann, erscheint der Kellner, um ihre Bestellung aufzunehmen.
»Bringen Sie uns die gnocchi«, bittet sie, »die Alessandro immer für mich macht.«
Der Mann nickt und verschwindet.
»So«, sagt sie, »und jetzt zum Geschäft.«
»Natürlich.«
»Mein Film, Der Kapitän zur See, wird bald zum ersten Mal gezeigt werden.«
»Ich gratuliere. Ich hatte gehört, dass die Finanzierung gesichert sei. Aber ich wusste nicht, dass er schon fertig ist.«
»Vielen Dank.«
Die gnocchi kommen. Hal kennt nur die Variante alla romana