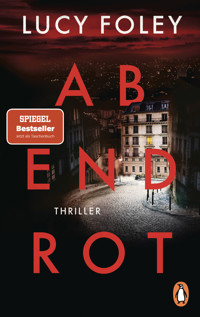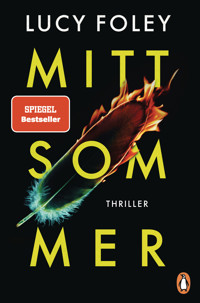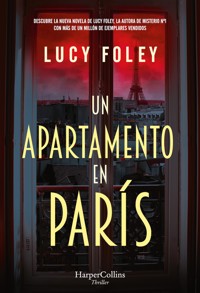9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Istanbul, 1921: Die ehemals schillernde Metropole des Osmanischen Reiches ist durch Krieg und Besatzung nur noch ein Schatten ihrer selbst. Viele Bewohner haben ihr Zuhause verloren. So auch die junge Nur, die wohlbehütet in einer intellektuellen Familie aufgewachsen ist, fließend Englisch spricht und sich am liebsten an die herrlich trägen Sommer in ihrem Haus am Bosporus erinnert.
Inzwischen lebt sie mit Mutter und Großmutter in einer kleinen Wohnung und schlägt sich mit Näharbeiten durch. Eines Tages findet sie einen Waisenjungen und nimmt ihn zu sich. Als er hohes Fieber bekommt, bringt sie ihn in ein englisches Militärkrankenhaus. Einer der Ärzte, George, kümmert sich aufopferungsvoll um das Kind, und sosehr Nur ihn, den Engländer, also einen der feindlichen Besatzer, auch verachtet – nach und nach entspinnen sich zarte Bande zwischen den beiden …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 478
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Lucy Foley
Die leuchtenden Tage am Bosporus
Roman
Aus dem Englischen von Katja Bendels
Insel Verlag
Für Al, der immer mein erster Leser ist.
Ich liebe Dich.
Siegreiche Entente in Konstantinopel!
Seit heute, dem 13. November 1918, steht Konstantinopel unter Besatzung. Das besiegte Reich der Osmanen, das den Fehler beging, sein Schicksal mit dem Deutschen Kaiserreich zu verbinden, wird sich nun den siegreichen Streitkräften der Alliierten beugen müssen.
Die britischen Schiffe erreichten das Goldene Horn, nachdem sie bereits am Dienstag die Dardanellen und mit ihnen die schicksalhaften Schauplätze der unrühmlichen Schlacht von Gallipoli vor drei Jahren passiert hatten. Es mag ein Fiasko für die Entente gewesen sein, ja, aber nicht weniger auch für die damals siegreiche osmanische Streitmacht. Es war an diesen Stränden von Gallipoli, dass sie die Blüte ihrer Jugend verschwendete, ein Verlust, von dem sie sich niemals erholte.
Kaum, dass sie das Goldene Horn erreicht hatten, stürmten die Truppen, fast 3 000 britische, gut 500 französische und 500 italienische Soldaten, umgehend an Land und besetzten Militärbarracken, Hotels, italienische und französische Schulen, Häuser und Hospitäler. Die Männer werden dort ausharren, bis die Administration der siegreichen Mächte organisiert ist und die Requirierung privater Wohnhäuser beginnen kann, damit die Ordnung in dieser von Krieg gezeichneten Stadt bald wiederhergestellt ist. Anders als die Mehrheit ihrer Kameraden werden diese Männer nicht zu ihren Familien zurückkehren, sondern Tausende von Meilen entfernt ihrer ehrenhaften Aufgabe nachkommen.
Der Feind übernimmt Stambol
Heute, am 13. November 1918, haben die Schiffe unserer Feinde unsere herrliche Stadt, die Blume unseres Reiches, eingenommen. Dieser Zug der sogenannten »Entente« straft alle Versprechen Lügen, dass sie nicht an einer Besetzung osmanischer Gebiete interessiert seien. Zum Glück haben die Osmanen schon lange gelernt, dass man dem Wort ihrer westeuropäischen Kontrahenten keinen Glauben schenken kann.
Mit Trauer in ihren Herzen verfolgten Männer, Frauen und Kinder von den Ufern unseres geliebten Goldenen Horns aus den Einzug der Schiffe. Einige der Männer hatten 1915 an den Stränden von Gallipoli beherzt gegen diese »Alliierten« gekämpft. Sie haben damals viele Kameraden verloren, und doch einen ehrenvollen Sieg davongetragen. Nun mit ansehen zu müssen, wie ihre einst geschlagenen Feinde ihnen hierher folgen, um Anspruch auf ihre Stadt zu erheben und sich ihrer Häuser zu bemächtigen, wenn ihnen der Sinn danach steht, ist die größte nur denkbare Demütigung.
Erster Teil
Konstantinopel
1921
Drei Jahre unter Besetzung der Westmächte
Nur
Früher Morgen. In einem Zimmer oberhalb der Schiffswerften des Bosporus schläft eine Frau. Ihr langes schwarzes Haar hat sich in der rauen See der Nacht um ihren Körper geschlungen. Sie hat vergessen, es zusammenzubinden, wie sie es normalerweise tut. Zu müde. Ein Arm liegt wie achtlos fortgeschleudert über ihrem Kopf, eine körperliche Nachlässigkeit, die sie sich am Tage niemals erlauben würde. Ihre Finger sind gespreizt, die Hand wie in einer flehenden Geste geöffnet.
Es ist still, abgesehen vom selbstgefälligen Ticken einer Uhr: eine eher klobige Konstruktion aus dunklem Holz. MADE IN ENGLAND. Ihr lautes Ticken hallt im Raum, denn neben dieser Uhr und dem niedrigen Diwan mit seiner schlafenden menschlichen Fracht gibt es nur wenige Möbel. Aber es hat einmal welche gegeben; die dunkleren Spuren auf dem Boden, die das Sonnenlicht noch nicht hat ausbleichen können, sind noch immer zu sehen. Sie stammen nicht nur von Möbeln, auch von Teppichen, viel feiner als dieses abgenutzte Ding, das übrig geblieben ist. Kelim aus Anatolien, soumak aus Persien.
Die Sonne geht auf. Sie klettert über die grünen Grasflächen am anderen Ufer des Bosporus und streicht über das Wasser wie Butter. Jetzt berührt sie Europa. Innerhalb weniger Minuten hat sie zwei Kontinente überspannt; ein tägliches Wunder. Sie vergoldet den hässlichen mechanischen Detritus der Werften. Jetzt erreicht sie das Zimmer der Schlafenden. In der muffigen Luft vollzieht sich ein weiteres Wunder: Die schwebende Staubschicht verwandelt sich in einen Schwarm tanzender Goldpartikel.
Egal wie häufig die Wohnung auch geputzt wird, der Staub bleibt. Vielleicht liegt es am Alter des Gebäudes oder daran, dass es vollständig aus Holz gebaut ist und über die Jahre Regen, brütende Hitze, Frost und Schnee ertragen hat. Es ist geschrumpft und gewachsen, hat sich gebogen und geatmet wie das lebende Wesen, das es einst war.
Mittlerweile ist das Licht lautlos die Bettlaken hinaufgewandert und hat schlafende Zehen unter einem Lüftungsschacht aus Stoff gefunden. Ein Muster aus ungeübt, aber doch ansehnlich gestickten Granatäpfeln. Ihre Farbe entspricht beinahe vollkommen den Früchten, die bald an den Bäumen in einem Garten auf der anderen Seite des Wassers reifen werden. Die roten Kerne der aufgebrochenen Früchte werden zu einem Muster und marschieren am Saum der Decke entlang; ein goldener Faden bildet die Fasern zwischen ihnen.
Jetzt erreicht das Licht die wirren Haarsträhnen. Im Schatten schienen sie schwarz – nun zeigt sich, dass sie in verschiedenen Brauntönen changieren, an manchen Stellen so leuchtend wie der goldene Stickfaden. Das Licht sammelt sich für seinen finalen Coup: den Hals zu erklimmen, die feinen Knochen des Kiefers, den leicht geöffneten Mund, den vorstehenden Bug der Nase, die Augenlider …
Nur erwacht. Rosiges Licht. Sie öffnet die Augen. Weiß. Sie setzt sich auf, verschlafen, wischt sich über den Mund. Es war eine unruhige Nacht. Was hat sie in den frühen Morgenstunden aus dem Schlaf gerissen? Ein schlechter Traum. Sie kann sich nicht mehr an die Details erinnern. Je intensiver sie versucht, ihrer habhaft zu werden, desto rascher versinken sie, wie kleine Wesen, die sich im Sand eingraben. Ihr bleibt nur das Gefühl eines nachhallenden Unbehagens. Weit beunruhigender jedoch ist dieses Gefühl des Nichtwissens. Sie steht auf, betrachtet den Tag. Jenseits der flachen Dächer kann sie das Wasser erahnen, ein helles Glitzern. Bis zum Frühstück wird sie ihre Unruhe von sich abgeschüttelt haben. Da ist sie sicher. Denn was kann einen schon an einem solchen Morgen erschüttern?
Oh. Ein Zögern. Etwas fehlt. Und nun geschieht es, wie jeden Morgen. Die Erinnerung an alles, was sich verändert hat. Sie spürt, wie das Wissen sich wieder auf ihre Schultern hinabsenkt – beinahe schon auf beruhigende Weise vertraut. Denn nun hat sie es zumindest wiedergefunden, kennt sein Gewicht. Es ist weit schlimmer als die Erfindung eines simplen Albtraums.
Im Zimmer nebenan kocht jemand Kaffee. Der Geruch ist wie der Tag selbst – eine Andeutung von Wärme und Wohlbefinden. Sie kann diesen besonderen Klang des Kupferkessels hören, als er gegen den Herd schlägt. Sie schiebt die Füße in ihre abgetragenen babouches und schlurft in den Flur hinaus. Lang nach oben gestreckt, sodass das Kinn gerade über die Kante des Herds ragt, auf dem der Kessel eine gefährliche Dampfwolke ausatmet, steht eine kleine Gestalt. Der Junge. Er blickt zu ihr auf, gefangen zwischen Stolz und Schuldgefühlen. Dann lächelt er.
Sie kann ihm nicht böse sein. Der Junge ist beinahe wie ein anderes Kind im Vergleich zu dem, der er noch vor zwei Jahren war. Oftmals findet Nur ihn morgens mit offenen Augen auf dem Rücken liegend und fragt sich, ob er sie überhaupt geschlossen oder die Nacht damit verbracht hat, eine Projektion der Schrecken an der Decke zu verfolgen. Wenigstens hat er wieder angefangen zu essen. Doch es hatte etwas Mechanisches, die Art, wie er das Essen nahm und kaute und schluckte und den Mund öffnete, um erneut etwas hineinzuschieben. Es war nichts weiter als der Instinkt eines Organismus, am Leben zu bleiben.
Lange Zeit hatte es keine Anzeichen mehr von dem Jungen gegeben, den sie einst gekannt hatte. Nur fragte sich, ob dieses Kind gänzlich von der Bildfläche verschwunden war – und niemals zurückkehren würde. Es gab Dinge, die einen Menschen vollkommen verändern konnten. Und als Kind war man formbarer, leichter zu beeindrucken; die Veränderung konnte umso verheerender sein.
Nur nimmt ihre Tasse mit hinauf auf das flache Dach des Hauses. Dies ist ihr heimliches Versteck; sie glaubt nicht, dass die anderen Bewohner des Blocks es kennen. Hier kann der Tag sie noch nicht treffen. Sie ist seine Herrin. Der Morgen ist klar, noch kühl. Doch die Hitze des Tages kündigt sich bereits an. Das Wasser schwappt und plappert unaufhörlich. Und am Horizont liegt ein Schimmern; die Wolken, die sich dort oben ballen, haben die Farbe von Safran.
Sie trinkt einen Schluck Kaffee. Er ist gut, weit besser als der, den ihre Großmutter zubereitet, die sich zu gut dafür ist, Kaffee zu kochen, und ihn jedes Mal zu heiß aufbrüht.
Der Tag ist so still wie ein Gemälde. Man kann sich kaum vorstellen, dass dort unten Bewegung herrscht, Chaos. Doch sie kann es hören: die Geräusche der erwachenden Straßen, den Ruf des Milchverkäufers, die fernen Rufe der Schauermänner am Kai, die Fischer, die ihren Fang feilbieten. Ganz in der Nähe das Rattern und Quietschen einer Straßenbahn. Aus dem nahegelegenen Viertel Pera, nur etwa zweihundert Meter nach Westen gelegen, dringt das Wimmern einer Geige – Relikt nächtlicher Vergnügungen.
Früher hätte Nur dieses Viertel, Tophane, nie als Wohnort in Erwägung gezogen. Es war ein Nirgendwo – ein Nachgedanke, der am Rockzipfel der großen Stadt hing, ein Ort, an dem verschiedene Wohnviertel zwangsläufig zusammenkamen, wo ihre Hauptstraßen aufeinandertrafen wie die losen Enden eines Seils.
Sie blickt über die Anlegestellen hinweg auf die glitzernde Weite des mit Kriegsschiffen gesprenkelten Bosporus. Von hier oben sehen sie winzig aus, als könnte man sie mit der flachen Hand wieder ins Meer zurückschieben. Sie repräsentieren drei der vier Sprachen, die Nur beherrscht. Eine vage imaginierte Zukunft in Friedenszeiten, erfüllt mit besinnlichem Zeitvertreib – Paris, London, Rom; die Lektüre der europäischen Literatur.
Der Beginn der Besetzung. Das Donnern ihrer Stiefel auf dem Kopfsteinpflaster, beobachtet von hundert Augen, die ihnen in einer – wie es für die Unwissenden scheinen mag – leeren Straße hinter verschlossenen Läden folgen: alte Frauen, junge Frauen, die sie hassen, die sie fürchten. Die Geschütztürme der riesigen hässlichen Schiffe im Goldenen Horn, die sie auf die antiken Schätze der Stadt richteten – die Ayasofya, Süleymaniye, Sultanahmet. Eine unausgesprochene und doch ohrenbetäubende Drohung.
Diese ersten Nächte, wie ein angehaltener Atemzug.
Dabei hatten sie gesagt, es würde keine Besetzung geben. Sie hatten es versprochen. Die Engländer, die Franzosen, die Italiener – beim Waffenstillstand von Compiègne, der den Krieg beendete. Selbst diejenigen, die noch nie eine Zeitung gelesen haben, selbst die, die gar nicht lesen können, wissen das. Wissen jetzt, dass sie ihnen nicht vertrauen können.
Die neuesten Demütigungen sind ein Schlag ins Gesicht: Den Männern wird befohlen, ihre roten Fese abzunehmen, die sie getragen haben, seit sie denken können. Die Frauen werden begafft, aus irgendeinem Grund vor allem dann, wenn sie den Schleier tragen.
Hier oben, auf dem Dach, hat sie gesessen, vor den Blicken verborgen, als die Soldaten der britischen Armee unter ihr durch die Straßen marschierten. Einzelne Gesprächsfetzen schwebten zu ihr herauf:
»… leben wie Tiere …«
und
»… ihre Frauen wirklich kaum besser als Huren …«
und
»… ein Mann hier kann so viele Frauen haben, wie er will …«
und
»… vielleicht hast du Glück, Clarkson, wenn die Ladys hier in diesen Angelegenheiten nichts zu melden haben …«
und
»… seht euch nur den Zustand dieses Hauses an. Kein Wunder, dass sie verloren haben.«
Wären sie auch so laut gewesen, wenn sie gewusst hätten, dass man ihnen zuhörte und verstand, was sie sagten? Nur vermutete – und das war von allen die beleidigendste Variante –, dass die Männer sich nicht weiter darum geschert hätten. Die Stadt gehört ihnen. Sie haben sogar ihren eigenen Namen für sie: Konstantinopel. Dieser andere Name stammt aus dem Reich der Bürokratie, der Kartenmacher. İstanbul, so nennen ihre Bewohner sie. So hat Nur selbst sie immer gekannt. Das ist der Ort, an dem sie aufgewachsen ist – vertraut, geliebt. Aber die Regeln werden jetzt von anderen gemacht.
Als diese Männer fortfuhren mit ihren Beleidigungen, war sie an die Kante des Daches gekrochen, wobei sie darauf geachtet hatte, außer Sichtweite zu bleiben. Sie hatte die Tasse Kaffee, die sie in der Hand hielt, gekippt und zugelassen, dass ein paar Tropfen hinunterfielen. Völlig aus dem Affekt heraus; doch sie fielen, als hätte Nur es sorgfältig geplant. Ein dicker Lieutenant, der gerade seine Mütze abgezogen hatte, um seinen kahlen Kopf ein paar Sekunden lang zu kratzen. Das beinahe vernehmbare Zischen, als die brühend heiße Flüssigkeit mit der empfindlichen Haut in Berührung kam. Sein Aufheulen, schriller als das einer Straßenkatze.
Doch damals waren sie noch mutiger gewesen. Gerüchte von Widerstand. Kühne Worte, rebellische Worte: Sie würden ihre Besatzer bei allem, was sie taten, unterminieren; sie würden ihre Lagerhäuser in Brand setzen, die Sperrstunde ignorieren, würden ihnen ins Gesicht spucken. Doch dann wurde die Demütigung alltäglich. Eine gewisse Stumpfheit setzte ein. Die Herausforderungen des Lebens kamen ihnen dazwischen, das war es. Alle schienen stillschweigend zu der Übereinkunft zu kommen, dass die beste Form des Widerstands nicht in kühnen Taten und öffentlicher Meuterei bestand, sondern darin, so weiterzumachen, als sei nichts geschehen. Sie würden sich dem Feind widersetzen, indem sie die Anwesenheit von khakifarbenen Uniformen auf den Straßen, die Armada im Goldenen Horn ignorierten. Ausgenommen der paar wenigen, muss man sagen, die im Schatten hockten und handfeste Pläne zur Vernichtung der Eindringlinge schmiedeten.
Nur blickt über den Bosporus zum gegenüberliegenden Ufer, auf die dunkelgrünen Hügel eines anderen Kontinents. Asien. Die wenigen sichtbaren Häuser zwischen den Bäumen sind so verschachtelt und filigran, als hätte man sie aus Papier ausgeschnitten. Zwischen ihnen steht ein weißes Haus, schöner als alle anderen.
Nur wird von Sehnsucht erfüllt. Vertraut, doch konzentrierter an diesem Morgen, intensiver, als sie sie bisher gespürt hat. Ein Gedanke kommt ihr in den Sinn. Warum nicht?, fragt sie sich. Was soll schon geschehen?
Sie ruft zu dem Jungen hinunter: »Ich muss ein paar Stickereien bei Kemal Bey abliefern.«
»Ich könnte mit dir kommen.«
»Nein.« Sie hat jetzt noch ein zweites Ziel für diesen Vormittag, und dort muss sie allein hingehen.
»Aber ich gehe so gerne auf den Basar.«
»Das weiß ich. Aber dort bist du wie eine Katze, die einem Geruch folgt. Letztes Mal bist du bis zum Gewürzmarkt spaziert, bevor ich bemerkt habe, dass du fort warst.« Die Erinnerung an diesen Moment bringt einen Nachhall der Panik mit sich, die sie ergriffen hat. Sie schüttelt sie ab. Er ist hier, er ist in Sicherheit, sie wird nicht zulassen, dass es noch einmal passiert. »Außerdem«, sagt sie, »warten deine Bücher auf dich, wenn ich mich recht erinnere?«
Er wirft einen sehnsüchtigen Blick aus dem Fenster auf die sonnenbeschienenen Straßen. »Es ist so warm draußen.«
»Du kannst draußen lesen, in der Sonne.«
Er öffnet den Mund, begegnet ihrem Blick, schließt ihn wieder. Sie ist jetzt so vieles für ihn. Doch in diesen Augenblicken ist sie in erster Linie seine Lehrerin.
Gare D'Austerlitz, Paris
Fast ein ganzes Menschenleben später
Der Reisende
Früher Morgen. November. Kalt, sodass der Atem dampft, blaukalt wie ein Schleier, der über allem liegt. Dieser hier ist einer der ersten Züge, die den Bahnhof verlassen. Trotz der frühen Stunde wimmelt es von Menschen. Am tabac-Kiosk wartet bereits eine kleine Schlange, um Zeitungen und Zigaretten zu kaufen. Der Bahnsteig ist überfüllt. Gut, ich mag es, Leute zu beobachten. Über mir wölben sich eiserne Rippen, das Skelett eines Monsters aus der Zeit der Industrialisierung. Ein erhabener, hallender Ort, ein Tempel der Geschwindigkeit und der Effizienz.
Es gab einmal einen anderen Bahnhof wie diesen. Vor langer Zeit.
Dort vorn stehen Geschäftsleute in einheitlichem Grau, vielleicht auf dem Weg nach Lausanne. Auf den ersten Blick wirken sie, als wären sie allesamt vom selben Schneider ausgestattet und mit Hüten und Schuhen versehen worden. Viele lesen Zeitung. Die neuesten Meldungen: Nukleartests, russische Spionageringe, Anti-Vietnam-Demonstrationen. Die Geschichte des Jetzt. Ich frage mich, was sie wohl von mir halten würden, einem älteren Mann mit einem noch älteren Koffer. Oder was sie von den Seiten, die ich in der Hand halte, denken würden, seit so vielen Jahrzehnten schon veraltet. Die beiden Artikel, der britische und der türkische, sind zusammengeheftet. Ich habe sie viele Male gelesen; einzelne Passagen kenne ich auswendig. Ehrenhafte Aufgabe. Größte nur denkbare Demütigung. Irgendwo dazwischen, zwischen diesen wenigen kurzen Absätzen, liegt der Anfang der Geschichte. Der Schlüssel, mit dessen Hilfe es vielleicht möglich sein wird, ein ganzes Leben zu verstehen.
Seltsam, wie ähnlich sie sich sind, diese Artikel; obwohl ich mir sicher bin, ihre Verfasser wären entsetzt, wenn sie das wüssten. Zwei Hälften eines Ganzen? Das Gesicht und seine Reflektion im Spiegel – jedes Detail umgekehrt, und doch im Prinzip dasselbe. Oder die zwei Pole eines Magneten, vom Schicksal dazu bestimmt, sich in alle Ewigkeit gegenseitig abzustoßen.
Wir – sie.
Ost – West.
Irgendwo in der Mitte: ich.
Jetzt folgt mein Blick einem eleganten Paar nur wenige Schritte entfernt. Er ist ein paar Jahre älter als sie. Sie trägt einen rosafarbenen Mantel, ein blasser Schock gegenüber dem Grau der Geschäftsleute und dem Tag selbst. Er trägt Dunkelblau, als solle sein Outfit den Hintergrund für ihres bieten, ihr erlauben, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Sie könnten frisch verheiratet sein, denke ich, auf dem Weg in die Flitterwochen in den Bergen. Oder vielleicht haben sie eine Liaison, laufen davon. Etwas in der Art, wie sie sich ansehen, lässt letzteres vermuten. Übermüdet und hungrig. Eine Erinnerung kommt auf. Nicht frisch und vollständig, nicht fokussiert, um vor dem inneren Auge wie die Szene aus einem Film noch einmal abgespielt zu werden, sondern hauptsächlich ein Gefühl, eine Stimmung.
Ich muss wohl starren. Der Mann sieht mich direkt an, und ich bin ertappt. Ich habe etwas gesehen, das nicht für meine Augen bestimmt war – für niemanden als die beiden Verschwörer.
Ich lege meinen Koffer neben mich auf die Bank; das Leder an den Ecken ist blass und abgenutzt.
Ich öffne ihn, um die Zeitungsausschnitte wieder an ihren Platz zurückzulegen. Während ich das tue, verberge ich das Innere des Koffers mit meinem Oberkörper vor den Blicken der Menge; eine Art Beschützerinstinkt. Denn sehen Sie, ein Teil meines Gepäcks ist ein wenig unorthodox. Neben meiner Zahnbürste, meiner Kleidung zum Wechseln, meinem Rasierzubehör, trage ich auch Fragmente meiner Vergangenheit bei mir. Falls einer meiner Mitreisenden einen Blick auf den Inhalt meines Koffers werfen konnte, so wird er oder sie mich vielleicht für eine seltsame Spezies eines Handelsreisenden halten, der sich auf antike Kuriositäten spezialisiert hat. Sie würden sich fragen, wer meiner Ansicht nach daran interessiert wäre, so etwas zu kaufen. Diese Dinge besitzen keinen Wert an und für sich. Ihr Wert als Relikte, als Beweisstücke jedoch ist unbezahlbar. Es sind Hinweise darauf, wie ein kurzes Zwischenspiel in der Vergangenheit eine ganze Zukunft gestaltet hat. Und so scheint es nur richtig zu sein, dass ich sie, diese Talismane, auf diese Reise mitgenommen habe.
Der Zug fährt jetzt in den Bahnsteig ein. Um mich herum brandet die unweigerliche Welle der Panik auf, als fürchteten meine Mitreisenden, es könnte keinen Platz mehr für sie geben, dabei halten sie alle Fahrkarten mit den Nummern ihrer Plätze in den Händen. Ich stelle fest, dass ich einen Augenblick lang wie gelähmt bin. Zum ersten Mal wird mir bewusst, was ich hier tue. Ich fürchte, so ist es schon immer mit mir gewesen: erst handeln, bei Gelegenheit dann nachdenken, bereuen. Doch jetzt habe ich plötzlich Angst. Wenn ich in diesen Zug steige, so wird mein Leben, das spüre ich, sich erneut auf eine Art verändern, die ich nicht vorherzusehen vermag.
Die Geschichte neu zu deuten, dieselbe, die vor so vielen Jahren abgebrochen wurde, hat nie einen endgültigen Abschluss ermöglicht. Mit einem Mal bin ich mir nicht mehr sicher.
Der Bahnsteig um mich herum leert sich. Ein Horn ertönt unheilverkündend. Mir bleiben etwa dreißig Sekunden.
Ein Zischen sich lösender Bremsen. Und dann stürze ich zum Zug, den Koffer ratternd hinter mir herschleifend, während die anderen Passagiere mich mit großen Augen anstarren.
Hinein durch die Tür, die der Schaffner gerade zuzieht, in den warmen Waggon.
Konstantinopel
1921
Der Junge
Vom Fenster aus blickt er Nur hanım nach, als sie am Ende der Gasse in die breitere Durchgangsstraße mit seinen drängelnden Menschenmassen einbiegt. Seltsam, auf ihn wirkt sie immer so kraftvoll. Doch jetzt sieht er, dass sie im Vergleich zu anderen Leuten nicht sehr groß ist. Tatsächlich wirkt sie neben vielen von ihnen eher klein, auch durch die schwere Tasche mit den bestickten Stoffen an ihrer Hüfte, deren Gewicht sie ein wenig schwanken lässt. Auf eine komplizierte Art bereitet ihm das Sorgen. Er folgt ihr mit seinen Blicken, als wären sie ein Mantel, der sie vor Unheil schützen könnte, bis sie nicht länger zu sehen ist.
Er weiß genau, was er jetzt tun wird, und es hat nichts mit der Lektüre seiner Schulbücher zu tun.
Er ist immerzu hungrig. Als der Krieg kam, vergaß die Stadt, die Menschen, die in ihr lebten, mit Lebensmitteln zu versorgen. Einst hatte es überall etwas zu essen gegeben. Hinter jeder Ecke ein neuer Geruch: die süße Hefe der simits, hoch aufgetürmt und mit Sesam bestreut, das salzige Kochwasser gefüllter Muscheln, die über dem Feuer gegart wurden, die gebratenen Makrelen, die in dicke Brotrollen geschoben wurden, das Aroma verbrannten Zuckers, das von der offenen Tür einer pastane herbeischwebte, der scharf-würzige, unbotmäßige Geruch gekochter Schafköpfe.
Manchmal reichte es schon, diese Düfte, so überwältigend, dass es einem beinahe schien, als würde man sie essen, wenn man nur nahe genug herankam, einfach nur einzuatmen. Manchmal war es notwendig, sich von ein paar Notfall-piastres – nur für den Fall größter Not – zu trennen und auf dem Weg zur Schule mit seinen Freunden einen warmen simit zu teilen.
Der Stolz, mit dem die Verkäufer ihre Waren präsentierten: frisch geschälte Mandeln, vom bademci, dem Mandelverkäufer, auf einem glitzernden Kuchen aus Eis drapiert; die sauren grünen Pflaumen, die man nur zwanzig Tage im Jahr essen konnte, sorgfältig in kleine Papiertütchen verpackt. Eine gigantische Pyramide aus prallen runden Tomaten, die nach der Sonne selbst rochen und schmeckten.
Als der Krieg kam, verschwand all dies. Nicht sogleich. In den ersten Wochen gab es bloß ein bisschen weniger. Zuerst waren es die Essensstände an den Straßen, sie verschwanden allmählich aus der Stadt wie ein Detail aus einem alten Gemälde. Dann die Bäckereien. Anfangs war das Brot einen Tag alt. Dann eine Woche, dann zwei Wochen. Dann verschwand es ganz.
In dem abgebrannten Haus hatte er drei Tage lang nichts gegessen. Er war im Dunkeln geblieben und hatte darauf gewartet, dass es ihn holte. Als sie ihn fand, wäre er nicht in der Lage gewesen, allein dort hinauszugehen – er hatte nicht einmal die Kraft, seinen Kopf vom Boden zu heben. Jetzt ist es, als hätte der Hunger einen Weg tief in sein Innerstes gefunden, dort Wurzeln geschlagen. Und selbst jetzt, da es mehr zu essen gibt, geht der Hunger nicht fort. Selbst nachdem er etwas gegessen hat, ist das Gefühl noch da und nagt an seinen Eingeweiden. Er denkt pausenlos ans Essen; er träumt davon.
Die anderen Frauen sind im anderen Zimmer: die alte und die, die niemals spricht. Durch den Spalt unter der Tür hindurch dringt Tabakrauch. Der Rauch riecht nach verbrannten Dingen, spricht von der Zeit davor. Er wird jetzt nicht daran denken. Das Wichtige ist, dass sie beschäftigt sind. Das gibt ihm Zeit, die Küche zu erkunden.
Diese Erkundungen sind nie besonders einträglich. Eine alte Zwiebel vielleicht, schon weich. Er isst sie wie einen Apfel. Die Erinnerung in seinem Mund schmeckt exakt so, wie der Schweiß eines Mannes riecht. Oder vielleicht ein Kanten Brot, mit der weiß-grünen Blüte des Schimmels. Und Spinnweben, wenn es in irgendeinen schwer zu erreichenden Spalt gefallen ist, aus dem nur ein Arm so dünn wie seiner es wieder herausholen kann.
Doch jetzt, da er tiefer in die dunklen Winkel greift als jemals zuvor, streifen seine Finger über etwas Neues. Nur mäßig neugierig zieht er es heraus. Ein Buch. Für ihn ist es nicht von besonderem Interesse; man kann es nicht essen. Bücher bedeuten Schule und Mühen. Doch für dieses hier spricht, dass es von ihm allein gefunden wurde.
»Hallo«, sagt er.
Ein Geheimnis umgibt dieses Buch. Er trägt es hinüber in den Lichtkegel der Straßenlaterne, um es genauer zu betrachten. Es ist selbstgemacht, nicht gedruckt, geschrieben in einer Handschrift, die ihm vage vertraut ist. Keine Bilder – eine Enttäuschung. Er hat wenig Geduld für Wörter. Er weiß, dass er nicht dumm ist, aber Wörter können ihn austricksen, können sich unter seinen Blicken verändern.
Eine Weile starrt er auf das Buch, kaum bemüht, es zu entziffern, schon bereit, es aufzugeben. Dann erweckt ein Wort seine Aufmerksamkeit, als hätte der Lichtschein selbst dessen Bedeutung aus der Seite hervorgesogen: Hühnchen. Ihm läuft das Wasser im Mund zusammen. Er liest das nächste Wort: Walnüsse. Es ist schon jetzt, dank dieser zwei Wörter, das spannendste Buch, das er je in seinen Händen gehalten hat.
Mit aller Konzentration, frustriert von der eigenen Langsamkeit, entziffert er auch die übrigen Wörter. Paprika – das kennt er, es ist das leuchtende Pulver, das aus den gleichnamigen Früchten gewonnen wird. Diese Wörter beschreiben etwas. Ein Gericht. Paprika-Hühnchen mit Walnüssen. Er kann es sich vorstellen, ja. Er schließt die Augen und beschwört unter großen Mühen seiner Vorstellungskraft den Geschmack herauf. Das zarte Fleisch, den leicht bitteren Geschmack der Nüsse, das süß-rauchige Aroma des Gewürzes.
Die Vorstellung dieses Gerichts in seinem Kopf ist eine Art angenehme Qual. Es ist fast so gut, wie es zu essen. Natürlich fehlt anschließend das Gefühl eines vollen Magens. Doch dieses Gefühl kennt er ohnehin kaum, kann sich nicht daran erinnern, wann er sich zum letzten Mal von dem, was er zu essen bekam, vollständig gesättigt gefühlt hat.
Die Magie des imaginierten Mahls ist vorbei.
Er blättert weiter, um die nächste Köstlichkeit zu entdecken. Hühnchen – das ist einfach, er hat das Aussehen des Wortes jetzt im Kopf. Hühnchen mit … er kneift die Augen zusammen und starrt auf das Wort. Feigen. Das ist die beste Zeit des Jahres, wenn der Baum auf dem Schulhof seine Früchte freigibt. In der Zeit des größten Hungers waren sie ihm alles. Nicht so sättigend wie Brot, doch besser als die Häute der Auberginen, die er aus den Mülltonnen herausfischte. Es gibt zwei Sorten von Feigen: weiß und lila. Letztere sind größer, doch die weißen haben einen feineren Geschmack. Kleine duftende Bissen. Die mag er am liebsten. Leider mögen auch die Vögel sie am liebsten. Einmal, nach der Schule, hätte er vor Enttäuschung beinahe geweint, als er feststellen musste, dass sie sich so viele bereits vor ihm geholt hatten. Und sie waren so verschwenderisch. Oft aßen sie nur einen Teil der Frucht und ließen den Rest einfach hängen, wobei er trocken wurde oder verfaulte. Die Hälfte ihres Diebesguts verteilten sie auf dem Boden. Diese Reste nahm und aß er oder steckte sie sich in die Taschen.
Er liest weiter; ihm läuft das Wasser im Munde zusammen, sein Magen protestiert, sein Kopf ist voll unmöglicher Fantasien.
Nur
Die Verhandlungen mit dem Stoffhändler sind schwierig. »Jede Woche kommt eine andere Frau mit der gleichen Geschichte wie Sie, hanım. Mächtige Familien, die alles verloren haben, der Armut anheimgefallen sind. Und sie alle zeigen mir wunderschöne Arbeiten.«
»Aber ich bin als Erste zu Ihnen gekommen – das muss doch etwas gelten?«
Er scheint sie nicht gehört zu haben. »Die Russen! Sie kommen direkt von den Schiffen, mit riesigen Bündeln auf ihren Rücken. Seide aus Paris, die feinsten Kaschmir-Tücher. Was für arme Schlucker: keine Heimat, keine Zukunft. Sie können sich noch glücklich schätzen, hanım. Anderen geht es weit schlechter als Ihnen. Wir alle haben viel verloren.«
Es ist wahr. Jeden Tag kommen neue Menschen an, die vor den Folgen des großen Krieges, vor der Revolution in Russland fliehen. Enteignet, verzweifelt. Regelmäßig herrscht Chaos an den Docks, wenn die riesigen Schiffe mit ihrer menschlichen Fracht anlegen. Einige sickern in das System der Flüchtlingscamps der Besatzungsmächte. Andere werden von der Stadt verschluckt und verschwinden, ohne nennenswerte Spuren zu hinterlassen. Doch sie hofft, dass der Stoffverkäufer den langen Blick sieht, den sie über seinen Stand schweifen lässt, der mittlerweile viermal so groß ist wie früher, über das hübsch restaurierte Schild mit seinen goldenen Schriftzeichen, den wunderschönen silbernen Samowar, von dem er sich weigert, ihr Tee anzubieten.
Als sie den Basar verlässt, sieht sie Soldaten billigen Tand kaufen. Es reicht ihnen nicht, diese Stadt zu besetzen, sie wollen ein Stück davon mit nach Hause nehmen. Ein Souvenir. Eine Kriegstrophäe. Exotisch, aber harmlos wie ein Tanzbär mit Maulkorb. Ihre bestickten Stoffe werden in einer Kiste landen, werden die lange Reise quer durch Europa antreten, um Kommoden und Tische in London und Paris zu schmücken. In optimistischeren Momenten betrachtet sie es als ihre eigene Art der Kolonisierung.
Die Uniformen der Männer sind sauber, doch Nur sieht sie mit Blut getränkt. Wie viele Männer hast du getötet?, fragt sie stumm einen sonnenverbrannten Jungen, während er mit dem wenig überzeugenden Gehabe eines Experten einen falschen Klumpen Bernstein gegen das Licht hält. Und du? – einen fetten Offizier, der ein paar paillettenbesetzte babouches für Damen betatscht – hast du meinen Ehemann abgeschlachtet, in Gallipoli? Meinen Bruder, in dem unbekannten Ödland, in dem wir ihn verloren haben?
Jeden Tag denkt sie an Kerem, ihren vermissten Bruder. Überall wird sie an ihn erinnert – besonders im Klassenzimmer, wo er es sein sollte, der vor den Schülern steht, nicht sie. Doch es geht noch sehr viel tiefer: In ihr sitzt ein körperlicher Schmerz, als hätte sie einen unsichtbaren und doch lebensnotwendigen Teil ihrer selbst verloren.
Mit dem Verlust ihres Ehemanns ist es anders. Manchmal denkt sie tagelang nicht an Ahmet – und dann plötzlich erinnert sie sich und zuckt schuldbewusst zusammen. Es ist nicht so, dass es sie nicht berührte, muss sie sich selbst erinnern. Es ist vielmehr, dass alles – er selbst, sie als seine Braut und dann für kurze Zeit als seine Frau, die Nacht, die folgte – so abstrakt, so wenig greifbar ist wie ein Traum. Einst ertappte sie sich dabei, wie sie die Kleidertruhe in der Wohnung durchwühlte und verzweifelt nach ihrem Hochzeitskleid suchte. Vielleicht würde sein Anblick ihr das Gefühl der Trauer bringen, das sie eigentlich verspüren sollte. Denn sie trauert um ihn, wie sie um den Verlust eines Fremden trauern würde. Doch dann wiederum war er genau das – selbst in den beiden Wochen als Mann und Frau, bevor er in den Krieg ging. Wenn sie an Ahmet denkt, dann denkt sie mit ehrlicher Traurigkeit: Wie schrecklich für seine Mutter. Was für eine Verschwendung jungen Lebens. Sie denkt es nicht, zumindest nicht sofort, in Bezug auf sich selbst. Zu was für einer Witwe macht sie das?
Auf dem Rückweg mit der Fähre steigt sie nicht in Tophane aus, wie sie es normalerweise tun würde, um nach Hause zu gehen. Als sie über den breiten Kanal des Bosporus fahren, beobachtet sie, wie das asiatische Ufer näher kommt, und spürt ihre Haut prickeln wie jemand, der im Begriff steht, ein Verbrechen zu begehen. Auf der anderen Seite steht, zunehmend deutlicher zu erkennen, das weiße Haus.
Sie sollte es nicht tun. Sie weiß, dass es zu nichts Gutem führen kann. Doch ihr Instinkt hat den Verstand überwältigt.
Das Schlimmste war, dass sie es sich nahmen und nicht nutzten. Die finale Demütigung, es Staub ansetzen zu lassen wie das Skelett eines Menschen, dem die Riten der Bestattung versagt wurden.
Ihr Vater hatte das Haus einmal – auf seine eigentümliche Art – als eine Frau beschrieben, die sich neben dem Wasser niedergelassen hatte, um ein wenig auszuruhen, doch für immer eingeschlummert war. Diese Vorstellung, so wie manche Dinge, die sie in ihrer Kindheit gehört hatte, loderte in ihren Gedanken. Selbst jetzt kann sie sich der Vorstellung der Schlafenden nicht entziehen – die Baumgruppe, die ihr wildes dunkles Haar bildet, der schmale Bootssteg wie eine Hand, die durchs Wasser streicht. Während sie sie betrachtet, steigt in Nur ein Gefühl des Verrats auf. Was für ein Luxus wäre es gewesen, all dies zu verschlafen, ohne sich im Geringsten zu sorgen? Es ist das gleiche Gefühl, wie sie es gegenüber den streunenden Katzen empfindet, die sie regelmäßig füttert. Wenn sie sieht, wie der dreifarbige Glückskater sich auf den von der Sonne gewärmten Fliesen auf dem gegenüberliegenden Dach ausstreckt, dann ist ihr bewusst, dass sie Zeugin einer Verachtung wird, die für einen Menschen – besonders für die, die hier leben – unerreichbar ist.
Sie wendet den Blick nicht von dem Haus. Als die Fähre sich bebend dem Anlegesteg nähert, ist sie sicher, eine Bewegung in einem der unteren Fenster im Erdgeschoss wahrgenommen zu haben. Das ist natürlich unmöglich – es muss eine Spiegelung gewesen sein. Das Haus ist die ganze Zeit über leer gewesen, nutzlos. Und doch ist der animalische Teil ihres Hirns beunruhigt, und sie ertappt sich dabei, wie sie nach weiteren Anzeichen von Bewegung Ausschau hält. Es muss im haremlik, in den Frauengemächern gewesen sein, dem Reich, über das ihre Großmutter geherrscht hat wie eine Königin. Nun, dieses Haus birgt so viele Erinnerungen, möglicherweise hat sie tatsächlich die Vergangenheit aufflackern sehen.
Als sie auf den Anleger hinaustritt, fühlt sie sich wie auf dem Präsentierteller und stellt sich vor, wie sie wohl auf jemanden wirkt, der sie kennt, was dieser Mensch wohl von ihrem Vorhaben erraten würde. Die Vorstellung, dass man sie bemitleiden würde, ist das Schlimmste. Weit schlimmer als das Misstrauen, das man ihr früher entgegengebracht hat. Die Unschuld ihres toten Vaters ist praktisch dadurch bewiesen, dass die Besetzer nichts getan haben, um die Familie zu würdigen oder zu belohnen. Was hatten sie noch zu verlieren, um ihre Unterstützung für das Reich zu beweisen? Einen Sohn verloren, eine Tochter zur Witwe gemacht … was noch musste geopfert werden, um nicht länger verdächtigt zu werden?
Zum ersten Mal seit langer Zeit sehnt sie sich beinahe nach ihrem Schleier, nach dem Schutz, den er bietet. Sie hält den Kopf gesenkt und verachtet sich zugleich für ihre Feigheit. Es ist nicht schändlich, was sie tut, nur ein wenig traurig.
Der Pfad zum Haus, der private, verborgene zwischen den Bäumen und Büschen hindurch direkt am Wasser entlang, liegt offen und deutlich sichtbar da. Nur hätte erwartet, dass undurchdringliches Gestrüpp den Weg mittlerweile überwuchert hätte. Hatte der Selbsterhaltungstrieb in ihr nicht vielleicht sogar gehofft, dass sie gezwungen gewesen wäre, an dieser Stelle wieder umzukehren? Nun musste sie die Sache weiterverfolgen, sie beenden.
Auch hier wird sie von unerwarteten Erinnerungen heimgesucht: Gerüche von wilder Feige, Olive, Blue Mint Bush, Farnkraut, die sich mit der salzigen Luft des Wassers mischen. Ein Druck auf ihrer Brust, ein Knoten aus Tränen, die nicht vergossen werden, der somit nicht gelöst werden kann.
Aus der Nähe verströmt das Haus weniger Magie als vom Wasser aus betrachtet. Von hier sieht man die Stellen, an denen die weiße Farbe abblättert und das alte graue Holz darunter zum Vorschein kommt, dass die alten Balkone unter dem Gewicht von mehr als einem Jahrhundert hinabsacken, dass unter den Dachvorsprüngen die fragilen Reste der Vogelnester der vergangenen Jahre hängen. Doch Nur betrachtet diese Mängel mit derselben Zärtlichkeit, mit der man die im Gesicht eines geliebten Menschen betrachtet.
Sie ist jetzt nah genug, um das Gurgeln und Klatschen des Wassers im Bootskeller zu hören, die Begleitmusik während der Stunden, die sie auf dem kleinen Steg gesessen und gelesen oder eine Leine ausgeworfen und geangelt hat, wie ihr Vater es sie gelehrt hatte. Sie war besser darin gewesen als ihr Bruder. Jedes Mal, wenn sie einen Fisch gefangen hatte, egal wie klein und stachelig, servierte Fatima ihn, sorgfältig gegart über aromatischem Holzfeuer und mit Zitrone und Petersilie angerichtet, zur nächsten Mahlzeit. Als Kind hatte Nur hier auf diesem Steg gesessen, die Füße und Knöchel ins Wasser getaucht und die sofortige Abkühlung an einem heißen Tag gespürt. Der Gedanke nimmt sie gefangen, wächst in ihr. Sie ist allein, niemand wird es sehen. Sie steigt die steinernen Stufen hinunter auf die hölzernen Planken des Steges, setzt sich, schlüpft aus den Schuhen und streckt ihre nackten Füße ins Wasser.
Manchmal erscheint ihr das alte Leben heute so fern wie etwas, das man in einem Buch gelesen hat. Aber an diesem Nachmittag ist es so nah, die Erinnerungen überfallen sie geradezu. Wenn sie darauf achtet, nicht zu den riesigen grauen Kriegsschiffen hinüberzusehen, die weiter stromabwärts sorgfältig aufgereiht liegen, könnte sie sich fast einbilden, hier in ihrer eigenen Vergangenheit zu sitzen.
Wie alt ist sie? Sie überlegt. Sie hat die Kontrolle über dieses Gedankenspiel, kann wählen. Zwölf. Die Zeit, bevor alles kompliziert wurde. Vor all den Reden über Heirat, Anstand, Krankheit und Tod. Sie ist gerade auf einen Baum geklettert … ihre Hände und Füße kleben vom Harz. Sie wird sie abwaschen, hier, in den Wellen des Bosporus, bevor sie ihre Angelleine auswirft.
Die älteren Frauen werden nach einem ausgiebigen Mittagessen in den Frauengemächern sitzen, dem haremlik. Vielleicht haben sie Besuch von Freundinnen aus der Stadt in ihren nach Pariser Mode geschneiderten Gewändern, die mit ihren Schleiern eine seltsame Kombination bilden. Oder vielleicht sind sie von weit her gekommen, aus Anatolien, traditionell in weite Seidengewänder gekleidet, die Fingernägel mit roter Farbe gefärbt. Mittlerweile werden sie tief in ihrem Klatsch und Tratsch versunken sein. Oder vielleicht haben sie eine weibliche miradju gerufen, um sie alle mit ihren Geschichten zu unterhalten. Die meisten dieser professionellen Geschichtenerzähler verlassen sich auf eine sorgfältig geschliffene Sammlung von Geschichten, von denen die meisten ihren Zuhörern bekannt sind und die sie dennoch dank des eigenen Stils und der Verzierungen des Erzählenden immer wieder erfreuen. Doch die Besten von ihnen können Geschichten spontan erfinden, Menschen und Orte direkt kraft ihrer Imagination heraufbeschwören.
Einmal erzählte Nur ihrer Mutter, dass es ihr größter Wunsch sei, eine von diesen Frauen zu werden – und erhielt prompt eine Predigt darüber, wie wichtig es sei, sich seiner Stellung in der Gesellschaft bewusst zu sein. Diese Frauen waren und blieben Verkäuferinnen – keinen Deut besser als die simit-Händlerinnen oder die Lumpenfrauen –, auch wenn sie mit Worten handelten.
Schritte, hinter ihr. Ihr Vater, der gekommen ist, um ihr beim Angeln Gesellschaft zu leisten. Oder vielleicht hat er das Backgammon-Spiel, innen mit Ebenholz, Elfenbein und Perlmutt verziert, mitgebracht. Sie dreht sich um.
Hinter ihr, am Kopf der Treppe, steht ein Mann in einem weißen Gewand. Eine Pfeife hängt ihm gefährlich weit aus dem offenen Mund. Zwischen seinen Fingern brennt unbeachtet ein Streichholz. Offenbar hat er es in seiner Überraschung vergessen.
»Beim Jupiter«, sagt er und weicht eilig einen Schritt zurück. Und dann, als die Flamme weit genug am Streichholz emporgeglommen ist, um an seinen Fingern zu lecken: »Aua!«
Ein Engländer, halb bekleidet, hier, auf der asiatischen Seite des Bosporus. Nichts davon ergibt für Nur einen Sinn: Sie hatte gedacht, gehofft, dass die Besetzer allein auf Pera beschränkt seien. Er starrt, sie starrt zurück. Wie zwei Straßenkatzen, denkt sie, die einander misstrauisch beäugen.
»Beim Jupiter«, sagt er noch einmal leise, als sei es das Wichtigste, überhaupt etwas zu sagen – als ob er auf diese Weise irgendeine Art von Kontrolle über diese Situation erlangen könnte. Nur kommt auf die Beine und sucht verstohlen mit den Füßen nach ihren Pantoffeln. Sie riskiert einen weiteren raschen Blick. Sie hat noch nie einen Engländer – überhaupt irgendeinen Mann – in einer solchen Aufmachung gesehen. Er trägt ein langes, sehr weites, sehr dünnes weißes Hemd; falls sie sich gestatten würde, genauer hinzusehen, würde sie feststellen, dass es ihn nicht vollkommen bedeckt.
»Also«, fragt er in scharfem Ton, »was zum Teufel treiben Sie hier?« Er setzt darauf, die Oberhand zu gewinnen, stellt sie fest. »Sie verstehen mich nicht, oder?« Er hat seinen Stolz wieder im Griff. »Das hier ist Privateigentum. Privat. Fort mit Ihnen …« Er hebt gebieterisch den Arm und weist in die Richtung des Trampelpfads. »Schsch!«
»Ich nehme an, ich könnte Ihnen die gleiche Frage stellen.«
Er weicht einen Schritt zurück.
Sie hat gelernt, besonders in dieser Zeit seit der Besetzung der Stadt, ihre Sprachkenntnis als eine mächtige Waffe zu führen.
Er verlagert sein Gewicht von einem Fuß auf den anderen – und einen Moment lang scheint er zu taumeln. Die Überraschung scheint ihm den Schwung genommen zu haben. Er wirkt ein wenig bleich, denkt sie, selbst für einen blassen Engländer – eine Zerbrechlichkeit umgibt ihn, die ihr zuvor, abgelenkt von seiner kuriosen Erscheinung und ihrer Überraschung, nicht aufgefallen ist.
Jetzt nähert sich ein weiterer Mann vom Haus her. Er ist vollständig bekleidet, und zwar in der britischen Khaki-Uniform. Nurs Magen verkrampft sich, und ihr wird bewusst, dass sie auf dem Bootssteg eingekesselt ist: diese Männer auf der einen Seite, das Wasser auf der anderen. Doch sie wird sich nicht einschüchtern lassen; schließlich hat sie nichts Falsches getan.
Irgendetwas an ihm, dem anderen Mann, kommt ihr vertraut vor. Auch er scheint sie zu kennen. Er runzelt die Stirn. Sein Blick wandert von ihrem Gesicht zu ihren nackten Füßen und wieder zurück. »Sie sind es. Die Frau mit den Büchern.«
Ja, jetzt weiß sie, wer er ist. Es ist nicht so sehr das Gesicht als vielmehr seine Stimme. Doch sie wird ihm nicht die Genugtuung gönnen, es zuzugeben. Indem sie es ihm verweigert, wird sie die Oberhand behalten. »Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen.«
Er zieht die Brauen zusammen. »Sie erinnern sich nicht? Vor nicht einmal zwei Wochen … hinter der Galatabrücke. Ich bin mir sicher, dass Sie es waren. Sie haben …« – ein Zögern, dann, triumphierend: »…ein rotes Notizbuch fallen lassen!«
Vor einer Woche. Sie war spät dran, auf dem Weg zur Schule. Es hatte quälende Verhandlungen mit dem Stoffhändler gegeben, der versucht hatte ihr einzureden, dass der Markt übersättigt sei und er ihr nur ein Drittel des üblichen Preises zahlen könne. Sie hatte die gesamte Palette aufrufen müssen – sich auf dem Absatz umdrehen und davongehen, bis er sie zurückrief. All das hatte eine gute Viertelstunde verschlungen, die sie eigentlich nicht hatte erübrigen können.
Im Klassenzimmer herrschte sicher bereits das Chaos – es scheint sich schon auszubreiten, wenn sie ihren Schülern auch nur eine Minute den Rücken zuwendet. Selbst jetzt, wo es nur so wenige sind. Nur liebt sie dafür. Doch nun erscheinen schreckliche Bilder vor ihrem inneren Auge: umgeworfene Pulte, verschüttete Tinte.
Sie konnte nicht schnell genug laufen. Das Kopfsteinpflaster in diesem Teil der Stadt ist lebensgefährlich, besonders wenn man in Eile ist. Jeder dritte Schritt schien falsch gesetzt zu sein und ließ sie nach vorn taumeln, als würde sie jeden Augenblick stürzen. Sie spürte, wie Frust in ihr aufstieg, und es gab nichts, worauf sie ihn lenken konnte, als auf die Männer, die diese unebenen Steine irgendwann in unbekannter Vorzeit verlegt hatten. Doch der Frust steigerte sich zu einer schwelenden Wut auf die Stadt im Allgemeinen, wo alles und jeder mit einem Mal des Lebens überdrüssig, gebrochen zu sein schien. Es gab zu viel Vergangenheit, zu viele Leben und Zeitalter übereinander. Wie konnte man jemals hoffen zu wachsen, voranzukommen, wenn einem der allgegenwärtige melancholische heiße Atem der Geschichte in den Nacken blies?
Sie hörte Schritte hinter sich.
»Entschuldigen Sie?« Auf Englisch.
Nur hielt den Blick gesenkt und eilte weiter. Ein weiterer Fehltritt; ihr Knöchel verdrehte sich, und ein Pfeil des Schmerzes schoss ihr Bein hinauf.
»Bakar mısınız?«
Sie zögerte, überrascht von dem Türkisch, so unbeholfen es auch klang. In diesem Augenblick des Zögerns hatte er zu ihr aufgeholt.
»Sie haben das hier verloren.«
Sie drehte sich um. Sah, als sie aufblickte, eine khakifarbene Gestalt, das Oval eines Gesichts. Für mehr hatte ihr Blick keine Zeit; sie hätte nicht sicher sagen können, ob dieses Gesicht auch Augen, eine Nase, einen Mund gehabt hatte. Denn die Sache mit fremden Soldaten ist: Man tut alles, um sie nicht ansehen zu müssen. Nicht um so zu tun, als existierten sie nicht; das wäre unmöglich. Nach drei Jahren der Besatzung sind sie so sehr ein Teil der Stadt geworden wie die streunenden Hunde, die durch die Straßen ziehen. So wie diese Hunde haben sie sie zu ihrer Stadt gemacht; sie in Besitz genommen, sich Freiheiten genommen. Man vermeidet es, sie anzusehen, um Ärger zu vermeiden. Von einem Mann könnte ein zu langer Blick als Bedrohung empfunden werden; viele sind aus geringeren Gründen in die Gefängnisse der Besatzer gewandert. Von einer Frau könnte es als Einladung ausgelegt werden.
Sie nahm das Buch, das er ihr hinhielt, auch wenn selbst das sich anfühlte wie eine Schwäche. Seine Finger berührten ihre, ein Versehen, und sie zog die Hand zurück. Es war ihr rotes Notizbuch, in dem sie ihre Schulstunden vorbereitete. Sie schob es unter den Arm zu den anderen, drehte sich um und ging davon.
Zehn Schritte später fiel ihr auf, dass sie sich nicht bedankt hatte. Nun, dachte sie. Ein kleiner Akt des Widerstands seitens der Besiegten.
»Sie waren es, nicht wahr?«
»Ja«, sagt sie. »Ich war es.« Wenn er darauf wartet, dass sie sich bei ihm bedankt, wird er lange warten müssen.
Er lächelt. Sie denkt, wie gern sie ihn schlagen möchte oder ihm vor die Füße spucken. »Wie geht es Ihrem Knöchel?«
»Meinem Knöchel geht es hervorragend.« Sie hört die Schärfe in ihrer Stimme. Vorsicht, treib's nicht zu weit. Er lächelt, doch bei diesen Eindringlingen kann sich das innerhalb von Sekunden ändern. Und dennoch weigert sie sich zu zeigen, dass sie Angst vor ihm hat, besonders hier, an diesem Ort. »Wieso sind Sie hier?«, fragt sie.
»Das hier ist ein Hospital«, sagt er. »Ich bin der Arzt hier. Dieser Mann, Lieutenant Rawlings, ist einer meiner Patienten.« Und dann, fast zu sich selbst: »Der eigentlich gar nicht hier draußen sein sollte.« Er wendet sich an die Gestalt im weißen Gewand. »Warum sind Sie hier draußen, Rawlings?«
»Ich bin hergekommen, um meine Pfeife zu rauchen. Drinnen darf ich das verdammte Ding nicht anmachen – Schwester Agnes hat sich beschwert.«
»Nun, an Ihrer Stelle würde ich schleunigst zurückgehen, sonst werden Sie sich ihr erklären müssen. Ich kann mir vorstellen, dass dies hier in ihren Augen das schlimmere Vergehen ist.«
Der Mann scheint etwas erwidern zu wollen, überlegt es sich jedoch anders. Mit geröteten Wangen löscht er seine Pfeife und macht sich mit unsicheren Schritten auf den Weg zurück zum Haus. Doch Nur sieht, dass er nicht wirklich hineingeht – er verbleibt als stummer Zuschauer am Rande des Blickfelds.
»Entschuldigen Sie bitte dieses unhöfliche Verhalten.« Die Stimme des Arztes ist jetzt weicher. »Wie Sie sehen, bekommen wir nicht sehr häufig Besuch.«
Sie weiß, dass das nur britische Heuchelei ist. Man erwartet noch immer eine Erklärung von ihr. Sie wüsste nicht, wie sie es über sich bringen könnte, selbst wenn sie der Ansicht wäre, er hätte eine Erklärung verdient. Stattdessen fragt sie: »Das hier ist ein Krankenhaus?«
»Ja. Es war einmal ein Wohnhaus, doch seine Besitzer haben es verlassen.« Ihm kommt ein Gedanke. »Möglicherweise kannten Sie sie ja?«
»Nein.« Er wartet noch immer, sie weiß es, auf ihre Erklärung. Es liegt keinerlei Drohung in seiner Stimme oder seinem Gebaren, doch die Drohung ist in die Uniform, die er trägt, hineingenäht.
»Ich habe Familie«, sagt sie, »ein Stück die Küste hinunter. Ich kenne diesen Pfad und dachte, ich folge ihm, am Wasser entlang.«
Er runzelt die Stirn. Sie ist sich ziemlich sicher, dass er nicht überzeugt ist. Und gleichzeitig vermutet sie, dass die Höflichkeit es ihm verbietet, sie als Lügnerin zu überführen.
»Wissen Sie, warum man dieses Haus verlassen hat? Was ist mit seinen Bewohnern geschehen? Ich frage, weil es sich anfühlt, als seien sie noch nicht lange fort.«
»Ich kannte sie nicht.« Sie reißt sich zusammen. »Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden …« Sie geht einen Schritt auf ihn zu. So nah wie jetzt ist sie noch keinem von ihnen gekommen, und sie spürt, wie ihr Magen sich vor Angst zusammenzieht.
Erst jetzt scheint ihm bewusst zu werden, dass er ihr den Weg ans Ufer versperrt. Er tritt zur Seite.
Langsam geht sie den Weg zurück, den sie gekommen ist. Es ist ihr gleichgültig, dass es ihm seltsam vorkommen wird, dass sie, wenn ihre Geschichte wahr wäre, in die andere Richtung weitergehen würde, am Haus vorbei, nicht in Richtung des Fähranlegers. Ihre Hände zittern; sie ballt sie zu Fäusten.
Hinter sich hört sie: »Nun, das ist jetzt alles ein wenig verwirrend …«
»Was mich weit mehr verwirrt, Rawlings, ist der Umstand, dass Sie immer noch hier draußen sind.«
Es könnte schlimmer sein, denkt sie. Man hätte auch eine Kaserne daraus machen können oder einen Nachtclub wie die, die überall in Pera, dem europäischen Viertel, wie Pilze aus dem Boden sprießen. Ein Hospital ist nicht so schmachvoll wie so etwas. Und dennoch war ihr Zuhause eingenommen worden. All ihre Erinnerungen, das intime, private Leben ihrer Familie. Erneut spürt sie den Verlust. Und dieser lächelnde Engländer mit seiner skeptischen Höflichkeit. Aus irgendeinem Grund wäre es besser, beinahe weniger beleidigend gewesen, wenn er mit der kurz angebundenen Grobheit des anderen Soldaten mit ihr gesprochen hätte.
In Gedanken sieht sie sich auf ihn zustürzen, als er zur Seite tritt, um ihr Platz zu machen, sieht sich mit beiden Händen zustoßen … sieht ihn, wie er nach hinten stolpert und in den Bosporus fällt. Sie stellt sich seine Überraschung vor, köstlich; die Demütigung seines Falls.
Sie hätte zur Fähre zurücklaufen können, bevor er selbst oder dieser Invalide Zeit gehabt hätten, zu reagieren.
Sie bringt ihre Gedanken wieder unter Kontrolle. Weiß, dass sie es niemals hätte tun können. Ihre Mutter und ihre Großmutter, der Junge, die Schule – es steht einfach zu viel auf dem Spiel. Und doch kann es nicht schaden, es sich vorzustellen. Dieser Ort, das Reich ihrer Fantasie, kann nicht besetzt werden.
George
Stabsarzt George Monroe sieht der Frau nach, als sie sich ihren Weg über den Trampelpfad bahnt – ihr Tritt ist überraschend sicher in den langen Röcken, die sie trägt. Sie wirkt melancholisch, aber das mag allein ihrer dunklen Kleidung und der Art geschuldet sein, wie sie sich gegen den Wind stemmt, der vom Wasser herüberweht.
»Die hat nicht mehr alle Tassen im Schrank, wenn Sie mich fragen«, sagt Rawlings gebieterisch. »Sah aus, als wollte sie sich in den Bosporus stürzen.«
Es erscheint ein wenig übertrieben von einem Mann, der George in den Fängen des Fiebers gebeten hat, ihm »ein Glas von dem gelbbraunen '05er« zu bringen. »Und seien Sie nicht zu geizig damit. Und sagen Sie Smythson, ich hätte gern meinen üblichen Platz am Feuer.«
Auf George hat sie vollkommen zurechnungsfähig gewirkt. Neben all den Offizieren der Besatzungsmächte, die von der Hitze und den neuen Freiheiten und der langen Zeit fern der Heimat ein wenig abgedreht waren, schienen die Einheimischen die Einzigen mit einem Bezug zur Realität zu sein, sich auf ihr alltägliches Leben zu konzentrieren.
Aber was zum Teufel hat sie hier getrieben?
Ihre Erklärung hat ihn nicht überzeugt. Er vermutet, dass sie es nicht gewohnt ist, zu lügen. Kurz denkt er an Spionage oder Sabotage, lässt den Gedanken jedoch gleich wieder fallen. Eine weniger bedrohliche Gestalt – eine Frau, die ihre Füße badet, um Himmels willen – kann er sich nicht vorstellen.
Vor einer Woche. Er kam gerade vom Barbier und war auf dem Weg zurück zur Brücke. Eine der Gestalten, die ihm entgegenkamen, bewegte sich schneller als die anderen, und sein Auge war ihr gefolgt, zuerst instinktiv, dann, als er sie deutlicher sehen konnte, aus Neugier. Man sah auf der Straße weit weniger Frauen als Männer, und diese hier rannte geradezu. Zumindest versuchte sie es – behindert von ihren langen Röcken, dem Kopfsteinpflaster, einem schwankenden Stapel Bücher. Er beobachtete sie, halb amüsiert, halb gebannt, die Schultern bereits leicht nach oben gezogen in der Gewissheit, dass das Unglück gleich folgen würde.
Er hatte gesehen, wie etwas hinuntergefallen war.
Als er ihr das Buch überreichte, sah sie ihn mit fast schon hasserfülltem Blick an. Und aus irgendeinem Grund respektierte er sie dafür.
Was für ein bemerkenswerter Zufall, derselben Frau innerhalb von nur einer Woche gleich zweimal zu begegnen … in dieser riesigen Stadt. Doch er hat bereits gelernt, dass es hier wiederkehrende Motive gibt, Begegnungen, die diese riesige Metropole zuweilen eher wie ein Dorf anmuten lassen. Einige der Gesichter darin sind ihm bereits vertraut: die Verkäufer der Makrelen-Sandwiches am Anlegesteg, die Besatzung der Fähren, ein französischer Offizier, der die gleiche Vorliebe für türkischen Kaffee zu haben scheint wie er selbst.
Er ist kein abergläubischer Mensch – er glaubt allein an das allen Dingen zugrundeliegende Chaos. Und doch ist er sich seltsam sicher, dass er ihr wieder begegnen wird.
Der neue Standort für das Lazarett der britischen Streitkräfte in Konstantinopel ist nicht der beste, aber es ist ein friedlicher Ort und wird sich als nützlich erweisen, falls es notwendig sein sollte, eine Quarantänestation einzurichten.
Das Gelände ist nicht mehr wirklich Teil der Stadt – die Bäume und Sträucher hinter dem Haus scheinen nur darauf zu warten, es sich einzuverleiben und sich wieder mit dem Wasser bekannt zu machen. Doch es gab keine Alternative. Es bedurfte eines großen, gut durchlüfteten Gebäudes, und dieses Haus war alles, was zur Verfügung stand – requiriert von den Türken. Und man durfte nicht vergessen: Im Vergleich zu einem Zelt in der Wüste war es der reinste Luxus. All die Monate an der Front in Mesopotamien, wo sich immer neue Fliegen in den Wunden gesammelt hatten, noch während man die alten fortscheuchte. Wo die Temperaturen in gottlose, unerträgliche Höhen geklettert waren, selbst im Schatten der Zeltplanen, und wo jederzeit eine Windböe voller Sand hineinfegen und alles bedecken konnte, die Nasen und offenen Münder der Männer, die zu krank waren, um die Demütigung dieser Invasion zu bemerken.
All seine Vorbehalte gegen das Haus – nicht für diesen Zweck erbaut, zu weit vom Zentrum der Stadt entfernt – schwanden bei dessen Anblick. Es ist das schönste Gebäude, das er bisher am Bosporus gesehen hat. Es ist weder das größte noch das am schmuckvollsten verzierte, doch in seiner Lage, in seiner anmutigen weißen Form, den dunklen, melancholischen Zypressen, die ringsumher aufragen, wie um es abzuschirmen, liegt eine beispiellose Eleganz.
Er hat sich gefragt, wie es wohl kam, dass es leer stand. Als er es zum ersten Mal betrat, konnte er sich des Gefühls nicht erwehren, dass seine früheren Bewohner es soeben erst verlassen hatten – dass sie jeden Augenblick zurückkehren könnten, um etwas zu holen, das sie vergessen hatten. Eine feine Staubschicht lag über den Möbeln und hing wie eine Wolke in der Luft. Offensichtlich war es längere Zeit nicht bewohnt gewesen. Doch viele Dinge schienen in der nachlässigen Art eines Menschen zurückgelassen worden zu sein, dem nicht bewusst gewesen war, dass er für immer fortgehen würde. Hier, überall, gab es Anzeichen von Leben, das mit all seinem Chaos, all seiner Eleganz geführt worden war. In den Laternen befanden sich noch die halb abgebrannten Stümpfe der Kerzen; eine schwere bemalte Vase enthielt noch die braunen Skelette von Hyazinthen. Ein das Haus umgebender Garten, in dem die menschliche Hand noch immer erkennbar ist: Jasminranken, die an einem gestrichenen Spalier entlanggezogen wurden und nun beginnen, wild zu wuchern, Strauchrosen, die an den halbmondförmig angelegten Rändern wachsen, ein Gemüsegarten, in dem riesige gelbe Kürbisse ungenutzt vor sich hin faulen und gigantische Zierspargel im Wind tanzen. Vom Ast eines der Feigenbäume hängt eine Schaukel. Und im Zentrum des Ganzen residiert der König dieses Gartens: ein gigantischer alter Granatapfelbaum. Die meisten der Früchte sind von den Vögeln aufgepickt worden oder durch die schiere Gewalt ihrer ungepflückten Reife aufgeplatzt. In ihnen glitzern noch ein paar wenige Kerne und versprechen einen späten Schatz.
Am ersten Tag, als George die Aufstellung der Krankenbetten überwachte, war er sicher, ein kleines Kind draußen weinen zu hören: das Wimmern eines dünnen Stimmchens, mal lauter und mal leiser. Bestürzt folgte er dem Geräusch hinaus in den Garten und sah die Schaukel traurig knarzend im Wind schwingen. Beinahe so – eine unheimliche Vorstellung –, als hätte eben noch jemand dort gesessen.
George ist ein Pragmatiker, ein Atheist. Und doch kann er sich der Vorstellung von Geistern nicht erwehren, die hier zurückgelassen wurden.
Im größten Zimmer des Hauses hat man die Krankenstation eingerichtet: Die Wände sind pistaziengrün gestrichen und mit Stillleben dekoriert: dunkle Trauben, die über einen Teller hängen, üppige Pfirsiche mit ihrem prachtvoll dargestellten zarten Flaum. Bei ihrem Anblick läuft dem Betrachter das Wasser im Munde zusammen. In der Mesopotamischen Wüste gab es Zeiten, in denen George von solch frischen Dingen geträumt hat – auch wenn seine Träume vielleicht ein wenig bescheidener ausfielen. Ein Kopf Salat. Ihn in die Hände zu nehmen und hineinzubeißen, wie man in einen Apfel beißen würde, und die Blätter kalt und nass auf der Zunge zu spüren: das Gegenteil all dessen, was die Wüste war. Wenn er dies nur ein einziges Mal erleben könnte, so glaubte er, könnte er alle Entbehrungen ertragen.
Der Raum verströmt eine weibliche Atmosphäre. Was möglicherweise an den Farben liegt. Er weiß wenig über das Leben der Osmanen, aber eines hat er gelernt: dass es in jedem Haus, egal wie groß oder klein, einen Bereich gibt, der allein den Frauen vorbehalten ist. Ein Gefühl unbefugten Betretens. Er weiß, wenn er in der Lage wäre, seinem Gefühl Worte zu verleihen, würde man über ihn lachen. Dies ist der Lauf der Dinge, seit Anbeginn der Zeit. Für die Sieger existiert so etwas wie unbefugtes Betreten nicht. Alles, was vor ihnen liegt, ist erobert, ist nun ihrs. Etwas anderes zu behaupten wäre beinahe Verrat.
In den Straßen lässt seine Kleidung ihn mit den anderen verschmelzen, mit allen Vor- und Nachteilen, die das mit sich bringt. Er hat gesehen, wie die Menschen hier auf die verschiedenen Uniformen reagieren, am negativsten von allen auf das Khaki der Briten. Ein mancher hat sich gewisse Freiheiten genommen. Und einige der Soldaten, viele von ihnen, betrachten es als ihr gutes Recht.
Ist das nicht die größte Schande, sich für seine eigenen Leute schämen zu müssen?