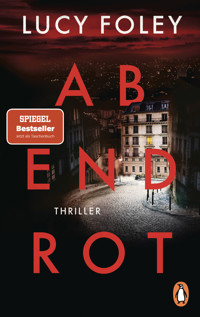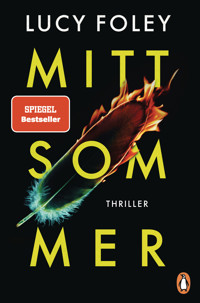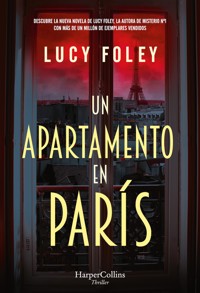9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vom alten England in die Straßencafés von Paris, über das in der Augusthitze flirrende Korsika bis ins pulsierende New York führt uns diese fesselnde Familiensaga. Sie erzählt von der Macht der wahren Liebe über Jahrzehnte, Kontinente und Generationen hinweg – und davon, wie Herzen und Familien gerade dann miteinander vereint werden, wenn sie für immer verloren scheinen. England, 1928: Alice und Tom kennen sich aus unbeschwerten Kindertagen: sie, die vor Energie sprühende junge Aristokratin, und er, der noch unbekannte Maler. Ihre Liebe fühlt sich an wie die reinste Magie – doch nicht nur Alices Familie setzt alles daran, eine gemeinsame Zukunft zu verhindern. London, sechzig Jahre später: Die junge Fotografin Kate findet im Nachlass ihrer Großmutter eine alte Porträt-Skizze, die ihrer verstorbenen Mutter verblüffend ähnlich sieht. Was hat es mit der Zeichnung auf sich? Und wer ist die Frau darauf? Um dem Geheimnis um das Porträt und um die Vergangenheit ihrer Mutter näher zu kommen, macht sich Kate auf die Suche nach dem Künstler, dem berühmten Maler Thomas Stafford … Die Stunde der Liebenden erzählt von Sehnsucht und Hoffnung, von Verlust und Schmerz, von Abenteuer und Freiheit. Davon, aus Konventionen auszubrechen und den Mut zu finden, seine Ängste zu überwinden. Und vor allem von Liebe und Nähe, die man zulassen muss, um sein Glück im Leben zu finden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 602
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
England, 1928. Alice und Tom – die lebenshungrige Tochter aus gutem Hause und der talentierte Künstler aus einfachen Verhältnissen: Sie kennen sich aus ihrer Kindheit, und jetzt hat der Zufall sie nach Jahren wieder zusammengeführt. Ihre Liebe ist die reinste Magie. Doch nicht nur Alices Familie setzt alles daran, eine gemeinsame Zukunft zu verhindern …
London, 1986. Kate, eine junge Fotografin, fängt auf ihren Streifzügen durch die Stadt das pulsierende Leben ein. Sie selbst hingegen lebt zurückgezogen, auch Familie hat sie keine mehr: Ihre Mutter war eine Waise und ist vor Jahren gestorben, ihren Vater hat sie nie gekannt. Eines Tages fällt Kate eine alte Zeichnung in die Hände, datiert auf das Jahr 1928. Und Kate traut ihren Augen kaum: Denn die Frau darauf sieht ihrer Mutter täuschend ähnlich …
In der Hoffnung, das Geheimnis um die Zeichnung und um ihre Familie zu lüften, macht Kate sich auf den Weg. Und stößt dabei nicht nur auf die Geschichte einer großen Liebe, sondern findet auch den Mut, für ihr eigenes Glück zu kämpfen.
Lucy Foley, 1986 in Sussex geboren, hat Englische Literatur in Durham studiert und ihren Masterabschluss in Moderner Literatur an der Universität in London gemacht. Sie arbeitete einige Jahre als Verlagslektorin und schrieb währenddessen ihren ersten Roman, Die Stunde der Liebenden. Lucy Foley lebt in London, bereist die Welt und arbeitet derzeit an ihrem zweiten Roman.
LUCY FOLEY
Die Stundeder Liebenden
ROMAN
Aus dem Englischenvon Christel Dormagen undBrigitte Heinrich
Die Originalausgabe erschien 2015 unter dem TitelThe Book of Lost and Found bei HarperCollins Publishers, London.
Copyright © Lost and Found Books Ltd 2015
All rights reserved
eBook Insel Verlag Berlin 2015
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des insel taschenbuchs 4407.
© der deutschen Ausgabe Insel Verlag Berlin 2015
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr.
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlagfoto: Guylain Doyle/Getty Images
Umschlaggestaltung: Zero Werbeagentur, München
Satz: Satz-Offizin Hümmer GmbH, Waldbüttelbrunn
eISBN 978-3-458-74219-7
Die Stunde der Liebenden
Das Porträt
Sie hängt jetzt in der National Portrait Gallery. Ihr Lächeln hat sich im Laufe der Jahre nicht verändert, und ihre Haare, seidig wie Katzenfell, fallen ihr immer noch bis knapp übers Kinn. Sie sitzt etwas ungeschickt da, eine Haltung, die dem Moment geschuldet ist, festgehalten für die Ewigkeit. Sie blinzelt leicht, die Augen mit der Hand gegen eine unsichtbare Sonne abgeschirmt.
Wer ist sie? Weder die Zeichnung noch das kleine Textschild daneben geben einen Hinweis. Eine Freundin des Künstlers, um 1928, Federzeichnung. Freundin ist ein schwieriges Wort – es kann so viel verbergen. Wer war sie wirklich für den jungen Mann, der sich eines Nachmittags hinsetzte und sie zeichnete, die Reste ihres Picknicks neben sich? Denn selbst dieser so begabte Künstler kann, beschränkt durch sein Medium, nur im Reich des Sichtbaren arbeiten. Einige Dinge verbleiben für immer im Dunkel der Zeit.
Erster TeilDas Werk eines Meisters
1
Hertfordshire, August 1928
Der Garten summt vor Leben. Erwartung liegt in der Luft. Hier sind Menschen, die leichtsinnige Dinge vorhaben, törichte Dinge, die sie später vielleicht bedauern. Obwohl es genau darum geht, nichts zu bedauern. Denn das Zeichen, unter dem die Party steht, ist die Jugend. Nicht alle Gäste sind jung, aber das macht nichts – mit der richtigen Haltung lässt Jugend sich leicht simulieren. Es ist die Haltung, die zählt. Sie liegt in den blassen Knien, die unter Kleidersäumen hervorblitzen, im Champagner, der aus klirrenden Gläsern schäumt, im Dschungelrhythmus der Trommeln. Vor allem aber liegt sie im Tanz – schnell, zu schnell, als dass einzelne Bewegungen zu erkennen wären, alles, was sich wahrnehmen lässt, ist eine Art hysterischer Nebel, brodelnd, glänzend von Schweiß.
Tom ist kein Tänzer. Zumindest nicht ohne vorher einige Gläser Champagner getrunken zu haben, deren erstes er gerade durstig leert. Der lange, dünne Stiel und die weite Schale mit ihrem zerbrechlichen Rand sind jedoch nicht dafür entworfen, den Inhalt hastig hinunterzustürzen, und so schafft er es, sich einen Großteil über die Hemdfront zu schütten, worauf der Stoff ihm jetzt durchsichtig auf der Haut klebt.
Tom ist überfordert. Er war noch nie auf einer solchen Veranstaltung. Sie ist von der Art, über die man sonst in den Gesellschaftskolumnen liest: die reiche, betrunkene Jugend, die sich unverschämt danebenbenimmt; »die Jungen und Schönen«. Die Presse liebt und hasst sie – sie feiert sie, sie schmäht sie, und sie weiß sehr wohl, dass sie ohne diese strahlenden jungen Menschen niemals so viele Exemplare ihrer Zeitungen loswürde. In den schattigeren Bereichen des Geländes lauern Männer mit Fotoapparaten. Bei seiner Ankunft hat Tom zwei von ihnen im Gebüsch entdeckt; auf ihn hatten sie allerdings kein Blitzlichtgewitter verschwendet. Er ist nur ein »Mitgebrachter« – der Gast seines gut vernetzten Oxforder Bekannten Roddy. Sie sind jetzt beide schon seit einem Jahr dort, und Tom ist nicht ganz überzeugt, dass ihre Freundschaft bis zum Abschlussexamen halten wird, da die beiden praktisch nichts miteinander verbindet, und doch sind sie jetzt gemeinsam hier. »Du siehst gut aus«, hatte Roddy erklärt. »Du wirst die Mädels anziehen, und dann kreuze ich auf und schnappe sie mir.«
Das Thema des Abends lautet »Arabische Nächte«. Tom trägt einen Fez und eine Art Überwurf, verziert mit Spiegelscherben und bunten Perlen. Beides hat er in einem Antiquitätengeschäft in Islington gefunden. Die Teile rochen nach Mottenkugeln und der tückischen Feuchtigkeit alter Räume, doch er war stolz auf seine Entdeckung, allerdings auch im Zweifel, ob er womöglich übertrieb.
Er hätte sich keine Sorgen machen müssen: Die anderen Gäste wetteifern offenbar im Übertreiben. Bei der Ankunft hat Robby ihm die Gastgeberin gezeigt – Lady Middlesford, in scharlachfarbenen Chiffon gehüllt, mit den Schätzen des Orients beringt und behängt und das Gesicht unter einem Schleier im selben Rot, von dem tausend metallene Schmuckstücke baumeln und wie winzige Glöckchen klingeln. Eine Frau lächelt ihn an, die unpassend blassblauen Augen rußig mit Kajal umrandet. Und an der Tür zum Garten steht eine Odaliske, der Bauch nackt bis auf einen funkelnden Rubin als Verzierung.
Sobald die beiden Männer in den Garten hinausgetreten waren, hat Roddy Tom stehen lassen, angeblich um Getränke zu besorgen, aber seitdem ist fast eine Stunde vergangen.
Eine Frau wendet sich an Tom. »Haben Sie Feuer, mein Lieber?« Ihr Akzent ist hoheitsvoll, von glasklarer Präzision, der Inbegriff englischer Oberklasse, auch wenn ihr Kostüm – weite seidene Pluderhosen und ein fuchsienfarbenes enges Leibchen – wie die reinste Scheherazade-Imitation wirkt. Ein Koboldgesicht, nicht hübsch, zu verkniffen um die Augen, mit zu langen Schneidezähnen, aber dennoch interessant. Ein androgyner Spatzenkörper und ein in Wellen gelegter Bubikopf, der gerade die Ohren bedeckt, in einem unmöglich grellen Aprikot. Dann plötzlich erkennt er sie. Er liest die Mail nicht regelmäßig, aber man müsste schon ein Einsiedler sein, um diese »Junge Schöne« nicht zu kennen. Babe Makepeace: »einundzwanzig und widmet sich allein dem Vergnügen«. Lebt, wenn die Gerüchte stimmen, von einer kümmerlichen finanziellen Unterstützung, die ihr verärgerter alter Dad ihr nur unwillig zukommen lässt. Ernährt sich offenbar von einer Diät aus Nüssen und Prärieaustern, um sich diesen so modisch schlanken Knabenkörper in dem Flapper-Fähnchen zu erhalten.
Er holt sein Feuerzeug aus der Tasche. Sie hebt die Zigarette an die Lippen, ihr lustiges kleines Gesicht zieht sich zusammen, während sie tief inhaliert.
»Sie sind ein Schatz.« Sie gibt ihm einen spielerischen Stups gegen den Arm. »Wie heißen Sie?«
»Thomas. Thomas Stafford.«
»Nun, Thomas … Tommie … möchten Sie mit mir tanzen?« Sie blickt durch die edelsteingeschmückten Schlaufen ihres Kopfschmucks erwartungsvoll zu ihm hoch.
»Das wäre wunderbar … aber vielleicht später? Ich bin kein großer Tänzer.«
»Wie Sie wollen, Tommie.« Bevor noch einer von ihnen ein weiteres Wort sagen kann, wird sie von einem anderen beherzt um die Taille gefasst und ins Gedränge der Tanzfläche gezogen. Tom hat wenig dagegen. Er ist sogar froh, dass er die exotische Fremdheit der Szenerie aus der Distanz betrachten kann. Unten am See hat gerade ein kleines Boot vom Ufer abgelegt, darin zwei Männer, die sich gegenüber sitzen, und eine Frau, die zwischen ihnen steht und lachend Champagner direkt aus der Flasche in ihre offenen Münder träufelt. Einer der Männer zieht sie auf seinen Schoß. Sie kreischt, und das kleine Boot schaukelt wie verrückt auf dem dunklen Wasser.
Er wendet sich wieder den hitzigen Tänzern zu. Er würde Babe Makepeace gern tanzen sehen, denn der Anblick scheint sich zu lohnen. Mitten in der Menge entdeckt er jetzt einen vertrauten Rotschopf: Roddy. Da ist er also. Und dann sieht er sie. So wie sie tanzt, muss er an die Bewegung eines Schwans denken, an die energische Kraft unter dem Wasser und das sanfte Dahingleiten darüber. Sie geht mit der Musik, sie bewegt sich darin, schwebt über ihr. Die nackte Haut ihrer Arme ist blass und leuchtet im Schein des Windlichts, ihr Haar ist dunkel und unterhalb der Ohren gestutzt. Selbst aus der Entfernung glaubt er zu wissen, dass ihr Nacken so weich und samten wie Katzenfell sein muss. Sie ist schlicht faszinierend. Und da ist noch etwas anderes – etwas, das über ihr bloßes Auftreten hinausgeht. Sie erscheint ihm … wie? Vertraut. Doch er bekommt dieses Gefühl des Wiedererkennens nicht richtig zu greifen.
Er versucht, ihr Gesicht genauer zu sehen. Er erhascht jedoch nur unvollständige, flüchtige Blicke. Schließlich beendet die Band ihr Stück, schrill und abrupt, und beginnt eine neue, langsamere Melodie. Die Tänzer strömen zur Bar, schweißnass, mit glasigem Blick und selig erhitzt. Und auch sie geht davon, lächelt Roddy an und schüttelt seine Hand, die auf ihrem Arm gelandet ist, höflich ab. Sie kommt in Toms Richtung, aufs Haus zu. Tom holt unsicher Luft. Soll er sich mit ihr unterhalten? Er hat kein Talent, mit Frauen zu reden. Da er Schwestern hat, sollte er eigentlich darin geübt sein, doch als Jüngsten haben sie ihn oft gepiesackt, und er hat eher den Eindruck gewonnen, Frauen seien beängstigende, überspannte Wesen.
Als sie näher kommt, sieht er, dass ihre Schönheit auf charmante Weise unvollkommen ist. Ihr Mund ist etwas zu breit für das zarte Gesicht mit der kleinen, schmalen Nase und den dunklen Augen. Sie ist größer als die meisten anderen Frauen hier und eher mager – »dürr« würde seine Schwester Rosa vielleicht sagen.
Sie ist nur noch wenige Schritte entfernt, und er weiß, dass er sie anstarrt, sie wird ihn jede Sekunde bemerken, und er wird wie ein Idiot aussehen. Gerade noch rechtzeitig senkt er den Blick. Er spürt seinen Herzschlag in den Ohren. Sie geht an ihm vorbei, geht einfach vorbei, und der silberne Stoff ihres Kleides streift sein Bein. Es ist nur eine winzige Berührung, aber jeder Nerv in seinem Körper vibriert.
»Tom?«
Zunächst glaubt er an Einbildung und blickt nicht auf.
»Aber Sie sind es doch, oder? Tom Stafford?«
Als er den Kopf hebt, steht sie direkt vor ihm, ihr Gesicht auf gleicher Höhe mit seinem. Ihre Nase ist aufs Zarteste mit Sommersprossen gesprenkelt, und ihre Augen haben eine ganz und gar ungewöhnliche Farbe, nicht dunkel, wie er dachte, sondern von einem eigentümlich quecksilbrigen Grau. Er räuspert sich. »Ja … richtig.« Seine Stimme kommt ihm komisch vor, wie ein Instrument, das in einer falschen Tonart gespielt wird. »Würden Sie mir die Frage gestatten, wie …?«
»Ach, Tom, ich kann es nicht glauben!« Ihr Lächeln ist strahlend, fröhlich. Und mit einem Mal wird aus dem beunruhigenden Gefühl des Wiedererkennens Gewissheit.
»Alice?«
Zuletzt hat Tom Alice Eversley 1913 gesehen. Da war sie sechs Jahre alt, kaum zwei Monate jünger als er. Ihre Beine waren zu lang für ihre Körpergröße, Storchenbeine mit aufgeschrammten Knien, und ihr Haarschopf glich einer wilden Bubenmähne, schwarz wie Onyx. Nicht das, was die Leute bei der Tochter der anbetungswürdigen Lady Georgina Eversley erwarteten, der strahlenden Gesellschaftsgöttin. Oder bei dem Polarforscher Robert Eversley, der auf Expeditionsfotos zwar einen mit Walfett gestriegelten Bart trug, in England allerdings stets gut rasiert und elegant gekleidet auftrat.
In jenem Sommer hatten Toms Eltern beschlossen, dass die Familie ihre Ferien in Cornwall verbringen würde. Seine Mutter, Mrs. Stafford, hatte in einem Artikel gelesen, wie wichtig die frische Seeluft für die Gesundheit von Kindern sei, und ihre jüngere Tochter Caro erholte sich gerade von einem heftigen Keuchhusten.
Mrs. Stafford und die Kinder würden zwei Monate in Winnard Cove, in der Nähe des Fischerorts Fowey, verbringen. Mr. Stafford, ein Rechtsanwalt, würde mit von der Partie sein, solange es ihm seine Arbeit erlaubte. Toms Mutter hatte die Anzeige in einer Zeitschrift entdeckt: Eyrie House, für Familien geeignet. Malerisch in einer idyllischen versteckten Bucht gelegen. Genau die richtige Bleibe für sie: mit direktem Blick aufs Meer, klein, verwittert und salzverkrustet, aber unbezwingbar. Wie versprochen, gab es unterhalb des Cottages einen langen Sandstrand, mit allerlei interessantem Treibgut übersät und gegen den Wind durch die umgebenden Klippen geschützt.
Das Einzige, was nicht ganz zutraf, war das Versprechen von Abgeschiedenheit. Die Bucht hätte ihnen gehört, wenn auf der anderen Seite nicht, halb versteckt hinter einem Bergulmendickicht, ein riesiges elisabethanisches Herrenhaus aus massivem, graubraunem Stein gestanden hätte. Das, so hatte ihre alte Vermieterin stolz verkündet, sei Eversley Hall: seit über dreihundert Jahren im Besitz derselben Familie.
Am dritten Ferientag kehrte Mr. Stafford klatschnass und mit vor Kälte und Erregung rotem Gesicht von einem Ausflug im Dingi zurück. Seine Frau und die Kinder, die gerade im Garten Tee tranken, blickten bei seiner Ankunft neugierig auf.
»Ihr glaubt ja nicht, wen ich heute getroffen habe. Lord Eversley höchstpersönlich. Hier in Cornwall. Ich kann es nicht fassen, dass ich nicht schon vorher darauf gekommen bin … Eversley Hall gehört natürlich ihm.«
Nach und nach kam die ganze Geschichte zum Vorschein. Wie sich herausstellte, hatte Mr. Stafford es fertiggebracht, das Dingi zum Kentern zu bringen, als er die Bahn einer wunderschönen Segelyacht kreuzte, was prompt zu einem ziemlichen Chaos führte. Um alles noch schlimmer zu machen, verhedderte sich bei seinem Sturz ins Wasser seine Schwimmweste in der treibenden Großschot, und es gelang ihm nicht, sich loszumachen.
Er hatte jemanden rufen gehört und plötzlich bemerkt, dass neben ihm noch ein Körper im Wasser war. Der Steuermann der Yacht war vom Boot gesprungen und hatte es seiner Mannschaft überlassen, ohne ihn zu manövrieren.
»Einfach so, hat nicht einmal gezögert, ist ins Wasser gesprungen und hat mich befreit. Er war es höchstselbst: Lord Robert Eversley. Einer der nettesten Menschen, die mir je begegnet sind.« Mr. Stafford strahlte alle an. »Er hat uns zum Abendessen eingeladen – uns alle, auch die Kinder.«
Und so waren die Staffords an jenem Abend über den Strand gelaufen und an die Treppenstufen zu Eversley Hall hinaufgestiegen, die von den vielen Vorfahren der Familie abgenutzt und rund ausgetreten waren, und schließlich an der Eingangstür von einem livrierten Butler in Empfang genommen worden. Im Innern hatte das Haus die kühle Eleganz einer Kathedrale: dunkles Holz, kostbares Glas und uralter Stein. Ihre Schritte hallten, und die ehrwürdige Aura schüchterte sie ein. Es fiel ihnen schwer, das Gefühl, nicht an einen solchen Ort zu gehören, zu ignorieren.
Doch Robert Eversley war, ebenso wie sein goldhaariger Sohn Archie, die Liebenswürdigkeit in Person. Selbst die etwas seltsame, bleiche Tochter schenkte ihnen ein schiefes Lächeln. Es schien, als bemühten sich alle auf ihre Art, den Staffords das Gefühl zu geben, ebenbürtige Gäste des Hauses zu sein.
Das heißt, alle bis auf Lord Roberts Frau. Wie Mrs. Stafford später bemerken sollte, behandelte die schöne Lady Eversley sie wie »die Dienerschaft, der man zu Weihnachten ein nettes Geschenk macht, worauf am nächsten Morgen alle wieder ihre rechtmäßige Stellung einnehmen«. Sie hatte ihnen gegenüber nicht das geringste Interesse oder Mitgefühl gezeigt, und selbst die Kinder hatten die Geringschätzung gespürt. Es hatte ein kühles Lächeln gegeben, als Mr. Stafford seinen Beruf beschrieb, eine hochgezogene Augenbraue, als Mrs. Stafford ihr Haus in Parson's Green erwähnte. »Sie ist ein grauenhafter Snob«, sagte Toms Mutter am nächsten Tag beim Frühstück vorwurfsvoll. »Sie findet, wir verschwenden ihre Zeit, und sie hat dafür gesorgt, dass wir das auch merken. Ich habe nach der ersten halben Stunde aufgegeben, mich um sie zu bemühen: Es war einfach zu anstrengend. Es ist ziemlich ermüdend, das Gefühl vermittelt zu bekommen, man sei derart minderwertig.«
Lady Eversleys reservierte Kühle war der einzige Makel eines Abends, den ansonsten alle genossen hatten. Toms Eltern hatten hingerissen Eversleys Geschichten gelauscht: von wanderndem Eis, das ein ganzes Schiff, erst recht einen Menschen, in seiner Riesenfaust zermalmen kann; von der blendenden Schönheit von Eis, so blau und hart wie die Saphire in Lady Eversleys Halskette; von Eis als klaffendem Abgrund, der, schwarz und trügerisch, Menschen in ihr Verderben locken kann.
Rosa und Caro, vierzehn und zehn, hatten den ganzen Abend lang völlig hingegeben Archie angehimmelt, der mit siebzehn groß und breitschultrig war wie ein erwachsener Mann – glücklicher Erbe sowohl des heroisch guten Aussehens seines Vaters als auch der flachsblonden Haare seiner Mutter.
Und dann war da die Tochter Alice. Toms Schwestern fassten rasch eine Abneigung gegen das seltsame, jungenhafte Mädchen mit den schrecklichen Haaren, das einer gänzlich anderen Spezies anzugehören schien als ihr sehr viel älterer Bruder. Aber Tom – Tom hatte in Alice eine verwandte Seele gefunden. Genau wie er war sie fest davon überzeugt, dass sie von ihrem Schlafzimmerfenster aus Piraten und Schmuggler sehen konnte, die über Lichtzeichen mit Verbündeten am Ufer kommunizierten. Und sie besaß eine beachtliche Sammlung von Kuriositäten, die sie bei ihren stundenlangen Streifzügen am Strand entdeckt hatte: einen Sonnenschirm; eine Brille; ein seltsam gebogenes Messer, das, wie Tom zugeben musste, eine auffällige Ähnlichkeit mit einem Entermesser in Miniatur hatte.
Während die Erwachsenen weiteraßen, entwischten Alice und Tom nach draußen und liefen im Schutz der Dunkelheit über das taunasse Gras zum Ufer, um nach verdächtigen Bewegungen auf dem Wasser Ausschau zu halten. Lord Eversley hatte seiner Tochter in einem Baum ein kleines Podest gebaut, das einen exzellenten Ausguck bildete. Dort waren sie so lange geblieben, bis Sir Robert auf Anweisung seiner Frau durch den Garten zu ihnen gekommen war und sie mit einem Lächeln in der Stimme aufgefordert hatte, zurück ins Haus zu kommen.
Während jener sechs Wochen in Winnard Cove waren Tom und Alice unzertrennlich. Sie forschten nach Piraten, jagten Krebse, bauten Unterstände aus Treibholz und kämpften sich unter den wachsamen Augen von Toms Mutter und Alices Kindermädchen tapfer durch die kalte, donnernde Brandung, um im ruhigeren Wasser weiter draußen zu schwimmen. Alice war klein für ihr Alter und fast unnatürlich blass – aber sie war stark und furchtlos, mutiger als alle, denen Tom jemals begegnet war. Sie erzählte ihm, sie wolle Abenteurerin werden, wie ihr Vater, die allererste weibliche Forscherin – und Tom zweifelte nicht daran, dass ihr das gelingen würde. Sogar damals schon konnte er sich das scharf konturierte Gesicht geschwärzt von Walfett und die kleinen Füße in pelzbesetzten Stiefeln vorstellen.
So wie es sich für alle echten Kindheitsfreundschaften gehört, schien auch diese beiden nichts jemals trennen zu können. Und Toms Eltern, ebenso interessiert an einer Wiederholung, versprachen, im folgenden Jahr wieder nach Winnard Cove zu kommen.
Doch eines Oktobermorgens, nur wenige Wochen später, fiel Mr. Stafford vor Schreck die Teetasse aus der Hand.
EVERSLEY STIRBT IM EIS DES SÜDENS
lautete die Schlagzeile. Lord Eversley war in eine von trügerisch dünnem Eis und Schnee verdeckte Gletscherspalte gestürzt und hatte dort den Tod gefunden. Die Leiche konnte nicht geborgen werden.
Die Eversleys kehrten nie mehr nach Winnard Cove zurück. Die Staffords ebenso wenig. Und dann kam der Krieg. Mr. Stafford, ein stolzer Patriot, meldete sich zum Dienst an der Front, kämpfte in Frankreich und kehrte als gänzlich veränderter Mann zurück. Aber er hatte mehr Glück als manch anderer gehabt. Archie Eversley wurde in Ypres an einem der ersten Kampftage getötet.
2
Kate
Wie soll ich meine Mutter beschreiben?
Sie war klein, aber sehr stark. Stark in dem Sinne, dass sie mit makelloser Anmut und Präzision stundenlang tanzen konnte, auch wenn jeder Muskel ihres Körpers vor Schmerz brannte, wenn das Blut ihrer zerquetschten Zehen in die Holzklötzchen sickerte, die sie stützten, selbst wenn sie, geblendet von der hellen Bühnenbeleuchtung, hochgehoben und gedreht wurde. Aber auch in dem Sinne, dass sie fähig war, ihre Situation zu akzeptieren – ausgesetzt, elternlos – und daraus Stärke zu ziehen, das wesentliche Element des June-Darling-Märchens. Die Dinge, die nur ich über sie weiß, möchte ich nicht beschreiben. Denn sie sind das, was mir geblieben ist, was ich in Ehren halten kann. Außerdem interessieren sich die Leute für das, was über das Tanzen und das Märchen hinausgeht, nicht besonders.
Ich bin mir sicher, Sie werden von meiner Mutter gehört haben. Selbst Menschen, denen das Ballett fremd ist, kennen ihren Namen – als sie starb, hatte sie diese Stufe internationalen Ruhms erreicht. Und in jener Nacht, als das Flugzeug vom Himmel trudelte, als wäre es aus Papier und Zahnstochern gemacht, in ebenjener Nacht, in der sie starb, hörten schließlich auch die wenigen von ihr, die sie bis dahin nicht gekannt hatten. June Darling, das tanzende kleine Mädchen, dem es allein durch sein Talent gelungen war, dem für sie vorgesehenen armseligen Lebensweg zu entkommen.
Meine Mutter hatte sich immer lustig gemacht über das, was sie den Mythos ihrer Herkunft nannte. So schlimm sei es nie gewesen, pflegte sie zu sagen. Sie war nie vernachlässigt oder misshandelt worden, und auch wenn sie anfangs keine echte eigene Familie hatte, so hatte sie doch bald Evie und dann mich, und wir waren ein perfektes Trio, ein eng verbundenes Dreieck der Liebe.
Zumindest muss es so gewirkt haben. In meinen heimlicheren, schamvolleren Momenten fragte ich mich allerdings, ob Evie es mir nicht eigentlich übelnahm, dass ich hinzukam und die Dinge verkomplizierte, dass ich jenes heilige Bündnis zwischen ihr und meiner Mutter störte. Habe ich irgendwelche Beweise dafür? Nicht direkt. Auch wenn ich nicht glaube, dass es unfair wäre zu behaupten, dass Evie mit mir gesprochen hat, wie sie mit meiner Mutter nie gesprochen hätte. Denn so scharf und ungeduldig wäre sie mit Mum bestimmt nie gewesen.
Irgendwann war ich ganz besessen von dem Gedanken an Großeltern – solche, wie meine Schulfreundin Georgina am Wochenende besuchte. Solche, die dir vorlesen und für dich Kuchen backen und mit dir in Ausstellungen gehen würden. Das war nicht die Beziehung, die Evie und ich miteinander hatten. Ich sagte nicht Granny zu ihr oder irgendetwas in der Art. Ich nannte sie Evie, und wir sprachen wie Erwachsene miteinander. Im Rückblick bin ich mir sicher, dass sie mich geliebt hat, aber verglichen mit dem, was sie für meine Mutter empfunden hatte, verblassten all ihre Gefühle mir gegenüber. Meine Mutter war nämlich ebenso sehr ihre Retterin gewesen wie sie die Retterin meiner Mutter, und ich glaube, dass Evie für einen anderen Menschen schlicht nicht ebenso tief empfinden konnte.
Vielleicht mochte sie mich auch nicht, weil ich sie an meinen Vater erinnerte, dem sie offenbar ankreidete, dass er durch die Schwangerschaft Mums Karriere zu Fall gebracht hatte – ungeachtet der Tatsache, dass Mum, in Kategorien des Balletts, bereits alt war, als sie mich bekam. Mein Vater hatte die Rolle des Bösewichts gut erfüllt und war beim ersten Anzeichen von Ärger von der Bildfläche verschwunden. Doch das kann man auch von einer anderen Seite aus betrachten. Wenn Sie meine Mutter gefragt hätten, hätte sie Ihnen erzählt, dass mein Vater ihr, abgesehen von seiner Beteiligung an meinem Zustandekommen, nur wenig bedeutet hatte. Wir hatten ihn für unser Leben nicht gebraucht: Wir hatten ja uns.
Meine Mutter war von den Nonnen, die die Einrichtung leiteten, in der sie seit ihrer frühesten Kindheit lebte, June getauft worden. Ich fand immer, dass ihr Name irgendwie seltsam amerikanisch klang, aber sie war – wie sie mir erklärte – nach dem Monat benannt, in dem sie in das Heim kam. Und sie hatte Glück gehabt, dort zu landen, als das Wetter mild war; wenn man sie im Februar auf der Türschwelle abgelegt hätte, wäre ihre Geschichte womöglich schon dort zu Ende gewesen.
Waisenhäuser haben keinen guten Ruf, aber dieses Haus war nicht von der Dickens'schen Sorte, und die Entbehrungen, die das Wort »Einrichtung« nahelegt, hatte meine Mutter, wie sie stets behauptete, nie erfahren. Es stimmt, dass die Verpflegung und die Möglichkeiten zur Unterhaltung nicht gerade großartig waren, doch es gab drei bescheidene Mahlzeiten pro Tag, die Kinder bekamen Unterricht, sogar Musikstunden, und sie durften in den Park. Im Vergleich zu manch anderen hatte meine Mutter es gar nicht so schlecht getroffen. Außerdem kannte sie nichts anderes.
Zwei ältere Mädchen behaupteten, sie hätten an jenem Junitag eine Frau gesehen. Das samtene Schnurren eines Motors unter dem Schlafsaalfenster habe sie sehr früh am Morgen geweckt. Sie seien aus dem Bett geklettert, um hinauszuschauen, und hätten eine Frau mit einem Bündel auf das Haus zukommen und es Minuten später ohne das Bündel wieder verlassen sehen. Sie habe nicht an der Haustür geklingelt. Die Frau habe, hatten sie später gesagt, genauso schlank und teuer ausgesehen wie das Auto, in dem sie davongefahren wurde; auf die Einzelheiten – die Farbe ihrer Haare unter dem Hut, ihre Größe, ihr Alter – konnten sie sich allerdings nicht einigen. Doch bei beiden hatte sie den Eindruck großer, außergewöhnlicher Schönheit hinterlassen.
Einmal fragte ich meine Mutter, ob sie die Nonnen geliebt habe. Sie erklärte, dass sie sich gar nicht an jede einzelne von ihnen erinnern könne, eher an deren abstrakte Güte, etwas Allgegenwärtiges, so ähnlich wie die Vorstellung von Gott, die die Schwestern ihr vermittelt hatten. Die eine Ausnahme war Schwester Rose, die aus allen anderen hervorstach. Nicht wegen irgendeiner speziellen persönlichen Eigenheit, sondern weil sie an der Gestaltung der Zukunft meiner Mutter besonderen Anteil hatte. Sie war die Schwester, die für die Musikstunden zuständig war, wofür ihr aber kaum mehr als eine Sammlung älterer Instrumente zur Verfügung stand – Schenkungen verschiedener Förderer, die in einer Holztruhe im Turnsaal aufbewahrt wurden. Jeden Freitagnachmittag wurden sie herausgeholt und außerordentlich gerecht unter den Mädchen verteilt, die ohne Anleitung darauf spielen durften.
Dann geschah etwas ziemlich Ungewöhnliches. Als meine Mutter etwa sechs Jahre alt war, wurde ein neues Projekt eingeführt. Es war das geistige Kind eines wohlhabenden Förderers, eines anonymen Philanthropen, der ein Programm entwickelt hatte, mit dessen Hilfe es den Mädchen ermöglicht wurde, die Freuden des Singens und Tanzens zu erlernen.
Wäre meine Mutter nur wenige Jahre später geboren, hätte ihr Leben einen ganz anderen Verlauf genommen, denn solch ein Projekt hätte niemals fortgeführt werden können, während es aus deutschen Bomben Feuer auf die Stadt regnete. So aber erhielt sie ihre Chance.
Und die Ballettlehrerin, die, wie sich herausstellte, die Tochter des Philanthropen war, der das Projekt entwickelt hatte, war eine Frau namens Evelyn Darling.
Die Geschichte der Evelyn Darling
Evelyn Darling wurde in die Art von Leben hineingeboren, in dem die meisten Dinge garantiert waren. Ihr Vater Bertram hatte die Hüttenwerke seines Vaters geerbt, die dann im Ersten Weltkrieg unter Bertram ihre Blütezeit erlebten. Als einziges Kind hatte Evelyn die Aussicht auf ein großes Vermögen und eine sorglose Zukunft. Wie sich jedoch rasch herausstellte, war sie mit dem Leben, das Erbinnen gewöhnlich führen, nicht zufrieden. Sie hatte ehrgeizigere und ungewöhnlichere Pläne.
Als kleines Mädchen war Evelyn mit ihren Eltern einige Male im Ballett gewesen, und so etwas Schönes, Zauberhaftes wie diese Wesen, die da vor ihr auf der Bühne hin und her flatterten, hatte sie noch nie gesehen. Sie wollte auch so tanzen lernen, und ihr Vater, der ihr keinen Wunsch ausschlagen konnte, bezahlte ihr Ballettstunden – so viele, wie sie aushalten konnte. Er zögerte allerdings, sie auftreten zu lassen: Für Mädchen der besseren Gesellschaft, der er angehören wollte, schien es nicht ganz das Richtige zu sein. Schließlich erlaubte er ihr aber doch, hier und da bei kleineren privaten Zusammenkünften zu tanzen.
Evelyn war ziemlich gut. Vielleicht nicht absolut erstklassig, aber mit neunzehn doch so talentiert, dass sie einem gewissen jungen Mann auffiel. Und wenn sie auch nicht hübsch im konventionellen Sinn war, so hatte sie doch eine besondere Art, sich zu bewegen – wie eine Waldnymphe –, und eine Stimme so rein wie hohes, klares Glockengeläut.
1935 verlobten sich Evelyn und Harry. Nach ihrer Hochzeit würde Evelyn wieder mit dem Tanzen beginnen, aber sie würde wahrscheinlich nie mehr öffentlich auftreten: Für eine verheiratete Frau schickte sich so etwas nicht, außerdem war jetzt Harry die Liebe ihres Lebens.
Wenige Monate vor dem Termin, der für die Zeremonie festgesetzt worden war, machte Harry mit Evelyn in dem neuen Auto, einem vorgezogenen Hochzeitsgeschenk ihres Vaters, einen Ausflug ins ländliche Sussex. Es war ein herrlicher Tag voll sommerlicher Verheißung, die Luft sonnenhell und die Straßen trocken. Und so konnte sich auch niemand wirklich erklären, was die Reifen zum Rutschen brachte. Allerdings stellte man fest, dass der Wagen sehr schnell gefahren sein musste, viel zu schnell, als dass Harry noch rechtzeitig hätte gegensteuern können, ehe sie in eine der Buchen am Straßenrand krachten. Evie hatte Glück. Sie verlor das Baby, von dem sie nicht einmal etwas gewusst hatte, und ihr rechtes Bein war an sieben Stellen gebrochen, sodass es danach für alle Zeiten von einem raffinierten Gerüst aus metallenen Stiften und Bändern zusammengehalten werden musste. Harry hatte nicht solches Glück gehabt: Er war auf der Stelle tot.
Trotz ihres jugendlichen Überschwangs verfügte Evelyn über eine angeborene zähe Härte. Sie wusste, dass sie nie wieder tanzen würde, weder professionell noch für sich, dass sie niemals wieder Kinder bekommen würde und dass sie wahrscheinlich nie mehr einen Mann so lieben würde wie Harry. Und trotzdem widmete sie sich mit großer Entschlossenheit den für sie entwickelten Rehabilitationsmaßnahmen. Jeden Tag fuhr sie zum Battersea Park – direkt gegenüber vom Wassergrundstück ihres Vaters auf der anderen Seite der Brücke –, um im Freien ihre Kräftigungsübungen zu machen. Hier sah sie dann eines Tages auch die Waisenmädchen in ihren weinroten Kitteln, die, flankiert von zwei Schwestern, einen Spaziergang machten. Das war der Moment, in dem die Idee geboren wurde.
Ich halte es nicht für falsch zu behaupten, dass Evie in meiner Mutter nicht nur die Tochter fand, die sie selbst nie hatte haben können, sondern mit ihr vielleicht auch die Erfolgsgeschichte erlebte, die nie ihre eigene hatte werden können. Sie brachte ihr alles bei, was sie wusste. Und ein Jahr nachdem Mum über die Schwelle des Ballettstudios getreten war, hatte Evie sie adoptiert.
1938 gewann meine achtjährige Mutter ein Stipendium für die Ballettschule & Kompanie der Sadler's-Wells-Oper. Der Rest ist, wie es so schön heißt, Geschichte. Das Waisenhaus, das schon durch mehrere Hände gegangene gebrauchte Trikot, in dem sie anfangs trainierte – all das wurde Teil des Märchens, das meine Mutter erzählte.
Märchen enden jedoch nicht immer glücklich – ziemlich häufig ist sogar das Gegenteil der Fall, anders als moderne Nacherzählungen es einen glauben machen wollen. Das war eine schwierige Lektion, die ich lernen musste; vielleicht bin ich immer noch dabei. Der vierzehnte April 1985. Später versuchte ich zu rekonstruieren, was ich damals, zu dem exakten Zeitpunkt, als es passierte, eigentlich genau gemacht hatte. Wusste ich es in dem Moment irgendwo tief in meinem Innern? Ich habe den schrecklichen Verdacht, dass ich in dem Pub in der Goodge Street saß, in dem wir uns immer trafen, und gerade eine Runde für ein paar meiner alten Freunde von der Kunsthochschule ausgab: völlig unbekümmert und ohne jede Ahnung, wie sehr mein Leben sich in diesem Moment verändern würde.
Nach dem Flugzeugabsturz zog ich wieder in das Haus in Battersea, wo wir drei zusammen gelebt hatten: ein großes, vollgestopftes, umgebautes viktorianisches Gebäude in einer der Straßen, die vom Park wegführen. Jetzt wohnte nur ich noch dort. Evie war schon einige Jahre zuvor in ein Heim gezogen, nachdem bei ihr eine fortgeschrittene Demenz diagnostiziert worden war. Mum hatte sich lange Zeit geweigert, die Möglichkeit einer Pflegeunterbringung in Betracht zu ziehen. Als Choreographin war sie viel auf Reisen, aber sie sagte, sie würde kürzertreten und sich Arbeit in der Nähe suchen, um mehr Zeit für Evie zu haben. Doch Evie wurde immer verwirrter und unberechenbarer. Und als sie dann eines Tages in einem anderen Stadtteil mit gebrochenem Ellbogen aufgefunden wurde und nicht sagen konnte, wie sie sich so weit vom Haus hatte entfernen können, war klar, dass sie nicht nur mehr Pflege benötigte als bisher, sondern eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung. Mum konnte es sich nicht leisten, gar nicht mehr zu arbeiten, und ich hatte keine Zeit, da ich an der Slade-Hochschule gerade meinen Abschluss in Kunstgeschichte machte.
»Es wäre besser für sie«, sagte die Sozialarbeiterin im St. George's, die wie ein bebildertes Handbuch redete, »wenn sie Gesellschaft hätte – was sich mit häuslichen Besuchen erreichen lässt, aber sehr viel einfacher in einem Pflegeheim zu bewerkstelligen ist, wo sie auch ein geselliges Leben führen kann.«
Ich begreife sehr wohl, wieso meiner Mutter die Entscheidung so schwerfiel. Immerhin war Evie die Frau, die sich seit ihrer Kindheit um sie gekümmert hatte; die Frau, ohne deren Liebe und Einfluss sie niemals das Leben gehabt hätte, das sie führte. Ich weiß, dass sie litt, weil sie das Gefühl hatte, einen schrecklichen Verrat zu begehen. Erschwerend kam hinzu, dass Evies Zustand nicht durchgehend so schlimm war – sie konnte plötzlich Augenblicke überraschender Klarheit haben, und es gab ganze Tage, in denen es schien, als wäre alles in Ordnung. Aber die schlimmen Tage waren immer sehr schlimm, und der Gedanke, was in den Stunden, in denen Evie allein war, alles passieren konnte, war absolut beängstigend. Am Ende akzeptierte Mum, dass es keine Alternative gab.
3
London, Mai 1986
Ein Jahr nachdem Mum gestorben war, nahm dann alles seinen Anfang. Ich hatte mir gerade halbwegs eingeredet, dass es mir gutging. Im Rückblick sehe ich allerdings, dass das nicht stimmt. Ich war siebenundzwanzig, und meine Tage bestanden meist aus einer unveränderlichen Routine: Arbeit und Besuche bei Evie. Es gelang mir, nach außen hin den Eindruck zu erwecken, ich sei erfolgreich dabei, Mums Tod zu überleben. Es ist immens hilfreich, dass die Leute einen nach den ersten drei Monaten im Allgemeinen nicht mehr fragen, wie es einem geht, und – wenn sie keine deutlichen Beweise des Gegenteils sehen – glauben, man komme gut zurecht.
Ich traf mich kaum noch mit meinen Freunden von der Kunsthochschule. Es war nicht unbedingt eine bewusste Entscheidung, aber heute kann ich sehen, dass ich mich zunehmend von ihnen entfernte. Ich begann, die Einladungen zu Partys und Ausstellungen abzulehnen, selbst die zu den wöchentlichen Treffen in unserem Pub. Ich hatte rasch gespürt, wie sehr mich mein Kummer von ihnen distanzierte, hatte erkannt, welchen Abgrund er zwischen meinem und ihrem Leben schuf. Selbst wenn ich über meine Mum hätte sprechen wollen, hätte ich es nicht mit ihnen tun können. Wir redeten nie über »wesentliche Sachen«. Die Unterhaltungen drehten sich um milden Klatsch, wer mit wem schlief, wer sein gesamtes Werk an einen wichtigen Sammler »losgeschlagen« hatte, eben um die vielen kleinen Intrigen unserer kleinen, inzestuösen Welt. Der Gedanke, den Tod in diesen fröhlich-frivolen Mix zu tragen, war unvorstellbar.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!