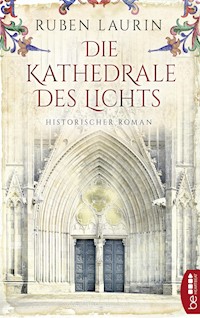9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Lübeck 1232: Der Waisenjunge Bertram weckt völlig unverhofft das Mitleid einer reichen Kaufmannstochter. Aber die zarte Liebe ist unmöglich. So heuert er als junger Mann bei einem Hanseschiff an, um sein Glück zu machen. Als sich das Schicksal nach vielen gefährlichen Abenteuern gegen ihn zu wenden droht, gelobt er: Wenn der Tod ihn noch einmal verschone, werde er einen Ort der Barmherzigkeit für die Alten und Schwachen erbauen. Und er setzt alles daran, sein Gelübde zu erfüllen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 788
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Über das Buch
Lübeck 1232: Der Waisenjunge Bertram weckt völlig unverhofft das Mitleid einer reichen Kaufmannstochter. Aber die zarte Liebe ist unmöglich. So heuert er als junger Mann bei einem Hanseschiff an, um sein Glück zu machen. Als sich das Schicksal nach vielen gefährlichen Abenteuern gegen ihn zu wenden droht, gelobt er: Wenn der Tod ihn noch einmal verschone, werde er einen Ort der Barmherzigkeit für die Alten und Schwachen erbauen. Und er setzt alles daran, sein Gelübde zu erfüllen.
Über den Autor
Ruben Laurin ist das Pseudonym eines preisgekrönten Autors, der vor allem phantastische und historische Romane verfasst. Seine Faszination für die Geschichte der Stadt Magdeburg und die mittelalterliche Kirchenarchitektur brachten ihn auf die Idee, einen Roman über den Bau des Magdeburger Doms zu schreiben: Die Kathedrale des Lichts. Ruben Laurin lebt in der Nähe von Wismar.
RUBEN LAURIN
Ein Lübeck-Roman
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Originalausgabe
Die Veröffentlichung dieses Werkes erfolgt auf Vermittlung der literarischen Agentur Peter Molden, Köln
Copyright © 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Friederike Haller, Wortspiel, Berlin
Kartenillustration: © Markus Weber, Guter Punkt
Umschlagmotive: © shutterstock Harald Schmidt | Svetocheck | canadastock | villorejo | Cristian Andriana | Kompaniets Taras; © iStockphoto MATJAZ SLANIC; © Richard Jenkins Photography
Umschlaggestaltung: Sandra Taufer, München
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-7788-0
www.luebbe.de
www.lesejury.de
Wo die Angst ist,da führt der Weg entlang.
Günter Ammon zugeschrieben
Ring the bells that still can ring
Forget your perfect offering
There is a crack in everything
That’s how the light gets in
Leonard Cohen
Für Wismars großen Wirt Berthold Börner undsein freundliches Reich, den Nikolaiblick,
für den unermüdlich Liebenden und nach Landspähenden Seefahrer Frank Augustus Schmidt
und für den selbstvergessenen Hirten derMecklenburger Ostseeküste Jochen Schmachtel.
DRAMATIS PERSONAE:
Die mit einem Stern (*) versehenen Figuren sind historische.
Bertram Morneweg* – Kaufmann und Ratsherr
Petrus von Edinburgh – sein »Hofmarschall«
Gertrud Morneweg* – seine Frau
Matthias »Matthis« Stalbuk – sein Freund
Schwester Victoria – Ordensfrau
Fridolin »Frido« Sak – Kapitän und Veteran
Bertram Stalbuk* – Kaufmann, Matthias’ Vater
Lothar von Turku – Graf und Kaufmann
Johannes von Köln – Maler
Anna Warendorp – Tochter eines Kaufmanns
Burchard von Serkem* – Geistlicher
Kasimir von Lyon – Ordensmeister der Deutschritter
Jakob von Metz – Baumeister
Silvester von Bamberg – Meistermaler
Conrad Jacobi – Kaufmann und Kapitän
Eisauge – sein Bootsmann
Martinus Bardewik – Kaufmann
Birger von Kamen, »der Haken« – sein erster Kaufgeselle
Andreas Kröpelin, »das Gespenst« – sein zweiter Kaufgeselle
Brunhilde Jessen – Amme seiner Tochter
Käfer – sein Schreiber
Ein Glossar befindet sich auf den letzten Seiten des Buches.
ZEITTAFEL
1226
Der »Reichsfreiheitsbrief« Kaiser Friedrichs II. verleiht Lübeck den Status einer Freien Reichsstadt
1227
Norddeutsche Fürsten und Lübecker Bürger besiegen in der Schlacht von Bornhöved den dänischen König Waldemar II.; mit dem Ende des dänischen Imperiums beginnt Lübecks Aufstieg zur größten Ostseemacht und führenden Hansestadt
1227
Der Lübecker Rat verfügt, dass kein Bürger »den geistlichen Gewalten Grundstücke verkaufen oder als Stiftung« überlassen darf
1228
Gründung des Heiligen-Geist-Hospitals am Klingenberg durch Ritter des Deutschen Ordens und den Lübecker Rat
1237
Unweit von Danzig gründen Ritter des Deutschen Ordens, Lübecker Handwerker und Kaufleute die Stadt Elbing
1237
Mongolen unter Batu Khan erobern Moskau
1240
Mongolen zerstören Kiew
1241
Mongolen besiegen ein deutsch-polnisches Heer in Liegnitz und fallen in Ungarn ein
1243 bis 1249
Auf dem Baltikum wehren sich die heidnischen Prußen gegen den Deutschen Orden und dessen Missionierungsversuche
1250
oder später: Bertram Morneweg kehrt aus Riga zurück, lässt sich in Lübeck nieder, heiratet und wird Mitglied des Rates
1251
Am 11. Juni vernichtet ein Stadtbrand halb Lübeck
1259
Der dem Rat und den Bettelmönchen freundlich gesonnene Johannes von Tralau wird Bischof von Lübeck
1260
Etwa um diese Zeit beginnt die Arbeit am neuen Heiligen-Geist-Hospital am Koberg
1276
Am 15. Juni verwüstet ein Stadtbrand den Norden Lübecks
1276
Der Domherr und Erste Pfarrherr der Marienkirche Burchard von Serkem wird Bischof von Lübeck
1277
urkundliche Erwähnung eines Mornewegs im englischen Lynn
1277
Bischof Burchard exkommuniziert den gesamten Rat und etliche Kaufleute von Lübeck wegen des Streites um Beerdigungen durch die preisgünstigeren Franziskaner
1281
Aufhebung der Exkommunikation per Kardinalsspruch
1286
Bertram Morneweg wird vom Rat nach England gesandt, stirbt – vermutlich im November – und wird im Johanniskloster der Franziskaner beigesetzt; er hinterlässt ein Vermögen von 13.500 Mark lübisch (ca. 3,1 Millionen Euro)
1301
Gertrud Morneweg stirbt
1312
Hermann Morneweg, Sohn von Bertram und Gertrud und seinerzeit reichster Kaufmann der Stadt, wird Bürgermeister von Lübeck
DAS ENDE
Der Junge schob eine Kiste an die Backbordreling, stieg hinauf und lehnte sich über die Balustrade. Der Wind zerwühlte seinen blonden Lockenkopf, das Licht des neuen Tages blendete ihn. Er kniff die Augen zu Schlitzen zusammen und blinzelte nach Osten. Dorthin ging die Fahrt, dorthin sehnte er sich – nach nie gesehenen Küsten, Fjorden und Flussmündungen.
Die Sonne stand bereits zwei Handbreit über dem Horizont. Herden kleiner Wolken stiegen aus dem Meer und bevölkerten den rotgoldenen Lichthof unter ihr. Die dunkelste und kleinste stülpte sich spitzbogenförmig aus den Wellen in den Morgenhimmel.
»Wie eine schwarze Harfe siehst du aus«, murmelte der Junge, und eine dunkle Ahnung beschlich ihn.
Schnell wandte er sich ab und beobachtete lieber die abziehenden Delfine. Seit so vielen Tagen schon begleiteten die Tiere das Schiff, doch nun wurde ihnen das Meer wohl zu kalt, und sie schwammen zurück nach Westen.
»Lebt wohl.« Der Junge winkte ihnen hinterher.
Am Heck schrien die Möwen über dem Kielwasser, wie sie seit Sonnenaufgang immer wieder schrien. Der Südwestwind blähte die Segel wie gestern und vorgestern schon, und die Wellen klatschten im gleichen Rhythmus gegen die Bordwand, wie sie es bereits zwei Wochen zuvor bei der Abfahrt getan hatten.
Vertrautes Stimmengewirr erfüllte das Oberdeck – das raue Gelächter der Männer, ihre derben Flüche, ihr unablässiges Palaver. Vor den Böcken mit der Pinasse stauchte der Bootsmann jemanden zusammen, was er gern und oft tat. Diesmal traf es zwei halbwüchsige Seeleute, die ihm den Kiel des Beibootes nicht sorgfältig genug geputzt und geteert hatten.
Und beim Ruderschwengel, neben dem alten Steuermann, stand der Vater und rief Befehle nach rechts und links und in die Takelage hinauf. Schön und stark und groß sah er aus mit seinen breiten Schultern, seinem langen blonden Haar, seinem weichen braun gebrannten Gesicht, seinem goldgelben Bart und dem breiten schwarzen Brustgurt mit dem zweischneidigen Schwert unter dem roten Rock.
Nein, da gab es nichts, was den Jungen hätte beunruhigen müssen – alles wie immer, alles wie schon auf seiner ersten Fahrt vor drei Jahren, alles gut. Der Junge blinzelte wieder nach Osten. Und was sollte auch Schlimmes passieren, wenn doch der Vater auf dem Schiff herrschte? Was machte es da, wenn die eine bogenförmige Wolke, die Harfe, nicht mit den anderen Wolken in den Lichthof der Morgensonne schweben wollte? Wenn sie am Meer haften blieb und größer und größer wurde?
Das machte mehr, als der Junge sich zunächst eingestehen wollte – es machte, dass sein Herz schneller schlug und seine Hände schwitzten.
»Du bist gar keine Harfe«, murmelte er. Und dann fuhr er herum und schrie: »Ein Schiff!« Er schrie es zuerst in Richtung des Vaters und dann zur aufgebockten Pinasse hinüber: »Ein Schiff! Backbords hält ein Schiff auf uns zu!«
Palaver und Gelächter an Bord verstummten, von allen Seiten liefen die Männer an die Backbordreling und spähten nach Osten aufs Meer hinaus.
»Wo siehst du ein Schiff, Junge?!«, riefen sie, und der Junge deutete auf den rasch größer werdenden schwarzen Flecken zwischen Himmel und Wellen. Nicht mehr einer Harfe glich er jetzt, sondern eher einer Axtklinge, die ein Riese aus dem wogenden Meer streckte.
»Tatsächlich!«, hieß es bald, und: »Der Knirps des Kapitäns hat recht«, und: »Seit wann segeln denn die Russen mit schwarzem Tuch?«, und ein anderer, der schärfere Augen hatte, widersprach: »Die Segel sind nicht schwarz, sie sind schwarz und rot gestreift.«
Das Schiff kam schnell näher, beängstigend schnell.
»Hol’s der Henker«, entfuhr es dem Bootsmann. »Das ist eine verdammte Galeere.«
Vom Ruderschwengel aus rief der alte Steuermann: »Die rudern ja, als sei der Gottseibeiuns hinter ihnen her!«
»Und sie rudern geradewegs auf uns zu.« Der Bootsmann spuckte über die Reling, schabte sich den Bart und zischte: »Was zum Henker wollen die?!«
Danach sagte lange keiner mehr was, und es wurde seltsam still an Bord. Nur die Möwen hörte der Junge noch schreien. Das Herz schlug ihm nun bis zum Hals, mitten in dem Kloß, der dort anschwoll.
Eine Hand legte sich auf seine Schulter. Er hob den Blick und schaute hinauf ins Gesicht seines Vaters. Das sah sehr ernst aus und härter als sonst. Er schaute auch hinauf in die Gesichter der Seeleute rechts und links: lauter schmale Augen, lauter grimmige Mienen, lauter bebende Kaumuskeln.
Plötzlich wusste der Junge: Dieser Tag würde anders werden als alle Tage zuvor, seit sie in See gestochen waren. Anders auch als alle Tage seines Lebens bisher.
Von Sonnenaufgang her pflügte das Schiff mit den schwarz-roten Segeln durch die Wellen und wurde größer und größer. Es hatte drei Masten. Deutlich erkannte der Junge die vielen Riemen, die zu seinen beiden Seiten in die Wogen eintauchten, aus den Wogen auftauchten, in die Wogen eintauchten.
Dieses Schiff wollte nicht irgendwohin, dieses Schiff wollte zu ihnen.
Der Junge legte die Hände an die Brauen, blinzelte in die Morgensonne und versuchte, die Flagge auf dem Großmast der Galeere zu erkennen.
Nie zuvor hatte er Angst gehabt auf dem Schiff seines Vaters. Keine raue See hatte ihn jemals erschreckt während seiner vier Fahrten, keine Polarnacht, kein Sturm, kein noch so schwarzer Himmel.
Seine liebe Mutter, ja, die hatte Angst gehabt; eigentlich immer, bevor er und der Vater auf Fahrt gingen. Beim ersten Mal, vor drei Jahren, hatte sie noch mit dem Vater gestritten, als der ihn schon vor sich her auf die Laufplanke schob.
»Lass mir meinen Sohn!«, hatte sie geschrien. »Er ist doch erst fünf Jahre alt!«
»Der muss ein Seefahrer werden!«, hatte der Vater bestimmt und die Mutter zurück in die Menge am Hafen gestoßen. »Und der wird ein Seefahrer!«
Bevor der Junge zum vierten Mal an Bord ging, vor drei Wochen, hatte sie ihn nur noch mit Tränen in den Augen und kummervollem Gesicht angeschaut. Und ihn dann ganz fest umarmt und geküsst. Und sich danach schnell abgewandt.
»Ein Schiff auf Backbord!« Der Schiffsjunge im Krähennest hatte die Galeere endlich auch entdeckt. »Eine Galeere! Mit Ramme!«
»Besoffener Hundsfott!«, schimpfte der Bootsmann zu ihm hinauf. Und anschließend leiser und seltsam heiser: »Aber der kleine Scheißer hat recht.« Er zog eine Flasche aus dem Rock, entkorkte sie und nahm einen Schluck. »Der verdammte Kahn schiebt einen verdammten Rammdorn vor sich her durch die Wellen.« Er reichte die Flasche weiter.
Die heranpflügende Galeere war noch höchstens vierzig Ruten entfernt. Der Junge legte den Kopf schräg und mühte sich, das Bild auf ihrer flatternden schwarzen Flagge zu erkennen. Doch er nahm nur eine Art Spindel wahr, ein Bild, aus dem er nicht schlau wurde. Die Spindel war weiß und in der Mitte zusammengeschnürt. Ihre untere Hälfte sah zu einem guten Teil rot aus, die Schnürung in ihrer Mitte und die obere Hälfte trugen ein paar rote Spuren.
»Eine Sanduhr und ein Rammdorn.« Mit ungeduldiger Geste forderte der Bootsmann seinen Rum zurück. »Das kann nur eines heißen.« Er setzte die Flasche an und leerte sie.
»Sind das Seeräuber?« Aus großen glänzenden Augen blickte der Junge zu seinem Vater hinauf. Der nickte und drückte seine Schultern. Seine Miene war so finster und grimmig, dass dem Jungen der Atem stockte.
»Zu den Waffen!«, rief der Vater mit donnernder Stimme. Die Männer rannten zu ihren Unterkünften. Der Vater drehte sich nach dem Steuermann um. »Scharf nach Südost!«, brüllte er. »Versuche, ihnen auszuweichen! Steuere an ihrer Backbordseite vorbei! Vielleicht können wir ihnen mit dem Kiel die Riemen zerbrechen.« Nach einem prüfenden Blick auf die Takelage schickte er eine Handvoll Seeleute unter die Masten, um die Rahen in den Wind zu drehen.
Schließlich hob er den Jungen von seiner Kiste hoch und drückte ihn an seine Brust.
»Hast du Angst?« Der Junge nickte stumm. »Gut so.« Der väterliche Blick aus blauen Augen hielt seinen eigenen Blick fest, strahlte Ruhe und Kraft aus. »Angst macht klug. Nur Dummköpfe haben keine Angst.« Mit einer verächtlichen Kopfbewegung deutete der Vater auf die Galeere. »So was gehört zur Ausbildung eines Seefahrers. Hast du mich verstanden?« Der Junge nickte und versuchte, den Kloß im Hals herunterzuschlucken. »Ohne Schmerz und Todesnähe wird keiner ein Seefahrer. Hast du das verstanden, Sohn?«
Der Junge nickte und unterdrückte seine Tränen.
Gemeinsam blickten sie zur Galeere. Keinen Steinwurf weit entfernt stach sie heran. Schon konnte der Junge die Gesichter der Seeräuber am Bug erkennen und ihr Kampfgeschrei hören. Ihre Axtklingen und Säbel funkelten in der Morgensonne. Es gab kein Ausweichen mehr, zu schnell trieben Segel und Ruderer der Galeere der Backbordseite des Vaterschiffes entgegen.
»Was immer gleich geschehen wird – folge deiner Angst, sie zeigt dir den Weg.« Der Vater setzte ihn ab und zog sein Schwert. »Und nun geh und versteck dich.« Die Klinge funkelte in der Morgensonne. Deutlich konnte der Junge die über der Parierstange in den polierten Stahl eingravierten Buchstaben erkennen: ein Segensspruch und die Namen aller Familienmitglieder; das wusste er von der Mutter. »Hörst du nicht, was ich dir sage, Sohn? Du sollst dich verstecken!« Der Vater wandte sich ab und rief Befehle zum Ruderschwengel hin.
Der Junge stand wie gelähmt. Die Seeleute hasteten zurück an die Reling, versammelten sich rings um ihn mit Schwertern, Spießen und Äxten. Manche knieten auf den Planken nieder und beteten. Drei spannten ihre Jagdbögen, einer spannte eine Armbrust. Der Vater rief noch mehr Befehle, der Bootsmann ließ seinen Rosenkranz durch die Finger gleiten, der alte Steuermann beschimpfte die Männer unter den Masten, weil sie die Rahen nicht schnell genug drehten.
Mit offenem Mund und weit aufgerissenen Augen sah der Junge die Galeere ihre schäumende Bugwelle heranschieben. Die Seeräuber drängten sich am Bug und schüttelten die Fäuste. Einer, der größte, hatte strohblonde Zöpfe und trug einen weißen Pelzmantel über einem Kettenhemd. Andere waren nackt, viele hatten sich schwarze oder rote Tücher um die Köpfe gebunden, die meisten winkten siegesgewiss mit Säbeln und Äxten, und einige lachten sogar. Unter ihnen, am Bug ihrer Galeere, tauchte für einen Augenblick der eiserne Rammdorn aus den Wellen auf. Heißer Schrecken fuhr dem Jungen in die Glieder.
»Seht ihr den Blonden im Eisbärenmantel?« Der Bootsmann war mit seinem Säbel an die Reling zurückgekehrt. »Den mit der schwarzen Axt? Ich wette, das ist ihr Kapitän.«
Atemlos blinzelte der Junge hinüber zu der heranpflügenden Galeere. Der Piratenkapitän stand sehr still unter den anderen, er lachte nicht, er stieß keine Kampfschreie aus, er drohte nicht mit der Faust. Er hatte seine Axt auf die weiße Schulter gelegt und lauerte zu dem Jungen und seinem Vater herüber. Der schwarze Stiel seiner Axt sah aus wie von Blut bespritzt.
»Ich kann ihnen nicht mehr ausweichen!«, brüllte der alte Steuermann. »Sie werden unser Achterschiff erwischen!«
Ein Fauststoß in den Rücken riss den Jungen aus seiner Schreckensstarre. »Wirst du dich wohl verstecken?!« Der Vater beugte sich zu ihm herunter. »Das nächste Mal darfst du mitkämpfen, jetzt aber fort mit dir!« Mit seinem Schwert deutete er zum Mittelschiff. Der Junge rannte los.
Er lief zum Großmast, blickte zum Krähennest hinauf – der Schiffsjunge hing auf halber Höhe in der Strickleiter und versperrte den Weg nach oben.
Er lief zur Luke des kleinen Laderaums, vermochte jedoch vor lauter Zittern nicht, sie zu öffnen.
Er riss die Tür zur Stiege auf, die ins Unterdeck zu den Kajüten und Kojen führte, doch der schreckliche Rammdorn stand ihm vor Augen, und im Geist hörte er schon das Wasser durch das unvermeidliche Leck rauschen und sah es die Stiege heraufsteigen.
Der Junge fuhr herum, rannte weiter, hörte nun auch den Vater, den Bootsmann und die Seeleute Kampfgeschrei ausstoßen. Das klang nicht halb so wütend wie das Gebrüll der Seeräuber. Auf einmal stand er vor der Pinasse, wusste selbst nicht, wie er dorthin gelangt war. Zwischen den Böcken kroch er unter ihr hindurch auf die andere Seite. Kein klarer Gedanke gebot ihm das, allein seine Angst. Niemand sollte ihn beobachten, wenn er ins Beiboot kletterte.
Auf der Steuerbordseite der Pinasse stieg er auf den Bock, klammerte sich am Ruderblatt fest und zog sich hoch zum Bootsrand. Er kroch unter die Plane und drückte sich zwischen den Bänken auf die Planken des großen Bootes.
Dunkelheit umgab ihn hier unter der Plane, seine eigenen keuchenden Atemzüge und sein Herzschlag gellten ihm lauter in den Ohren als draußen das Geschrei der Männer. Halb keuchend, halb flüsternd betete er ein Gute-Nacht-Gebet; ein anderes wollte ihm nicht einfallen.
Plötzlich ging ein gewaltiger Ruck durch das Boot – der erschütterte Rumpf bebte und schwankte, draußen hörte der Junge es splittern und krachen. Er lüpfte die Plane eine Handbreit weit vom Bootsrand – und hielt den Atem an: Der Seeräuber mit dem weißen Pelzmantel und den blonden Zöpfen balancierte zwischen dem Bug des Piratenschiffes und der Heckreling des Vaterschiffes auf dem Rammdorn. Er schwang seine Axt, und deutlich konnte der Junge die roten Zeichen erkennen, die im schwarzen Axtstiel prangten. Andere Piraten kletterten schon über die Reling. Der Junge ließ die Plane los, das Herz pochte ihm rasend schnell in der Kehle.
Kampfgeschrei wurde lauter und steigerte sich schnell zu wildem Kreischen. Der Junge zitterte. Schwerter klirrten gegen Schwerter, die Deckplanken außerhalb seines Verstecks dröhnten unter stampfenden Schritten und stürzenden Körpern.
Das Schiff neigte sich, der Junge rutschte gegen die Innenwand der Pinasse. Das Geschrei draußen hörte sich an wie das Kreischen der Möwen, Dohlen und Milane, wenn sie sich an der heimatlichen Flussmündung bei Ebbe über Abfallhaufen und Fischkadaver hermachten. Poltern und Krachen und Klirren von Klingen mischte sich in das entsetzliche Geschrei. Der Junge hielt sich die Ohren zu, das Schiff neigte sich schneller, die Pinasse kippte.
ERSTES BUCH
Vom Leben nach dem Tod
1
RATSHERR UND MALER
Lübeck, Herbst 1275
Auf der Schwelle des Stalltores blieb der Ratsherr stehen und lauschte. Hinter ihm krähte der Hahn, und die Morgensonne schien ihm in den Nacken. Im Stall herrschte Zwielicht, und die hohen Töne einer Flöte überlagerten das Schnauben der Rosse und das Tschilpen der Schwalben. Schwerer Duft nach feuchtem Stroh und Pferd schlug ihm entgegen. Schwalben schossen zu den schmalen Fenstern herein und hinaus.
Der Ratsherr lächelte still in sich hinein – er liebte den Klang dieser Flöte, er liebte ihre vertrauten Melodien. Summend hievte er sein Schwert auf die Schulter und nahm die Öllampe vom Wandhaken am Torpfeiler. Dann schritt er von Säule zu Säule und von Gewölbe zu Gewölbe, um die Schwalbennester zu besehen. Pferde wandten die Schädel und äugten nach ihm. Die Nester klebten zwischen den Kreuzbögen und auf den Kapitellen, und aus jedem reckte eine Handvoll Jungschwalben die Hälse und forderte lautstark, dass die Alten ihnen endlich die aufgerissenen Schlünde stopften.
Es hatte lange nicht Sommer werden wollen in diesem Jahr, und die zweite Brut war spät geschlüpft, sodass der Ratsherr sich sorgte, ob die jungen Schwalben rechtzeitig vor dem Aufbruch nach Süden flügge werden würden.
»Hör mir zu, allmächtiger Gott«, murmelte er. »Heißt es nicht, dass kein Vogel ohne deinen Willen vom Himmel fällt? Dann lehre doch diese nackten Schreihälse möglichst bald das Fliegen. In deiner grenzenlosen Güte, Amen.«
Die heisere und wie meist etwas wehmütige Flötenmelodie verstummte. Bald hallten Schrittlärm und Hufschlag von den Wänden und aus den Deckengewölben wider. Wieder wandten die Pferde ihre Schädel und äugten nun nach der hünenhaften Gestalt, die sich aus den Tiefen des Stalles näherte. Der Hofmarschall brachte die gesattelte Schimmelstute. Über dem Leder seines Wamses baumelte die kleine Flöte, die er an einem Silberkettchen um den Hals trug. Er nahm dem Ratsherrn die Öllampe ab und reichte ihm die Zügel.
»Danke, Petrus.« Lächelnd nickte der Ratsherr dem Älteren zu. Auch nach so vielen Jahren noch machte die Nähe des großen Mannes ihn froh, wenn er ihn morgens in der Küche, auf dem Hof oder in einem der Ställe erblickte. Oder wenn er den Klang seiner Flöte hörte. »Spanne heute den großen Wagen an, ja?«
Petrus, ein schwarzbärtiger, bulliger und ungewöhnlich hoch gewachsener Kahlkopf, trottete nickend zum Durchgang, der in den Ochsenstall führte.
Natürlich war er so wenig ein Hofmarschall, wie der Ratsherr ein Fürst oder ein König war, trotzdem nannte der ihn nicht anders als »Hofmarschall«. Petrus, der Latein, Englisch und Polnisch ähnlich fehlerfrei schrieb und verstand wie das Niederdeutsche, hätte dem Kontor des Ratsherrn vorstehen, die Lagerhäuser und Speicher verwalten, das Gesinde beaufsichtigen oder eines der Schiffe als Kapitän befehligen können. Doch er mochte lieber bei den Tieren sein. Und in der Nähe des Ratsherrn.
Der schnallte nun sein Schwert ans Sattelzeug der Schimmelstute und tätschelte ihr das weiße Halsfell. »Gott ist mit uns, Nedschinka«, raunte er ihr ins Ohr. »Ein guter Tag liegt vor uns, freu dich.«
Nedschinka – so ungefähr lautete das russische Wort für Schneeflocke. Der Ratsherr hatte die Stute von einer Russlandfahrt mitgebracht. Er führte das schöne Tier aus dem Stallgewölbe.
Im Hof badeten die Hühner mit Spatzen und Amseln in den Pfützen. Möwen kreisten über den Firsten. Bis zum Morgengrauen hatte es geregnet, jetzt klarte der Himmel auf, und strahlend erhob sich die Sonne über den Türmen und Dachfirsten der Stadt. Ein erstaunlich warmer Südwestwind wehte.
Welch ein Glück, dachte der Ratsherr, während er versuchte, trockenen Fußes zum Tor zu gelangen, welch ein Segen. Zu ebendieser Stunde nämlich verließ eine Handelsflotte den Hafen in Richtung Gotland. Drei seiner neuen Koggen segelten mit ihr, befehligt von seinem ältesten Sohn und zwei Schwiegersöhnen und beladen mit Salz, Waid, Rosenkränzen, Getreide, silbernen Gefäßen und flandrischem Tuch. Blieb der Wind günstig, würde die Flotte es in acht bis zehn Tagen nach Gotland schaffen. Und noch vor dem Winter nach Nowgorod.
Unter dem Torbogen seines großen Anwesens wartete der Ratsherr auf Petrus mit dem Ochsenwagen. Tief sog er die milde Luft ein. Sie roch nach Rauch, Meer und nassem Segeltuch. Seine Gedanken kreisten noch um seine Koggen, und das Fernweh packte ihn. Wie gern wäre er mitgefahren nach Gotland, Danzig, Riga und Nowgorod. Doch mochte er seine Stiftung, das gerade entstehende Heiligen-Geist-Hospital, nicht ohne Aufsicht lassen.
In den Pfützen auf der Mengstraße glitzerte das Licht der Morgensonne. Dunst hing in den Büschen und Baumkronen auf dem Kirchplatz. Steinmetze und Zimmermänner liefen schwatzend vorüber und überquerten die Straße. Alle neigten die Köpfe und grüßten den Ratsherrn. Bei den Steinstapeln und Holzstößen vor dem Gotteshaus gesellten sie sich zu anderen Bauleuten, die dort bereits warteten. Gleich nach dem morgendlichen Stundengebet würden sie an die Arbeit gehen und fortfahren, die alte, für die stolze Stadt inzwischen viel zu kleine Kirche in eine große Backsteinbasilika umzubauen.
In diesem Augenblick öffnete sich das Portal von Sankt Marien, und ein junger Mann kam heraus. Der Ratsherr erkannte ihn sofort.
»Schau einer an«, murmelte er. »Der Johannes bereitet sich beim Stundengebet auf die Arbeit vor. Braver Mann. Wollte Gott, sein Meister würde sich ein Beispiel an ihm nehmen.«
Er stutzte, als er einen Atemzug lang das Gesicht des jungen Malers sehen konnte – die Miene eines zufriedenen Mannes sah anders aus. Er beobachtete ihn aufmerksamer: Johannes von Köln raffte seinen dunkelblauen Mantel enger um sich und zog den großen Hut tiefer ins Gesicht, während er zur Breiten Straße eilte. Wind bauschte sein langes Blondhaar auf. Den Ratsherrn und den Schimmel unter dem Torbogen nahm er nicht wahr in seiner Eile. Er hastete über die Kreuzung und bog in die Johannisstraße ein.
»So zielstrebig, wie er geht, arbeitet er auch«, murmelte der Ratsherr und lächelte zufrieden. »Wahrscheinlich bedrückt es ihn, gleich seinem Meister begegnen zu müssen. Der gütige Herrscher im Himmel möge ihn segnen. Und Meister Silvester das Maul stopfen.«
Der Ratsherr kannte das Ziel des Malers: das Heiligen-Geist-Hospital. Johannes von Köln arbeitete an einem Wandgemälde im Kirchenschiff des Neubaus. Der Ratsherr kannte den Entwurf seiner Arbeit, wusste, wie weit sie bereits vorangeschritten war, wusste, was ihrem Schöpfer bezahlt wurde, welche Farben er vor drei Tagen bestellt hatte und was sie kosten würden. Die Bestellung lief über ein Rechnungsbuch des Ratsherrn. Und den jungen Maler vom Rhein hatte er in der Karwoche persönlich eingestellt – gegen den erklärten Willen des Meisters.
Hinter ihm, aus dem Hof, näherten sich das Rattern der Karrenräder und der Hufschlag des Ochsengespanns. Der Ratsherr raffte seinen pelzbesetzten Rock hoch, schwang sich auf seine Schimmelstute und zog sich den großen dunkelroten Hut tiefer auf seine aschgrauen Locken. »Auf geht’s, Nedschinka.«
Vor dem Karren seines Hofmarschalls her ritt er schräg über die Mengstraße zur Breiten Straße hin. Als er sich noch einmal nach seinem Giebelhaus umdrehen wollte, sah er ein junges Mädchen aus dem Portal der Marienkirche huschen.
Die Jungfrau versuchte, ihr schwarzes Haar mit einem Tuch zu verhüllen, doch der Ratsherr hatte sie längst an ihrer aufrechten Gestalt und ihrem anmutigen Schritt erkannt: Anna, die jüngste Tochter seines Konkurrenten Fredericus Warendorp. Seines ehemaligen Konkurrenten – Warendorps Name tauchte immer öfter im Schuldbuch der Stadt auf; im Frühjahr hatte er sogar seinen Ratssitz verloren.
Während die ersten Domherren und Bürger der Stadt die Marienkirche verließen, eilte Anna Warendorp in Richtung Trave. Auf der anderen Seite des Kirchplatzes bog sie nach links zu den Schüsselbuden ab.
Der Ratsherr wandte sich nach seinem Haus um und winkte seiner Frau zu. Die lehnte im offenen Fenster ihrer Schreibkammer, lächelte und winkte zurück. Da schwoll ihm das Herz, und ganz warm wurde ihm in der Brust.
Es war noch nicht lange her, dass seine Frau hatte weinen müssen, wenn er sie früh am Morgen verließ; wenn er auf ein Schiff ging, um übers Meer zu segeln – nach London in England, nach Visby auf Gotland, nach Schonen im Königreich Dänemark oder gar nach Nowgorod im fernen Russland. Heute wusste sie: Er würde bald zurückkommen und neben ihr an der Tafel Platz nehmen. Früher jedoch hatte sich jeder Abschied wie ein endgültiger angefühlt.
Damit war es vorbei: Seit sieben Jahren betrieb der Ratsherr seine vielfältigen Unternehmungen vorwiegend von seiner Schreibkammer aus und schickte, wenn es nötig war, seine Söhne oder seine Kaufgesellen nach Schonen, Brügge, Riga oder Nowgorod. Er selbst ging nur noch selten auf Fahrt. Worüber er allerdings nicht halb so glücklich war wie seine Frau.
Über die vertraute Straße ritt er hinein in die Breite Straße und dann vorbei an den vertrauten Fassaden seiner Stadt. Er grüßte nach allen Seiten und erwiderte die Grüße der Lübecker. Wie vertraut ihm auch die meisten Gesichter erschienen! Das war längst nicht immer so gewesen.
Nicht jeder grüßte ihn. Manch einer senkte im Vorübergehen den Blick oder verschwand aus seiner offenen Haustür oder seinem Fenster, wenn er ihn kommen sah. Der Ratsherr kannte seine Feinde unter den Kaufleuten der Stadt, o ja – er kannte sie gut. Diese meist älteren Herren sprachen verächtlich von ihm, nannten ihn hinter vorgehaltener Hand einen Abenteurer, einen Glücksritter, einen neureichen Emporkömmling, der sein Vermögen durch Hinterlist erworben hatte oder gar mit Gewalt.
»Der allmächtige Gott wird einst sein Urteil über mich sprechen«, pflegte er zu sagen, wenn man ihm das Gerede dieser Leute zutrug. »Über mich und über sie.«
Wie jeden Freitag ritt er nicht direkt zur Baustelle, sondern machte einen Umweg über den Markt. Auf halbem Weg kamen ihm der Vorsteher seines Kontors, der Aufseher seiner Boten und sein oberster Kontierer entgegen. Auf dem morgendlichen Weg zur Arbeit pflegten sie nach den Marktbuden des Ratsherrn zu schauen. Der hielt seine Stute an, begrüßte die Männer, und der Vorsteher berichtete.
Zufrieden hörte der Ratsherr, dass sein jüngster Sohn und seine Händler die Buden bereits geöffnet hatten und die ersten Meter Tuch, die ersten Fässer Salzheringe und einige Kannen Bier über den Ladentisch gegangen waren. Auch vor den vermieteten Marktbuden hatten sich die ersten Käufer eingefunden. Der Ratsherr hörte es gern.
Die sieben Buden, die seine Familie auf dem Lübecker Markt betrieb, und die fünf, die sie vermietete, stellten zwar nur einen unbedeutenden Zweig seiner vielfältigen Geschäfte dar, doch nichts, was in Lübeck, Visby, Riga, Nowgorod und den Wendischen Städten an der Ostseeküste in seinem Namen geschah, erschien dem Ratsherrn zu gering für seine persönliche Sorge und Aufmerksamkeit. Der Betrieb seiner Marktbuden genauso wenig wie die Pflege seiner Pferde und das Gedeihen der jungen Schwalben in seinem Stall.
Der Vorsteher und Schreiber, ein ehemaliger Dominikaner aus Magdeburg namens Benedikt, erinnerte ihn an zwei Briefe, die noch vor Mittag geschrieben und abgeschickt werden mussten. Der erste betraf eine größere Anzahl von Bierfässern, die des Ratsherrn zweitgeborener Sohn in Wismar ankaufen sollte, mit dem zweiten sollte die Bestellung für die letzte Salzlieferung vor dem Winter nach Lüneburg gehen.
Der Ratsherr befahl dem Schreiber Benedikt, die Briefentwürfe auf Wachs zu skizzieren und mit seiner Frau zu besprechen, bevor er sie ins Reine schrieb; und er kündigte an, in drei Stunden in die Schreibkammer in der Mengstraße zu kommen, um sich die fertigen Briefe vorlesen zu lassen und dann zu versiegeln. Er selbst konnte Niederdeutsch oder gar Latein nur in sehr dürftigem Maße lesen und schreiben.
Den Kontierer wies er an, erneut Rechnungen für die noch immer nicht bezahlten Lederlieferungen nach Salzwedel und die Gewürzlieferungen nach Hamburg zu schreiben, und diesmal in strengerem und mahnendem Tonfall. Die Männer versprachen, sorgfältig zu erledigen, was der Ratsherr ihnen auftrug.
Der Hofmarschall, dem heidnische Krieger vor Jahren die Zunge herausgeschnitten hatten, gab dem Aufseher der Boten mit Handzeichen und Lippenbewegungen zu verstehen, welche Pferde er den Boten geben sollte, die Briefe und Rechnungen zu überbringen hatten. Petrus wusste zu jeder Stunde, welches Pferd gesund und bei Kräften war und welches Schonung brauchte. Sein ungeheures Gedächtnis und sein wachsamer Blick hatten dem Ratsherrn und ihm selbst mehr als einmal das Leben gerettet.
Nachdem alles beredet worden war, wünschten die Männer einander einen gesegneten Tag, und jeder ging seines Weges. Der Ratsherr ritt auf den Markt. Dort kaufte er Rüben, Kohl, frühe Äpfel und Zwetschgen – so viele Kisten und Körbe voll, wie Petrus und die Händler auf den Ochsenwagen laden konnten.
Danach bezahlte er dem Fischhändler dreißig Dorsche und bat ihn, fünf davon Lübecker Bürgern und Geistlichen senden zu lassen, deren Namen er ihm nannte. Den Großteil der Fische ließ er beiseitelegen.
Petrus überreichte dem Händler eine Liste mit knapp zwei Dutzend Namen von Witwen und Frauen, deren Männer so krank waren, dass sie nicht arbeiten konnten, die jedoch allesamt viele Kinder satt bekommen mussten. Zu diesen armen Leuten würde die Frau des Ratsherrn noch am Morgen Laufburschen schicken, um ihnen die gute Nachricht vom geschenkten Dorsch ausrichten zu lassen.
Als auf dem Markt alles getan war, was er sich vorgenommen hatte, lenkte der Ratsherr seine Schimmelstute in die Wahmstraße und zur Königsstraße hinunter und auf dieser zum knapp hundertsechzig Ruten entfernten Koberg, wo das neue Heiligen-Geist-Hospital erbaut wurde. Unterwegs stellte er sich die dankbaren Gesichter der Frauen vor, wenn sie bald die großen Fische nach Hause tragen würden. Er dachte an das fröhliche Geschrei ihrer Kinder, wenn der Bratenduft durch ihre armseligen Buden ziehen würde. Bester Dinge und eine muntere Melodie summend, grüßte er die Handwerker und Fuhrleute, die ihm entgegenkamen, und die Kinder und Greise in den offenen Türen und Fenstern.
Kurz vor der Baustelle bog ein kleiner Knabe aus einer Gasse und rannte auf ihn zu. Der Ratsherr erkannte den fünfjährigen Sohn seiner Küchenmagd und hielt seine Schimmelstute an.
»Deine Frau schickt mich, Herr!« Vor dem Pferd blieb der Knabe stehen und schöpfte Atem. »Ich soll dir sagen, dass der oberste Pfarrherr auf dem Weg zum Hospital ist. Und dass er sehr wütend auf dich ist!«
»Soso.« Lächelnd betrachtete der Ratsherr den kleinen Burschen; der sah putzig aus in seinem knielangen Kleidchen und mit seinen dicken, von Eifer und Anstrengung geröteten Backen. »Wütend ist er also, der Pfarrherr.« Der Knabe nickte und machte ein ernstes und wichtiges Gesicht. Er sprach natürlich vom Domherrn und Priester Burchard von Serkem, daran gab es keinen Zweifel. »Und woher weiß meine Frau das?«
»Frau Morneweg hat am Fenster gestanden, als der Pfarrer vom Morgengebet kam, da hat sie ihn schimpfen hören. Auf dich, Herr Morneweg.«
»Gleich nach dem Morgengebet hat der Pfarrherr schimpfen müssen?« Der Ratsherr schnalzte mit der Zunge und schüttelte den Kopf. »Der Ärmste.« Er drehte sich nach dem Hofmarschall um. »Gib dem Jungen einen Apfel, Petrus.« Und wieder an den kleinen Burschen gewandt: »Danke. Bist ein braver Bote.« Der Junge strahlte und rannte zum Ochsenwagen, um seinen Botenlohn in Empfang zu nehmen.
»Weiter geht es, Nedschinka.« Die Miene des Ratsherrn wirkte nicht mehr ganz so vergnügt, als er sein Pferd antrieb und weiterritt, und das Summen ließ er ebenfalls bleiben. Burchard, der oberste Pfarrherr der Marienkirche, war bekannt für seinen leicht entflammbaren Zorn. Leider nutzte er jede Gelegenheit, um mit den Ratsherren zu streiten. Worüber mochte er sich wohl heute Morgen wieder geärgert haben? Man konnte nur hoffen, dass der Heilige Vater den ständig beleidigten, machtbewussten und ehrgeizigen Grafensohn aus Serkem möglichst bald auf einen Bischofsstuhl einer möglichst weit entfernten Stadt berief.
*
Am Koberg warteten etwa vierzig Männer und Frauen jeden Alters mit kleinen Körben und Säcken vor der Baustelle am Straßenrand. Ihre stumpfen oder trübsinnigen Mienen hellten sich ein wenig auf, als sie den Ratsherrn heranreiten sahen, und mehr noch, als der Hofmarschall das Ochsengespann mit dem vollgeladenen Wagen vor ihnen anhielt. Kaum stand er still, umringten sie ihn auch schon.
»Petrus wird jedem zuteilen, was er braucht.« Der Ratsherr deutete auf die Kohlköpfe, Rüben und Früchte. Und an den Hofmarschall gewandt: »Ich schicke ein paar Ordensleute heraus, damit sie dir helfen.«
Vom Kutschbock aus kletterte Petrus auf die Ladefläche, mit der Peitsche vertrieb er zwei große Möwen. Die wartenden Menschen drängten sich vor dem Wagen, die ersten streckten bereits ihre Körbe oder Säcke zum Hofmarschall hinauf. Mit herrischen Gesten und strenger Miene bedeutete Petrus den ärgsten Dränglern, sich hinten anzustellen. Niemand wagte ein Widerwort, alle gehorchten sie ihm.
Der Ratsherr ließ seinen Blick über die Männer und Frauen wandern. Die meisten waren schon alt, und viele wirkten gebeugt und kränklich. Kaum jemand unter ihnen trug Kleid oder Rock, die nicht zerschlissen oder vielfach geflickt waren.
Sein Blick begegnete dem eines ehemaligen Konkurrenten, eines Kaufmanns, der um gut zehn Jahre jünger war als er selbst und der innerhalb weniger Monate durch Seeräuber und treulose Gesellschafter sein gesamtes Vermögen verloren hatte. Das Erbarmen packte ihn, als er in das fahle und hohlwangige Gesicht des Bedauernswerten sah. Er nickte ihm zu und lenkte dann seine Schimmelstute durch das Tor im Bauzaun und zwischen Holzstapeln und aufgetürmten Backsteinen hindurch auf den Bauplatz.
Die meisten Männer und Frauen, die hinter ihm am Wagen zurückblieben, wohnten im alten Heiligen-Geist-Hospital am Pferdemarkt. Dort hatten sie Zuflucht gesucht, nachdem sie durch Krankheit, Schicksalsschläge oder einfach nur durch Alter und Gebrechlichkeit in Armut gestürzt waren. Nicht wenige verarmte und kranke Lübecker suchten dieses Haus des Erbarmens auch zum Sterben auf. Dort konnten sie gewiss sein, von den Ordensbrüdern und -schwestern gepflegt und vom Priester des Hospitals mit dem Sterbesakrament versehen zu werden.
Weil das alte Hospital am Pferdemarkt längst zu klein geworden war, hatte der Bischof, gleich nach seiner Wahl vor fünfzehn Jahren, dem Rat gestattet, hier am Koberg ein neues, größeres Haus des Erbarmens zu errichten. Einen Teil des für den Bau nötigen Geldes hatte ein Kreis zwölf vermögender Lübecker aufgebracht. Er, der Ratsherr Morneweg, gehörte zu den zwei wichtigsten Stiftern und war damit einer der beiden Vorsteher der Stiftung.
Möwen kreisten über dem emsigen Treiben auf der Baustelle. Zimmerleute luden Dachbalken von einem Fuhrwerk; Mörtelknechte schleppten Wasser und Sand zu den Mörtelkübeln; Steinmetze zogen Leiterwagen mit behauenen Kapitellen und Rundsteinen aus Gotländer Kalkstein in den Neubau des Mittelschiffs; an der nördlichen Stirnseite der Hospitalkirche schufteten Arbeiter im Drehrad eines Trommelkrans, um den Zimmerleuten Dachbalken für das Dach des Seitenschiffs nach oben zu hieven; Windenknechte kurbelten mit Backsteinen beladene Paletten über den nahezu vollendeten Giebel des südlichen Seitenschiffs hinaus und bis zu den verwinkelten und sorgfältig verstrebten kleinen Turmgerüsten hinauf. Dort warteten die Maurer, die den zweiten der schmalen und hohen Türme errichteten, die den geistlichen Herren vom Domkapitel so missfielen.
Hammerschläge, Männergeschrei, das Kreischen von Sägen, das Quietschen von Winden und das Rattern und Knarren von Trommelkränen lagen über der Baustelle. Der Ratsherr musste rufen, um den Zimmermeister, den Schmied oder den Meister des Hospitalordens zu grüßen. Der stand mit einem Bettelmönch zwischen zwei Kübeln, in denen einige Brüder und Schwestern des Heiligen-Geist-Hauses Mörtel anrührten. Eine Ordensfrau mit schlohweißem Haar erkannte den Ratsherrn, winkte und kam zu ihm.
Er schwang sich aus dem Sattel, um sie zu begrüßen. »Wie geht es dir, Schwester Victoria?« Er reichte ihr die Hand.
»Ich bin zufrieden.« Sie hielt seine Rechte fest und legte ihre Linke darauf. »Und wie geht es dir heute, mein Bruder?« Ihre grünen Augen leuchteten. Wie gern schaute er in sie hinein. Niemanden in Lübeck kannte er länger als diese alte Ordensfrau; und niemand kannte ihn besser als sie.
»Mein Herz schlägt, ich atme, und ich habe Hoffnung und Lust genug zum Leben, Schwester. Wie könnte ich klagen?«
Sie drückte seine Hand und gab sie dann frei. »Du bringst wie jeden Freitag die Armenspeisung für unser Haus des Erbarmens, nehme ich an.« Die Ordensfrau lächelte, und ihr Gesicht legte sich in hundert Falten.
Er riss sich los von ihren Augen – von ihren schönen alten Augen, die so viel schon gesehen hatten, viel mehr noch als seine. »Der Ochsenkarren mit Feldfrüchten und Obst steht wie immer auf der Burgstraße«, sagte er und deutete hinter sich. »Der Hofmarschall braucht Hilfe bei der Verteilung.«
»Dann wollen wir schnell zu ihm gehen.« Mit knapper Geste gab sie ihren Brüdern und Schwestern am Mörtelkübel ein Zeichen. »Nicht dass die Bettlägerigen im Hospital zu kurz kommen. Ich wünsche dir einen gesegneten Tag.« Sie lief in Richtung Burgstraße. Drei Ordensleute zogen ihre Schaufeln aus dem Kübel, stachen sie in den Sandhaufen hinter sich und folgten ihr.
Auf dem Gerüst der nördlichen Seitenschifffassade entdeckte der Ratsherr einen Mann mit Senkblei und Messstab – den Baumeister. Er winkte und führte seine Schimmelstute zu ihm. Vor dem Portal hielt er an, um nach dem Maler Johannes zu schauen, doch das Gerüst, auf dem im Kirchenschiff die Maler zu arbeiten pflegten, war leer. Auch Meister Silvester und seine anderen Gesellen konnte er nirgends entdecken.
»Ist denn noch kein Maler bei der Arbeit, Meister Jakob?«, rief er zum Baumeister hinauf. »Ich habe Johannes von Köln doch zur Baustelle laufen sehen!«
»Ihr Meister hat ihnen schon mächtig die Ohren lang gezogen heute Morgen«, antwortete der Baumeister. »Die Farbmischungen haben ihm nicht gefallen.« Er blickte nach links und rechts, ging in die Hocke und senkte die Stimme. »Dabei hat er die Mischung selbst verdorben – gestern Abend, im Suff.« Mit einer Kopfbewegung deutete er nach Norden zur Großen Gröpelgrube. »Hat sie alle vier mit Schlägen und Tritten vor sich her zur Bauhütte getrieben. Dort werden sie jetzt wohl neue Farben mischen.«
Der Ratsherr runzelte die Brauen und spähte zur Bauhütte der Maler. Die grobe Art des Malermeisters hatte ihm von Anfang an missfallen. Und seine übergroße Neigung zum Bier sowieso.
»Ich habe einen Wagen voller Früchte, Kohl und Rüben mitgebracht, Meister Jakob«, wandte er sich wieder an den Baumeister. »Was von der Armenspeisung übrigbleibt, mögen sich nachher Eure Bauleute teilen. Zur Mittagspause werden meine Brauknechte außerdem ein Fass Bier zur Baustelle bringen. Und Euch habe ich am Fischstand einen Dorsch gekauft und zurücklegen lassen.«
Der alte, stämmige Baumeister neigte den Kopf und bedankte sich. Er stammte aus Metz. Im Königreich Frankreich hatte er bereits an der Erbauung zweier Kathedralen im neuen französischen Stil mitgearbeitet. Das Heiligen-Geist-Hospital war das erste Bauwerk, das er allein verantwortete. Er führte ein strenges Regiment auf der Baustelle und verlangte sorgfältige Arbeit von seinen Bauleuten. Das gefiel dem Ratsherrn.
»Gestern musste ich einen Maurer hinausschmeißen«, sagte der Franzose. »Heute Morgen hat seine Frau mir schon die Ohren vollgejammert.« Er deutete zu den Bauhütten am Südrand der Baustelle. »Sie hat auf Euch gewartet.«
Zwischen Holzstapeln, Sandhaufen und Mörtelkübeln eilte eine Frau herbei, die ein einfaches Wollkleid und eine blaue Haube trug. »Gnade, edler Herr!«, rief sie. »Lasst Gnade vor Recht walten und gebt meinem Mann wieder Arbeit in Eurem Bauwerk.«
»Weder bin ich ein edler Herr, noch ist dies mein Bauwerk.« Die Frau hatte strähniges graues Haar und ein verheultes Gesicht. »Wenn Meister Jakob deinen Mann weggeschickt hat, wird er gute Gründe dafür haben.« Fragend blickte der Ratsherr zum Baumeister hinauf.
»Fünf Lagen Steine mussten wir aus dem Südtürmchen reißen, weil er krumm gemauert hat, der Suffkopf! Und ständig habe ich ihn ermahnen müssen, weil er mir die guten Backsteine zerklopft hat.« Der Baumeister machte eine grimmige Miene und schüttelte den Kopf. »Nein! Einen, der schon morgens nicht mehr gerade stehen kann vor lauter Wein, so einen kann ich nicht auf der Baustelle brauchen.«
»Aber wie soll ich denn meine Kinderschar satt kriegen, wenn mein Mann kein Geld mehr nach Hause bringt?« Die Frau sank vor dem Ratsherrn auf die Knie und streckte die gefalteten Hände zum Baumeister im Gerüst hinauf. »Bitte, Ihr edlen Herren! Bitte, bitte versucht es noch einmal mit meinem Gerhard! Ich flehe Euch an! Er hat mir versprochen, sich mit dem Wein zu mäßigen.«
»Wie oft hat er dir das schon versprochen?«, fragte der Baumeister. »Zehnmal? Hundertmal?«
»Diesmal wird er Wort halten, Meister Jakob!«, versicherte die Frau. »Diesmal ganz bestimmt! Gerhard hat’s geschworen, bei der Heiligen Gottesmutter hat er’s geschworen!«
»Und wie oft hat er’s schon geschworen? Und bei welchen Heiligen noch?« Der alte Baumeister winkte ab. »Er wird mir irgendwann besoffen vom Gerüst stürzen und am Ende noch einen anderen mit hinabreißen.« Mit unerbittlicher Miene deutete er zum Koberg und zum Ausgang der Baustelle. »Nichts da! Weg mit dir! Richte dein Flehen zu Gott – möge er dir helfen, wenn er will.«
Die Frau warf sich auf den Boden, rief die Heilige Jungfrau und deren Sohn Jesus Christus an und weinte bitterlich dabei.
Dem Ratsherrn schnürte so viel Kummer das Herz zusammen. Aber was sollte er tun? Er trat von einem Fuß auf den anderen und schaute zum Baumeister hinauf, der jedoch hielt seinem Blick stand und zuckte nur mit den Schultern. Meister Jakob hatte ohne Zweifel die richtige Entscheidung getroffen – und doch erbarmte den Ratsherrn die heulende Frau.
Er ging vor ihr in die Hocke und berührte sie an der Schulter. »Weil Meister Jakob die Verantwortung für all die Bauleute hier trägt, hat er so entschieden, Weib, nicht weil er ein hartes Herz hätte.« Sie hob den Kopf, sah schluchzend zu ihm hoch. Sand und Tränen verschmierten ihr Gesicht. »Draußen steht ein Ochsenwagen mit Früchten und Rüben. Lass dir geben, was du heute für deine Kinder brauchst. Dann geh nach Hause, und wenn dein Mann sich bis übermorgen mäßigen kann, komme wieder und berichte uns. Meister Jakob und ich werden uns besprechen.«
Die Frau stammelte einen Dank, ergriff seine Hand und küsste sie. Dann sprang sie auf und eilte über die Baustelle zum Koberg und auf die Straße hinaus. Der Ratsherr erhob sich und schaute zum Baumeister hinauf. Der hatte die Fäuste in die Hüften gestemmt und machte eine strenge, vorwurfsvolle Miene.
»Ihr habt vollkommen recht entschieden, Meister Jakob. Doch sie dauert mich, versteht Ihr? Lasst uns noch einmal über ihren Mann reden, ja?« Der Ratsherr griff nach dem Zügel seiner Schimmelstute. »Heute Abend. Natürlich werdet Ihr das letzte Wort haben.«
Der Baumeister wandte sich murrend und mit grimmiger Miene ab, und der Ratsherr führte sein Pferd zu den Bauhütten am Nordrand der Baustelle. Schon von Weitem hörte er Meister Silvester mit seinen Gesellen schimpfen. Er band die Schimmelstute in einem Stoß Rundholz fest, schnallte sich den Brustgurt mit dem Schwert um und ging zu den Malern hinein.
Zwischen Hockern und Farbeimern knieten drei junge Männer auf den Holzdielen – einer fast noch ein Knabe –, mischten Farben und pinselten Kreise und Striche auf ein weiß getünchtes Brett, um die Mischung zu testen. Ihr Meister, ein erfahrener Maler aus Bamberg, stand über ihnen, fuchtelte, schlug mal dem einen auf den Hinterkopf, trat mal dem anderen ins Kreuz. Ganz offensichtlich war er unzufrieden mit ihrer Arbeit.
»Meister Silvester!« Der Mann fuhr herum, und der Ratsherr bedachte ihn mit einem missbilligenden Blick. »Wo ist Johannes?«
»Beleidigt!« Der Wüterich, ein untersetzter schwarzlockiger Mann in den besten Jahren, kam zu ihm. »Fasst man ihn nicht mit Samthandschuhen an, ist er gleich beleidigt und rennt weg.« Er schnaubte verächtlich; sein Atem roch nach Bier, und sein Gesicht – vor allem seine Nase – glänzte rötlich.
»Mich wundert’s, dass die anderen drei nicht auch weglaufen, Meister Silvester. So wie Ihr sie behandelt.«
»Mit Recht bin ich streng mit ihnen!« Der Meister stemmte die Fäuste in die Hüften. »Die Wandgemälde müssen perfekt werden! Schließlich geht es um die Ehre unseres Herrn Jesus Christus und seiner Heiligen Mutter Maria. Und mit diesem Kölner, den Ihr eingestellt habt, Herr Morneweg, mit dem bin ich viel zu lange schon nachsichtig gewesen!«
»Was habt Ihr gegen Johannes von Köln, Silvester?« Der Ratsherr wich ein wenig zurück, denn der Bamberger pflegte einem so nahe zu rücken, dass man seinen Bieratem riechen und seinen Kugelbauch spüren musste. »Was ich bisher von seinem Christophorus gesehen habe, gefällt mir richtig gut.«
»Er ist ein fauler Strick, glaubt mir nur.« Meister Silvester blies verächtlich die Backen auf. »Und nie bei der Sache! Träumt mit offenen Augen! Schafft ihn mir vom Hals, er bringt nichts Rechtes mehr zustande. Seit Tagen schon nicht.«
»Was Ihr nicht sagt.« Der Ratsherr wusste, dass Silvester von Bamberg mit Neid auf die Arbeit des so viel jüngeren Kölners schielte. Der nämlich malte seinen Christophorus weit kunstvoller als der Meister seine Himmelskönigin. Was genau zwischen Silvester und dem Gesellen vorgefallen war, davon besaß der Ratsherr keine Kenntnis. »Wo ist er denn?«
»Weggelaufen, sag ich doch!« Zornig gestikulierend wandte Meister Silvester sich ab. »Weiß ich, wohin? Bin ich ein Prophet?«
»Er steigt manchmal in den neuen Keller des Querhauses hinab, wenn er nachdenken will«, sagte der älteste der drei Gesellen.
»Arbeiten sollst du, nicht schwatzen!« Der Meister stapfte drohend auf den Gesellen zu. »Muss ich denn bis zum Jüngsten Tag auf mein Himmelblau warten?!«
Kopfschüttelnd wandte der Ratsherr sich ab. In Stunden wie diesen bereute er, dem Rat den Maler aus Bamberg für die Erschaffung der Wandgemälde in der neuen Hospitalkirche vorgeschlagen zu haben. Doch daran war nun nichts mehr zu ändern.
Zwei Maler hatten bereits die Flucht ergriffen vor Meister Silvesters Jähzorn, einer hatte sich gar in einer Weide an der Wakenitz aufgehängt; als Ersatz für ihn hatte der Ratsherr den Johannes nach Lübeck berufen. Dessen Oheim hatte den jungen Maler und seine Kunst empfohlen. Diesem Oheim des Johannes kaufte der Ratsherr jedes Jahr vierzig Fässer Rheinwein ab, die er in Visby, Danzig und Nowgorod weiterverkaufte. Mit der Herbstlieferung des vergangenen Jahres hatte der Kölner Kaufmann eine Bibel geschickt, von seinem Neffen verziert und bebildert. Der Ratsherr konnte sie zwar nicht lesen, hatte aber so viel Freude an den Darstellungen, kunstvollen Miniaturen und farbigen Majuskeln gehabt, dass er dem Rat von Lübeck empfahl, den jungen Johannes in die Stadt zu berufen.
Am Trommelkran vorbei ging er zum Hauptportal. Er wollte sich ein Bild von Johannes’ Arbeit machen und dazu einen Umweg über das Innere des neuen Mittelschiffs nehmen, bevor er in den Keller stieg, um nach dem jungen Maler zu schauen.
Ein Halbwüchsiger kam auf ihn zu, ein blasser, dürrer Bursche. »Der Baumeister schickt mich zu Euch, Herr Morneweg.« Ängstlich schielte er nach dem Schwert des Ratsherrn und senkte den Kopf. »Ich bin der älteste Sohn des Zimmermanns Paul Steffens aus der Fischstraße.« Kaum wagte er dem Ratsherrn ins Gesicht zu schauen. »Mein Vater hat mitgebaut an Euren Speicherhäusern am Hafen und an Eurer neusten Kogge, Herr Ratsherr, und gestern Abend ist er aus dem Dachstuhl des neuen Heiligen-Geist-Hospitals gestürzt …«
»Der gütige Gott sei ihm gnädig!« Der Ratsherr schlug die Hände zusammen. »Hat er sich denn schwer verletzt?«
»Am Knie und an den Rippen, er kann nicht laufen und kaum Atem holen. Deshalb schickt meine Mutter mich, dass ich an seiner Stelle hier arbeite, doch der Baumeister sagt, er brauche keine Hilfsknechte, er brauche gestandene Zimmerleute.«
Der Ratsherr musterte die feingliedrige, hochgeschossene Gestalt des Jungen und sein hohlwangiges Gesicht. Vermutlich reichte zu Hause schon heute nicht mehr das Geld, um alle satt zu kriegen. »Wie viele Geschwister hast du?«, wollte er wissen.
»Sechs. Ich bin der Älteste.«
»Komm mit mir.« Er winkte ihn hinter sich her und aus der Baustelle heraus. »Was hast du bisher gearbeitet?«
»Ich habe bei den Marktbuden des Herrn van der Brügge geholfen. Dorthin hat die Mutter nun meine zwei kleinen Brüder geschickt.«
Sigfrid van der Brügge saß, wie Herr Morneweg, im Rat und war, wie Herr Morneweg, Vorsteher des Heiligen-Geist-Hospitals. Herr Morneweg erkundigte sich nach dem Alter der kleinen Brüder und erfuhr, dass sie sechs und acht Jahre alt waren.
Vor der Baustelle, am Ochsenwagen, standen nur noch wenige Männer und Frauen an, um sich ihre Säcke und Körbe füllen zu lassen. Der Ratsherr wies Petrus an, dem Zimmermannssohn einen Korb mit Früchten und Kohl zu geben.
»Der Fischhändler hat zwei bezahlte Dorsche zurückgelegt, die noch für niemanden bestimmt sind«, wandte er sich dann wieder an den Burschen. »Geh und nimm einen mit nach Hause. Danach hole einen Medikus zu deinem Vater.« Er drückte ihm eine Münze in die Hand. »Davon könnt ihr ihn bezahlen. Und morgen früh komm wieder auf die Baustelle – wir werden schon Arbeit für dich finden.«
Im bleichen Gesicht des Jungen glühten auf einmal die Wangen. Er bedankte sich stammelnd und mischte sich unter die kleine Schar der Bettler am Ochsenwagen.
»Das war nur Geld, gütiger Gott«, murmelte der Ratsherr, »du aber mach dem Zimmerer Steffens rasch die Knochen heil, damit er bald wieder seine Familie ernähren kann. In deiner grenzenlosen Güte, Amen.«
Er wandte sich ab und setzte seinen Weg zum Mittelschiff des Kirchenneubaus fort. Während er an Bauholzstapeln, Mörtelkübeln und Bauleuten vorüberging, nahm er sich vor, mit Meister Jakob über den Zimmermannssohn zu sprechen. Vielleicht gab es ja bei den Backsteinöfen draußen in den Traveniederungen Verwendung für einen wie ihn.
Er trat in die neue Kirche. Vor dem Malergerüst an der Ostwand blieb er stehen und betrachtete, was vom heiligen Christophorus bereits zu erkennen war: die Umrisse von Kopf und Bart und die übergroße Hand, die den weiß gewandeten Heiland hielt, der auf seiner Schulter saß.
Am Dienstagabend hatte der Ratsherr dem Kölner zuletzt bei der Arbeit zugesehen, vor drei Tagen. Er suchte nach Anzeichen von Veränderungen in dem Gemälde, nach neuen Einzelheiten, neuen Farben, fand jedoch kaum etwas, das er nicht bereits kannte. Oder waren die Augen des Heilands heute schon besser zu erkennen als vor drei Tagen? Schon möglich. Und hatte der Christophorus nicht eine Bartlocke mehr als noch am Dienstag? Der Ratsherr war sich nicht sicher, doch es sah fast danach aus.
»Viel hat er wahrhaftig nicht getan, der Johannes«, murmelte er und strich sich über den Bart. »Was ist nur los mit dem braven Mann?« Grübelnd verharrte er vor dem nicht mal halb fertigen Gemälde, bis er von draußen eine vertraute Frauenstimme seinen Namen rufen hörte. Er wandte sich um und ging zurück zum Portal. Schwester Victoria kam ihm entgegen.
»Der Pfarrherr Burchard verlangt nach dir«, flüsterte sie, als sie bei ihm war. »Dieser streitsüchtige Hundsfott zürnt schon wieder, diesmal wegen der Beerdigung gestern.«
Ein Ochsengespann aus sechs Tieren zog einen Wagen voller Backsteine auf den Bauplatz. Daneben erkannte der Ratsherr die stolze Gestalt des Mannes, den ihm seine Frau durch den Sohn der Küchenmagd bereits angekündigt hatte. Weil der oberste Pfarrer von Sankt Marien groß und beleibt war, fiel er sofort auf inmitten seines Gefolges. Sein bartloses, leicht gerötetes Gesicht sah grimmig und hart aus – wie das Gesicht eines Mannes, der gern laut geschrien hätte, sich das aus Sorge um seinen Ruf aber verbot.
An der Seite der alten Ordensschwester ging der Ratsherr auf ihn zu. Er lächelte und schlug mit der flachen Hand auf die vorüberrollende Backsteinladung.
»Prächtige Steine können wir in unserer neuen Hospitalkirche verbauen, hochwürdiger Burchard!«, rief er dem Pfarrherrn zu, der vor dem Fuhrwerk bis an einen Stapel Bauholz zurückgewichen war. »In den Brennöfen des vergangenen Herbstes sind sie besonders gut gelungen. Und wie steht es um den Umbau unserer Marienkirche?«
»Der geht so schnell voran, als würden jeden Tag tausend Bauleute darin arbeiten.« Burchards Züge glätteten sich ein wenig, und ein selbstzufriedener Ausdruck machte sich in ihnen breit. »›Seinen Knechten schenkt es der Herr im Schlaf‹, heißt es nicht so?« Sofort kehrte die Strenge in seine Miene zurück, und er reckte das Kinn nach vorn, lief los und winkte die Männer seines Gefolges hinter sich her. »Ich habe mit Euch zu reden, Herr Morneweg!« Sein missbilligender Blick streifte das Schwert des Ratsherrn.
Kaum sieben Schritte trennten beide noch, da sah der Ratsherr etwas über den Weg krabbeln, den Burchard nehmen würde. Hastig riss er die Arme hoch und sprang dem anderen mit großen Schritten entgegen. »Vorsicht!« Er setzte dem Pfarrherrn die Linke auf die Brust, drückte ihn ein Stück zurück und bückte sich nach einem großen schwarzbraunen Käfer. Auf einem Holzkeil hob er ihn aus Gras, Hobelspänen und Backsteinsplittern.
»Ein Hirschkäfer!« Aus leuchtenden Augen staunte der Ratsherr das Tier an. »Ist er nicht wunderschön, Hochwürden? Seht nur das prächtige Geweih! Fast hättet Ihr ihn totgetreten. Danken wir Gott für seine Rettung.« An Burchard und seinem Gefolge vorbei trug er den Käfer zum Holzstapel und setzte ihn dort auf einem Balken ab.
Der verdutzte Burchard schaute ihm hinterher und wirkte ebenso sprach- wie ratlos. Die Priester, Diener und Domherren seines Gefolges beobachteten den obersten Pfarrherrn der Stadt mit hochgezogenen Schultern und angespannten Mienen; ganz so, als fürchteten sie, er könnte jeden Moment in wütende Raserei verfallen.
Nachdem der Hirschkäfer unter die Balken gekrabbelt war, drehte der Ratsherr sich nach Burchard um. »Worüber wollt Ihr mit mir sprechen, Hochwürden?« Er lächelte ihn freundlich an und trat wieder auf ihn zu.
Burchard von Serkems Gestalt und Miene strafften sich. »Das wisst Ihr ganz genau!« Seine Stimme klang gepresst. »Ihr habt die Familie des Goldschmieds Runge aufgefordert, den verstorbenen Vater von den Minderen Brüdern neben deren Klosterkirche bestatten zu lassen.«
»Falsch, Hochwürden!« Das Lächeln des Ratsherrn wurde kühler, seine Stimme schärfer. »Herrn Runges Witwe und sein ältester Sohn haben mich und einige Ratsmitglieder gefragt, ob es rechtens sei, die Totenmesse für den Gatten und Vater von den Bettelmönchen vom Orden des heiligen Franziskus halten zu lassen statt von Euch.«
»Und Ihr habt dazu geraten!« Der zornige Pfarrer streckte Arm und Finger nach ihm aus. »Stimmt es etwa nicht?«
Der Ratsherr zog die Brauen hoch und musterte Burchard von Serkem aufmerksam. Der große und wohlgenährte Mann hatte ein breites, beinahe knabenhaftes Gesicht. Außer der Burg und dem Dorf seines gräflichen Vaters, dem Chor der Marienkirche und den Gesichtern seiner Mätressen hatte sein hochfahrender Blick noch nicht viel vom Leben gesehen.
Der Ratsherr neigte den Kopf auf die Schulter. »Seit wann nennt man einen Ratschlag eine ›Aufforderung‹, Hochwürden?«
»Wortklauberei!« Burchard ballte die Faust, und der Zorn trieb ihm erneut das Blut ins Gesicht. »Ich bestehe darauf …«
»Und nicht einmal einen Ratschlag erteilt haben wir«, fiel der Ratsherr ihm ins Wort. Mit auf einmal sehr ernstem Blick schaute er dem Pfarrer ins gerötete Gesicht, und seine Stimme klang bedrohlich leise. »Ich jedenfalls habe die Runges lediglich auf das Recht der Bürgerschaft und der Bettelmönche hingewiesen, in der Katharinenkirche Bestattungen durchzuführen.«
»Die Familie gehört zu meiner Pfarrei!«, rief Burchard. Weil er so laut geworden war, hatten inzwischen viele Bauleute die Arbeit eingestellt und sahen zu ihm und dem Ratsherrn herüber. »Also hätte der Tote durch Sankt Marien bestattet werden müssen!«
»Da irrt Ihr, Hochwürden. Außerdem sind die Bestattungen und Totenmessen bei Euch in der Marienkirche erheblich teurer als in der Klosterkirche.« Die Miene des Pfarrherrn gefror, und der Ratsherr genoss den Anblick – er hatte den Finger in die eigentliche Wunde gelegt. »Wer den Pfennig umdrehen muss, geht mit seinen Toten lieber zu den Bettelmönchen als zu Euch.« Lächelnd zuckte er mit den Schultern. »Ist das so schwer zu verstehen?«
Der Pfarrherr sog scharf die Luft ein. »Ich verbiete, dass künftig jemals wieder ein Toter meiner Pfarrei von den Minderen Brüdern bestattet wird!« Er wandte sich an Schwester Victoria. »Richte das ihrem Abt aus, wenn du zu ihm ans Krankenlager gehst!«
»Ich denke nicht, dass Ihr das Recht für ein solches Verbot habt, Bruder Burchard«, erklärte die Ordensschwester in größter Ruhe. Sie stand in hohem Ansehen bei den Lübeckern, weil sie sich auf Kräuterkunde und Heilkunst verstand. Auch den kranken Abt der Minderen Brüder pflegte und behandelte sie.
»Ich soll dazu kein Recht haben?!« Burchard stampfte mit dem Fuß auf, schrie sie an und holte zum Schlag aus. »Ich werd dir gleich zeigen, welches Recht ich habe!«
Sofort sprang der Ratsherr zwischen Ordensfrau und Pfarrer. »Genug!«, rief er und legte die Rechte auf den Knauf seines Schwertes.
Burchard erbleichte und wich zurück. Wie jeder in Lübeck kannte gewiss auch er die Geschichten, die man sich in den Küstenstädten der Ostsee vom Ratsherrn Morneweg erzählte, und wusste also, dass der gelernt hatte, Faust und Schwert zu gebrauchen, und dass er sich nicht scheute, von seiner Kampfkunst Gebrauch zu machen, wenn es sein musste.
»Wer seine Toten in der Katharinenkirche bestatten lassen will, hat auch künftig das Recht dazu!«, erklärte Herr Morneweg mit fester Stimme. »Fragt unseren Bischof, Herr von Serkem, fragt unseren Bürgermeister und fragt den Rat von Lübeck!«
Der oberste Pfarrherr der Stadt sog erneut scharf die Luft durch die Nase ein und schluckte ein paarmal. »Ihr werdet in dieser Sache noch von mir hören!«, zischte er dann. »Ich werde mich beim Erzbischof beschweren.« Er wandte sich ab und stapfte zum Ausgang der Baustelle. Die geistlichen Herren seines Gefolges warfen scheue Blicke nach dem Ratsherrn, bevor sie sich Burchard anschlossen.
Der Ratsherr sah ihnen kopfschüttelnd hinterher. »Hör mir zu, allmächtiger Gott«, murmelte er. »Schenke diesem zornigen und stolzen Mann endlich einen Kardinalshut. In Rom kann er unserem schönen Lübeck keinen Schaden zufügen. In deiner grenzenlosen Güte, Amen.«
»Amen«, seufzte Schwester Victoria.
»Ach, hochwürdiger Herr Burchard!«, rief der Ratsherr plötzlich. Der erboste Pfarrer fuhr herum, die Männer hinter ihm traten zur Seite. »Eines noch: Ich habe beim Fischhändler ein Geschenk für Euch zurücklegen lassen, einen Dorsch! Schickt doch schnell einen Diener zum Markt, damit er mein Geschenk abholen kann.« Er hob die Hand zum Gruß. »Einen gesegneten Tag wünsche ich Euch.«
Der Pfarrherr stieß ein paar Worte aus, die der Ratsherr lieber nicht verstehen wollte, dann eilte er von der Baustelle zum Koberg hinunter.
Jetzt, wo rund um ihn Geraune und Getuschel sich erhoben, jetzt erst merkte der Ratsherr, wie still es auf der Baustelle zwischenzeitlich geworden war.
»Geld und Macht!«, rief ein Mann von den Bauhütten auf der Nordseite her. »Taste es ihnen an, und sie jaulen auf wie Hunde, denen man auf den Schwanz tritt. Nimm es ihnen, und sie hängen dir an der Kehle!«