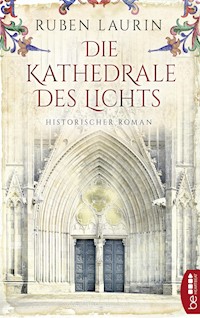9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Magdeburg, 1275: Eine festliche Prozession gerät zur Katastrophe. Viele Menschen sterben, beinahe auch die junge Jüdin Esther, doch der Knappe Wolfram rettet sie. Eine zarte Liebe entsteht, doch der Geldverleiher Amos will seine Tochter keinem Christen zur Frau geben. Wolfram verlässt die Stadt und wird zu einem berühmten Ritter im Dienste des Markgrafen von Brandenburg. Zwei Jahre später kreuzen sich die Wege der Jüdin und des Christen erneut. Nun ist es Esther, die Wolfram retten kann ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
Über das Buch
Magdeburg, 1275: Eine festliche Prozession gerät zur Katastrophe. Viele Menschen sterben, beinahe auch die junge Jüdin Esther, doch der Knappe Wolfram rettet sie. Eine zarte Liebe entsteht, doch der Geldverleiher Amos will seine Tochter keinem Christen zur Frau geben. Wolfram verlässt die Stadt und wird zu einem berühmten Ritter im Dienste des Markgrafen von Brandenburg. Zwei Jahre später kreuzen sich die Wege der Jüdin und des Christen erneut. Nun ist es Esther, die Wolfram retten kann …
Über den Autor
Ruben Laurin ist das Pseudonym eines preisgekrönten Autors, der vor allem phantastische und historische Romane verfasst. Seine Faszination für die Geschichte der Stadt Magdeburg und die mittelalterliche Kirchenarchitektur brachten ihn auf die Idee, einen Roman über den Bau des Magdeburger Doms zu schreiben: Die Kathedrale des Lichts. Ruben Laurin lebt in der Nähe von Karlsruhe.
Ruben Laurin wurde für „Das weiße Gold der Hanse“ mit dem goldenen Homer ausgezeichnet und ist somit der Gewinner des HOMER-Literaturpreis für den besten historischen Roman aus dem Jahr 2019.
RUBEN LAURIN
DIE
JÜDIN
VON
MAGDEBURG
Historischer Roman
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Originalausgabe
Die Veröffentlichung dieses Werkes erfolgt auf Vermittlung der literarischen Agentur Peter Molden, Köln
Copyright © 2020 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Dr. Ulrike Brandt-Schwarze, Bonn
Umschlagmotive: © shutterstock: Marcus_Hofmann | Wolfgang Zwanzger | richardjohnson | EvGavrilov | R.Filip | Kompaniets Taras | VanoVasaio; © iStockphoto: MATJAZ SLANIC; © Arcangel Images: Collaboration JS
Umschlaggestaltung: Sandra Taufer, München
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-9436-8
www.luebbe.de
www.lesejury.de
WHEN YOU’RE DOWN AND OUT,
WHEN YOUR’RE ON THE STREET,
WHEN EVENING FALLS SO HARD
I WILL COMFORT YOU, I’LL TAKE YOUR PART.
WHEN DARKNESS COMES UND PAIN IS ALL AROUND,
LIKE A BRIDGE OVER TROUBLED WATERI WILL LAY ME DOWN.
Paul Simon
PERSONENLISTE
Die mit einem * versehenen Namen verweisen auf historische Personen.
Amos, auch genannt Silbersack, jüdischer Geldverleiher
Lea, seine Frau
Esther (Sophia), ihre Tochter
Elias, Esthers Oheim, Halbbruder ihrer Mutter
Jakob, ihr Vetter
Judith, ihre Muhme
Johannes, Amos’ Pferdeknecht
Anna, Küchenmagd im Judendorf
Nikolaus, ihr Mann
Samuel, Rabbiner
Mechthild von Magdeburg*, christliche Mystikerin, Dichterin, Begine
Genoveva, ihre Pflegetochter
Theodorus, »Dostl«, Schmied und Jäger
Adalbert von Stendal, Ritter des Herzogs von Schwerin
Wolfram von Hildesheim, sein Knappe
Sigurd, Knappe
Otto IV.*, Markgraf von Brandenburg
Erich von Brandenburg*, Domherr und Propst in Halberstadt, Ottos Bruder
Bodo von Spandau, Graf und Ritter Ottos
Tankred von Cölln, Ritter Ottos
Heilwig*, Tochter von Johann I., Graf von Holstein-Kiel
Adolf V.*, Graf von Holstein-Kiel, ihr ältester Bruder
Konrad II. von Sternberg*, Erzbischof von Magdeburg
Günther von Schwalenberg*, Erzbischof von Magdeburg
Gallus von Trier, Priestermönch
Gero von Greifenstein, Ritter Konrads
Slawomir von Sternberg, Geros Knappe
Joseph Hardenberg, Zunftmeister der Tuchmacher
Heinemann von Schartow*, Ritter und Ratsherr
Bruno von Stövenbeck*, Poet, Kaufmann und Constabler
ZEITTAFEL
805 n. Chr.
Unter Kaiser Karl dem Großen wird Magdeburg, ein fränkisches Kastell an der Elbe, zum zentralen Handelsplatz mit den Wenden.
937
König Otto der Große gründet in Magdeburg das Benediktinerkloster St. Mauritius (St. Moritz).
955
Otto beginnt, seiner 946 verstorbenen Frau Edgitha eine Grabstätte zu bauen: den ersten Dom von Magdeburg.
um 1207
Mechthild von Magdeburg wird in einer Burg in der Nähe der Stadt geboren.
Ostern 1207
Magdeburg brennt, der erste Dom wird zerstört.
1208
Erzbischof Albrecht lässt die Brandruine abreißen und den Grundstein für einen neuen Dom legen.
1214
Kaiser Otto IV. fällt in das Erzbistum ein, weil Albrecht den Kirchenbann gegen ihn verhängt hat; seine Truppen verwüsten weite Landstriche und zerstören das Judendorf und andere Ortschaften in der Umgebung Magdeburgs.
November 1220
Friedrich II. wird in Rom von Papst Honorius zum Kaiser gekrönt.
ab 1222
Franziskaner und Dominikaner fassen in Magdeburg Fuß.
1228
In den folgenden Jahren gilt die Stadt als angesehener Bildungsort und blühendes Kulturzentrum.
Oktober 1232
Erzbischof Albrecht stirbt während einer Italienreise.
1234
In der Dombaustelle wird die erste Messe gelesen.
um 1237
An der Handelsstraße zwischen Lebus an der Oder und der Elbmetropole Magdeburg entsteht ein kleines Dorf namens Berlin.
um 1240
Heute unbekannte Bildhauer erschaffen für den neuen Dom die Statue des Schwarzen Ritters und der heiligen Katharina, die Figurengruppe der Zehn Jungfrauen und das Reiterdenkmal Kaiser Ottos I.
ab ca. 1250
Mechthild, die bereits als junge Frau nach Magdeburg gekommen ist, verfasst ihre mystische Schrift Das fließende Licht der Gottheit; darin deutet sie Konflikte mit dem Klerus der Stadt an.
1261
Während des Laubhüttenfestes Ende September lässt Erzbischof Ruprecht das Judendorf überfallen und plündern; die reichsten Männer der jüdischen Gemeinde werden eingekerkert und erst gegen hohe Lösegeldzahlungen wieder freigelassen.
Juni 1264
Papst Urban IV. befiehlt den Magdeburger Domherren, Erich von Brandenburg ins Domkapitel aufzunehmen; diese weigern sich und verhindern so, dass die Brandenburger Markgrafen sich im Erzbistum festsetzen.
1266
Graf Konrad von Sternberg wird Erzbischof von Magdeburg.
1274
In einer Urkunde vom 10. März wird darüber geklagt, dass es in den seit Langem stockenden Neubau des Domes hineinregnet.
1277
Im Januar stirbt Erzbischof Konrad II., Graf Günther von Schwalenberg wird zu seinem Nachfolger gewählt.
1278
Tief gekränkt, weil man seinen Bruder Erich nicht gewählt hat, fällt Markgraf Otto von Brandenburg im Januar mit einem Kriegsheer ins Erzbistum ein.
WIE ES BEGANN
Magdeburg, Ende September 1261
Der Spätsommermorgen hüllte das Land in Stille und Glanz. Noch knarrten keine Windmühlenflügel, noch brüllte kein Wächter von der Stadtmauer herab, noch holperte kein Fuhrwerk zum Markt hinauf, noch weinte niemand, noch floss kein Blut, noch schnürte es keiner Mutter das Herz zusammen. Nur auf den Koppeln der Gehöfte ringsum blökte eine Kuh hier und da, und in der Vorstadt krähten die Hähne. Doch klang es nicht dringender als sonst?
Die Sonne zerstrahlte die letzten Dunstschwaden auf den Schafweiden und in der Uferböschung der Elbarme. Ein Rudel Rehe hob die Schädel und sprang in wilder Flucht über das abgemähte Gerstenfeld zum fernen Wald hin. Der Himmel hatte sich mit rötlichen Schönwetterwolken geschmückt und wölbte sich über Türmen, Dächern, Obstgärten, Wiesen und zwei Frauen, die Hand in Hand auf dem Weg zwischen Sudenburger Tor und Judendorf liefen.
Die Ältere hatte es eilig, zog die Jüngere hinter sich her, wollte schnell an der Siedlung Sudenburg vorbei und zum Judendorf hinunter, denn eine schlechte Nachricht brannte ihr auf dem Herzen und trieb sie voran. Hager war diese Frau, sehr aufrecht ging sie, und ihr graues Haar hatte sie mit einem schwarzen Stirntuch aus dem Gesicht gebunden. Ihr weites und helles Leinengewand flatterte in der Morgenbrise.
Die sie hinter sich herzog, war fast noch ein Mädchen. Sie war von kleiner gedrungener Gestalt und hatte haselnussbraune Locken. Sie wusste nichts von böser Botschaft, sie freute sich nur auf das Fest und auf die kleinen Kinder unten im Judendorf, auf David und Esther.
»Was für ein schöner Morgen, o Herr«, betete die Ältere mit dunkler, heiserer Stimme. »Goldenes Licht, der Himmel voller Schwalben, und die Obstbäume biegen sich unter der süßen Last ihrer Äpfel und Birnen. Aber wie hässlich wird der Abend sich anfühlen, wenn unten im Judendorf die Leute sich krümmen werden vor Kummer und Angst.«
»Was schwatzt Mamechma von Kummer und Angst?« Aus ihren großen, dunklen Knopfaugen schaute die Jüngere zu ihr herauf; Mamechma war der Kosename, mit dem sie ihre Pflegemutter rief. »Se singet doch!« Mit heftigen Kopfbewegungen deutete sie zum Judendorf hinunter. »De Juds singet, hör doch, Mamechma!«
Die Ältere, Mechthild, achtete nicht auf ihre Worte, betete einfach weiter. »Müssen denn schon wieder Blut und Tränen fließen, o Herr?« Sie bekreuzigte sich. »Nicht, wenn du hilfst. Nicht, wenn du dich Gier und Gewalt in den Weg stellst. Amen, Amen, Amen.«
»De Leuts singet!« Die Jüngere runzelte ihre dichten, braunen Brauen, sodass sich dazwischen eine tiefe Falte eingrub. Widerwillen und Empörung standen in ihrem runden, von Blatternarben entstellten Gesicht. »Se singet doch!« Sie ließ Mechthilds Hand los und deutete zum Judendorf hinüber. »Hört Mamechma nicht, wie schön se singet, de Juds?« Ihre Stimme klang krähend und durchdringend wie die einer Elster. Immer schneller lief sie nun, sprang beinahe wie ein Fohlen und klatschte bei jedem Hüpfer in die Hände.
Es stimmte ja: Unten im Judendorf zogen sie singend aus ihren Häusern. Mechthild, die ein Stück zurückblieb, sah es jetzt auch. Die Bauersleute und Handwerkerfamilien im Süddorf, deren nördliche Höfe ans Judendorf angrenzten, standen bereits an ihren Zäunen und Mauern und begafften die feiernden Juden. Auch aus Sudenburger Häusern liefen sie schon auf die Weiden und Wege hinaus, um sich den Beginn des Laubhüttenfestes anzuschauen.
Die Juden sammelten sich vor der großen Laubhütte, die sie vor ihrem Versammlungshaus errichtet hatten und an der die ganze Judengemeinde während der vergangenen Woche gebaut hatte. Die ersten Männer begannen, um die herbstbunte Hütte herumzuziehen. An ihrer Spitze tanzte ihr wilder Levit, ihr Rebbe, wie sie ihn nannten. Trotz der Entfernung konnte Mechthild erkennen, wie er eine Schriftrolle über den grauen Lockenkopf hochstemmte. Ihm folgten die Männer und halbwüchsigen Burschen, dann kamen die Frauen und Kinder.
Ja, es stimmte: Unten im Judendorf feierte man ab heute das Laubhüttenfest, und es herrschte Festtagsstimmung. Aber konnte das Mechthild trösten? O nein! Es machte ihr das Herz nur noch schwerer, denn sie wusste, was man im Palast des Erzbischofs beschlossen hatte.
Von der Elbe her ertönte plötzlich ein lautes, klatschendes Geräusch wie von hektischen und kräftiger werdenden Schlägen. Erschrocken wandte Mechthild sich um und blickte zum Strom: Bei den Anlegestellen unterhalb des Judendorfes streckte ein Schwanenpaar die Hälse, schlug mit den Flügeln ins Wasser und trat mit gespreizten Schwimmfüßen in die Fluten, schneller und schneller, bis es sich schließlich vom Fluss lösen konnte. Nach und nach gewannen die Schwäne an Höhe und flogen nach Norden zur Stadt hin. Kurz vor dem Brücktor trennten sie sich: Einer glitt unter der alten Brücke hindurch, der andere flog über sie hinweg.
Und dann hörte Mechthild das Unheil auch schon an die Tür des noch unschuldigen Tages pochen: Hinter ihr, irgendwo zwischen den Zinnen des Sudenburger Tors, brüllte ein Wächter. Sie blieb stehen und fuhr herum. Das Mädchen jedoch sprang weiter, klatschte weiter in die Hände und krähte fröhlich. »Se singet! Se singet, se singet doch!«
Oben an der Stadtmauer aber, höchstens zweihundert Schritte entfernt, traten sie stumm aus dem Tor – die Waffenknechte des Erzbischofs Ruprecht. Und an ihrer Spitze schritt er, der Priestermönch mit der Peitsche.
Mechthild ließ die Schultern hängen. Zu spät. Kurz schloss sie die Augen und seufzte. Zu spät, zu spät, zu spät. Aber was hätte es den Juden unten im Dorf auch genützt, wenn ihre Warnung sie rechtzeitig erreicht hätte? Nichts hätte es ihnen genützt, gar nichts.
Da stand sie nun also, Mechthild von Magdeburg, auf halbem Weg zwischen Stadtmauer und Judendorf. Da stand sie, die Gottbegeisterte, die Schreiberin, die Seherin, die Freundin des Herrn Jesus Christus, die Feindin vieler Herren in den Klöstern und Kirchen der großen Stadt Magdeburg. Und wie schon viel zu oft in all den Jahrzehnten, die sie nun hier lebte, wusste sie, dass auch heute Gewalt und Gier über Liebe und Schönheit triumphieren würden.
Die Jüngere jedoch merkte von alldem nichts, hüpfte noch immer krähend dem Judendorf entgegen, klatschte noch immer fröhlich in die Hände. »Still!«, zischte Mechthild ihr zu. »Willst du wohl Ruhe geben!« Das stämmige Mädchen mit den schwarzen Wieselaugen verstummte augenblicklich, sperrte den Mund auf, guckte dümmlich und stand da wie gelähmt.
»Gib, dass sie wenigstens niemanden erschlagen, o Herr«, betete Mechthild und bekreuzigte sich abermals. »Her zu mir, kleine Genoveva!« Sie warf einen sorgenvollen Blick auf das Judendorf, wo die ersten Männer sich in die Laubhütte bückten, und winkte dabei das Mädchen zurück an ihre Seite.
Nun erkannte auch die Jüngere den Mönch mit der Peitsche, den Schrecken der Stadt. Er war unverwechselbar, der Gallus von Trier mit seinem vornübergebeugten Gang, mit seinen großen, federnden Schritten, mit seiner Peitsche; unverwechselbar, auch wenn an diesem Morgen die Kapuze seines schwarzen Habits seinen Kopf verhüllte. An der Spitze waffenklirrender Männer marschierte er auf Mechthild und das Mädchen zu und klopfte bei jedem Schritt mit dem Peitschenstiel gegen seine schwarze Mönchskutte.
»Was wollet die?« Genoveva vergaß den Gesang unten im Judendorf, vergaß das Laubhüttenfest und die Kinderchen, die sie so liebte. Sie griff nach der Hand ihrer Pflegemutter und Lehrerin und drängte sich an sie. »Was wollet de Kerls mit de Schwerts, was will de böse Bruder Gallus?«
»Was wird der schon wollen?« Mechthild spuckte aus und seufzte bitter. »Den Willen seines Herrn erfüllen will er.« Sie kannte die Pläne des Erzbischofs und wusste von seiner leeren Schatulle. Auch sein enges und kaltes Herz kannte sie – und seinen härtesten Prügel, den Peitschenmönch.
Der blieb stehen, als er die fromme Frau und ihre Schülerin erkannte. Weniger als hundert Schritte trennten sie noch. Hinter ihm drängten sich die bischöflichen Waffenknechte. Die meisten überragten den kleinen Mönch um Haupteslänge.
Gallus von Trier war unter Mechthilds Feinden in der Stadt der erbittertste. Der Benediktiner ging beim Erzbischof ein und aus. Manche hielten ihn für dessen Beichtvater.
Mechthild konnte erkennen, wie er die dichten schwarzen Brauen unter seiner hohen Stirn runzelte und wie er die große, scharf geschnittene Nase rümpfte. »Du schon wieder!«, rief er.
Mechthild nickte nur. Und an ihre Pflegetochter gewandt, sagte sie leise: »Was gefällt dir besser, meine kleine Genoveva – wenn Menschen singen und beten wie die Juden unten bei ihrer Laubhütte, oder wenn sich Menschen mit geschärften Klingen, finsteren Mienen und bösen Gedanken vor dem Stadttor zusammenrotten?«
»Tanze soll’n de Menschs, singe und tanze. Dassis schön.«
»Nicht wahr, mein Kind?« Die hagere, zerbrechlich wirkende Frau legte den Arm um die Schulter des Mädchens. »Aber das Schöne trägt kein Schwert und verschafft sich mit keiner Peitsche Gehör. Sieh hin und lerne, Genoveva.«
Gallus setzte sich wieder in Bewegung, klopfte heftiger mit dem Peitschenstiel gegen die Wade und winkte die Waffenknechte hinter sich her. Mechthild schätzte, dass knapp dreißig meist junge Männer ihm folgten.
Sie stemmte die Fäuste in die Hüften. »Steh nicht da wie ein ängstliches Lämmlein!«, befahl sie ihrem Schützling. »Wir verlieren, doch wir bleiben Sieger. Hast du das verstanden? Kopf hoch also, Brust raus, und heiliger Zorn soll in deinen Augen glänzen!«
In diesem Moment merkten sie auch unten im Judendorf, was die Stunde geschlagen hatte.
»Se höret auf zu singe.« Genoveva wandte den großen Kopf und schaute zum Dorf. »De Fraus fliehet in de Hauses, und de Manns kommet zurück aus de Laubhütt.«
»Kehrst du Magdeburg endlich den Rücken, Mechthild?« Fünf Schritte vor ihnen blieb der Priestermönch stehen und hob die Rechte, sodass auch die stillstanden, die hinter ihm marschierten. »Haben die frommen Weiber dir und deiner Schwachsinnigen endlich die Tür gewiesen?«
Er sprach von der Gemeinschaft der frommen Frauen, die mit Mechthild und Genoveva auf einem Gehöft der Burggrafenburg lebten und die man landauf, landab Beginen nannte.
»Darauf werdet ihr noch lange warten müssen, du und deinesgleichen.« Mechthild heftete ihre leuchtend grünen Augen auf den Mönch. »Und wohin gehst du, Bruder Gallus? Wohin führst du diese waffenstarrende Rotte?«
»Was geht’s dich an, Wahnsinnige?« Der Mönch wich ihrem durchdringenden und gebieterischen Blick aus und schaute an ihr vorbei zum Judendorf hinunter. Er hatte eng zusammenstehende braune Augen und ein bartloses knochiges Gesicht mit spitzem Kinn und kleinem Mund. »Vielleicht wollen wir ja genau wie du das Judenfest besuchen und schauen, wie es sich so wohnt in einem Blätterverschlag.«
»Ja, tu das, Gallus.« Mechthild nickte langsam. »Und erzähl’s dann dem Erzbischof. Auch dem stünde es gut an, in einer Laubhütte zu wohnen wie ein Pilger statt in einem Palast wie ein Fürst.« Mechthild trat näher zu ihm, so nahe, dass die Zehenspitzen ihrer bloßen Füße seine Stiefelspitzen beinahe berührten. »Und wozu nimmst du diese da mit aufs Judenfest?« An ihm vorbei deutete sie auf die Männer, die sich hinter ihm drängten.
»Was gibst du dich mit diesem närrischen Weib ab, Mönch?« Ein sehr junger, hochgewachsener Bursche mit strohblondem Haar trat aus der Rotte der Waffenknechte, fuchtelte mit seiner Saufeder und streckte die Hühnerbrust vor. »Soll ich sie aus dem Weg prügeln?«
Der Priestermönch winkte zornig ab und wandte sich an Mechthild. »Was geht’s dich an, Wahnsinnige?« Er trat einen Schritt auf sie zu und hob die Peitsche. »Aus dem Weg mit dir!«
Mechthild rührte sich nicht von der Stelle. »Ich will dir sagen, wozu du sie mitnimmst, Bruder Gallus!« Ganz ruhig sprach sie, und ihr brennender Blick ließ sein Gesicht nicht mehr los. »Um von den heiligen Zehn Geboten gleich vier müheloser brechen zu können: Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten, du sollst nicht begehren deines Nächsten Gut! Du sollst keine anderen Götter …«
Gallus stieß einen Wutschrei aus, stieß sie weg von sich und schlug zu – doch der Hieb traf Genoveva, die sich schützend vor ihre Lehrerin und Pflegemutter geworfen hatte.
»Schlägt de Gallus Mamechma, schlägt er de Heiland und sein Mutter Maria!«, rief sie.
Gallus zischte nur und schlug erneut zu. Die Peitsche traf Genovevas Gesicht so hart, dass sie aufschrie. Es gelang ihr jedoch, die Peitschenriemen zu fassen und festzuhalten. Vor Wut kreischend zerrte sie so fest daran, dass der Stiel dem Mönch aus der Faust glitt. »Böser Gallus!« Das Mädchen konnte ungeheure Kräfte entwickeln, wenn es erregt war. Genoveva zerbrach den Peitschenstiel und schleuderte dem Mönch die Bruchstücke vor die Füße.
»Saukrodd!«, brüllte der Benediktiner. »In den Tartarenturm mit dem hässlichen Wurm!«
Der junge Bursche mit dem Sauspieß und zwei weitere Waffenknechte stürzten an ihm vorbei, packten das strampelnde und um sich schlagende Mädchen und versuchten, es zu bändigen. Die anderen aber und Gallus selbst machten einen Bogen um Mechthild und stürmten zum Judendorf hinunter.
»Lasst sie sofort los!« Mechthild stieß die ausgestreckten Arme zwischen Mädchen und Männer, so als wollte sie alle vier segnen. Ihr durchdringender Blick richtete sich auf die drei Waffenknechte. »Ich befehl’s euch im Namen des Herrn!« Einem nach dem anderen schaute sie in die Augen, und einer nach dem anderen senkte den Kopf und gab das strampelnde und zeternde Mädchen frei.
Im selben Moment begann unten im Süddorf die Glocke der Dorfkirche St. Michael zu läuten. Vielleicht, weil die Bauern und Handwerker dort sich vor den heranstürmenden Waffenknechten fürchteten, vielleicht auch, um die Judengemeinde zu warnen.
»Bedenkt ihr denn gar nicht, was ihr tut?«, sagte Mechthild streng. »Denkt ihr denn gar nicht daran, was euch blüht?« Zwei der Männer wichen erschrocken vor ihr zurück, nur der halbwüchsige Spießträger rührte sich nicht von der Stelle. »Ihr versündigt euch an dem Mädchen, ihr versündigt euch an den jüdischen Schwestern und Brüdern – so oder so fahrt ihr zur Hölle!«
»Altes Narrenweib!« Der Bursche mit der Saufeder spuckte aus. »Wer bist du denn, dass du mir gebieten willst?« Er wandte sich ab, winkte die anderen hinter sich her und rannte los – der bewaffneten Rotte und dem Peitschenmönch hinterher.
»Kehre um, Gero!«, rief Mechthild ihm nach. »Zurück in die Stadt mit dir!« Sie kannte den unbändigen Burschen und wusste auch, wessen Sohn er war. »In der Domschule hast du zu sitzen um diese Zeit!« Viele kannten den Bastard des Grafen von Greifenstein, denn wo immer das Jungvolk von Magdeburg über die Stränge schlug, war er meistens ganz vorn mit dabei.
Der zweite Waffenknecht bekreuzigte sich und folgte zögernd dem Domschüler mit dem Spieß. Der dritte fiel vor Mechthild auf die Knie. »Betet für mich, fromme Frau«, stammelte er. »Betet für meine arme Seele.«
»Wirst du wohl aufstehen!«, fuhr Mechthild ihn an. »Vor Gott, deinem Schöpfer, und vor Christus, deinem Heiland, sollst du knien und flehen, nie vor einem Sterblichen!« Sie wandte sich ab und packte das heulende Mädchen am Arm. »Ja, ich werde für dich beten, Kerl!«, rief sie im Fortgehen. »Du aber bereue und tue Buße, sonst nützt dir selbst das Gebet des heiligen Mauritius nichts!« Sie zog Genoveva hinter sich her und lief mit ihr zum Süddorf hinunter und ins Judendorf hinein.
Dort waren die Waffenknechte längst über die Festgemeinde hergefallen. Sie drangen in die steinernen Häuser der Juden ein, zerrten Jungfrauen und Knaben aus Höfen und Stallungen, stießen langbärtige Männer aus dem Inneren der Laubhütte in den Staub des Dorfplatzes, verfolgten Mütter und Halbwüchsige, die mit einer Kinderschar zur Elbe hinunter flohen, wo die Bootsstege der Juden lagen.
»Herr, erbarme dich!«, rief Mechthild atemlos und lief, so schnell sie nur konnte. »Herr, so erbarme dich doch!«
Genoveva schüttelte die Hand der Älteren ab und rannte voraus. »Meine Kinds, meine Kinds!«, schrie sie. »Mein David, meine Sophia!«, heulte sie und hetzte wie eine gejagte Häsin ins Judendorf hinein. Mechthild rief sie zurück, aber die kaum Dreizehnjährige hastete immer weiter, vorbei an der Laubhütte und zum prächtigen Haus des Geldverleihers Amos hin, auf dessen kleine Kinder sie hin und wieder aufpassen durfte und in die sie ganz vernarrt war.
Vor der Laubhütte sah Mechthild, wie Samuel, der Levit, sich im Griff zweier Waffenknechte wand, während der Mönch mit seiner Peitsche auf ihn eindrosch. Die blaue Kappe des Rebbe und die Schriftrolle lagen zwischen ihnen im Staub, und er brüllte dem Prügelnden hebräische Sätze ins Gesicht – Flüche, vermutete Mechthild –, die Gallus aufstachelten, nur noch heftiger zuzuschlagen. Schweißperlen glänzten bereits auf der hohen Stirn des Benediktiners, doch selbst die wütendsten Hiebe vermochten nicht, den jüdischen Priester zum Schweigen zu bringen.
Zwei junge Männer der Judengemeinde sah Mechthild herbeistürzen. Sie stießen die Waffenknechte zur Seite und stellten sich schützend vor ihren fluchenden und blutenden Rebbe. Auch auf sie schlug der Peitschenmönch ein.
Gut hundert Schritte trennten die um Atem ringende Mechthild noch von der Laubhütte, als ihr Blick auf Genoveva fiel. Wie festgewachsen stand sie vor dem großen Haus des Geldverleihers und spähte zum Fluss hinunter. Waffenknechte stießen Amos und Elias, den jungen Halbbruder seiner Frau, aus dem Tür. Elias strauchelte und stürzte von der Treppe neben Genoveva in den Dreck.
Im selben Moment schrie das Mädchen auf, sprang los und rannte zur Elbe hinunter. Mechthild erkannte sofort, was Genoveva dort entdeckt hatte: ein Boot, das ein paar Halbwüchsige in die Elbe hineinschoben, um die Frauen und Kinder darin vor dem Zugriff der heranstürmenden Waffenknechte zu bewahren. Und im Gedränge auf dem Boot und im Uferwasser entdeckte Mechthild die Kleinkinder, die ihr Pflegling so liebte: Die noch nicht einmal dreijährige Esther hing weinend im Arm ihrer Mutter Lea, ihr etwas älterer Bruder David kletterte eben ins Boot.
»Gott sei euch gnädig«, keuchte Mechthild, blieb schwer atmend vor der Laubhütte stehen – und erstarrte. Die beiden jungen Männer, die ihrem Rebbe zu Hilfe gekommen waren, lagen zuckend in ihrem Blut. Einer mit gespaltenem Schädel und über den Knien des heulenden Rebbe ausgestreckt, der andere mit durchstoßener Brust neben der Schriftrolle.
Stumm vor Entsetzen hob Mechthild den Blick und schaute in Augen, in deren hellem Blau eisige Grausamkeit funkelte. Der Halbwüchsige mit dem Sauspieß, der Domschüler! Die eiserne Klinge seines Spießes über seiner Faust triefte vom Blut der jungen Juden.
»Das kannst du nicht wieder gutmachen, Gero«, flüsterte Mechthild. »Das kannst du deinem Gott niemals bezahlen.«
»Was willst du, Alte? Es sind doch nur verdammte Juden.« Der Bursche schob den Unterkiefer vor und versuchte zu grinsen, was ihm nicht recht gelingen wollte. Schließlich ließ er die erschütterte Mechthild stehen und rannte an Gallus von Trier vorbei zur Elbe hinunter. Der Priestermönch und seine erzbischöflichen Waffenknechte marschierten zum Haus des inzwischen gefesselten Geldverleihers Amos, den manche auch Silbersack nannten.
Im Nordwesten der Vorstadt begann die Glocke der Sudenburger Kirche St. Ambrosius zu läuten. Mechthild sank vor dem lauthals trauernden Judenpriester und den beiden Sterbenden in den Staub. Entsetzen und Seelenschmerz raubten ihr schier den Atem.
»Es tut mir so leid, Samuel«, brachte sie mit rauer Stimme hervor, »es tut mir im Herzen weh!« Als sie die Arme zum Himmel strecken wollte, um Gott um Vergebung für die Stadt Magdeburg zu bitten, hörte sie das kreischende Heulen Genovevas, und sie schaute hinunter zum Elbufer.
Das überfüllte Boot war gekentert, und wer irgend konnte, schwamm oder kroch oder stolperte durchs seichte Wasser an die Uferböschung zurück, wo schon die höhnisch lachenden Waffenknechte des Erzbischofs warteten. Und am lautesten lachte der wilde Gero.
Nach kaum einer Stunde war alles vorüber und das Unglück vollendet: vier erschlagene jüdische Männer, doppelt so viele, die von den Mannen des Erzbischofs übel zugerichtet worden waren, und fast ein Dutzend Gefangene, die Gallus von Trier ins Verlies des erzbischöflichen Palastes werfen ließ. Nicht zu reden von all dem Hausrat, Schmuck, Silber und Gold, das die Waffenknechte für Erzbischof Ruprecht aus den jüdischen Häusern geraubt hatten.
Noch am selben Abend ließ dieser der schreckensstarren und verzweifelten Judengemeinde seine Lösegeldforderungen überbringen: Allein tausend Mark Silber verlangte er für die Freilassung von Amos und Elias.
Den ganzen Tag über suchte Mechthild nach Genoveva und fand sie schließlich in der Flussböschung beim Brücktor. Jüdische Männer mit ratlosen und betretenen Gesichtern schritten das Ufer ab. Bis zur nördlichen Stadtmauer, wo beide Elbarme wieder zusammenflossen, sah Mechthild sie durch das Gestrüpp stapfen.
Unter der alten Brücke hockte Genoveva Arm in Arm mit Lea im hohen Gras. Beide schluchzten so jämmerlich, dass es Mechthild das Herz zusammenschnürte.
Sie ahnte Schlimmes und ging neben ihnen die Hocke. Das Töchterchen der jüdischen Frau, die kleine Esther, streckte sein Köpfchen aus deren Mantel und schaute Mechthild aus großen dunklen Augen an.
»David?«, fragte Mechthild leise, und beide heulten nur noch lauter. Mechthild schloss die Arme um die Frauen, zog sie samt der kleinen Esther an sich. »Mein Gott, mein Gott«, stöhnte sie, »warum nur, warum?«
So kauerten sie zu viert im hohen Gras, weinten miteinander und hielten einander fest, während über ihnen Hufschlag über die Brückenbohlen polterte und die hölzernen Brückenpfeiler unter der Last von Fuhrwerken ächzten und knarrten.
»Nimm Davids unschuldige Seele in Gnaden auf, du allmächtiger Gott«, betete Mechthild unter Tränen, als sich irgendwann die Nacht herabsenkte.
Wenige Wochen später kaufte Erzbischof Ruprecht Ländereien vom Domkapitel – Geld genug hatte er ja nun. Um diese Zeit wurde zweitausend Ruten stromaufwärts der entstellte Leichnam eines kleinen Jungen gefunden. Genoveva hörte davon und rannte sofort hinunter ins Judendorf. Sie ließ auch ihre Pflegemutter und Lehrerin dorthin rufen, denn nun war kein Zweifel mehr möglich: David, Amos und Leas kleiner Sohn, hatte den Tod gefunden.
Seine Mutter hockte klagend auf der Treppe vor ihrem Haus, als Mechthild dort ankam. Lea rieb sich Asche in Haar und Gesicht und zerriss ihr Gewand. »Ich bin schuldig!«, jammerte sie. »Verflucht muss ich sein!« Das halbe Dorf stand vor dem Haus – und mitten in der Menge Genoveva. Sie schluchzte laut und drückte das Töchterchen der Jüdin an ihre Brust, das im Judendorf Esther gerufen wurde, doch von Genoveva nur Sophia.
»Keiner von euch ist schuldig, arme Frau.« Mechthild kniete vor der trauernden Mutter nieder und redete ihr gut zu. »Allein der Erzbischof hat dieses Unglück über deine Familie gebracht.«
»Nein, o nein!« Die Frau raufte sich das aschige Haar. »Ich allein habe Jahwes Zorn auf uns gebracht! Ich allein durch meine böse Tat! Ihr wisst ja nicht, ihr wisst ja nicht!« Sie schrie laut auf, schaukelte hin und her und verbarg den Kopf schließlich zwischen den Knien. »Lass mich sterben, Allmächtiger! Verflucht muss ich sein!« Verzweifelt fuhr sie hoch und reckte die Arme gegen den Himmel. »Lass mich sterben, lass mich sterben!«
ERSTES BUCH
Die Brücke
Juni und Juli 1275
1
VERSE
Burg Landsberg, Mitte Juni 1275
Eine milde Abendbrise rauschte durch das Laub der Obstbäume und ließ das Gras vor Wolframs Augen erzittern. Nach einem verregneten und viel zu kühlen Frühling war es seit ein paar Tagen endlich doch noch warm geworden.
Der junge Knappe sog die Luft ein, denn der Wind wehte den süßen Duft des Flieders heran, der entlang der Gartenmauer blühte. Ein Duft nach Sommer und Sehnsucht – Wolfram mochte ihn sehr. Er stellte sich vor, dass die Liebe nach Flieder schmeckte und Frauenhaut nach Flieder roch. Wie die Liebe sich anfühlte, glaubte er zu wissen, Frauenhaut kannte er nur vom Anschauen im Badehaus.
Sie kauerten wieder hinter dem größten der vielen Haselnussbüsche im Burggarten. Wolfram, dem gar nicht wohl war in seiner Haut, beugte sich tiefer ins Gras und versuchte auszusehen wie ein zu großer Maulwurfshügel. Er hatte sich die Kapuze seines roten Wappenmantels über den Kopf gezogen, lauschte ständig nach allen Seiten und hoffte, dass es schnell vorübergehen würde, schneller als in der Nacht zuvor. Sein Ritter dagegen richtete sich wieder und wieder auf den Knien auf, um durch eine Lücke im Geäst zu den Burgfenstern hinüberzuspähen.
In einigen flammte bereits der Schein erster Talglampen und Fettholzflammen auf. Bald flackerte auch in jener Fensteröffnung Licht, die Wolframs Ritter mit sehnsüchtigem Blick beobachtete, seit sie nach Sonnenuntergang in den Burggarten geschlichen waren.
»Endlich«, flüsterte Adalbert von Stendal, »endlich ist sie in ihren Gemächern.« Er griff nach Wolframs Arm und drückte ihn. »Zeig mir noch einmal das Lied.«
»Und wenn nun der Markgraf bei ihr schlafen wird?« Wolfram blinzelte misstrauisch zum Burgfenster hinauf, hinter dem seit bald einer Woche Heilwig, die Tochter des Grafen von Holstein-Kiel, nächtigte. »Ihr habt doch sicher gehört, dass Otto von Brandenburg um sie wirbt und dass er heute Abend in der Burg weilt?«
»Wie kannst du so etwas auch nur denken!«, zischte der empörte Ritter und holte aus, um Wolfram ins Gesicht zu schlagen. Doch er beherrschte sich gerade noch und schnaubte nur wütend. »Heilwig ist eine fromme und sittsame Frau. Eine Ehrendame ist sie! Niemals würde sie …« Seufzend schaute er zum Fenster seiner Angebeteten hinauf. »Her mit dem Lied«, forderte er in tadelndem Ton.
Wolfram richtete sich auf, zog ein Papier aus dem Mantel und entrollte es. Im letzten Tageslicht beugte der Ritter sich darüber. Im Haselnussgestrüpp begann eine Grille zu zirpen. Zwischen den letzten Schönwetterwolken am Horizont schimmerte ein verwaschener Fleck – der Abendstern. Viele Wochen hatte es aus grauem Himmel fast ununterbrochen geregnet, und weder die Sonne noch die Sterne hatten sich gezeigt. Wolfram seufzte leise, denn gern hätte er weiter nichts getan, als dem Abendstern beim Aufleuchten zuzuschauen. Es würde wieder das Gleiche geschehen wie in der vergangenen Nacht. Und es geschah.
»Deine elende Handschrift!«, zischte Adalbert. »Ich hasse sie! Und zu dunkel ist es auch schon für meine armen Augen.« Als wären die Augen seines Knappen scharf genug, um trotz der fortgeschrittenen Dämmerung noch lesen zu können, drückte er ihm das Blatt gegen die Brust. »Lies mir das Lied noch einmal vor, Strophe für Strophe.«
Wie schon am Vorabend tat Wolfram auch heute, was er verlangte. Die Verse, die er noch entziffern konnte, las er ab, was das Dämmerlicht seinem Blick bereits verhüllte, trug er auswendig vor. Flüsternd und mit geschlossenen Augen sprach der Ritter die Worte mit, und bei jeder Zeile, die seine Liebe zu der schönen Grafentochter beschwor, nickte er heftig, als wolle er einen Schwur bekräftigen.
Die Wahrheit war: Adalbert von Stendal hatte ähnlich scharfe Augen wie Wolfram, und die Schönheit und Reinheit von Wolframs Handschrift wurde nur von jener des Mönchs übertroffen, der ihn Lesen und Schreiben gelehrt hatte. Nur hatte Adalbert es in seiner frühen Jugend vorgezogen, mit Holzschwertern auf die Pferdeknechte loszugehen und auf einem rollenden Leiterwagen das Lanzenstechen zu üben, statt im Skriptorium der väterlichen Grafenburg Lesen und Schreiben zu lernen. Der Ritter beherrschte weder das eine noch das andere. Lateinische und arabische Zahlen allerdings konnte er entziffern und zeichnen, und seinen eigenen Namen auch.
Unterdessen wurde es dunkel, und immer mehr Sterne funkelten am Nachthimmel. Der Ritter duckte sich plötzlich und zog die Schultern hoch, denn etwas schwebte dicht über ihre Köpfe hinweg. Wolfram hob den Blick – die Silhouette eines großen Vogels schwang sich lautlos in die Luft, segelte dem Ostflügel der Burg entgegen und begann um den Bergfried zu kreisen. Eine Schleiereule.
Adalbert schimpfte leise, und Wolfram beobachtete die enger werdenden Kreise des Nachtvogels. Er hatte schon am vergangenen Abend gemerkt, dass ein Eulenpaar unter dem Turmdach brütete. Vom Turmwächter wusste er, dass die Vögel sich angriffslustig zeigten, seit die ersten Küken geschlüpft waren.
»Und jetzt noch einmal die Anfänge der Strophen«, flüsterte Adalbert.
Wolfram staunte, weil sein Ritter das Lied noch immer nicht auswendig konnte, doch klaglos sprach er ihm nacheinander die ersten Zeilen jeder Strophe vor, und Adalbert wiederholte sie. Er wirkte sehr aufmerksam dabei, und seine Augen glänzten voller Vorfreude, aber sein tanzender Adamsapfel verriet Wolfram, wie unruhig und angespannt er war.
Unterdessen verstummten die letzten Stimmen auf dem angrenzenden Burghof und unten im Dorf. Nach und nach breitete sich Abendstille aus, und Wolfram empfand das Zirpen der Grille im Haselnussstrauch als durchdringend laut. Eine Katze schlich aus dem Busch, reckte den Schwanz in die Höhe, maunzte und rieb sich an seinem Knie. Irgendjemand leerte einen Nachttopf aus einem Burgfenster, im Norden ging der Vollmond auf, und irgendwo unterhalb des Burgfelsens entfernte sich Hufschlag.
»Verdammte Grille!«, zischte der Ritter und schlug mit der flachen Hand ins Geäst. Die Katze floh, die Grille verstummte. Hinter dem Fenster der Grafentochter erlosch das Kerzenlicht.
Adalbert, der es sofort bemerkte, schien einen Atemzug lang zu erstarren. »Sie geht schlafen«, flüsterte er. Fahrig strich er sich über Bart und Haar, und Wolfram sah wieder seinen Adamsapfel hüpfen. Endlich griff der Ritter nach seiner Laute und erhob sich. »Jetzt oder nie«, flüsterte er, verließ die Deckung des Haselnussstrauches, stellte sich breitbeinig unter das Fenster seiner Angebeteten und begann zu singen und die Laute zu zupfen.
Wolfram hatte schon schöneren Liedvorträgen gelauscht, zumal Adalberts hohe Fistelstimme vor Aufregung ziemlich heiser klang. Auch sonst bot seine Erscheinung nicht gerade ein Bild, das eine Frau auf Anhieb für ihn einnehmen mochte: Adalbert war nicht besonders groß, dafür stämmig und breit. Er hatte krumme Beine, und sein Bauch, sein feister Hintern und seine Hängebacken verrieten, dass er länger nicht an einem Feldzug teilgenommen hatte.
Allein den gedrechselten und geschickt gesetzten Worten seines Liedes traute Wolfram zu, das Herz einer schönen Jungfrau wie Heilwig zu betören. Und diese stammten nicht aus Adalberts eigener Feder.
Genau wie in der letzten Nacht erschien ihre Silhouette in der Fensteröffnung. Wolframs Herz schlug schneller, denn er bildete sich ein, ihre edlen Züge zu erkennen. Statt sich hinauszulehnen und still zu lauschen, lief sie hin und her und bewegte den Kopf, als würde sie sich umblicken. Eine dunkle Ahnung beschlich Wolfram, und er kämpfte gegen den Drang an, aus dem Burggarten zu fliehen.
Statt seine Ahnung ernst zu nehmen, kroch er unter dem Busch hindurch bis dicht hinter seinen Ritter. Er musste Adalbert die Worte einflüstern, sollte der mit den Liedversen durcheinanderkommen, was allzu oft vorkam. Sein Schwert zog der junge Knappe hinter sich her.
Das Herz schlug ihm bis zum Hals, und ständig spähte er nach allen Seiten – was nämlich Adalbert offenbar gänzlich kalt ließ, beunruhigte ihn außerordentlich: dass Otto von Brandenburg und sein Bruder Erich auf der Burg Landsberg weilten. Angeblich, um auf dem Wege nach Magdeburg ihre Schwester zu besuchen, die mit dem Markgrafen von Landsberg verheiratet war. In Wirklichkeit, um Heilwig den Hof zu machen. Das jedenfalls hatte der Pferdeknecht des markgräflichen Truchsesses Wolfram hinter vorgehaltener Hand verraten.
Nein, Wolfram war gar nicht wohl in seiner Haut, denn Markgraf Otto galt als harter und wilder Kriegsmann, der jeden Feind erbarmungslos aus dem Weg räumte. Und musste ihm einer, der um dieselbe Frau warb wie er, nicht als sein ärgster Feind erscheinen?
Adalbert von Stendal waren derartige Bedenken offenbar fremd. Mit heller und hoher Stimme hob er laut an zu singen:
»Wie Gold erstrahlt die Frühlingsnacht,
wenn du erscheinst, Licht meines Herzens!
In deinem Glanz verblasst der Mond,
erbleicht …«
Und schon geriet er ins Stocken, brach ab, zupfte die Laute leiser und blickte hilfesuchend hinter sich, um der Stimme seines Knappen zu lauschen.
»Erlischt Orion und verglimmt der Abendstern«, flüsterte Wolfram ihm zu, und der Ritter fuhr mit seinem Gesang fort. Wolfram aber stutzte, denn Heilwig lief nicht nur hin und her hinter ihrer Fensteröffnung, sie winkte auch noch, als hätte sie Adalbert etwas Dringendes mitzuteilen.
»In deinem Glanz verblasst der Mond«, setzte der Ritter noch einmal an, »erlischt Orion und verglimmt der Abendstern.« Auch in anderen Fensteröffnungen sah Wolfram nun Umrisse von Burgbewohnern auftauchen und Vorhänge sich bewegen. Adalbert von Stendal jedoch sang unbeirrt weiter:
»Ward jemals wärmer mir und heller,
als unter deinem Liebesblicke?
Ward jemals Liebeslust und …?«
Adalberts Fistelstimme überschlug sich plötzlich, und dann verstummte er schon wieder, diesmal abrupter als beim ersten Mal.
Wolfram verdrehte die Augen und flüsterte: »Hat Liebeslust und banges Sehnen mir heißer je die Brust entflammt?« Doch Adalbert hörte nicht mehr zu, hatte sogar die Laute sinken lassen.
Wolfram hob den Blick und runzelte die Stirn. Warum unterbrach der Ritter sein Liebeslied? Warum ging er plötzlich weg vom Haselnussgestrüpp, und warum trat er so dicht ans Burggemäuer heran? Jetzt legte er auch noch den Kopf in den Nacken, blickte zum Fenster seiner Angebeteten hinauf und lauschte ihrem Geflüster.
»Otto will heute Nacht singen, ihr müsst euch vorsehen.« Jedes Wort der Grafentochter konnte Wolfram verstehen. »Ihr müsst sofort aus dem Burggarten fliehen, ihr Herren. Jemand hat die Verse aufgeschrieben und dem Markgrafen überbracht, die Ihr in der vergangenen Nacht gesungen habt, Herr Adalbert. Und nun rast er, weil sie so viel schöner sind als seine eigenen. Eilt aus dem Garten, ich bitte Euch, schnell …«
Ein Zweig knackte unter schwerem Stiefelschritt. Augenblicklich unterbrach sich Heilwig und verschwand in der Dunkelheit ihres Gemachs. Wolfram spähte zum Obstgarten hin, denn von dort waren rasche Schritte zu vernehmen. Bald schälte sich die Gestalt eines großen, breitschultrigen Mannes aus dem Halbdunkel zwischen den Umrissen der Apfel- und Birnenbäume heraus.
»Was für ein elendes Katzengejammer will uns in dieser milden Frühlingsnacht den Schlaf rauben?«, rief der zielstrebig näherkommende Mann mit rauer und tiefer Stimme. Vierzig Jahre alt mochte er sein, höchstens. Er schwang eine große Laute in der Linken und stapfte heran. »Ist es Zufall, dass du unter dem Fenster der schönsten Frau im Reiche krächzt und jaulst, Kerlchen?«
Es war Otto, der Markgraf von Brandenburg, Wolfram erkannte ihn sofort. Er hatte ihn vor drei Jahren bei einer Fehde gegen einen wendischen Fürsten kennengelernt, als Otto genau wie Adalbert an der Seite des Herzogs von Schwerin gefochten hatte. Und erst im vergangenen Jahr war er ihm in Wittenberg wiederbegegnet, bei einem Turnier. Der schwarze Bart, die dicken Lippen, die langen schwarzen Locken und das breite Gesicht mit der kantigen Nase und der schlecht verheilten Narbe auf der Wange – eine Verwechslung war ausgeschlossen. Und dann die polternde Art, wie er auftrat und wie er tönte! Wolfram duckte sich tiefer ins Gras.
Sein Ritter aber stand wie festgewachsen. »Seit wann ist es verboten, einer schönen Dame Minnelieder darzubringen?«, fragte er, und es klang ein wenig kleinlaut.
»Gar nicht, mein Herr!« Der Markgraf ließ seine Laute ins Gras gleiten und zog sein Schwert. »Singt nur wacker weiter!« Drohend duckte der große Edelmann sich wie zum Sprung und hob seine Klinge. »Singt nur wacker weiter unter dem Fenster der künftigen Markgräfin von Brandenburg, wenn Euch Euer Leben weniger wert ist als Euer lächerliches Lied!«
Blitzschnell drang er auf Adalbert von Stendal ein, und Wolfram hielt den Atem an. Sein Ritter ließ seine Laute fallen und konnte gerade noch ausweichen, sodass Ottos Klinge gegen das Gemäuer klirrte und dort Funken schlug. Wolfram erschrak, als er merkte, wie todernst es dem Markgrafen war – dieser kriegerische Edelmann wollte seinen Rivalen nicht einfach nur vertreiben, er wollte ihn erschlagen!
Adalbert wich zurück und riss nun ebenfalls sein Schwert aus der Scheide. Ottos nächsten Schlag parierte er noch, doch der danach folgte, war mit solch wütender Wucht geführt, dass er Adalbert das Schwert aus der Hand und ins Gras hieb und ihn selbst ins Straucheln brachte.
Wolfram unterdrückte einen Schrei, denn sein Ritter torkelte rückwärts, stolperte und schlug lang hin. Der Markgraf knurrte wie ein hungriger Bär, zögerte nicht einen Augenblick, sondern sprang zu ihm und hob die Klinge, um ihm den Schädel zu spalten.
»Haltet ein, Otto!« Heilwig hatte sich weit aus dem Fenster gelehnt.
Die Männer hoben die Köpfe und spähten hinauf, auch Wolfram. Ihre Zofe lehnte neben ihr und hielt eine Talglampe heraus, deren Docht so weit aufgedreht war, dass Wolfram das Gesicht der Grafentochter in seiner ganzen Lieblichkeit erkennen konnte.
»Versündigt Euch nicht!«, schrie Heilwig und raufte sich das lange Haar. »Habt Ihr mir denn jemals ein Liebeslied gedichtet, hoher Herr? Habt Ihr jemals bei meinen Brüdern um meine Hand angehalten? Habt Ihr mir je einen Liebesbrief geschrieben? Ihr habt kein Recht, diesen Minnesänger zu erschlagen!«
»Alles Recht der Welt habe ich!«, brüllte der Markgraf zum Fenster hinauf. »Liegt dieser Burggarten nicht im Reich meines Schwagers? Und weiß nicht jeder, der es wissen will, dass ich Euch zur Frau begehre und hierhergekommen bin, weil ich um Euch werben will?« Er schlug sich mit der Faust auf die Brust. »In diesem Herzen hier schlummern all die Briefe, die ich Euch zu schreiben gedenke! In diesem Herzen hier klingt ein Lied, das ich Euch in dieser Nacht singen wollte und singen werde!« Mit dem Schwert deutete er auf Adalbert, der sich auf den Knien aufrichtete und nach seiner Klinge tastete. »Wenn dieser Hundsfott da tot ist, sollt Ihr es zu hören bekommen!«
»Ich will kein Lied hören, das von Blut befleckt ist!«, rief Heilwig vom Fenster herab. »Ich flehe Euch an, fügt diesem unschuldigen Sänger kein Leid zu, Otto!«
In diesem Augenblick schoss ein Schatten die Burgfassade herunter, glitt erst über Adalberts Scheitel und dann so dicht über Ottos Lockenpracht, dass es dem Markgrafen das Haar zerwühlte. Die Schleiereule! Adalbert warf sich ins Gras, Otto taumelte fluchend zur Seite und gegen die Burgfassade.
Das Blatt mit den Liedstrophen in der Linken und sein blankgezogenes Schwert in der Rechten, sprang Wolfram auf und stürzte zwischen seinen Ritter und den wütenden Markgrafen. »Mich müsst Ihr töten, Otto von Brandenburg!«, schrie er und richtete die Klinge gegen den Mann. »Versucht es, wenn Ihr wollt, denn ich bin es, der diese Verse gedichtet hat.« Er hob das Papier und schwang es hin und her.
Die Augen des Markgrafen verengten sich zu Schlitzen. »Du wagst es, Bursche? Willst du wirklich schon sterben?« Zorn und Verblüffung zugleich spiegelten sich in seiner Miene. Seine Blicke flogen über Wolframs hochgewachsene Gestalt und zwischen dem Schwert in seiner Faust, seinen kräftigen Schenkeln und seinem blauschwarzen Scheitel hin und her. »Wer bist du überhaupt?«
»Wolfram von Hildesheim, der Knappe dieses Ritters.« Mit einer Kopfbewegung deutete Wolfram hinter sich. »Ich habe ihm Treue und Gefolgschaft geschworen, und nur über meine Leiche werdet Ihr ihn töten.«
»So redest du mit mir, dem Markgrafen von Brandenburg?« Halb staunend, halb zürnend runzelte Otto die Brauen.
»Ja, so rede ich mit Euch, Herr.« Wolfram hob das Schwert, um keinen Zweifel an seiner Kampfbereitschaft aufkommen zu lassen. »Ihr zwingt mich dazu.«
Otto musterte ihn eindringlich, und jetzt war sein Blick eher neugierig als zornig, eher bewundernd als verblüfft. Sein eben noch glühender Zorn schien bereits zu verrauchen. »Und wer ist dieser unbegabte Sänger da hinter dir?«
»Der edle Adalbert von Stendal«, sagte Wolfram. »Er ist ein Ritter und Lehnsmann des Herzogs von Schwerin.«
»Ich erinnere mich.« Otto kam nun näher, ließ sogar die Klinge sinken. »Deinen Ritter und dich kenne ich doch, Bursche. Bist du nicht der Schwarze, der beim Turnier in Wittenberg letzten Herbst die sächsische Burg erobert und die Fahne vom Turm geholt hat?«
Wolfram nickte stumm. Die sächsischen Ritter hatten einen Heuschober zu ihrer Turnierburg umgebaut und befestigt. Adalbert und seine Gefolgsmänner hatten sie belagert und gestürmt, und Wolfram war es schließlich gewesen, der den Sachsen die Fahne geraubt hatte. Unter den Edelfrauen in Wittenberg, die ihm dafür einen Turnierpreis zugesprochen hatten, war auch die schöne Heilwig von Holstein-Kiel gewesen.
Otto kam noch einen Schritt näher, sodass er nun beinahe neben Wolfram stand. Feindselig belauerte er Adalbert, der noch immer im Gras kniete und nicht wagte, nach seiner Klinge zu langen. »Stimmt das? Ist Euer Knappe der Minnedichter?« Adalbert machte ein grimmiges Gesicht und schwieg. »Es stimmt also.« Höhnisch grinsend schüttelte Otto erst den Kopf und brach dann in schallendes Gelächter aus. »Habt Ihr zugehört, schöne Heilwig?«, rief er lachend zum Burgfenster der Grafentochter hinauf. »Habt Ihr das vernommen? Der Schwarze hat dem Ritter die Verse geschmiedet!«
»Ihr seid hochmütig, Markgraf!«, rief die junge Edelfrau aus der Fensteröffnung herab. »Habt Ihr nie gehört, dass auf den Hochmut der Fall folgt?«
Geduckt und mit einer Maus im Maul schlich plötzlich die Katze aus dem Haselnussbusch. Wolfram schaute zu ihr hinunter, und diesen einen Augenblick der Unaufmerksamkeit nahm Otto trotz seiner Erheiterung wahr – und reagierte sofort: Blitzartig hob er die Klinge, schlug Wolframs Schwert zur Seite und riss ihm das Blatt aus der Hand.
»Und nun trollt Euch, ihr Herren!«, rief er, schwenkte triumphierend das Liedblatt und hob sein Schwert. »Für dieses Mal lass ich es gut sein, aber wir treffen uns besser nie wieder unter diesem Fenster und in diesem Garten! Und sollte es euch doch danach gelüsten, geht vorher zur Beichte und lasst euch auch gleich die Letzte Ölung erteilen. Und jetzt fort mit euch, los!«
2
MUTTER
Magdeburg, Mitte Juni 1275
Etwas stimmte nicht. Esther spürte es, noch bevor der Vater den ersten Satz des Tischgebetes beendet hatte. Etwas lag in der Luft, über etwas wurde so angestrengt geschwiegen, dass es einfach nicht zu überhören war.
Es liegt an mir, ging es Esther durch den Kopf, es kann nur an mir liegen – ob irgendjemand mich beim Beginenhof erkannt hat?
Alle löffelten stumm ihre Milchsuppe, und niemand sprach ein Wort. Weder die Großeltern noch die Muhmen, Vettern, Basen, Knechte und Mägde, nicht einmal Johannes, der Pferdeknecht, der sonst gern einen Scherz zu viel machte. Das Schweigen lastete auf Köpfen, Tisch, Schüsseln und Kerzenleuchtern wie die Kettenschabracke eines Schlachtrosses.
Sie haben über mich gesprochen, dachte Esther, die etwas später zur Tafel gestoßen war. Schon als sie sich nach jüdischer Sitte im Flur die Hände gewaschen hatte, waren ihr die raunenden Stimmen aufgefallen.
Sie suchte die Blicke der anderen. Vergeblich. Alle taten, als würde die Mahlzeit ihre gesamte Aufmerksamkeit fesseln. Nur ihr Vetter Jakob gönnte ihr von Zeit zu Zeit einen verstohlenen Blick. Was immer geschieht, sagte dieser Blick, ich kann nichts dafür.
Esther beobachtete ihren Vater. Mit verschlossener Miene starrte er auf seine Schüssel, und bei jedem Löffel, den er zum Mund führte, sah er aus, als würde ihm das Essen Schmerzen bereiten. Seine Leidensmiene erboste Esther. So schaute er nur, wenn schlechte Geschäfte drohten. Oder wenn etwas wirklich Unangenehmes vorgefallen war.
Die bedrückte Stimmung schnürte Esther die Kehle zu, die Wut stieg ihr aus dem Bauch hinauf bis in den Kopf – unmöglich, noch länger an sich zu halten. »Ist jemand gestorben?« Sie warf den Holzlöffel auf den Tisch und blickte in die Runde. »Oder warum macht ihr Gesichter wie sieben Tage Finsternis?«
»Mit so was scherzt man nicht«, sagte die Muhme Judith streng. »Mit der ägyptischen Finsternis nicht und mit dem Sterben zweimal nicht.« Sie schaute zu ihrer Schwester am anderen Ende der Tafel, zu Esthers Mutter. Lea saß tief gebeugt auf ihrem Hocker und starrte stumm in ihren Suppennapf.
»Noch ist niemand gestorben«, erklärte der Großvater mit mürrischer Miene. »Der Ewige und Allmächtige, gelobt sei er, möge verhüten, dass wieder irgendjemand aus unserer Gemeinde einen plötzlichen Tod sterben muss, doch erinnere dich, wie die Waffenknechte im letzten Winter den Nachbarn aufs brüchige Eis der Elbe getrieben und wie die Mönche an Karfreitag den Sohn des Rebbe verprügelt haben. Und denk auch an die Tochter des Kantors, die wir vor drei Jahren tot und geschändet im Steinbruch gefunden haben.«
Sonst antwortete niemand auf Esthers zornige Worte. Der Vater bedeutete ihr mit einer Kopfbewegung lediglich, weiter zu essen und zu schweigen, und die Mutter stach den Löffel heftiger in die Milchsuppe als zuvor und führte ihn schneller zum Mund. Dabei starrte sie ins Leere oder in irgendeine Ferne, was auf das Gleiche herauskam.
Von ihr hatte Esther auch keine Auskunft erwartet – Lea sprach kaum noch seit jenem Tag.
Manches Mal hasste Esther sie dafür. Oder nein – sie tat es viel zu oft.
Esther rührte ihre Suppe nicht mehr an. Mit vor der Brust verschränkten Armen saß sie kerzengerade auf ihrem Hocker und wartete, bis die anderen ihre Schüsseln ausgekratzt hatten. Als es so weit war, sprach der Vater das Gebet, hob danach den Blick, schaute sie an und verkündete: »Ich habe ein ernstes Wort mit dir zu reden, meine Tochter.«
»Dachte ich’s mir.« Sie verschränkte die Arme noch fester vor der Brust. »Deine Haltung, deine Miene, die dicke Luft hier … Also los, sprich dein ernstes Wort.« Verächtlich dehnte sie die letzten Silben.
»Sei nicht so vorlaut deinem Vater gegenüber!«, zischte Judith, Jakobs Mutter, während sie sich erhob, um Lea beim Abräumen zu helfen. Alle anderen sprangen auf und verließen fluchtartig den kleinen Speiseraum. Nur der Großvater blieb sitzen.
»Wie du weißt, war ich gestern in der Stadt, beim Innungsmeister der Tuchhändler«, begann der Vater. »Meister Hardenberg sagte mir, er hätte dich am Mittwoch wieder in der Burgstraße vor dem Beginenhof gesehen.« Er atmete tief und geräuschvoll durch und blickte Esther streng und kopfschüttelnd in die dunklen Augen. »Du warst also doch wieder bei Mechthild. Dabei habe ich dir bereits zweimal verboten …«
»Aber was ist denn Unrechtes dabei, wenn ich zu ihr gehe?« Esther ballte die Fäuste und beugte sich so heftig und angriffslustig über die Suppenschale, dass ihr die schwarzen Locken ins Gesicht fielen. »Die Mechthild ist ein guter Mensch!« Sie warf ihr Haar aus dem Gesicht. »Sie ist weise und voller Liebe. Ich kann so viel von ihr lernen.«
»Sie ist geisteskrank, heißt es, und …«
»Sie ist von Gott begeistert!«, fiel Esther ihrem Vater ins Wort.
»Sie ist eine Goi!«, rief die Muhme Judith vom Herd aus. »Eine Heidin! Und du bist vorlaut und widersprichst deinem Vater!« Kopfschüttelnd und mit strenger Miene stemmte sie die Fäuste in die Hüften. »Nennst du das ›Vater und Mutter ehren‹?«
»Ich antworte dem Vater nur, weiter nichts!« Empört breitete Esther die Arme aus. Die Mutter nahm ihr den noch halb vollen Napf und den Löffel weg. Kein Wort sprach sie dabei, keinen Blick gönnte sie Esther.
»Sie war dir immer eine liebevolle Mutter«, sagte der Vater oft, wenn Esther sich über ihre Kälte und Stummheit beklagte. Das stimmte – sie war immer voller Liebe gewesen, o ja! Voller Liebe, seit Esther denken konnte, voller Liebe für den toten David.
»Unrecht daran war, dass du mein Verbot missachtet hast, als du wieder zu Mechthild gegangen bist«, erklärte er in großer Ruhe. »Mag diese Goi auch weise und gütig sein, ich verbiete dir, sie zu besuchen, und weil du mein Verbot nun schon dreimal übertreten …«
»Aber warum denn, Vater?« Esther wurde noch lauter. »Sie mag eine Goi sein, doch sie liebt Gott, genau wie du ihn liebst, genau wie ich ihn liebe!«
»Du weißt, dass die Gojim uns hassen, Esther!«, ergriff nun wieder die Muhme Judith das Wort. »Du weißt auch, was sie uns schon alles angetan haben!« Sie sprach lauter als der Vater und mit sehr barscher Stimme. »Und was sie uns jahraus, jahrein aufs Neue antun.«
»Denk an den Greifensteiner, Kind«, sagte der Großvater. »Denk daran, wie er seit Monaten immer wieder in unser Dorf hinabgeritten kommt und unser Haus beobachtet.« Seufzend schüttelte er seinen grauen Kopf, und Sorgenfalten erschienen auf seiner Stirn. »Ich fürchte, es ist die Bosheit, die ihn zu uns treibt, die pure Bosheit.«
»Mördersau, verfluchte!«, zischte die Muhme. Ihre Miene wurde hart und kantig, und sie ballte die Fäuste. »Möge ihm sein Gemächt am lebendigen Leib verfaulen.«
Esther musste ihnen recht geben: Den wilden, widerwärtigen Ritter, der Davids Tod verschuldet und zwei junge Männer der Gemeinde mit eigener Hand erschlagen hatte – darunter Judiths Gatten und Jakobs Vater –, diesen verhassten Ritter sah man in den letzten Monaten viel zu oft im Judendorf. Niemand wusste, was er hier wollte, und bisher hatte niemand gewagt, ihn das zu fragen.
Am Waschzuber, neben der fluchenden Muhme, stand ganz still die Mutter, senkte den Kopf und zog die Schultern hoch. Esther sah es und wusste, woran sie dachte. An David. Esther konnte niemandes Gedanken lesen, auch nicht die der Mutter, doch dessen war sie gewiss: Ihre Mutter dachte an David. Immer.
»Leider hassen einige von ihnen auch die Mechthild«, sagte der Vater gedankenschwer. »Der schreckliche Gallus zum Beispiel, der Peitschenmönch. Und auch sonst nicht wenige, die das Sagen haben oben in Magdeburg. Wenn nun eine von uns bei dieser unbeliebten Frau ein- und ausgeht, die manche sogar eine Wahnsinnige nennen, kann das leicht wieder den Zorn der Gojim auf uns lenken.«
»So ist es«, bekräftigte der Großvater. »Und dazu kommt, dass viele Priester, Mönche und Domherren in Magdeburg auch die Beginen hassen, zu denen Mechthild sich ja zählt.«
»Der Gallus hasst sogar die schwachsinnige Genoveva«, sagte Judith mit bitterer Miene.
»Sie ist nicht schwachsinnig«, widersprach Esther.
»Du hast deinem Vater keine Widerworte zu geben!«, zischte die Muhme.
»Man munkelt, dass der Papst diese Vereinigungen von Weibern verbieten will.« Der durchdringende Blick des Vaters ließ Esther nicht mehr los. »Und wenn man dann unseren Namen im Zusammenhang mit Mechthild nennt, könnte der Erzbischof sich veranlasst fühlen, Gallus mit einer Rotte Waffenknechte in unser Dorf zu schicken.« Scharf sog er die Luft durch die Nase ein. »Du weißt, was uns dann blüht.«
Jakob kam zurück in die Speisestube, um ein paar Löwenzahnwurzeln im Zuber zu waschen. Während er das tat, hob er den Kopf und zwinkerte Esther zu, doch ihr war nicht danach, seinen aufmunternden Blick zu erwidern.
»Weißt du nicht, dass kein Monat ins Land geht, ohne dass die Gojim von Magdeburg jemanden aus unserer Gemeinde demütigen?« Die Muhme kam an den Tisch zurück und fuchtelte wütend mit den Händen. »Oder schlagen? Oder bestehlen? Oder Schlimmeres? Bist du denn blind und taub? Und haben wir dir und allen anderen nicht erzählt, was damals geschehen ist, an jenem bösen Tag, als dein Bruder starb?« Judiths zeternde Stimme drang Esther durch Mark und Bein. »Was geschehen ist und was jeden Tag wieder geschehen kann.«
»Denk an den Greifensteiner«, sagte der Großvater wieder, »wer weiß, was der Satan im Schilde führt.«
»Gott verfluche ihn!«, zischte die Muhme. »Gott schlage ihn mit stinkenden Eiterbeulen!«
»Der ist doch nur scharf auf die Esther«, sagte Jakob leichthin, woraufhin seine Mutter herumfuhr und ihm eine schallende Ohrfeige verpasste. Esthers Vetter zog den Kopf ein, rieb sich die Wange und eilte aus dem Raum.
Die Mutter ließ die letzte Suppenschale in das Wasser des Zubers gleiten und drehte sich nach Esther um. Ihr sonst so stumpfer Blick war plötzlich seltsam fiebrig, ihre Nasenflügel bebten. Kleid und Schürze hingen an ihr wie Lumpen an einer Vogelscheuche – sie war nur noch Haut und Knochen, ein Strich in der Landschaft, wie die Großmutter zu sagen pflegte, und ganz grau im Gesicht. Esthers Mutter aß zu wenig, sie trank zu wenig, und viel zu oft hockte sie unten an der Anlegestelle und starrte auf die Elbe hinaus. Ganze Stunden, ganze Tage.
Esther riss ihren Blick los von der Mutter. »Der Erzbischof ist ein gütiger und gerechter Mann«, sagte sie. »Außerdem leihst du ihm Geld, Vater, viel Geld, und andere Männer unserer Gemeinde tun das auch. Niemals würde einer wie er seine Waffenknechte auf uns hetzen. Konrad ist ein weiser und gütiger Mann und uns wohlgesonnen.«
»Vielleicht«, sagte der Großvater zweifelnd. »Aber er ist alt und krank, und bald wird ein neuer Erzbischof seinen Platz einnehmen. Und nur der Allmächtige weiß, wie der neue es dann mit uns halten wird.«
»Der Erzbischof mag gütig und weise sein oder raffgierig und närrisch!« Der Vater schüttelte unwillig den Kopf und schlug mit der flachen Hand auf den Tisch. »Ganz gleichgültig! Du aber, Esther, hast mein Verbot missachtet und damit mich und damit den Allmächtigen. Ich muss dich bestrafen, meine Tochter, ich kann nicht anders.«
»Bitte, Vater! Ich habe die Mechthild sehr lieb! Und ihr Mündel auch, die Genoveva.« Esther verlegte sich aufs Flehen. »Die beiden kommen doch schon in unser Haus, seit ich denken kann!«
»Zum letzten Mal: Du wirst die Mechthild nie wieder besuchen!« Der Vater setzte eine grimmige Miene auf, worin er nicht besonders geschickt war. Esther sah ihm an, wie schwer es ihm fiel. »Und diese zurückgebliebene Frau auch nicht …«
»Genoveva ist nicht zurückgeblieben!«, rief sie. »Sie hat ein gutes Herz und ist klüger als mancher in der Stadt, der verächtlich auf sie herabschaut!«
»Wirst du wohl deinen Vater nicht anschreien!«, keifte die Muhme Judith.
»Zurückgeblieben oder nicht – du besuchst sie nicht mehr!«, sagte der Vater streng. »Ich will’s einfach nicht!«
»Und ich auch nicht!« Auch der Großvater wurde nun laut und schlug mit der Faust auf den Tisch. »Kein Mann in der Gemeinde will das. Und noch einmal: Denk an den Greifensteiner!«
»Gott verfluche ihn!«, flüsterte die Muhme.
»Narren seid ihr!«, ließ sich auf einmal die Mutter vernehmen, und schlagartig verstummten alle anderen. »Gehst du selbst nicht regelmäßig zu den Gojim, Amos? Zum Gewandschneider, zum Innungsmeister, zu den Ratsherren und sogar zum Erzbischof? Verschafft es uns nicht ein gutes Auskommen, dass du mit den Gojim verkehrst?«
Alle schauten sie verblüfft an, und keiner mochte glauben, dass sie ihrer Tochter so energisch beisprang. Auch Esther selbst traute ihren Ohren kaum. Sie konnte sich nicht erinnern, jemals dergleichen erlebt zu haben.
»So viele Feinde haben wir unter den Magdeburgern!«, fuhr Lea fort. »So viele schlechte Menschen gibt es unter ihnen, und ausgerechnet den Umgang mit der besten unten ihnen willst du Esther verbieten? Mit der gerechten und barmherzigen Mechthild? Mit der herzensguten Genoveva? Werd einmal recht nüchtern, Amos! Und komm zur Vernunft!«
Sprach’s, drehte sich wieder um und beugte sich über den Zuber, um das Geschirr abzuwaschen. Die Muhme machte ein erschrockenes Gesicht, Vater und Großvater sahen einander ratlos an.
Es dauerte eine ganze Weile, bis der Vater seine Sprache wiederfand. »Bist selbst eine Närrin«, presste er schließlich zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. »Was ist denn in dich gefahren, dass du so redest?« Die Mutter fuhr fort, Suppenschüsseln und Holzlöffel zu waschen, und blieb stumm. »Verstehst du denn nicht, Lea? Esther hat mein Gebot missachtet, also muss ich sie bestrafen.«
»Lehrt nicht die Schrift, dass einer, der seine Rute schont, seinen Sohn hasst?«, rief der Großvater der Mutter zu, die allen den Rücken zuwandte und hartnäckig schwieg.
Die Muhme nickte energisch, und der Vater ergänzte: »Und seine Tochter.« Mit diesen Worten erhob er sich, ging zur Tür und winkte Esther hinter sich her.
Sie stand so abrupt auf, dass der Hocker hinter ihr auf die Dielen polterte. Zornig und aus zu Schlitzen verengten Augen funkelte sie erst den Großvater an und dann die Muhme, bevor sie ihrem Vater mit zusammengepressten Lippen in seine Schreibstube folgte. Die Wut brodelte heiß in ihrer Brust, trieb ihr die Tränen in die Augen und machte sie ganz bleich, doch sie schluckte sie tapfer hinunter und sagte kein Wort mehr.
In der Schreibstube nahm der Vater eine Pfauenfeder aus dem Gebinde an der Wand. Traurig schaute er Esther eine Zeit lang an. Dann trat er hinter sie und fuhr ihr sieben Mal mit der großen Feder über den Rücken.
3
TRAUM
Burg Landsberg, Mitte Juni 1275