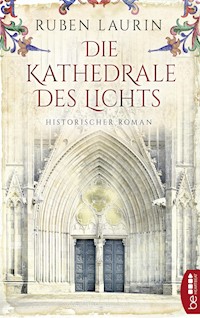
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Kathedrale, die zum Himmel wächst. Ein Steinmetz, der seiner Bestimmung folgt. Und eine Liebe, die nicht sein darf.
Anno 1215. Moritz ist gerade mal sechs Jahre alt, als seine Familie bei einem Überfall getötet wird. Ein Priester rettet dem Jungen das Leben. Doch das Schicksal meint es nicht gut mit ihm. Erst als Jahre später ein reisender Baumeister eine Statue entdeckt, die Moritz erschaffen hat, wendet sich das Blatt. Der Meister nimmt Moritz mit nach Magdeburg, wo eine Kathedrale errichtet wird. Rasch macht Moritz sich einen Namen unter den Steinmetzen. Doch nicht jeder auf der riesigen Baustelle bewundert den jungen Künstler. Vor allem der Bildhauer Gotthart neidet Moritz den Erfolg. Als sich Moritz ausgerechnet in die Frau verliebt, um die auch Gotthart wirbt, verfolgt dieser nur noch ein Ziel: die Vernichtung seines Rivalen, um jeden Preis ...
Ein opulentes Mittelalter-Epos um Liebe, Verrat und Tod - für Leser von "Die Säulen der Erde" und "Die Kathedrale des Meeres".
Von Ruben Laurin, der für sein Buch "Das weiße Gold der Hanse" den goldenen Homer 2019 vom Verein "HOMER für historische Literatur" erhalten hat.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 714
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel des Autors
Über dieses Buch
Über den Autor
Titel
Impressum
Zitate
Dramatis personae
Zeittafel
Prolog
ERSTES BUCH
1 VOLLMOND
2 MUTTER
3 VOLLMOND
4 SCHMUTZIGE HÄNDE
5 STURZ
6 GEFÄHRLICHE MINNE
7 KAIN
8 TJOST
9 STÜRZE
10 LAUF!
11 LICHT
12 SCHÖN WIE DIE SONNE
13 GÄNSEBRATEN
14 ROTER SCHNEE
15 MAGDEBURG
16 SIEH HIN
INTERMEZZO I
ZWEITES BUCH
1 GESICHTER
2 KUSS
3 1150 SILBERPFENNIGE
4 BULLENHÖRNER
5 TOD AM ELBUFER
6 PLÄNE
7 ENGEL
8 TODFEIND
9 DANKMESSE
10 HERRENMESSE
11 DIEBSTAHL
12 KRIEG
13 WACHSTUM
INTERMEZZO II
DRITTES BUCH
1 VERSUCHUNG
2 ZU SPÄT
3 TODESANGST
4 ABSCHIED
5 GELÜBDE
6 MESSE
7 HOFTAG
8 SCHWARZER FLAUM
9 DER SCHWARZE RITTER
10 AXTMANN
Epilog
Nachwort und Dank
Glossar
Weitere Titel des Autors
Das weiße Gold der Hanse
Die Jüdin von Magdeburg
Über dieses Buch
Eine Kathedrale, die zum Himmel wächst. Ein Steinmetz, der seiner Bestimmung folgt. Und eine Liebe, die nicht sein darf.
Anno 1215. Moritz ist gerade mal sechs Jahre alt, als seine Familie bei einem Überfall getötet wird. Ein Priester rettet dem Jungen das Leben. Doch das Schicksal meint es nicht gut mit ihm. Erst als Jahre später ein reisender Baumeister eine Statue entdeckt, die Moritz erschaffen hat, wendet sich das Blatt. Der Meister nimmt Moritz mit nach Magdeburg, wo eine Kathedrale errichtet wird. Rasch macht Moritz sich einen Namen unter den Steinmetzen. Doch nicht jeder auf der riesigen Baustelle bewundert den jungen Künstler. Vor allem der Bildhauer Gotthart neidet Moritz den Erfolg. Als sich Moritz ausgerechnet in die Frau verliebt, um die auch Gotthart wirbt, verfolgt dieser nur noch ein Ziel: die Vernichtung seines Rivalen, um jeden Preis …
Über den Autor
Ruben Laurin ist das Pseudonym eines preisgekrönten Autors, der vor allem phantastische und historische Romane verfasst. Seine Faszination für die Geschichte der Stadt Magdeburg und die mittelalterliche Kirchenarchitektur brachten ihn auf die Idee, einen Roman über den Bau des Magdeburger Doms zu schreiben: Die Kathedrale des Lichts. Ruben Laurin lebt in der Nähe von Wismar.
RUBEN LAURIN
DIEKATHEDRALEDES LICHTS
Historischer Roman
beHEARTBEAT
Digitale Neuausgabe
»be« - Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Die Veröffentlichung dieses Werkes erfolgt auf Vermittlungder literarischen Agentur Peter Molden, Köln.
Copyright © 2018/2020 by Bastei Lübbe AG, KölnLektorat: Judith MandtTitelgestaltung: © Johannes Wiebel | punchdesign, München,unter Verwendung von Motiven von shutterstock/pavila ; shutterstock/scottchan und dreamstime/Zwawol
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7517-0281-2
www.luebbe.de
www.lesejury.de
NIMMDAS LICHTFORT, UNDALLE DINGEWERDENUNERKANNTINDER FINSTERNISBLEIBEN.
Johannes von Damaskus (um 700)
UND GOTTSPRACH:ESWERDE LICHT! UNDESWARD LICHT.UND GOTTSAH, DASSDAS LICHTGUTWAR.
Aus Genesis 1
Dramatis personae
Historische Figuren sind mit einem Stern (*) gekennzeichnet
Moritz – wendischer Waisenjunge, Burgsklave, Steinmetz und Bildhauer
Meister Bohnsack* – Baumeister
Helena – seine Tochter
Gotthart von Saint Leonard – Bildhauer
Hubertus – sein Steinmetz und Diener
Wastl – sein Steinmetz und Pferdeknecht
Conrad – sein Sekretär
Ansgar von Lund – Ritter
Lothar von Magdeburg – sein Knappe
Mechthild von Magdeburg* – für manche eine von Gott Begeisterte, für andere eine Geisteskranke; Autorin des Buches »Das fließende Licht der Gottheit«
Monica – Schwiegertochter eines Burgschmieds, Moritz’ Freundin
Benno – ihr Mann, Schmied und Moritz’ Freund
Jacques von Straßburg – »Jakob«, Bildhauer
Slawomir von Rügen – wendischer Ritter
Rochus – Mönch und Priester
Gabriel – Mönch und Priester
Botho von Schwerin – Ritter
Dietrich von Dobin* – Domherr zu Magdeburg
Graf Albrecht von Käfernburg* – Erzbischof von Magdeburg
Graf Wilbrand von Käfernburg* – Albrechts Halbbruder, Dompropst von Magdeburg, später Erzbischof von Magdeburg
Burchard* – Burggraf von Magdeburg
Magdalena – die »Weise«; Hebamme
Hugo von Meißen – Ritter und Burgherr
Bodo – sein Knappe
Mauritius* – römischer Offizier
Candidus* – römischer Offizier
Innocentius * – römischer Standartenträger
Exuperius* – römischer Ausbildungsoffizier
Maximian* – römischer Kaiser
Zeittafel
Karfreitag 1207 – Magdeburg brennt; der Dom Kaiser Ottos I. wird stark beschädigt; Erzbischof Albrecht II. lässt die Brandruine abreißen
um 1207 – Mechthild von Magdeburg wird geboren
1208 – Grundsteinlegung für den neuen Dom
28. Sept. 1220 – Erzbischof Albrecht bringt die Schädelplatte des Heiligen Mauritius nach Magdeburg
22. Nov. 1220 – Friedrich II. wird in Rom von Papst Honorius III. zum Kaiser gekrönt
1230 o. früher – Erzbischof Albrecht beschließt, antike Säulen aus dem alten Dom in den Chor des Domneubaus einzubauen
1222 bis Dez. 1224 – Franziskaner u. Dominikaner fassen in Magdeburg Fuß
1225 bis 1235 – Wilbrand, Graf von Käfernburg und Halbbruder Albrechts, ist Dompropst in Magdeburg
22. Juli 1227 – In der Schlacht von Bornhöved besiegt eine Koalition norddeutscher Fürsten unter Herzog Albrecht von Sachsen, einiger Wendenfürsten und dem Grafen Heinrich von Schwerin den Dänenkönig Waldemar II. und beendet so die Vorherrschaft der Dänen im Ostseeraum
1228 u. 1231/32 – Erzbischof Albrecht in Italien auf Hoftagen Kaiser Friedrichs II.
1228/29 – Kreuzzug Friedrich II.
um 1228 – Dietrich, Edler von Dobin (Theodericus) tritt als Domherr ins Domkapitel ein
um 1230 – Der Maulbronner Baumeister Bohnsack wird in Urkunden als magister operis Bonsac bezeichnet; eine wahrscheinlich ihn darstellende Konsolfigur an einem Vierungspfeiler des Doms gilt als Hinweis auf die Anerkennung seiner großen Leistung
1230 – Franziskaner siedeln in die Altstadt um und erklären Magdeburg zu einem ihrer beiden Hauptsitze in Deutschland; die Stadt ist zu dieser Zeit ein blühendes kulturelles Zentrum und ein angesehener Bildungsort
1231 – Aus Paris wird der Franziskaner Bartholomaeus Anglicus nach Magdeburg geschickt, um dort eine Enzyklopädie zu schreiben
15.10.1232 – Erzbischof Albrecht stirbt auf der Rückreise von Italien
1232 bis 1235 – Burkhard v. Waldenburg ist Erzbischof von Magdeburg
1234 – In der Dombaustelle wird die erste Messe gelesen
ab ca. 1235 – Mechthild verfasst in Magdeburg ihre Schrift »Das fließende Licht«; deutet darin Konflikte mit dem Klerus und die Nähe zum Domdekan Dietrich von Dobin an
8. Febr. – Erzbischof Burchard stirbt während eines Kreuzzuges in Konstantinopel
31. Mai – Sein Nachfolger Wilbrand von Käfernburg reist nach Italien, um die Bischofsweihe durch Papst Gregor IV. zu empfangen
1235 – Wilbrand und Begleiter sehen in Mailand ein Reiterdenkmal, das dem Magdeburger Reiter ähnelt
Sommer 1235 – Kaiser Friedrich hält Hoftag in Mainz; in seinem Gefolge: Afrikaner und Sarazenen
um 1237 – An der Handelsstraße zwischen Magdeburg und Lebus entsteht die Siedlung Berlin
um 1240 – – Heute unbekannte Bildhauer, aus derselben Werkstatt, erschaffen die Statue des Hl. Mauritius (den »Schwarzen Ritter«) und der Hl. Katharina, die Figurengruppe der »Zehn Jungfrauen« und das Reiterdenkmal Kaiser Ottos
1245 – Am 12. Mai wird Mechthilds Vertrauter Dietrich Domkantor, im Jahr 1262 Domdekan
1248 – Ein gewisser Meister Gerhard beginnt den Kölner Dom zu bauen
1250 – Der große Stauferkaiser Friedrich II. stirbt
1253 – Im Herbst stirbt Erzbischof Wilbrand
um 1282 – Mechthild stirbt im Kloster Helfta bei Eisleben
1520 – – Nach über dreihundert Jahren Bauzeit wird der Dombau von Magdeburg vollendet
Ein Glossar findet sich im Anhang
Prolog
Gallische Alpen, Sommer 285 n. Chr.
Der Kamm blieb hinter ihnen zurück. Und mit ihm die letzte Steigung. Endlich. Ab jetzt ging es nur noch bergab. Die Pferde fielen in einen leichten Trab. Erste Bäume standen am Wegesrand. Tief atmete der Centurio die deutlich wärmere Luft ein. Er glaubte, schon die Nähe des Flusstales und des Sees zu riechen. Noch war er guter Dinge, noch erfüllte ihn Zuversicht, noch brannte er darauf, seinem Kaiser und Feldherrn gegenüberzutreten.
Der Weg führte in ein Wäldchen. Die Schneefelder in den Hängen rechts und links waren höher gerückt, ihre weißen Zungen im Geröll schmaler geworden. Das Gras wuchs dichter hier. Der Centurio entdeckte Schafskot am Wegesrand. Daneben hatte sich eine Silberdistel der Morgensonne geöffnet.
Der Standartenträger hielt sein Pferd an. »Schaut euch das an, Brüder!« Mit der Standarte zeigte er auf zwei Silberdisteln.
Alle brachten ihre Pferde zum Stehen, alle betrachteten die silbrig-weißen Distelblüten. »Wie schön«, sagte der Centurio, der unter dem Namen Mauritius bekannt war. »Wie wunderschön!« Er drehte sich im Sattel um und blickte zurück. »Warten wir auf die Männer.«
Gut die Hälfte der Marschkolonne hatte den Kamm bereits überquert. Im Laufschritt kamen die Legionäre näher, der rhythmische Lärm ihrer Schritte schwoll an. Immer neue Reihen von Lanzenspitzen und behelmten Köpfen schoben sich über die Bergkuppe.
Der Anblick seiner Kohorte erwärmte das Herz des Centurios. Mauritius liebte seine Soldaten. Schon schlossen die ersten Marschreihen zu ihm und den Reitern auf. Der Centurio sah in schweißnasse, aber strahlende Gesichter. Die Nähe des Ziels beflügelte die Männer.
Noch glaubten sie, das kaiserliche Feldlager bei Octodurus sei ihr Ziel; noch rechneten sie damit, Rom bald im Kampf gegen gallische Rebellen dienen zu können. Auch Mauritius glaubte das zu dieser Stunde noch.
Nicht mehr lange, und alles würde sich ändern. Zwei Botschaften nämlich warteten auf Mauritius von Theben. Die erste gleich am Pass, von dem aus die alte Straße aus dem Hochgebirge ins Flusstal hinunterführte, die zweite kaum eine Wegstunde später jenseits des Passes. Die eine Botschaft sollten erst nachfolgende Generationen verstehen; die andere würde den Centurio wie aus heiterem Himmel treffen.
Tatsächlich wölbte sich zu jener Stunde ein strahlend heiterer Himmel über der Marschkolonne zwischen den Silberdisteln und dem Gebirgskamm. Die Schneegipfel leuchteten im Licht der aufgehenden Sonne. Sah es nicht aus, als würden sie in Flammen stehen? Mauritius konnte sich kaum sattsehen an diesem Lichtspektakel.
Im Norden erhoben sich keine Gipfel mehr, im Westen und Osten jedoch ragten die letzten Bergriesen der gallischen Alpen in den blauen Spätsommerhimmel.
»Schau dir diese Bergriesen an, Centurio!« Mauritius’ Standartenträger Innocentius geriet schier außer sich vor Entzücken. »Sehen sie nicht aus wie glühende Hörner himmlischer Drachen?« Innocentius schwenkte den Legionsadler in alle Himmelsrichtungen. »Schaut euch das an, Brüder!« So viel erhabene Schönheit machte ihn fassungslos. Innocentius gehörte auch sonst zu den leicht entflammbaren Naturen.
»Es gibt keine Drachen im Himmel!«, raunzte Candidus, der Zweite Centurio, in der ihm eigenen Barschheit. »Dort unten aber, hinter dem Wäldchen, gibt es einen Pass. Unseren Pass, schätze ich. Eine halbe Wegstunde noch. Höchstens.«
Mauritius legte die Hand über die Augen und spähte über die Baumwipfel hinweg nach Norden, wo nach einer sanften Bodensenke ein Gebäude zu erkennen war. Candidus hatte recht: Das war ihr Pass.
Exuperius, der Ausbildungsoffizier, lenkte sein Pferd herum und ritt die ersten Marschreihen der Kohorte ab. »Bald erreichen wir den Pass!«, rief er. »Danach geht’s hinunter zum Strom und in mildere Gefilde!« Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht unter den knapp siebenhundert Legionären und Pferdesklaven.
»Rhône« nennt man den Strom heute; damals hieß er »Rhodanus«. An seinem Lauf, ungefähr auf halbem Weg zum See, lag die Siedlung Octodurus, heute Martigny. Dort hatte der Kaiser und Feldherr Maximian mit seiner Legion Quartier bezogen.
Mauritius trieb sein Pferd an. Die Marschkolonne hinter ihm setzte sich wieder in Bewegung. Sie durchquerten das Wäldchen. Der Pass rückte näher, vor dem steinernen Gebäude am Weg konnte Mauritius schon Lasttiere, Kleinvieh und Menschen erkennen. Die Aussicht, das nächste Nachtlager im wärmeren Flusstal aufschlagen zu können, hob seine Stimmung beträchtlich.
»Ein Adler!« Der Waffenwart deutete in den Himmel über dem Pass, wo ein gewaltiger Greifvogel seine Kreise zog. »Und was für ein Biest! Hat einer von euch jemals so einen großen Adler gesehen?«
»Ein gutes Omen, Exuperius!«, rief der Dritte Centurio aus der vorderen Marschreihe, einer der wenigen unter Mauritius’ Legionären, die nicht getauft waren. »Der römische Adler kreist schon über dem ruchlosen Rebellen und seinem verfluchten Pack! Bald wird er auf sie herabstoßen!« Er stieß die Faust in den Himmel.
Der Dritte Centurio sprach von jenem Verräter, der sich selbst zum Kaiser der Provinz Gallien hatte ausrufen lassen. Sogar Münzen wagte er zu prägen. Um ihn zu vernichten, hatte Kaiser Maximian Mauritius und seine Thebäische Kohorte über die Alpen und an den Rhodanus rufen lassen.
Später, als geschehen war, was zu dieser Stunde noch keiner erwarten konnte, als das Ungeheuerliche schon den Weg in die Erzählungen erschütterter Zeugen und in die Schriften staunender Chronisten gefunden hatte, später pflegten die Leute von der »Thebäischen Legion« zu sprechen und zu schreiben. Doch nicht sechstausend Soldaten führte Mauritius an den Rhodanus, keine Legion also, sondern eine Kohorte: sechshundert Legionäre, dazu etwa zweihundertfünfzig Frauen und Pferdesklaven. Die meisten stammten wie Mauritius selbst aus der Wüstenregion rund um das ägyptische Theben. Und die meisten waren wie ihr Centurio getauft. Das war durchaus ungewöhnlich, denn damals verehrte man im römischen Reich noch die alten Götter.
Am Pass angekommen, winkte Mauritius dem Hornbläser. Der setzte seinen Lituus an die Lippen und stieß hinein. Das Blechhorn erklang, sein Echo brach sich an den Berghängen, die Marschkolonne stand still. Mauritius befahl dem Waffenwart und dem Dritten Centurio, die Legionäre im taunassen Gras am Wegrand zur Rast lagern zu lassen. Befehle wurden laut, und bald darauf erfüllten Gelächter und Stimmengewirr die Luft.
Vom Sattel aus blickte Mauritius sich um. Das langgezogene Gebäude am Weg war aus kaum behauenen Schieferplatten gebaut. Man musste fürchten, dass es jeden Moment zusammenbrach, so krumm stand es zwischen ein paar vom Wind gebeugten Kiefern.
Auf dem Hang dahinter weideten etwa dreißig Schafe. Eine weißhaarige Frau stützte sich auf einen Hirtenstab und sah zu Mauritius herunter. Ein großer schwarzer Hund hockte zu ihren Füßen.
Aus den Eselskarren vor dem Langhaus waren Männer und Frauen in zerschlissenen, sackartigen Kleidern geklettert. Sie luden Körbe, Krüge und prall gefüllte Schläuche ab, trugen sie zu den Legionären. Seltsam zögernd bewegten sie sich, und in ihren Mienen las der Centurio Misstrauen und Scheu. Der Anblick schwarzer Menschen schien sie zu verstören.
»Sieht aus, als wollten sie unseren Männern Quellwasser, Brot, Ziegenkäse und Wein verkaufen.« Candidus war den Leuten ein Stück entgegengeritten und hatte einen Blick auf ihre Waren geworfen.
»Lass uns den Legionären das Essen und den Wein bezahlen!« Mauritius trabte zu seinem Zweiten Centurio. »Sie haben es verdient, Candidus, der Marsch durch die Berge war hart.«
Candidus nickte, nahm den Münzbeutel entgegen, den Mauritius ihm reichte, und lenkte sein Pferd dann zu den Bergbauern. »Wartet!«, rief er auf Lateinisch und winkte. »Ich und der Centurio übernehmen die Rechnung!« Die Legionäre jubelten, und die Frau des Dritten Centurios übersetzte seine Worte den Eingeborenen.
Menschen liefen am Wegesrand zusammen, tuschelten, deuteten zu den Legionären und beäugten Mauritius und sein Gefolge. Römer mit dunkler Haut und krausem Schwarzhaar kannten sie nicht. Ihre Haut war sehr weiß, und etliche hatten blondes Haar.
Elende Gestalten wie sie hatte Mauritius immer wieder gesehen auf dem Weg vom Aostatal durch die Alpen. Und oft hatte er sich gefragt, wie man in solch eisigen Höhen sein Leben fristen konnte. Er lenkte sein Pferd zu den Eingeborenen, wollte sich nach ihrem Ergehen und nach Neuigkeiten erkundigen. Innocentius, Exuperius und zwei Pferdesklaven zu Fuß schlossen sich ihm an.
Oben bei den Schafen bellte der Hund. Die Hirtin konnte Mauritius nirgendwo mehr entdecken. Die Eingeborenen am Wegesrand, zwei Dutzend mochten es inzwischen sein, bildeten eine Gasse. Eine Frau schritt hindurch – die weißhaarige Hirtin.
Kurz blieb sie stehen und lauerte zu Mauritius herüber. »Was ist los mit der Alten?«, murmelte Innocentius.
»Wahrscheinlich ist es das erste Mal, dass sie Afrikaner zu sehen bekommt«, sagte Mauritius.
Die Hirtin packte ihren Stab und lief los. Nicht gebeugt und hinkend wie eine Greisin, sondern leichtfüßig und federnd wie eine junge Frau. Vor seinem Pferd warf sie sich auf die Knie, ließ den Hirtenstab fallen, streckte beide Arme über den Kopf und begann laut zu rufen. Mauritius verstand kein Wort; nur seinen Namen hörte er aus ihrem Wortschwall heraus.
Candidus hatte seinen Handel mit den Bergbauern inzwischen abgeschlossen und ritt zurück zu den Gefährten. Misstrauisch betrachtete er die greise Hirtin. »Jag sie weg, Mauritius. Sie ist irre.«
»Aber woher kennt sie den Namen des Centurios?« Innocentius, der Standartenträger, staunte auf die Alte hinunter.
»Vielleicht haben Maximians Legionäre ihr ein paar Schafe abgekauft und bei der Gelegenheit unsere Kohorte angekündigt.« Candidus zuckte mit den Schultern. »Wir sind ja nicht ganz unbekannt.« Und an Mauritius gewandt: »Schau sie dir an, Bruder! Sehen nicht Hexen so aus? Jag sie weg.«
Die Hirtin erhob sich aus Gras und Geröll, kam dicht an Mauritius’ Pferd heran und streckte die Rechte zu ihm hoch. Dabei redete sie immer weiter ihr unverständliches Zeug. Mit der Linken zerrte sie eine silberne Kette aus ihrem zerschlissenen Gewand, an der ein kleines, aus Holz geschnitztes Kreuz befestigt war. Sie ergriff die Hand des Centurios und streckte ihm das Kreuz entgegen. Eine Mischung aus Freude und Schmerz spielte nun um ihre welken Lippen, und in ihren grünen Augen lag ein Leuchten, das Mauritius’ Herz rührte.
»Seltsam, wie aufgeregt sie ist.« Der Centurio drückte ihre Hand. »Jemand muss dolmetschen. Ich will wissen, was sie mir zu sagen hat.«
Innocentius rief nach Regula, der Frau des Dritten Centurios. Regula stammte aus dem Rhodanustal. Als sie noch ein Mädchen war, hatte ein Legionär sie als Sklavin nach Rom verschleppt. Der Dritte Centurio hatte sie freigekauft und zur Frau genommen. Anders als er war Regula getauft.
Die Eingeborenen hatten sich inzwischen um Mauritius und die Hirtin geschart, auch etliche Händler und Legionäre waren neugierig geworden und herbeigekommen. Mauritius stieg vom Pferd und bat Regula, die Alte zu fragen, was sie von ihm wolle.
Regula sprach eine Zeitlang mit der Greisin und übersetzte dann. »Sie sagt, sie sei eine Prophetin und habe eine Botschaft für den römischen Centurio Mauritius aus der Thebäischen Wüste.«
»Was?!« Mauritius’ ungläubiger Blick flog zwischen Regula und der Hirtin hin und her. »Woher weiß sie von mir? Was für eine Botschaft?«
»Eine Botschaft Gottes«, erklärte Regula. »Sie sagt, Gott habe sie dein künftiges Leben schauen lassen, Centurio.«
Einige Legionäre feixten. Der Zweite Centurio jedoch schnaubte verächtlich. »Verdammte Wahrsagerin!« Wie einen Fluch stieß Candidus diese Worte aus. »Weg mit ihr!« Seine Miene wurde noch härter als sonst. »Wir sind Christen und haben nichts zu schaffen mit Zauberern und Wahrsagern!«
»Ist sie nicht auch eine Christin?« Innocentius deutete auf das kleine Holzkreuz in der Linken der Greisin. »Sieh doch hin, Candidus.« Der Zweite Centurio zuckte mit den Schultern und wusste nichts zu entgegnen.
»Es soll tatsächlich eine Christengemeinde geben im Rhodanustal«, sagte Exuperius, der Ausbildungsoffizier. »Brüder in Rom haben mir das erzählt.«
»Und mit eigenen Augen seht ihr, dass es auch hier oben in den Bergen Christen gibt.« Wieder deutete Innocentius auf das Holzkreuz der alten Hirtin.
»Frag sie, wer sie getauft hat«, verlangte Mauritius.
Regula sprach wieder mit der Alten und übersetzte dann deren Antwort: »Ein Priester namens Faustin, sagt sie. Der Bischof von Lugdulum habe ihn vor vielen Jahren den Rhodanum heraufgeschickt, damit er den Heiden in den Bergtälern das Evangelium predigt und eine Kirche baut.« Lugdulum am Rhodanus nannten spätere Generationen »Lyon«. Die greise Hirtin redete immer weiter, und Regula dolmetschte. »Hunderte habe dieser Faustin getauft, sagt sie.«
»In Lugdulum soll es schon einen Bischof gegeben haben, als der weise Mark Aurel noch Kaiser war«, sagte Innocentius, und Candidus rieb sich nachdenklich den breiten Nacken.
Mauritius sah der alten Hirtin prüfend ins freundliche Gesicht. Lächelnd nickte sie ihm zu. Mauritius’ Mund war plötzlich trocken. Er schluckte den schwellenden Kloß im Hals herunter, räusperte sich und fragte heiser: »Wie lautet die Botschaft Gottes, die du glaubst, mir ausrichten zu müssen?«
Regula übersetzte die Frage des Ersten Centurios in die Sprache der Eingeborenen. Ein beinahe feierlicher Ernst trat auf die greisen Züge der Hirtin, ihre Stimme klang nun zurückhaltender.
»So spricht Gott, der Herr«, übersetzte Regula. »Dein Glaube ist groß, Mauritius von Theben. So groß, dass du alle Versuchungen überwinden wirst, die deiner harren. Niemals jedoch wirst du deinen Fuß setzen in das wilde Land der Heiden jenseits dieses Gebirges, und dennoch wird man dir dort ein Haus bauen. An einem großen Strom hoch im Norden Germaniens wird man dir einen prachtvollen Palast errichten. In ihm wird man dich als Zeugen des lebendigen Gottes verehren, und in ihm sollst du wohnen für alle Zeit.«
Regula verstummte. Auch die Alte schwieg jetzt. Eine Zeitlang sprach keiner mehr ein Wort. Mauritius versuchte zu fassen, was er da gerade gehört hatte. Im Stillen wiederholte er Satz für Satz. Jeder brachte tief in ihm eine verborgene Saite zum Schwingen, und keinen einzigen konnte er begreifen.
»Wie soll das gehen?« Exuperius brach schließlich das Schweigen. »In einem Haus wohnen, das man nie betritt? Wie soll man denn darin wohnen, wenn man nicht einmal das Land betritt, auf dem es steht?« Der Waffenwart schüttelte den Kopf. »Schwachsinn!«
»Doch was, wenn sie wirklich eine Prophetin ist?«, gab Innocentius zu bedenken.
»Eine verdammte Wahrsagerin ist sie!«, zischte Candidus. »Hab ich’s nicht gleich gesagt? Jagt sie weg, die Hündin!«
Einige Legionäre machten Anstalten, die Alte zu packen. Doch Mauritius stellte sich schützend vor sie. »Gott allein sieht ihr ins Herz. Soll der Herr sein Urteil über sie sprechen, wenn er will.« Mit einer Kopfbewegung deutete er auf die Hirtin. »Lass ihr Wein und Brot geben, Exuperius. Und Tuch für einen Mantel. Der Winter kommt bald.«
Der Waffenwart schickte Legionäre zu den Lasttieren und den Bergbauern, damit sie den Befehl des Centurios ausführten. Mauritius wandte sich ab und mischte sich unter die Männer im Gras. Man gab ihm zu trinken und zu essen, doch er brachte keinen Bissen herunter. Die alte Hirtin kehrte zu ihren Tieren zurück. Mauritius beobachtete sie; ihre Worte glühten ihm in der Brust wie Klingen in der Esse.
Am späteren Vormittag trabte er tief in Gedanken versunken zwischen Candidus und Innocentius an der Spitze der Kohorte ins Rhodanustal hinunter. Da tauchte ein Reiter zwischen den Bäumen auf und trabte den Waldweg herauf, ein Legionär. Innocentius und Candidus galoppierten ihm entgegen.
»Ein Bote aus Octodurus!«, rief Innocentius, als sie den Reiter zu Mauritius eskortierten.
»Schon wieder eine Botschaft?« Mauritius runzelte die Brauen.
»Keine Sorge, Bruder.« Innocentius grinste müde. »Diesmal nur eine Botschaft des Kaisers Maximian.«
Mauritius sah dem Boten ins Gesicht. »Und wie lautet sie?«
Der Mann trieb sein Pferd an Mauritius’ Tier heran und reichte ihm eine versiegelte Briefkapsel. »Lies selbst, Centurio.«
Mauritius brach das Siegel, zog den Papyrusbogen heraus und entrollte ihn. Seine Lippen bewegten sich stumm, während er die kaiserliche Botschaft las. Als er den Blick wieder hob, sahen seine Augen aus wie Schlitze, und seine Miene war wie aus Basalt gemeißelt. »Ein neuer Befehl des Kaisers.« Mauritius’ Stimme klang heiser. »Wir sollen nicht nach Octodurus marschieren, sollen auch keine Rebellen bekämpfen …« Er stockte.
»Sondern?« Innocentius schaute ihn an, Miene und Stimme seines Centurios schienen ihn zu erschrecken. Candidus beugte sich aus dem Sattel zu Mauritius herüber und zog ihm den kaiserlichen Befehl aus der wie leblos herabhängenden Hand.
»Ab sofort sollen wir Christen jagen.« Mauritius sprach nur noch leise und schleppend. »Wo immer wir Männer oder Frauen finden, die sich zu Jesus von Nazareth bekennen, sollen wir sie töten.«
ERSTES BUCH
Wege nach Magdeburg
1VOLLMOND
Küstenwald an der Ostsee, Spätsommer 1215
Hähne krähten, Hunde schlugen an, aus allen Hütten tönten Kampflärm und Geschrei. Die Sachsen tobten durchs nächtliche Dorf. Keiner hatte vor ihnen gewarnt – kein Wächter, kein Zeichen, kein Traum. Nicht einmal der Dorfnarr.
Moritz kauerte stocksteif in der Fensteröffnung. Der Vollmond warf seinen Schatten auf das Nachtlager im Inneren der Hütte – auf Decken, Felle und Strohsäcke, auf die bleichen Gesichter der anderen. Seine Lippen bebten, er betete. Die Sachsen brachen trotzdem in die elterliche Hütte ein.
Vorweg ein hagerer Ritter in Kettenhemd und mit Fackel und Schwert. Hinter ihm ein stämmiger Graubart mit breitem Gesicht. Der hielt sein Schlachtbeil dicht hinter der Klinge. An der glänzte Blut – Moritz sah es genau –, und Blut glänzte auch auf der Faust des Mannes, und an seiner blutigen Faust fehlte der kleine Finger. Noch vier oder fünf andere drängten nach ihm in die Hütte.
Die Mutter warf sich über die kleinsten Geschwister, der Vater riss das steinerne Kreuz von der Wand und streckte es den Kriegsmännern entgegen. »Wir sind getauft!«, schrie er. »Alle! Auch wir sind Christen! Alle, alle!« Der mit der Axt schlug zu.
Die anderen packten die Mutter, trieben Kuh, Ziege und Schwein durch die Hütte und in die Mondnacht hinaus, fingen die Hühner ein, jagten den Brüdern und Schwestern hinterher. Den kleinen Jungen in der Fensteröffnung entdeckten sie nicht.
Moritz kniff die Augen zu. Bloß nicht mehr hinschauen müssen! Er hielt sich die Ohren zu. Bloß nichts mehr hören müssen von alldem Gejammer! Er biss sich die Unterlippe blutig, wollte lieber Schmerzen spüren, statt die Angst, die ihm durch Brust und Glieder tobte. Entsetzen verschloss ihm Kehle und Lippen.
Sechs Jahre alt war Moritz, als in jener Nacht seine Kindheit endete. Und dies ist seine Geschichte.
Sechs Jahre alt war in jenen Tagen auch Helena, deren Geschichte ohne Moritz eine andere geworden wäre. Weit südlich der Küstenwälder saß Helena jeden Abend bei ihrer Mutter auf der Steinbank im Klosterhof von Maulbronn. Von der Mutter lernte sie Lesen und Schreiben, und sie lernte Schönes von Hässlichem zu unterscheiden. Ihre Kindheit sollte noch sechs Jahre dauern.
Ohne Helenas Geschichte wäre auch die Geschichte des Grafensohns Ansgar eine andere geworden. Ihm spross bereits der Bartflaum zu jener Zeit. Hatte er je eine Kindheit gehabt? Schon als sehr kleiner Junge musste er Mutter und Heimat verlassen.
Oder die Geschichte des künftigen Bildhauers Gotthart. Kaum einer kannte seinen Vater, und wer ihn kannte, flüsterte den Namen des mächtigen Mannes nur hinter vorgehaltener Hand. Zu jener Stunde, als Moritz im Fenster kauerte und Ansgar vor Heimweh in sein Kissen weinte, lernte Gotthart bei Kerzenlicht das Vaterunser auf Lateinisch auswendig. Morgen, in der Klosterschule, würde er es dem Abt vorbeten müssen. Der Abt hatte kalte Augen, und immer lag eine frisch geschnittene Rute auf seinem Pult.
Und schließlich das fromme Mädchen Mechthild: Es lebte zu jener Stunde in einer Burg an der Elbe. Mehr weiß man nicht von Mechthilds Kindheit. Nur noch dies: Nicht lange nach jenem Tag sah sie zum ersten Mal das Licht, das sie für ein göttliches hielt, und hörte zum ersten Mal die Stimmen.
Zwölf Jahre noch, und die Wege aller würden sich in Magdeburg kreuzen.
Aus dem Inneren der Hütte stieß jemand Moritz gegen die Schulter. Er verlor das Gleichgewicht und nahm die Fäuste von den Ohren, um sich festzuhalten. Er kippte nach draußen, stürzte in den Haselnussstrauch zwischen Kräutergarten und Holzfassade und schlug auf Feldsteinen auf. Moritz spürte keinen Schmerz, er spürte nur würgende Angst und rasenden Schrecken.
Schritte schlurften näher. Er riss die Augen auf, starrte durch den Mondlichtschleier im Geäst des Haselnussstrauches: Auf dem Wall, der das Dorf umgab, bewegten sich Fackeln. Zwischen den Hütten wankten, liefen oder stolperten Umrisse von Menschen; manche hoch aufgerichtet wie Sieger, andere gebeugt oder halb am Boden durch Gras und Pfützen geschleift wie erlegtes Wild. Und überall Geschrei, Gejammer und Gebrüll. Schritte stapften weg von ihm.
Irgendwo krähten Hähne, jaulten Hunde, quiekten Schweine, plärrten Kinder, und ein Mann lachte wiehernd. Ein Sachse. Und dann ein Ruf: »Moritz!«
Die Mutter!
»Lauf, Moritz!« Auf diese Weise rief nur die geliebte Stimme der Mutter seinen Namen. War sie es gewesen, die ihn zum Fenster hinausgestoßen hatte? »Renn weg, Moritz!« Irgendwo am Walltor rief sie. »Lauf, mein Kleiner! Lauf, lauf! Gott sei mit dir!«
Er stemmte sich hoch, wollte aus dem Haselnussbuschwerk springen und zu ihr rennen. Eine Männerstimme brüllte ihr Rufen nieder. Moritz ließ sich wieder fallen. Die Mutter schrie gellend, schrie, wie die große Schwester geschrien hatte, als der Priester ihr an Sankt Johannis den vereiterten Zahn zog. Moritz presste wieder die Fäuste gegen die Ohren, kniff wieder die Augen zu.
Da lag er also, und nur das Getrommel seines kleinen Herzens lärmte noch in seinen Ohren. In seinem Kopf aber rief die Mutter immer weiter seinen Namen, in seinem Kopf schlug der mit der blutigen Axt immer weiter auf den Vater ein, und der im Kettenhemd wollte nicht aufhören, mit seinem Schwert auf die Mutter zu deuten. Ameisen krabbelten Moritz unter dem Hosenbein die Waden und die Schenkel hinauf. Ein Feldstein drückte ihm in die Rippen. Er rührte sich nicht, flehte stumm zu Gott, damit der ihn in einen Feldstein verwandelte.
Wie lange verharrte er so zwischen Hüttenwand und Haselnussstrauch? In seiner Erinnerung später erschien diese Zeit ihm kurz wie ein Atemzug, doch als er in jenen Stunden die Augen wieder aufriss, weil jemand ihn berührte, stand kein Vollmond mehr am Himmel, und über Hütten und Burgwall graute ein neuer Morgen.
Ein Schatten beugte sich über ihn. Jemand flüsterte: »Bürschlein?« Moritz atmete nicht. Vielleicht hatte Gott in seiner Gnade ihn ja doch in einen Feldstein verwandelt. Er machte sich steif und hart. »Lebst du noch, Bürschlein?« Das Gesicht des Schattens schwebte dicht über ihm. »Komm schon.«
Ein Traum? Eine Erscheinung? Moritz starrte in das knochige Gesicht; es hatte einen beinahe zahnlosen Mund. Moritz hörte einen Hahn krähen; er hörte auch noch Stimmen vom Walltor her. Weinte da jemand? Vielleicht die Mutter. Schnarchte da jemand? Waren die Sachsen noch im Dorf? Jetzt krähten schon zwei Hähne.
Knochige Hände streckten sich nach ihm aus, packten ihn an Ärmel und Hosenbund, zerrten ihn erst ins Kräuterbeet und dann auf die Beine. »Komm mit mir.« Es war der alte Priester, er stank aus dem Mund. »Schnell, schnell.« Der Alte winkte ihn hinter sich her.
Moritz stolperte über einen Stein, schlug lang hin, blinzelte hinter sich: Etwas Weißgraues lag da ins dunkle Gras getreten. Das steinerne Kreuz aus der elterlichen Hütte! Er selbst hatte es aus dem Kalkstein gehauen, vor dem letzten Osterfest, unter den prüfenden Augen des Vaters. Moritz langte danach, drückte es an seine Brust.
Der Priester bückte sich nach ihm, riss ihn erneut hoch. Der Alte ließ seine Hand nun nicht mehr los, und Moritz torkelte hinter ihm her: zwischen die Hütten, am Teich vorbei, über die Pferdekoppel, immer auf den Burgwall zu.
In den Hütten schnarchten Männer, jammerten Kinder, weinten Frauen. Im Wald jenseits des Burgwalls stimmten die ersten Vögel ihr Morgenlied an. Dunstschwaden krochen über den Wall und ins Dorf hinein.
Der Priester duckte sich zwischen die Pferde, legte den krummen Zeigefinger auf die Lippen. »Die sie nicht erschlagen haben, müssen nun in der Kirche ihres Schicksals harren«, flüsterte er. Die Kirche war die größte Hütte im Burgwall. »All unser Bier haben die Sachsen gesoffen, jetzt sind die meisten berauscht. Und haben berauschte Wachen aufgestellt.«
Der alte Priester war selbst ein Sachse. Als junger Mann war er eines Tages unter den Wenden in den Küstenwäldern aufgetaucht, hatte von einem neuen Gott erzählt, von einem Gott, der an einem Kreuz gestorben sei, damit die, die an ihn glauben, von aller Schuld befreit und gerettet sein sollen. Der alte Priester hatte die Kirche am Walltor gebaut und im See die Obersten der Wenden getauft. Moritz wusste das von seinem Vater. Der war damals noch ein kleiner Junge gewesen.
Der Alte duckte sich tiefer, zog Moritz mit sich ins Gras und deutete zum Burgwall hinauf. Zwei Männer wankten entlang der Wallkrone. Sachsen. Der Priester beobachtete sie, bis kurz vor dem Walltor Dunstschwaden ihre Gestalten halb verhüllten. Er richtete sich auf, zog Moritz hinter sich her über die Koppel und dann die Erdstufen zur Wallkrone hinauf. Von dort stieß er ihn die steile Außenseite hinunter. Er selbst schlidderte auf dem Hintern die dreißig Ellen ins Unterholz und zu den Brombeerhecken hinab.
Dabei stöhnte er auf wie unter Schmerzen, und weil ihm das Gewand bis zum Geschlecht gerutscht war, konnte Moritz das Blut an seiner Hüfte sehen. »Zum See.« Der Priester deutete nach Süden. »Schaffen wir es zum See, schaffen wir es auch nach Schwerin und zur Burg des Herrn Grafen.« Er hinkte in die ersten Lichtbalken, die sich inzwischen aus den Baumkronen ins Unterholz bohrten.
Moritz stand wie festgewachsen. Zum See? Weg von Mutter und Vater? Er starrte auf den Wall, er spähte in die Richtung, in der er das Tor wusste, er lauschte der mütterlichen Stimme in seinem Kopf: Lauf, mein Kleiner! Lauf, lauf!
Der Alte machte kehrt, hinkte zu ihm und schlug ihm ins Gesicht. »Komm zu dir!« Er zerrte den Jungen zwischen die Bäume. »Willst du verrecken? Willst du ein Sklave im Sachsenland werden? Oder bei den Polacken?« Moritz stolperte hinter ihm her.
Hinein ging es in Gestrüpp und Buschwerk, in dichtes Gehölz, durch Sumpf und Schilf. Dreimal durchquerten sie den Graben, der sich nordwärts durch den Wald zum Meer hin schlängelte, sie wateten kniehoch durch ausgedehnte Tümpel, sie folgten dem Wildpfad, der entlang des Grabens zum See führte.
Je höher die Sonne stieg, desto langsamer hinkte der alte Priester. Manchmal lehnte er gegen eine Eiche und atmete schwer. Im Licht der Mittagssonne sah seine Haut grau aus. Einmal sank er ins Farn, schnappte nach Luft und konnte lange nicht weiter. Er hob den Kopf und schaute Moritz ins Gesicht. Sein Blick brannte.
»Das Gericht Gottes, Bürschlein.« Der Alte sprach leise und schleppend. »Die Strafe Gottes dafür, dass einige im Burgwall noch den alten wendischen Göttern gehuldigt haben. Ich weiß doch, wo sie die steinernen Götzenbilder der Podaga und des Swarogs in ihren Hütten und Erdlöchern versteckt haben! Ich hab doch gesehen, wie sie vor ihnen auf die Knie gefallen sind!«
Moritz starrte ihn an. »Gericht Gottes …?« Die Stimme brach ihm. Vor seinem inneren Auge schlugen Flammen aus einem riesigen rauchenden Erdspalt, sprangen rote, gehörnte Wesen ihn an. Kaum eine Messe, in welcher der Priester die Hölle und den Teufel nicht in grellsten Farben geschildert hatte.
Die zerfurchte Miene des Alten wurde bitter. »Das Gericht Gottes, Bürschlein, ja, ja. Jetzt hast du’s am eigenen Leib erlebt. Und solltest du diesmal noch mit heiler Haut davonkommen, sieh zu, dass du künftig Gott und seinem Sohn Jesus Christus dienst, mit Haut und Haaren und aus ganzem Herzen. Vater, Sohn und Heiligem Geist musst du dienen, hörst du? Und der heiligen römischen Kirche, damit das nächste Mal nicht auch dich der Zorn Gottes dahinrafft.«
Die lange Rede erschöpfte den Alten endgültig, und er schlief ein. Moritz dachte an seine Großmutter. Während der letzten Schafschur war sie gestorben. Noch am Tag vor ihrem Tod hatte sie sich in ihrer Kammer vor dem Bildnis der Göttin Podaga verneigt. Und ja, auch der oberste Jäger pflegte vor jeder Saujagd die Podaga und den Swarog anzubeten. Doch er selbst? Niemals! Oder Vater und Mutter? Nie!
Warum aber hatte der Zorn Gottes dann ihn und seine Familie getroffen?
Stunden vergingen. Hinter jedem Rascheln im Wald vermutete Moritz sächsische Verfolger, hinter jedem Häherschrei das nahende Gericht Gottes. Er weckte den Priester, half ihm auf die Beine und zog ihn aus dem Farn.
»Weiter«, murmelte der Alte. Wie benommen wirkte er. »Immer weiter.«
»Aber wohin denn?«, wollte Moritz wissen.
»Nach Magdeburg, immer weiter nach Magdeburg.«
Im Abendlicht später glänzten große Schweißperlen auf der Stirn des alten Priesters, und unter seinen tränenden Augen lagen schwarze Schatten. Da konnte er sich nur noch auf einen Ast gestützt voranschleppen.
In der ersten Abenddämmerung dann breitete sich endlich der Obersee von Schwerin vor ihnen aus. Der Priester wusste, wo im Schilf die Fischer die Kähne versteckten. Als die Sonne sank, fanden sie einen Kahn. Der Priester stolperte hinein und griff nach dem Ruder. Moritz musste das Boot aus dem seichten Uferwasser in den See schieben und aus eigener Kraft hineinklettern. Der Alte war zu schwach, um ihm helfen zu können.
Sie ruderten den Kahn auf den See hinaus. Moritz war nass bis auf die Haut. Im Licht der untergehenden Sonne sah er einen großen Flecken im Gewand des Priesters glänzen. Feucht und schwer von Blut klebte es an seiner Hüfte. Der Sachse mit der blutigen Axt stand Moritz wieder vor Augen. Oder ein Schwerthieb? Oder ein Pfeil? Er wagte nicht zu fragen.
Dunst legte sich über den See. Bald war es so dunkel, dass Moritz in keiner Himmelsrichtung mehr Land erkennen konnte. Jedes Mal, wenn der alte Priester das Ruder ins Wasser stieß, stöhnte er auf. Irgendwann sank er vor seiner Ruderbank in den Bug des Kahns und zog die Beine an. Sein Atem ging rasselnd und schnell.
Moritz kniete zwischen den Ruderbänken nieder und beugte sich über den Priester. »Rudere du«, flüsterte der Alte, »nicht aufhören zu rudern, hörst du?«
Moritz schüttelte ihn sanft. »Bleibt bei mir. Ihr dürft mich nicht allein lassen!« Tränen schossen ihm aus den Augen.
»Wenn du Feuer in Schwerin siehst, sind die Sachsen auch dort schon«, flüsterte der Alte. »Dann nichts wie weg und hinüber ans Ostufer mit dir.«
»Verlasst mich nicht!« Moritz klammerte sich an ihm fest.
»Erreichst du das Waldufer, lauf weiter nach Süden, weiter der Elbe zu. Lauf einfach weiter, lauf in die Stadt …« Immer öfter unterbrach der Alte sich, immer schwächer klang seine Stimme. »Laufe nach Magdeburg, dorthin musst du …« Sein ganzer Körper bäumte sich auf, wenn er nach Luft schnappte. »… frag die Leute nach dem Erzbischof von Magdeburg. Der hat mich einst als Missionar zu euch geschickt. Sag ihm …«
Die Stimme des Alten erstarb. Er hörte auf, nach Luft zu schnappen. Moritz presste ihm die Wange ins kaltschweißige Gesicht. »Lasst mich doch nicht allein!« Er weinte laut. Er weinte um seine Mutter, um seinen Vater, um seine Geschwister, um sein Zuhause. Er weinte die halbe Nacht lang. Niemand hörte ihn dort draußen auf dem oberen Schweriner See. Er weinte sich in den Schlaf.
Im Traum sah er wieder die Sachsen in der elterlichen Hütte wüten. Am schlimmsten trieb es der stämmige Axtmann mit dem runden Gesicht und dem fehlenden kleinen Finger an der Rechten.
Wie ein Riese im Kettenhemd ragte der Hagere mit dem entstellten Mund vor Moritz auf. Der Bullenkopf prangte schwarz und grässlich auf seinem Schild und seinem Mantel. Die anderen sprangen, wohin er zeigte, und die Mutter spuckte dem Rothaarigen mit der schiefen Nase ins Gesicht.
Ihre Stimme hallte durch seinen Traum wie ein Echo, das niemals mehr aufhört: Lauf, Moritz! Lauf, lauf! Gott sei mit dir!
Schreiend fuhr er aus dem Schlaf hoch. Der Kahn schaukelte, Nebelschwaden wogten ringsum. Moritz zitterte, kalt und nass klebten ihm die Kleider auf der Haut. Schluchzend blinzelte er nach allen Seiten, versuchte vergeblich, irgendwo die Umrisse von Schwerins Mauern und Türmen zu erkennen.
Wo war er? Wohin trieb der Kahn?
Heulend beugte er sich schließlich über den Priester. Aschfahl war dessen Gesicht. Mund und Augen standen ihm offen. Er atmete nicht mehr.
Moritz schüttelte den Alten. Der Alte war tot.
Moritz’ Tränen versiegten, die Schultern sanken ihm, alle Kraft wich aus seinen Gliedern. Ganz krumm hockte er im Kahn und stierte in den Nebel. Die Umrisse eines Schwanenpaares schälten sich aus dem feuchten Grau; die stolzen weißen Vögel schwammen vorüber, beachteten ihn nicht, tauchten wieder in den grauen Schleier ein.
Er hörte Wasser plätschern – ein springender Fisch. Über ihm gellte der Ruf der Kraniche; unsichtbar für ihn zogen sie nach Süden. Die frühherbstliche Kälte drang ihm in die Knochen, er zitterte stärker. Irgendwo jenseits der Nebelwand begannen Vögel zu singen. Eine große Leere ergriff Moritz. Unendlich allein fühlte er sich.
Irgendwann bohrte der Hunger in seinem Bauch. Er griff zum Ruder, senkte es kraftlos ins Wasser. Doch in welcher Himmelsrichtung lag Schwerin? Wohin sollte er den Kahn denn lenken? Gleichgültig! Er ruderte einfach darauflos.
Bald durchdrang die Morgensonne den Nebel, die grauweißen Schwaden lichteten sich erst, lösten sich dann nach und nach auf. Keine drei Steinwürfe entfernt erkannte Moritz das Seeufer, sah Schilf, Wald und Gras. Keine Stadt, keine Burg. Hatte der Wind seinen Kahn denn ans Ostufer getrieben? Dort war er nie zuvor gewesen.
Er fand Blaubeeren und Brombeeren, stopfte in sich hinein, so viel er konnte. In Ufernähe wanderte er nach Süden; im abendlichen Nebel verlor er die Orientierung. Zwischen entwurzelten Kiefern fand er einen verlassenen Dachsbau und kroch hinein. Traumlos schlief er, bis Kranichrufe und das kehlige Fauchen eines Dachses ihn weckten.
Moritz kroch aus dem Bau. Morgennebel hing in Buschwerk und Gehölz. Im Unterholz fletschte ein dreieckiger, schwarzweiß gestreifter Schädel die Zähne. Moritz sprang auf, rannte davon. Er rannte, bis der Nebel sich lichtete.
Auf einer Lichtung fand er Brombeerhecken und stillte seinen Hunger. Danach folgte er bis zum Abend einem Bachlauf. Die Sonne trocknete seine Kleider, zum Schlafen wühlte er sich ins Vorjahreslaub. Am nächsten Morgen wieder Beeren. Im Bach fand er Muscheln und schlang sie herunter.
Der Bach mündete nicht in den Schweriner See, wie Moritz gehofft hatte, sondern in einen Teich. Weil er Wolfsspuren entdeckte, schlief er in der Krone einer Weide. Am nächsten Morgen suchte er vergeblich nach dem Seeufer, geriet immer tiefer in unwegsames Gehölz hinein.
Tagelang irrte er durch den Wald, trank aus Bächen, aß wilde Pflaumen, Pilze, Beeren und dreimal rohen Fisch. Einen fand er tot am Ufer eines Teiches, einen zweiten nahm er einem jungen Otter weg, den dritten ließ ein Kormoran aus einer Weidenkrone in einen Tümpel fallen.
Irgendwann gelangte er in ein Dorf. Er bettelte, fragte nach Magdeburg und dem Erzbischof. Man lachte ihn aus. Eine alte Frau gab ihm Brot und eine Speckschwarte und zeigte ihm einen Reitweg nach Süden.
Halb verhungert gelangte er Tage später in eine Stadt, bettelte auf dem Marktplatz, sprach einen Bauern auf Wendisch an und wollte wissen, ob er in Magdeburg sei und ob der Bauer den Erzbischof kenne. Leute versammelten sich um den Bauernwagen. Auch sie lachten ihn aus.
Warum, begriff Moritz nicht. Vielleicht, weil er zwischen seiner wendischen Muttersprache und dem Sächsischen, das er vom Priester gelernt hatte, hin und her wechselte. Sie rümpften die Nase, weil er stank; vielleicht auch, weil er ein Wende war. Am dritten Tag jagten sie ihn vom Marktplatz und aus der Stadt.
Monate später erst erfuhr er deren Namen: Havelberg.
Er schlief in der Flussböschung vor der Stadtmauer und bettelte tagsüber am Stadttor. Nach wenigen Tagen lag er mit Fieber im Staub. Er konnte sich kaum noch rühren.
Die Menschen erschienen ihm wie Schatten ohne Gesichter, Hufschlag und Geratter von Wagenrädern, wie Pauken und Trommeln aus den Gassen des Neuen Jerusalems. Moritz lauschte der Stimme seiner schönen Mutter. Er sprach mit ihr, war zufrieden, hoffte nichts weiter mehr, als bald in ihre Arme sinken zu können.
Ein aus dem Stadttor rollender Ochsenkarren hielt an, Schritte näherten sich ihm, zwei Schatten fielen auf ihn. »Er stinkt«, sagte der eine, »er lebt noch«, der andere.
»Mutter?« Moritz glaubte, bereits im Himmel zu sein. »Mutter?« Er schlug die Augen auf, blinzelte ins Tageslicht – und erschrak: Ein schwarzes Gesicht schwebte über ihm. Der Teufel? Oder einer seiner höllischen Knechte? Er konnte kein Gehörn entdecken, keinen Ziegenbart, er sah aber wulstige Lippen, eine dicke, klobige Nase, große, schwarzbraune Augen und eine dunkle Stirn, über deren Falten schwarzes, krauses Haar hing. Moritz klapperte mit den Zähnen.
Dem anderen Schatten gefiel seine Angst. »Das Stinkerchen hat Angst vor unserem Mohren!«, rief er denen im Wagen zu und lachte vergnügt.
Das schwarze Gesicht über Moritz entblößte große, weiße Zähne. Konnte ein Teufel lächeln? Hatte ein Teufel derart freundliche Augen? Der Mann mit dem schwarzen Gesicht schob seine schwarzen Arme unter Moritz’ zitternden, ausgemergelten Körper. Der Mann, der kein Teufel gewesen sein konnte, trug ihn zum Wagen, bettete ihn in Decken, gab ihm zu trinken.
Der Ochsenkarren rollte an und fuhr weiter.
Wohin?
2MUTTER
Maulbronn, zwölf Jahre später
Am Vormittag war Helena noch nach Singen zumute. Mit einem Lied auf den Lippen rauschte sie von einem Ende der großen Klosterküche zum anderen, wieder und wieder. An den Herdfeuern drehten zwei Küchenknechte die Spieße mit den Fasanen, Enten, Hühnern und Hasen. In einem großen Topf schmorten Stücke eines Kalbs, in einer Pfanne Scheiben vom Schweinerücken. Wie die Fasanenhaut brutzelte! Wie das Entenfett spritzte und über der Glut zischend in Flammen aufging! Und wie der Saft aus dem zarten Kalbfleisch sickerte! Herrlich! Tief sog Helena den Bratenduft ein.
Das Festmahl für den Abend entstand. Vom Backofen her strömte der Duft frischen Brotes durch die Klosterküche. Auf dem zweiten Herd garte in drei Töpfen die Weizengrütze. Ein jungenhafter Mönch schnitt Kräuter hinein, ein viel älterer Bauchfleisch. An der Zinkwanne neben der Tür zur Vorratskammer wuschen zwei Knaben Äpfel, Pflaumen und Birnen. Auf dem langen Tisch vor den Fenstern nahm eine Magd die Forellen aus. Katzen strichen um ihre Beine.
Leise singend lief Helena zwischen den Braten, dem Zuber, dem backenden Brot und der Hafergrütze hin und her und schaute nach dem Rechten. Sie liebte diese Stunden in der Klosterküche, wenn alles so geschah, wie sie es geplant hatte, wenn das Gesinde und sogar die Mönche auf ihre Anweisungen warteten und die Speisen gelangen. Sie gerieten eigentlich immer aufs Beste, wenn Helena die Aufsicht führte. So, wie sie früher gelangen, als die Mutter noch die Aufsicht führte.
Der jüngere der Küchenknechte, ein Bursche von kaum achtzehn Jahren, streckte die Rechte nach einer Ente aus, um einen Fetzen Haut abzureißen, der sich in der Brathitze abkrümmte. Helena unterbrach ihr Lied und klopfte ihm mit dem Kochlöffel auf die Hand. »Untersteh dich!« Sie drohte ihm mit dem Zeigefinger, und er, der Gleichaltrige, zog den Kopf ein und gab sich reumütig.
Die älteste Magd brachte ein Tablett mit Speisen herein und stellte es Helena zur Begutachtung hin: Käse, Brot, Zwetschgen und Wein – das Frühstück für den Vater. »Füll ihm noch ein Schüsselchen Weizengrütze ab«, befahl Helena. »Und dann gehe den Wirsing schneiden, ich will Meister Bohnsack selbst das Frühstück bringen.« Die Magd nahm eine Schüssel aus dem Wandregal und humpelte zum Herd.
Ein hochgewachsener Mönch von kräftiger Statur zog einen Leiterwagen vor die offene Küchentür, nahm einen Stapel Körbe heraus und stellte sie wortlos auf den Tisch neben der Tür ab. Dort hatte Helena Brote, Fleisch, Wein und Früchte auslegen lassen und was sonst übrig war an Essensresten vom vergangenen Tag.
Der Mönch drehte sich nach Helena um – etwas leuchtete auf in seinen dunklen Augen, und ein wohlwollendes, väterliches Lächeln machte seine ernsten Züge für einen Moment weich. Er nickte ihr zu und füllte dann seine Körbe mit den Gaben für die Armen.
Pater Rochus war der Almosenmeister des Klosters. Er hatte die Bettler zu versorgen, die am Klosterportal um Hilfe baten. Er stand unter einem Schweigegelübde, und es war Jahre her, dass Helena mit ihm gesprochen hatte. Dennoch schwang da etwas hin und her zwischen ihnen, etwas Warmes, Freundliches. Ein unsichtbares Band. Während Pater Rochus den letzten vollen Korb hinaustrug, nickte er Helena noch einmal zu und lächelte scheu. Man sah ihn nur sehr selten lächeln.
»Einen gesegneten Tag, Pater Rochus!«, rief Helena ihm hinterher. Durch das Fenster beobachtete sie, wie er seinen Leiterwagen über den Klosterhof zog. Seine Haltung war aufrecht und sein Schritt kraftvoll wie der eines jungen Mannes, dabei hatte er die Vierziger schon hinter sich.
Bis vor wenigen Jahren war er noch der Prior von Maulbronn gewesen, der Stellvertreter des Abtes; damals hatte er noch gesprochen. Niemand wusste, warum er das hohe Amt des Priors gegen das so viel geringere des Almosenmeisters hatte tauschen müssen.
Einer der Falkner lief mit seinen Hunden über den Klosterhof. Helena stürzte aus der Küche. »He, Falkner!« Er blieb stehen. »Wann willst du mit mir abrechnen?« Weil seine Falken keine Fasane gefangen hatten, musste er welche auf dem Markt kaufen. »Ich habe dir einen Groschen gegeben, ein Fasan kostet in diesem Herbst einen Heller, und du hast sechs gekauft. Das macht drei Pfennige, also schuldest du mir noch neun Pfennige. Her mit dem Geld des Meisters!«
Der Falkner kam herbei und kramte in den Taschen seines Wamses. »Gerade wollte ich zu Euch in die Küche kommen, Jungfer Helena.« Sein Gesicht rötete sich. »Gerade gehe ich über den Hof und denke, du musst noch mit der Baumeisterin abrechnen.« Er war zehn Jahre älter als Helena.
»Das wollte ich dir auch geraten haben.« Sie nahm die Silberpfennige entgegen, zählte sie sorgfältig und nickte zufrieden. Einer der Falknerhunde kläffte Helena an. Sie zischte zurück, und der Falkner trollte sich. Die alte Magd stellte ein Schüsselchen mit dampfender Weizengrütze zum Frühstück für den Vater hin.
Helena lief noch einmal zum Backofen. Wie köstlich das Brot roch, wie schön es bräunte! An der Hintertür sah sie den Knecht des Gärtners stehen; er hielt Blumen in den Händen und schaute erwartungsvoll zu Helena herüber. »Dass ihr mir auf das Brot achtet!«, rief sie in die Küche, während sie zu ihm eilte. »Es braucht nicht mehr lang. Seht mir ja zu, dass es nicht zu dunkel wird!«
»Das Grabgebinde«, sagte der Gartenknecht und hielt ihr die Blumen hin: violette Herbstastern, blauer Wolfswurz, rote Fetthennen, weiße Buschrosen, Herbstlaubzweige, ein paar schöne Gräser.
»Wo sind die gelben Rosen?«
»Keine gefunden.«
»Wo hast du gesucht?«
»Na, im vorderen Klostergarten, da wo die Mönche uns gestatten zu pflücken.«
»Im vorderen Klostergarten, so, so.« Helena stemmte die Fäuste in die Hüften. »Fauler Strick! War’s dir zu weit vom Blumengarten zu den Pferdeställen? Hinter denen und hinter der Schmiede habe ich gestern gelbe Rosen gesehen. Sie blühen gerade zum zweiten Mal.« Sie nahm dem Gartenknecht das Gebinde ab. »Lauf! Und kehre ja nicht ohne mindestens fünf gelbe Rosen zurück!«
Der Knecht machte kehrt und hastete im Laufschritt aus der Küche und über den Hinterhof. Helena legte den Schurz ab und strich ihr Kleid glatt. Wie sie ihren Vater kannte, arbeitete der bereits seit Sonnenaufgang und hatte noch nichts gegessen und getrunken.
Helena warf einen letzten Blick in die Grütztöpfe, in den Backofen und auf die Braten. »Das Brot kann raus!«, rief sie, und dem Burschen an den Spießen drohte sie vorsichtshalber noch einmal mit dem Finger. Dann nahm sie das Tablett mit dem Frühstück und lief leise vor sich hin summend über den Klosterhof zum neuen Herrenrefektorium.
Helena lächelte – durch die Küche würde jetzt ein Aufatmen gehen. So wie früher ein Aufatmen durch die Küche ging, wenn die Mutter endlich einmal die Küche verließ. Wie vor der Mutter – der »Baumeisterin« –, hatten sie inzwischen auch vor Helena Respekt, alle, dabei waren die meisten älter als sie. Manche fürchteten ihr Gefuchtel mit dem Holzlöffel, viele ihre spitze Zunge.
Am großen Zierbrunnen setzte sie das Tablett ab und beugte sich über den Wasserspiegel. Ein schmales Gesicht mit feinen Zügen und großem Mund schaute sie aus großen, dunkelblauen Augen an. Kastanienrotes Haar umrahmte ihr schönes Gesicht; meist trug Helena es wie heute zu einem dicken Zopf geflochten.
Ihre Arme waren dunkel, feine rötliche Härchen bedeckten sie. Genauso hatten die Arme der Mutter ausgesehen. Auch ihre drahtige und hoch gewachsene Gestalt hatte Helena geerbt. Dazu die Gewohnheit, nichts Hässliches an sich zu dulden – keinen Flecken auf den Kleidern, keinen Riss, keinen Mottenfraß, und sei er noch so klein; nichts, was schäbig oder gewöhnlich aussah. Helenas Mutter war die Tochter eines französischen Ritters gewesen.
Sie beugte sich tiefer über das Wasser, langte hinein und wusch sich das Gesicht. Ihr Spiegelbild verschwamm. Mit nassen Händen griff sie wieder nach dem Tablett und ging auf den Eingang des Klausurgebäudes zu. Kurz davor hielt sie noch einmal inne und bestaunte die prächtige Fassade, ihre Fenster, Säulen, Simse und das schöne Portal.
Wer hatte all das gebaut? Sicher – die Zimmerleute, Steinmetze, Bildhauer und Maurer. Doch wer hatte es erdacht? Wer hatte den Zimmerleuten, Steinmetzen, Bildhauern und Maurern in Zeichnungen, Modellen und vielen Worten vor Augen gestellt, was sein Geist geplant und gestaltet hatte? Niemand anderes als ihr Vater, der Baumeister Bohnsack! Stolz erfüllte Helena.
Zwischen so viel steinerner Schönheit hatte sie die beinahe achtzehn Jahre ihres bisherigen Lebens verbracht. Hier, zwischen Baustelle und Bauhütte, war Helena geboren worden; damals errichteten ihr Vater und seine Bauleute gerade die »Paradies« genannte Vorhalle der Klosterkirche. Hier, in der Klosteranlage und zwischen den Weinbergen Maulbronns war Helenas Zuhause. Ausgeschlossen, sich ein anderes auch nur vorzustellen!
Mit dem Ellenbogen drückte sie die schwere Klinke des Portals hinunter, schob es auf und betrat die Klausur. Ja, auch das hatte sie von ihrer Mutter geerbt – die Erlaubnis, diese an sich nur den Mönchen vorbehaltenen Gebäude zu betreten, um den Baumeister zu versorgen. Am nächsten Sonntag würde es damit vorbei sein, denn nach der Messe wollte der Abt die neuen Gebäude weihen.
Helena fand den Vater im neuen Speisesaal der Mönche, im Herrenrefektorium. Mehr Glas als Stein bildete die Wände des herrlichen Raums, und das Licht der Vormittagssonne flutete durch die vielen hohen Bogenfenster. Erst in der vergangenen Woche hatten die Bauleute ihres Vaters das Herrenrefektorium vollendet.
Mit dem Tablett in Händen stand Helena still, betrachtete die gewaltigen Säulen und staunte zu den prachtvollen Gewölben hinauf. Klein und bedeutungslos kam sie sich vor, und es schauderte ihr vor so viel Erhabenheit und Pracht.
Ihr Blick suchte den Vater. Vor der Mittelsäule hatte er den Fuß auf einen Säulensockel gesetzt. Das Skizzenbuch auf seinem Oberschenkel war aufgeschlagen. Den Kopf in den Nacken gelegt, schaute er in die Gewölbe hinauf. Sein wachsamer Blick wanderte über die steinernen Bögen, die sechs- oder siebenfach von jeder Säule nach oben strebten und die Gewölbe trugen und formten.
Helena stellte das Tablett auf dem großen runden Tisch vor einem der hohen Fenster ab. Stifte, Skizzenblätter und Modelle von Säulen und Kapitellen aus Ton und Wachs lagen auf ihm. »Guten Morgen, Herr Vater!« Sie ging zu ihm und küsste ihn auf die Wange.
Der Baumeister lächelte. »Einen gesegneten Tag wünsche ich dir, meine Tochter«. Dann senkte er den Blick und zeichnete einen Bogen in das Gewölbe ein, dessen Zeichnung bereits in seinem Skizzenbuch prangte. Kreuzrippengewölbe hatte er mit dicken Buchstaben darüber geschrieben.
Helena konnte, was selbst die Söhne des kaiserlichen Vogtes nicht konnten: lesen und schreiben. Sogar auf Französisch; die Mutter hatte es ihr beigebracht. Oft schon hatte sie im Skizzenbuch ihres Vaters geblättert und die zahllosen Abbildungen von Säulen, Gewölben, Rippenbögen, Arkaden, Kapitellen und pflanzenartigen Ornamenten betrachtet.
»Kommt zum Tisch, Herr Vater. Ihr müsst essen und trinken.«
»Sofort«, murmelte er geistesabwesend und blieb in seine Zeichnung versunken.
»Der kaiserliche Vogt und seine Familie haben Botschaft zum Abt geschickt.« Helena ging zurück zum Tisch. »Sie wollen heute Abend die Vollendung Eurer Arbeit mit uns feiern, Herr Vater.«
»Habe ich erwartet.«
»Vielleicht wird der Karl um meine Hand anhalten.«
»Vielleicht.«
»Vielleicht auch der Johannes.« Beide waren Söhne des Vogts.
»Schon möglich.« Der Vater legte wieder den Kopf in den Nacken, betrachtete das Gewölbe und das Kapitell der Mittelsäule so aufmerksam, als sähe er beides zum ersten Mal. Dann zeichnete er in sein Skizzenbuch, was er gesehen hatte.
Warum nur? Helena wunderte sich. Das Kloster war doch nun vollendet. »›Vielleicht‹?« Sie runzelte unwillig die Stirn. »Sonst sagt Ihr nichts dazu?«
Meister Bohnsack zuckte mit den Schultern, steckte seinen Kohlestift ein und klappte sein Buch zu. »Lass uns nach dem Fest über diese Dinge reden.« Er ging zum Tisch und rückte sich einen Stuhl vor das Frühstückstablett. »Ich danke dir, mein Kind.«
»Vielleicht will ich ja keinen von beiden.« Helena setzte sich auf den Tisch. »Wahrscheinlich sogar.« Sie griff nach dem Weinkrug und schenkte ihrem Vater ein.
»Ja, wahrscheinlich.«
»Im Grunde gefallen sie mir beide nicht wirklich ganz und gar. Doch irgendjemanden muss ich ja heiraten.« Schon als sie noch Kinder waren, hatten die Söhne und Töchter des Vogtes und Helena miteinander gespielt. »Sie werden einmal die Pferde und Rinder ihres Vaters besitzen, sie werden einmal Wald, Wiesen, Weinberge und Häuser rund um Maulbronn erben.«
»Und mit ihren Geschwistern teilen müssen«, gab der Vater kauend zurück.
»Welchen würdet Ihr Euch als meinen Mann wünschen?«
»Schwer zu sagen, mein Kind.« Irgendetwas schien den Vater zu beschweren, Helena sah es an den Falten auf seiner Stirn und um seine Mundwinkel. »Mir scheint, du bist noch ein wenig zu jung für die Ehe.«
Helena blies die Backen auf. »Bin ich etwa zu jung, Euren Haushalt zu führen? Bin ich zu jung, Euer Gesinde zu beaufsichtigen und Euer Geld zu verwalten?« Eine Zornesfalte stand plötzlich zwischen ihren dunklen Brauen. »Ich werde im Januar achtzehn, Herr Vater! Habt Ihr das vergessen?«
»Lass gut sein, mein Kind.« Meister Bohnsack griff nach dem Weinkelch. »Du weißt, wie sehr ich dich liebe.«
Er sah zu ihr hoch. Seine grauen Augen guckten hellwach, viele Furchen durchzogen sein graubärtiges, knochiges Gesicht, sein graues Haar hing ihm bis auf die breiten Schultern herab. Seine sehnigen Hände waren schwielig und groß. Er trug eine dunkle Wolltunika mit Säumen aus Fell. Seit achtzehn Jahren arbeitete er nun in der Klosteranlage von Maulbronn, ein Drittel seines Lebens.
»Jeden Morgen und jeden Abend danke ich Gott für dich, mein Kind. Lass uns morgen über diese Dinge sprechen, ja?« Er wandte sich ab und schlürfte seinen Wein.
»Ich geh jetzt zur Mutter«, sagte Helena ein wenig trotzig. »Die hört mir wenigstens zu und spricht mit mir.«
»Tu das, mein Kind.« Geistesabwesend langte Meister Bohnsack nach der Schüssel mit der Weizengrütze; er schien mit den Gedanken schon wieder ganz woanders zu sein. »Und bitte sorge dafür, dass ich ungestört bleibe, bis der Abt und die Familie des Vogtes zum Festmahl erscheinen.«
Auf dem Klosterfriedhof ging Helena vor dem Grab ihrer Mutter auf die Knie. Sie setzte das Blumengebinde dicht am Grabstein ab. Danach ließ sie sich auf ihre Fersen nieder und betrachtete den bunten Herbststrauß. Gelbe Rosen waren die Lieblingsblumen ihrer Mutter gewesen. Sie selbst mochte die weißen am liebsten.
»Die Speisen sind beinahe fertig, Frau Mutter«, sagte sie, »der Kalbsbraten ist wieder ein Gedicht geworden, und erst die Fasanen!« Helena spitzte die Lippen und schmatzte behaglich. »Nur der Herr Vater gefällt mir heute nicht. Speisesaal und Kapitellhalle sind seit Tagen fertig, und er läuft noch immer mit seinem Skizzenbuch zwischen Säulen und Gewölben umher. Und grübeln tut er auch. Was ihm wohl Kummer macht?«
Sie seufzte und betrachtete den Grabstein. Der Name ihrer Mutter war in den roten Sandstein gemeißelt. Marie-Magdalene. Der Blitz hatte sie erschlagen. Kein Mensch wusste, was sie im Gewittersturm in den Weinbergen zu suchen hatte.
»Der Herr Vater kann wohl nicht ohne Arbeit sein. Doch keine Sorge, geliebte Mutter, in der Vogtei gibt es genug Arbeit für einen Baumeister. Ich bete, dass der Bischof eine Kathedrale bauen lässt. Am besten in Pforzheim, Knittlingen oder Mühlacker.«
Helenas Blick wanderte über den Grabstein zur Friedhofsmauer und dann hinauf zu den Weinbergen. Dort oben hatte der Vater die Mutter gefunden. Im Frühling war es fünf Jahre her gewesen. Der Abt hatte ein Kreuz und eine Engelsstatue an der Stelle errichten lassen. Den schönsten Engel, den Helena je gesehen hatte.
»Davon träumt er doch schon, so lange er denken kann – als Baumeister eine Kathedrale zu errichten.« Sie schaute wieder auf den Grabstein. »Hat er davon nicht schon geträumt, als Ihr Euch kennengelernt habt? Damals in Chartres, als er noch ein junger Mann war und von seinem französischen Meister lernte, wie man ein Gotteshaus baut? So habt Ihr’s mir erzählt, Frau Mutter. Ihr erinnert Euch doch, oder?«
Die Glocken der Klosterkirche läuteten. Helenas Blick flog zum Turm. Das Läuten rief die Mönche zum Angelus, zum Mittagsgebet. Auch im Wald, auf dem Feld und in den Weinbergen verharrten sie jetzt, entblößten die Köpfe und bekreuzigten sich.
»Eine Kathedrale in Mühlacker würde mir gefallen, dann könnte ich den Herrn Vater jeden Sonntag besuchen. Und Euch auch.« Sie lächelte versonnen. »Ich würde Eure Enkel mitbringen. Und natürlich Vaters Lieblingswein und Lieblingsspeisen. Es sind ja nur wenige Wegstunden von den Gütern des Vogtes nach Mühlacker.«
Ein zweifelnder Zug legte sich auf ihr schönes Gesicht. »Obwohl – weiß ich denn wirklich sicher, dass ich einmal dort wohnen werde? Ich glaube, beide wollen mich, der Johannes und der Karl. Heute kommen sie zum Fest. Wie schade, dass Ihr nicht dabei sein könnt! Die ganze Familie des Vogtes kommt. Was meint Ihr, Frau Mutter – ob ich den Karl heiraten soll oder lieber den Johannes? Dem Vater ist’s gleich, scheint mir. Schade.«
Helena betrachtete das Grab und den kunstvoll bearbeiteten Grabstein. Er hatte die Form eines hoch aufragenden Bogens und war aus Buntsandstein. Das Grab war ein Familiengrab. In wenigen Jahren würde der Vater hier neben der Mutter liegen. Und irgendwann auch sie selbst. Vielleicht. Sie blickte sich um. Vielleicht aber auch im Familiengrab des Maulbronner Mannes, den sie einmal heiraten würde. Es sollte bald geschehen, denn etwas in ihr sehnte sich. Nach Nähe, nach Zärtlichkeit, nach Berührung.
Helena entdeckte ein spätes Gänseblümchen im Gras auf der anderen Grabseite. Sie richtete sich auf den Knien auf, beugte sich über das Grab und pflückte das Blümchen. Wieder auf den Fersen sitzend, lauschte sie in sich hinein.





























