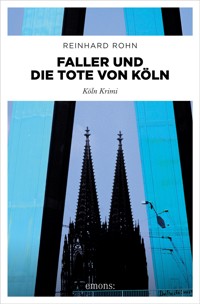8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ludwig Graf steht vor dem Nichts: Sein Familienleben ist gescheitert ist und sein Unternehmen, eine ehemals florierende Schokoladenfabrik, musste Konkurs anmelden. Verbittert zieht er sich in das kleine Ferienhaus seines Vaters zurück, fest entschlossen, seinem Leben am 24. Dezember ein Ende zu setzen. In der Stille der winterlichen Landschaft geschehen jedoch Dinge, die ihn unmerklich, jeden Tag ein Stückchen mehr, wieder ins Leben zurückholen und er trifft auf Menschen, die ihn von seinem ursprünglichen Plan immer weiter abbringen. Doch dann holt ihn seine Vergangenheit ein ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 284
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über das Buch
Ludwig Graf steht vor dem Nichts: Sein Familienleben ist gescheitert und sein Unternehmen, eine ehemals florierende Schokoladenfabrik, musste Konkurs anmelden.
Verbittert zieht er sich in das kleine Ferienhaus seines Vaters zurück, fest entschlossen, seinem Leben am 24. Dezember ein Ende zu setzen.
In der Stille der winterlichen Landschaft geschehen jedoch Dinge, die ihn unmerklich, jeden Tag ein Stückchen mehr, wieder ins Leben zurückholen und er trifft auf Menschen, die ihn von seinem ursprünglichen Plan immer weiter abbringen.
Doch dann holt ihn seine Vergangenheit ein ...
Über Reinhard Rohn
Reinhard Rohn wurde 1959 in Osnabrück geboren und ist Schriftsteller, Übersetzer, Lektor und Verlagsleiter. Seit 1999 ist er auch schriftstellerisch tätig und veröffentlichte seinen Debütroman »Rote Frauen«, der ebenfalls bei Aufbau Digital erhältlich ist.
Die Liebe zu seiner Heimatstadt Köln inspirierte ihn zur seiner spannenden Kriminalroman-Reihe über »Matthias Brasch«. Reinhard Rohn lebt in Berlin und Köln und geht in seiner Freizeit gerne mit seinen beiden Hunden am Rhein spazieren.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Reinhard Rohn
Das Winterkind
Roman
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
1. Dezember
5. Dezember
6. Dezember
7. Dezember
8. Dezember
9. Dezember
10. Dezember
11. Dezember
12. Dezember
13. Dezember
14. Dezember
15. Dezember
16. Dezember
17. Dezember
18. Dezember
19. Dezember
20. Dezember
21. Dezember
Epilog: 24. Dezember
Danksagung
>Impressum
Für meine Mutter, die diesen Roman leider nicht mehr lesen konnte.
1. Dezember
Am 24. Dezember werde ich mich umbringen. Dieser Entschluss kam heute morgen zu mir, ganz leicht, so als hätte er Flügel. Ich werde es mir bequem machen, keine Eile oder Aufregung an den Tag legen. Vielleicht lasse ich Musik spielen oder höre die Kirchenglocken, die friedlich aus dem Dorf herüberklingen, und denke einen letzten Gedanken, der nur ein Name ist oder ein vergeblicher Wunsch. Und dann werde ich mir die Pistole an die Schläfe setzen. Kalt und fremd wird sie sich an meiner Haut anfühlen, und auch wenn ich ein wenig Angst habe, in ein tiefes Dunkel zu stürzen, werde ich nicht zögern.
In der Nacht hat der Regen begonnen. Wenn es in dieser Gegend regnet, so bleibt der Regen über Wochen, nistet sich ein mit seiner scheußlichen, grauen Kälte. Ich erwachte kurz nach zwei Uhr, weil die ersten Tropfen von einem Holzsparren auf den Boden fielen. Das Dach war undicht. Ich hätte mir denken können, dass sich in den vergangenen Jahren kein Mensch vernünftig um das Haus gekümmert hat. Meine Anweisungen waren wieder nur halbherzig befolgt worden. Lediglich ein Gärtner war manchmal aus dem Dorf gekommen, hatte den Rasen gemäht und die Hecke geschnitten. Das Haus selbst roch muffig, als hätte hier in den letzten Jahren niemand auch nur ein Fenster geöffnet. Das Bettzeug war feucht, und in den Schränken schimmelten die letzten Lebensmittel vor sich hin. Ich hatte einen ganzen Tag gebraucht, um das Haus wieder einigermaßen bewohnbar zu machen. Ein Telefon hatte mein Vater hier nie installieren lassen, aber immerhin gab es Strom. Niemand würde mich finden.
Der Regen brachte mich um den Schlaf. Ich lag da und lauschte dem rhythmischen Tropfen. Ansonsten war alles still. Nicht einmal das Geräusch eines Zuges oder eines Autos war zu hören. So viel Stille war ich nicht mehr gewöhnt, aber dann fielen mir die Tage vor fast vierzig Jahren ein, die ich mit meinem Vater in diesem Haus verbracht hatte. Damals hasste ich das Haus, während er es liebte, sich hierhin zurückzuziehen und nachzudenken. Er hockte am Fenster, blickte zum See hinaus und rauchte eine dicke Zigarre nach der anderen. Niemand, der ihn auf seine Einladung oder besser auf seinen Befehl hin ins Haus begleitete, durfte das Wort an ihn richten. Man musste dasitzen, ihn anschauen und warten, dass er zu sprechen begann. Mein Vater beherrschte das Schweigen wie eine Kunst, ein hartes, herrisches Schweigen; es konnte eine Weile dauern, bis er anfing zu reden, und viele seiner Angestellten hat er in Grund und Boden geschwiegen. Er hat sie auf die Probe gestellt. Wer sein Schweigen nicht aushielt, würde auch sonst schnell die Nerven verlieren. Die Geschichte des Kakaos hat er mir in diesem Haus erzählt und wie er zum ersten Mal nach Südamerika geflogen war und eigenhändig Kakaobäume angepflanzt hatte. Niemand in Europa war damals auf die Idee gekommen, eigene Plantagen anzulegen. Mein Vater hatte in seinen Visionen geschwelgt, warum die Menschen sich bald nichts sehnlicher wünschen würden als gute Vollmilchschokolade, aber am Ende seines Monologs musste ich mir meistens seine Kriegserlebnisse anhören, endlose, ausschweifende Beschreibungen, wie man ihn aus einem brennenden Panzer gezogen hatte und warum er nicht gestorben war, obwohl doch die Haut an seinen Beinen vollkommen verbrannt war. »Ich hatte ein paar Rezepte im Kopf«, sagte mein Vater. »Rezepte für die beste Schokolade der Welt.«
Ich zog mich an und ging zum See hinunter. Der Regen hier ist heimtückisch. Er ist so fein, dass er einem rasch in die Kleider kriecht. Noch bevor ich am Ufer angekommen war, hatte ich das Gefühl, nass bis auf die Haut zu sein. Kein Licht schwebte über dem See. Eine stille, feuchte Dunkelheit hüllte alles ein. So ähnlich mussten die Menschen sich im Mittelalter das Ende der Welt vorgestellt haben: Sie standen da, auf dem letzten verlässlichen Flecken Erde, und blickten über das Wasser in eine schwarze, Furcht erregende Unendlichkeit.
Mich fror. Den Tod stelle ich mir warm vor, vielleicht riecht er auch ein wenig süßlich, wie flüssige, heiße Schokolade, bevor sie in die Abfüllrohre läuft und zu Tafeln gepresst wird.
Vermutlich fror ich aber auch nur, weil ich nutzlos geworden war. Keine Sekretärin wartete auf mich, kein Fahrer holte mich ab, keine Termine mehr. Die Türen haben sich endgültig hinter mir geschlossen.
Als es langsam heller wurde und sich ein grauer Schleier über den See legte, sah ich, wie ein Fischreiher über das Wasser zog und manchmal abrupt hineintauchte. Gehören Fischreiher nicht zu den Vögeln, die im Herbst in den Süden ziehen, um sich dort, irgendwo in Afrika, warme, fischreiche Jagdgründe zu suchen? So kam mir der Fischreiher wie ein Leidensgenosse vor. Wir beide waren zurückgeblieben, hatten den Anschluss verloren und uns hier am See verkrochen. Dem Fischreiher schien zu gefallen, dass ich ihm zuschaute. Er kehrte immer wieder zurück, einmal mit einem dicken, noch zappelnden Fisch im Schnabel, und dann flog er einen großen Bogen über mich, so als wollte er mir ein Kunstwerk vorführen, und verschwand in den tief hängenden Wolken.
Später kochte ich mir einen Kaffee. Wahrscheinlich war es das erste Mal in den letzten zehn Jahren, dass jemand den alten Elektroherd in der winzigen Küche angeschaltet hatte. Ich stand da, starrte in das Wasser und beobachtete, wie unendlich langsam die Wärme der rostigen Herdplatte in den Topf kroch und das Wasser zu sieden begann. Zeit hatte nun eine andere Bedeutung für mich. Ich hatte plötzlich zu viel davon; wie eine öde, karge Landschaft lagen die Stunden des Tages vor mir, und ich wusste nicht, wie ich sie füllen sollte. Ich hatte nicht geahnt, dass ich so viele Dinge verlernt hatte, einfache Dinge wie Bücher lesen, Schallplatten hören, zum Himmel schauen, mit jemandem reden.
Vielleicht hatte Ira mich deshalb verlassen. Nein, nicht nur deshalb, auch weil ich in den letzten zwei Jahren zu einem Verlierer geworden war. Schon vor drei Jahren begannen die Banker zu murren, es gefiel ihnen nicht mehr, wie ich meine Geschäfte führte. Expansion – ja, unbedingt, aber eine Schokoladenfabrik in Russland, dann eine in Rumänien und eine dritte und vierte in Ungarn?
Ich schüttete das Kaffeepulver einfach ins kochende Wasser. Nicht einmal, wie man Kaffee kochte, wusste ich noch. Wenigstens war der Kaffee heiß. Zum ersten Mal an diesem Tag wurde mir warm. Ich kletterte auf das Dach und entfernte die alten Holzschindeln an einer Ecke. Es regnete nicht mehr. Schwere Wolken schoben sich am Himmel entlang; sie lagen so tief, dass ich fast glaubte, sie würden unmittelbar über meinem Kopf dahinziehen. Manchmal hielt ich nach dem Fischreiher Ausschau, aber der Himmel war leer. Die Schindeln waren brüchig, und die dahinter liegende Teerpappe war porös geworden. In einem verwitterten Schuppen neben dem Haus, der offenbar dem Gärtner als Werkstatt diente, fand ich einen Eimer mit einer dickflüssigen Bitumenmasse und begann, die Teerpappe damit zu bestreichen, ohne eine Ahnung zu haben, ob es viel nutzen würde. Ich hatte einfach keine Lust, ins Dorf zu gehen und jemanden zu fragen. Die Leute im Dorf behandelten mich höflich, sie richteten kein falsches Wort an mich. Erst wenn ich mich umgedreht hatte und wieder ging, fingen sie an zu reden. Sie hatten auch einen Namen für mich. »Der alte Schokoladen-Graf«, so wurde schon mein Vater genannt.
Als ich das Dach gestrichen hatte und die Schindeln wieder einsetzen wollte, stand ein Junge vor dem Zaun. Er hatte eine Hand auf das Tor gelegt, als wollte er es öffnen, und blickte zu mir auf. Er rührte sich aber nicht, sagte auch kein Wort.
»Was willst du?«, fragte ich ihn etwas zu laut, weil mich sein argwöhnischer Blick störte. Vielleicht war es aber auch nur, weil ich mir albern vorkam, wie ich da in einer schmutzigen Arbeitshose, die wahrscheinlich dem Gärtner gehört hatte, auf dem Dach hockte.
Der Junge sagte noch immer nichts. Seine Augen waren braun und dunkel, und ich glaubte, ein abweisendes, feindliches Funkeln in ihnen zu entdecken.
»Willst du dir ein paar Süßigkeiten erbetteln?«, rief ich ihm nicht besonders freundlich zu. »Ich habe nichts für dich. Nicht einmal Schokolade.«
Der Junge bewegte sich nicht; wie ein schlechter, eigensinniger Schüler, der es gewöhnt war, dass der Lehrer ihn tadelte, stand er da. Er mochte neun oder zehn Jahre alt sein, wenn ich mich nicht vollkommen verschätzte. Plötzlich fiel mir auf, wie unangemessen er gekleidet war. Er trug ein weißes, ärmelloses Hemd, auf das eine untergehende Sonne aufgedruckt war, und eine kurze rote Hose. Sein Haar war nass, als hätte er eben noch im See gebadet.
»Geh nach Hause!«, rief ich. »Du wirst dich erkälten.« Doch er rührte sich nicht. Er stand da, mit der Hand auf dem Tor, und schaute zu mir herauf, als wäre er in eine Art Trance gefallen.
Ich tauchte den Pinsel in die Bitumenmasse. Ich mochte es nicht, wenn man mich so belauerte, wenn mich jemand so anstarrte, als würde er nur darauf warten, dass ich einen Fehler machte. Ich kannte diesen Blick noch von meinem Vater. Mit seinem düsteren, argwöhnischen Blick war ich aufgewachsen.
Als ich mich wieder umwandte und meine Hände hob, um eine Geste zu machen, als wollte ich einen herumstreunenden Hund verscheuchen, war der Junge verschwunden. Lautlos musste er davongelaufen sein, oder er war ein Geist gewesen und gar nicht wirklich da.
5. Dezember
An meinem Entschluss hat sich nichts geändert. Am 24. Dezember werde ich meinem sinnlosen Leben ein Ende setzen.
Ich hatte es tatsächlich geschafft, das Dach zu reparieren. Der Regen, der nur hin und wieder für ein paar Stunden aufhörte, konnte mir nichts mehr anhaben. Seitdem es nachts nicht mehr tropfte, schlief ich auch besser, obwohl mir meine Träume wenig Erleichterung brachten. Im Traum war Ira zu mir zurückgekehrt. Sie war viel jünger, nicht fünfzig, sondern höchstens Anfang dreißig, und sie schob voller Stolz einen breiten, glänzenden Kinderwagen. Zwei Kinder lagen in dem Wagen, Zwillinge, ein Junge und ein Mädchen, vielleicht sechs, sieben Monate alt. Die Kinder schliefen selig, als gäbe es nichts auf der Welt, wovor man Angst haben müsste. Ira war nur zurückgekommen, um mir zu zeigen, dass sie von einem anderen Mann zwei Kinder bekommen hatte.
Gestern hatte ich einmal den See umrundet. Ich kaufte mir in dem einzigen Geschäft im Dorf, in dem man beinahe alles bekommen kann, einen hässlichen gelben Regenmantel mit Kapuze und zog los. Achtzehn Kilometer misst der Weg, und ich begegnete niemandem. Einmal sah ich einen Schäfer aus der Ferne, der mit seiner Herde über eine Wiese zog. Auch auf dem See regte sich nichts. Die Feriengäste, die es hier im Sommer gibt, zeigten sich um diese Jahreszeit nicht. Nur eine Gestalt in einem Ruderboot war auf dem See zu sehen. Offensichtlich ein Forscher, der Wasserproben entnahm. Wiederholt konnte ich beobachten, wie die Gestalt sich über das schmale Boot beugte und ihre rechte Hand ins Wasser tauchte. Vielleicht war es aber auch nur jemand, der den Fischen nachschaute.
Als ich die Hälfte des Weges geschafft hatte und in einer kleinen Schutzhütte Rast machte, sah ich den Fischreiher wieder. Beinahe träumerisch und wie schwerelos glitt er am Himmel dahin, um dann plötzlich auf das Wasser herabzuschießen. Ihm schien zu gefallen, dass zu dieser Zeit im Jahr niemand seine Kreise störte. Er war der Herrscher des Sees, und ich war nichts als ein Eindringling. Ich kannte mich hier nicht aus, kannte die Pflanzen und Tiere nicht, auch wenn in jeder Schutzhütte Hinweisschilder hängten, die mit der Flora und Fauna vertraut machen sollten.
Auf den letzten Kilometern begann der Regen wieder. Doch diesmal störte er mich nicht. Meine Brille beschlug, die Schritte wurden mir schwer, weil ich in den letzten zehn Jahren, von ein, zwei längeren Bergtouren abgesehen, niemals so lange gewandert war. Trotzdem fühlte ich mich großartig. Ich hatte das Gefühl, dass mein Körper arbeitete, dass alle meine Organe versuchten, eine Höchstleistung zu erbringen. Als ich das Dorf hinter mir gelassen hatte und das Haus sah, hatte ich sogar für einen Moment das Gefühl, irgendwo anzukommen. Ich ging unter die primitive Dusche, die sich unter dem Dachvorsprung neben dem Haus befindet. In diesem Moment verstand ich meinen Vater, warum er dieses Haus, das eigentlich nicht mehr als eine Ferienhütte ist, nie hatte umbauen und modernisieren lassen. Es erinnerte ihn vielleicht an seine Kindheit, daran, dass es noch etwas anderes gab als Schokoladenfabriken, Abteilungsleitersitzungen, Verkaufskonferenzen.
Als ich nur mit einem Handtuch bekleidet die wenigen Schritte zum Haus ging, war der Junge wieder da. Es sah aus, als hätte er sich gar nicht wegbewegt: dasselbe Hemd, dieselbe Hose, derselbe dunkle, forschende Blick, der mich gleich wieder wütend machte. Nur dass er diesmal ein großes Handtuch über der Schulter trug.
»Was willst du?«, rief ich. »Verschwinde!« Vielleicht schämte ich mich auch, weil ich nackt vor ihm stand: ein müder Mann mit grauer, faltiger Brust, der sich vor aller Welt versteckte.
Erst als ich im Bett lag und spürte, wie die Wärme in meinen Körper zurückkehrte, dachte ich daran, dass ich besser der Mutter des Jungen hätte Vorwürfe machen sollen. Wer lässt einen Jungen zu dieser Jahreszeit in einem solchen Aufzug herumlaufen?
Ich schlich zum Fenster und spähte hinaus. Der Junge war verschwunden. Er musste aus dem Dorf gekommen sein. Woher sonst? Keines der wenigen Ferienhäuser in der Umgebung ist zurzeit bewohnt. Später hörte ich einen Hund kläffen, ganz nah, als würde er um das Haus streifen und versuchen, meine Aufmerksamkeit zu erlangen.
Das Haus hatte ein Geheimnis, wie ein Mensch, der zu lange allein geblieben war. Oder ich war es, der Geräusche hörte, wo keine sind, dem Stimmen durch den Kopf geisterten, weil er noch nie so viel Stille um sich gehabt hatte.
Noch nie war ich so lange ohne ein Telefon, einen Computer, ein Radio oder einen Fernsehapparat gewesen. Die Wolken hingen hier so tief, als würden sie durch die emporgestreckten Äste der Bäume hindurchgleiten. Das Einzige, das an Menschen erinnerte, war eine einsame Stromleitung, die sich zu den Ferienhäusern zog. Sonst war nur Stille da.
Ich durchsuchte die Schubladen, um wenigstens ein, zwei Geheimnissen auf die Spur zu kommen. Aber nach dem Tod meines Vaters war gründlich aufgeräumt worden. Borger, der alte Rechtsanwalt, dessen pflichtbewusster Sohn mich nun den Banken ausgeliefert hatte, war damals hierher herausgefahren und hatte alle wichtigen Aufzeichnungen an sich genommen. Mein Vater hatte ihm mehr vertraut als mir. Offenbar misstrauen alle Väter ihren Kindern, glauben nicht daran, dass sie das Geschäft mindestens genauso erfolgreich weiterführen wie sie.
Ich fand nicht besonders viel. In der obersten Schublade eines alten Sekretärs, des einzigen wertvollen Möbels, mit dem sich mein Vater in dem Haus umgeben hatte, entdeckte ich ein paar vergilbte Kreuzworträtselhefte. Mit diesen Heften hatte er sich in den beiden letzten Jahren die Zeit vertrieben und versucht, sein schon angegriffenes Gehirn zu beschäftigen. Am Ende gab es Tage, an denen sein Verstand so umnebelt war, dass er nicht viel mehr als seinen Namen wusste. Beinahe rührend mutete mich seine krakelige Handschrift an. Er hatte sich um klare Blockbuchstaben bemüht. In der Fabrik hatte er eine andere Handschrift gehabt, mächtige, eckige Buchstaben, die sich so ineinander schoben, dass jeder größte Mühe gehabt hatte, seine kurzen Anweisungen zu entziffern.
Die Zeit hatte auch meinen Vater im Stich gelassen.
In der nächsten Schublade fand ich nichts, und ich wollte sie schon schließen, als zwei kleine Fotos nach vorne rutschten. Offenbar war jemand beim Aufräumen doch nicht ganz so sorgfältig vorgegangen.
Das Erschrecken ließ mich frösteln. Ich nahm das erste Foto und strich mit den Fingern meiner rechten Hand darüber, als gäbe es da etwas, was ich wirklich ertasten könnte. Nie war ich mir in den letzten Jahren alt vorgekommen, nicht einmal im Krankenhaus, als man mir einen Bypass gelegt hatte, doch nun war das Alter wie eine Krankheit, die sich in meine Knochen geschlichen hatte und sie von innen auffraß. Ich sah mich auf dem Foto, so wie man einen Fremden sieht, an den man sich nur ganz allmählich erinnert. Mein braunes Haar war dicht und zerzaust. Ich saß auf einem weißen Motorroller und hatte einen Strohhut in der Hand, den ich zu einem überschwänglichen, etwas zu theatralischen Gruß hoch hielt, und ich lächelte so jung und selbstsicher, wie ich mich noch nie hatte lächeln sehen. Dabei hatte ich im Lauf der Jahre so viele Fotos und Filme über mich anschauen müssen.
Das zweite Foto erschreckte mich beinahe noch mehr. Es zeigte meinen Vater. Er musste um die fünfzig sein, er war schon fett, mit einem kräftigen Doppelkinn. Das spärliche Resthaar hatte er mit Pomade zurückgekämmt. Er saß in dem Korbstuhl, auf dem ich in diesem Moment saß, nur dass der Stuhl draußen im Sonnenlicht auf der Terrasse stand. Neben ihm, eine Hand auf seine massige Schulter gestützt, lehnte Ira. Wie eine Elfe sah sie aus in einem weißen, viel zu eleganten Kleid, das ihre Taille betonte. Sie war so schön gewesen, mit ihren dunklen, ausdrucksvollen Augen. Auch dieses Foto hatte ich noch nie gesehen. Zum ersten Mal bedauerte ich, dass ich mich nie um den Nachlass meines Vaters gekümmert hatte.
Als ich mir die dritte Schublade ansehen wollte, bemerkte ich, dass es draußen dunkel geworden war, und plötzlich hörte ich Stimmen, die allmählich lauter wurden. Kinder, die sich auf der Straße näherten. Sie sangen ein Lied, das ich nicht kannte, und trugen kleine Laternen vor sich her, wie bei einem Sankt-Martinszug.
Dann, als ich die ersten Worte des Liedes vernommen hatte, tat ich etwas, das ich mir hinterher gar nicht erklären konnte. Beinahe panisch löschte ich die Lampe auf dem Sekretär. Dann schlich ich im Dunkeln die steile Treppe in den Schlafraum im ersten Stock hinauf.
Ich sah nicht viel, ein paar kleinere und größere Schatten, die, beleuchtet von Laternen aus Papier, auf der schmalen Asphaltstraße dahinglitten. Den Jungen vom Gartentor konnte ich unter ihnen nicht erkennen.
6. Dezember
Eines der Geheimnisse, die das Haus hütet, wurde heute Nacht gelüftet. Ich konnte nicht schlafen. Mein Körper ächzte und quälte sich auf eine Art, die ich nicht gewöhnt bin. Früher schlief ich sogar vor den schwierigsten Entscheidungen immer gut, so gut, dass sich Ira häufig wunderte. Später richtete sie sich ihr eigenes Schlafzimmer ein, angeblich weil ich begonnen hatte zu schnarchen. Wahrscheinlich konnte sie meine Nähe nicht mehr ertragen, oder sie hatte Angst, ich könnte verstehen, was sie gelegentlich im Schlaf vor sich hinmurmelte.
Es gibt Stimmen im Haus. Sie geisterten durch die Nacht. Manche der Stimmen gehörten mir selbst, wie ich mit Ira gesprochen hatte, wie ich meiner Sekretärin Anweisungen gab, wie ich vor den Einkäufern großer Supermärkte eine Rede hielt. Ich vernahm sogar meine Stimme aus der kurzen Zeit, als ich in unseren eigenen Werbespots aufgetreten war, um meine Erfindung, die exquisite weiße Krokantschokolade, anzupreisen. Andere Stimmen erkannte ich nicht oder wollte sie nicht erkennen. Es war, als befände ich mich in einem leeren dunklen Saal, und irgendwo aus dem endlosen Universum sendete jemand Teile meines Lebens zu mir herunter.
Ich stand auf und schaltete sämtliche Lichter im Haus an, wie ein Kind, das sich im Dunkeln fürchtete. Wie hatte mein Vater es allein in diesem Haus ausgehalten? Ein-, zweimal hatte ich ihn hier besucht, nachdem er sich aus dem Geschäft zurückgezogen hatte, und immer hatte er einen ruhigen, ausgeglichenen Eindruck gemacht, als würde ihm die Einsamkeit nichts ausmachen. Ich zog mich an und lief wieder zum See. Es war kalt und roch nach Regen. Kein Stern war am Himmel zu sehen. Lediglich mein eigenes Licht aus dem Haus leuchtete in der Dunkelheit zu mir herüber.
War es wahr, dass wir nur in unserer höchsten Not einen anderen Menschen überhaupt verstehen konnten? Seine Ängste, seine Einsamkeit?
Ira hatte sich oft beklagt, dass ich zu viel in der Fabrik sei, dass ich zu viele teure Bilder von Malern kaufte, die es nie zu etwas bringen würden, zu viele Pläne machte, in denen sie keine Rolle spielte. Und alles nur, um mir und der Welt zu beweisen, dass ich ein besserer Geschäftsmann war als mein Vater.
Ich hatte ihre Einsamkeit nie verstanden und auch nie bemerkt, dass ich das Alleinsein nicht aushielt, nicht einmal mit ihr.
Der See machte keinerlei Geräusch. Wie ein schwarzer Spiegel lag er da. Oder als wäre er aus blankem düsterem Stahl.
Vor einem Jahr, als ich noch glaubte, Herr über zehn Fabriken und zweitausend Angestellte zu sein, hätte mich der Anblick dieses Sees auf ganz andere Gedanken gebracht. Wie könnte man solch einen See zu einer Attraktion machen? Wie wäre es mit einem großen Feuerwerk am Weihnachtsabend? Zum Abschluss würde groß und leuchtend unser Firmenzeichen in den Himmel gebrannt werden. Oder wie wäre es mit einem gigantischen Orgelkonzert mitten auf dem See, das von riesigen Lautsprechern an alle Ufer übertragen wurde?
Ira hatte mich zweimal verlassen. Drei Tage bevor ich den Konkurs eingestehen und mich den Banken ausliefern musste, hatte sie ihre Sachen gepackt und gesagt, dass sie es nicht mehr aushielte – mein Schweigen, meine Wutausbrüche und die Dunkelheit, die ich verbreitete, so jedenfalls hatte sie es ausgedrückt. Das Haus auf Gomera gehörte ihr. Sie sprach spanisch, hatte viele Freunde auf der Insel. Als hätte sie schon seit langer Zeit geahnt, dass unser Leben in einer Katastrophe enden würde, hatte sie sich ein Refugium auf den Kanaren geschaffen, in dem ich nichts verloren hatte.
Zum ersten Mal aber hatte sie mich vor achtzehn Jahren verlassen, an dem Tag, als unser Junge starb. Sie hatte gesehen, wie er verblutet war. An dem Zaun vor unserem Haus hatte er sich aufgespießt. Es war ein Spiel unter achtjährigen Kindern gewesen. Wer konnte am schnellsten über den Zaun klettern? Achtzehn Jahre lang hatte ich sie nicht anrühren dürfen. Ein Kuss auf die Wange vielleicht, mehr nicht. Ihr war es gleichgültig, wenn ich mir mein Vergnügen woanders holte. Achtzehn Jahre, in denen sie nie den Namen »Martin« aussprach und doch jeden Tag an unseren Sohn dachte. Nie hatte ich sie dabei beobachtet, wie sie ein Foto von ihm in der Hand hielt oder sich in seinem Zimmer einschloss, das unverändert in unserem Haus existierte. Sie hatte den Zaun abreißen lassen, aber sonst so getan, als müsste das Leben weitergehen. Manchmal waren wir zusammen auf dem Friedhof gewesen. Nie war uns am Grab etwas anderes eingefallen als zu schweigen. Ira beherrschte ein weiches, zweifelndes Schweigen, das sie mit niemandem teilte. Ich fühlte mich mit diesem Schweigen nie wohl, konnte es kaum ertragen. Man verlor sich darin wie in einer nebligen Landschaft, trieb von allen Wegen und Orientierungsmarken fort. Es rief seltsame Gedanken und sinnlose Sätze wie: »Lass uns ein anderes Leben führen!«, in mir wach – als hätte ich mich aus meiner Verantwortung für die Fabriken davonstehlen können.
Mit dem ersten Licht ging ich ins Dorf. Ich sah ein paar Kinder an einer Bushaltestelle. Der Junge von meinem Tor war nicht darunter. Die beiden einzigen Lokale, die es hier gibt, hatten noch nicht geöffnet. Daher ging ich in die Hotelpension, die genau gegenüber der Kirche und dem kleinen Friedhof liegt, und ließ mir ein großes Frühstück servieren, obwohl ich gar keinen Hunger hatte.
7. Dezember
Es gab viele Dinge, die ich niemals getan hatte und nun lernen musste. Geld an einem Bankautomaten abzuheben gehörte dazu; einen Einkaufszettel schreiben oder mit einem Dosenöffner umgehen, ohne mich zu verletzten, oder zu wissen, wie man Sicherungen auswechselt. Und wie man mit Kindern redete. Kinder kannte ich in den letzten Jahren nur noch von den Fotoaufnahmen, wenn wir eine neue Werbekampagne starteten.
Den ganzen Vormittag schlich ich durch das Dorf und wartete, dass der erste Schulbus zurückkehrte. Im Dorf gab es keine Schule mehr. Morgens gegen halb acht, wenn es noch stockdunkel ist, fanden sich ungefähr zwanzig Kinder an der Haltestelle ein. Gegen zwölf brachte der Bus die ersten Kinder zurück.
Ich setzte mich in das kleine Wartehäuschen und blickte auf die Straße hinaus, wie ein Wanderer, der zu müde war, um noch weiterzugehen. Als der Bus auftauchte, spürte ich, wie mein Herzschlag sich beschleunigte. Seltsamerweise war ich aufgeregt.
Lärmend sprangen die Kinder aus dem Bus. Sie waren winzige, bunt gekleidete Zwerge, acht oder neun Jahre, so alt, wie Martin gewesen war, als er sterben musste, und sie beachteten mich gar nicht, so sehr waren sie mit sich selbst beschäftigt. Ich traute mich nicht, einen von ihnen anzusprechen. Plötzlich kam mir mein Anliegen höchst albern vor. Zum Glück hatte mich kein Erwachsener gesehen. Wahrscheinlich hätte ich mich gleich verdächtig gemacht: der böse Onkel, der unschuldige Kinder mit Schokolade verführen wollte.
Dann, als der Bus schon wieder anfahren wollte, hüpfte ein Nachzügler aus der hinteren Tür, ein blasses blondes Bürschchen in einem türkisfarbenen Anorak.
Der Junge verharrte, kaum dass er mich bemerkt hatte. Seine Schwäche machte mir Mut.
»Komm mal her«, sagte ich und streckte ihm die Hand entgegen, als wäre er ein schwächliches Reh, das ich heranlocken wollte, um es zu füttern.
Der Junge machte einen Schritt, ohne den Blick von mir zu wenden.
»Ich heiße Ludwig«, sagte ich. »Und wie heißt du?«
Er antwortete nicht gleich, sondern schluckte nur. Sein winziger Kehlkopf hüpfte auf und ab. »Eugen«, sagte er dann mit leiser, piepsiger Stimme.
Beinahe hätte ich gelacht. Eugen – was für ein seltsamer Name. Sogar ich wusste, dass Jungen heutzutage Christian, Marcel oder Kevin hießen.
»Willst du mir helfen, Eugen?«, fragte ich weiter.
Er nickte und machte einen weiteren, vorsichtigen Schritt.
»Ich habe nur eine Frage an dich. Kennst du einen Jungen? Er ist blond wie du und ein wenig verrückt. Er geht selbst bei diesem Wetter im See schwimmen und läuft in einem Hemd herum, auf das eine Sonne gedruckt ist.«
Einen Moment glaubte ich einen sanften Schrecken in seinen Augen gesehen zu haben, aber vielleicht hatte ihn auch nur das Auto erschreckt, das auf der Dorfstraße vorbeifuhr.
Eugen schüttelte heftig den Kopf. »Mark hat einmal so ein Hemd getragen«, sagte er und senkte den Blick.
»Und wo wohnt Mark?«, fragte ich.
Der Junge schien mich nicht mehr anschauen zu wollen. »Keine Ahnung«, sagte er, dann drehte er sich herum und lief die Straße hinunter. Die Schultasche auf seinem Rücken wippte so heftig auf und ab, dass ich schon glaubte, er würde beim nächsten Schritt das Gleichgewicht verlieren und stürzen.
Den halben Tag verbrachte ich in meiner engen Küche hinter der Gardine. Ich hielt das Tor im Blick, wollte wissen, ob der Junge wieder auftauchte. Diesmal würde ich ihn zur Rede stellen und eigenhändig zu seiner Mutter zurückbringen. Doch nichts geschah. Nur dann und wann wehten ein paar Geräusche von der Hauptstraße hinüber – wenn ein Lastwagen ins Dorf fuhr oder ein Motorrad schnell die Straße hinunterrauschte. Sogar ein Motorflugzeug fern am düsteren Wolkenhimmel war klar und deutlich zu hören.
Der Junge tauchte nicht auf; wahrscheinlich lag er mit einer heftigen Grippe im Bett, weil er Anfang Dezember noch Hochsommer gespielt hatte.
Als ich mich schon abwenden wollte, um mir auf dem Herd einen Kaffee zu kochen, bog ein Mann auf einem Motorrad in die Straße ein. Er hielt auf das Haus zu und kam vor dem Tor zum Stehen. Unsicher schaute er sich um, als erwartete er, dass im nächsten Moment ein zähnefletschender Wachhund heranstürmen würde. Dann, als nichts passierte, rief er ein lautes und hilfloses »Hallo«.
Der Mann war offenkundig der Postbote des Ortes. Er hatte eine große gelbe Tasche auf seinem Gepäckträger und hielt einen Brief in der Hand.
Ich rührte mich nicht, sondern beobachtete ihn mit angehaltenem Atem.
Ira, dachte ich mit einem Gefühl der Freude und Beklommenheit. Sie hat mich doch noch nicht ganz abgeschrieben. Dann verordnete ich mir einen anderen, nüchternen Gedanken. Irgendjemand musste mich hier aufgespürt haben oder aber hatte auf gut Glück einen Brief an diese ländliche Adresse abgeschickt.
Der Postbote schien seine Pflichten ernst zu nehmen. Er legte die Hand auf das Tor und zog den Metallbügel hoch. Dann trat er ein. Natürlich wusste er, dass ich hier wohnte. In diesem Dorf konnte nichts geheim bleiben.
Ich wägte ab, was ich tun sollte: mich verstecken, mich tot stellen? Nein, ich entschied mich, ihm entgegenzugehen. Ein Blick in den winzigen Rasierspiegel im Bad, den einzigen Spiegel, den mein Vater im Haus geduldet hatte, verriet mir, dass ich einen müden, heruntergekommenen Eindruck machte. Schwarze Bartstoppeln, auf denen schon ein silberner Schimmer lag, bedeckten mein Gesicht. Die Falten um meine Augen und meinen Mund waren noch tiefer geworden. Ich sah aus, als hätte ich bei schmaler Kost schon ein paar Wochen auf einer einsamen Insel gelebt.
Der Postbote wich zurück, als ich aus der Tür trat. Er war viel jünger, als es aus der Entfernung gewirkt hatte, höchstens fünfunddreißig. Hellblaue Augen schauten mich an.
»Herr Graf«, sagte er zögernd und unsicher. »Ich habe ein Einschreiben für Sie.«
Ich nickte und bereute sofort meine Entscheidung, mich aus meinem Versteck begeben zu haben.
Der Brief kam vom jungen Borger, meinem Anwalt. Ich konnte es förmlich riechen. Er roch nach seiner piekfeinen Kanzlei, nach Nagellack und der teuren Tinte, mit der er seine Briefe unterschrieb. Borger würde vermutlich ein Treffen vorschlagen, damit ich mit ihm und dem Konkursverwalter die Lage besprechen konnte. Dabei gab es nichts mehr zu besprechen. Der Konkursverwalter musste einen Käufer für die Fabriken finden und meine Schulden bezahlen, so gut es ging. Für Ira und mich würde ohnehin nichts übrig bleiben. Das große Haus, die Bilder, die Autos – alles würde zum Teufel gehen.
Der Postbote legte mir den Brief in meine offene, ausgestreckte Hand. Ich bemerkte erstaunt, wie schmutzig sie war: die Hand eines Fischers oder Bauarbeiters.
Der Mann lächelte; vielleicht weil er meine schmutzige Hand auch bemerkt hatte.
»Bleiben Sie eine Weile bei uns?«, fragte er dann leise, während er sich schon halb abwandte. »Wir treffen uns am Sonntag nach der Kirche immer im alten Hotel.« Er tippte sich zum Abschied an die Stirn und verschwand.
Im alten Hotel am Sonntag? War damit die Hotelpension an der Kirche gemeint? Die Dorfbewohner hatten eine merkwürdige Art, ihre Einladungen auszusprechen.
Ich öffnete den Brief nicht, sondern legte ihn auf den Sekretär meines Vaters, als müsse er sich darum kümmern, als ginge mich Borgers Schreiben nichts an.
Später stand ich wieder am Fenster. Der Himmel verdüsterte sich. Immer dunklere, schwerere Wolken zogen am Himmel entlang und spiegelten sich auf dem Wasser. Niemand war auf dem Deich zu sehen. Ich ging in Richtung Dorf, vorbei an einem öden, verwaisten Campingplatz, aber als ich die ersten Lichter der Dorfstraße sah, überlegte ich es mir anders. Es gab niemanden im Dorf, mit dem ich reden wollte. Außer Ira fiel mir überhaupt niemand ein, dem ich etwas zu sagen gehabt hätte.
Ich kehrte um. An dem kleinen Sandstrand, der sich neben einem verwitterten Steg befindet, an dem nur noch ein ebenso verwittertes Ruderboot lag, zog ich meine Schuhe aus, krempelte mir die Hose hoch und watete ins seichte, grünliche Wasser. Ich hatte keine Ahnung, wie ich auf diese Idee gekommen war. Das Wasser war eiskalt, aber nach dem ersten Schreck hatte es eine belebende Wirkung, wie eine kalte Dusche nach einer großen Anstrengung. Einige Enten glitten neugierig aus dem Schilf heran. Ich watete auf sie zu und verscheuchte sie spielerisch. Fast hätte ich gelacht, weil sie plötzlich aufschraken und gemeinsam die Flucht antraten.
Als ich zum Ufer zurückging, war jede Kälte in meinen Gliedern verflogen. Auf dem Deich, in der Dunkelheit nur schemenhaft zu sehen, stand der Junge. Er hatte sich in ein riesiges blaues Tuch gewickelt, als wollte er tatsächlich schwimmen gehen. Immerhin trug er eine lange Hose und feste Schuhe.
Obschon ich mich bei einer Dummheit ertappt fühlte, winkte ich ihm zu, recht freundlich, wie ich fand, doch er drehte sich blitzschnell um und stürmte auf der anderen Seite den Deich hinunter.
8. Dezember
Der Fischreiher war wieder da. Von meinem Fenster sah ich, wie er über dem See kreuzte. Er flog seine Kreise und stieß dann und wann ins Wasser hinab, um sich einen Fisch zu fangen. Ich konnte nicht sehen, ob seine Jagd erfolgreich war. Manchmal schien er auch so hoch fliegen zu wollen, dass er beinahe in den Wolken verschwand.
Schließlich ließ er sich irgendwo im Schilf nieder, und ich zog mich an und lief auf den Deich hinauf. Wäre mein Vater nicht so ein illiterater Mensch gewesen, hätte er wenigstens ein Lexikon im Haus gehabt. Aber Bücher gelesen hatte er nur, wenn sie mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun hatten. Gehörten Fischreiher nicht zu den Zugvögeln? Was würde der Vogel tun, wenn der Winter strenger wurde und der See zufror? Vielleicht mussten dann ein paar Männer aus dem Dorf kommen und ihn füttern, damit er nicht verhungerte.