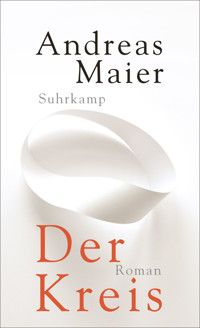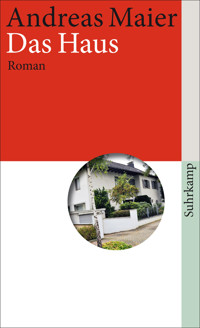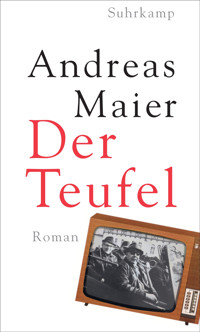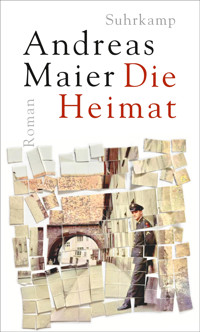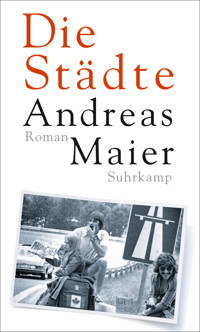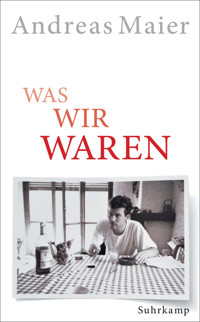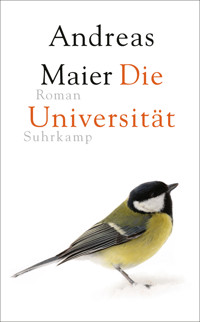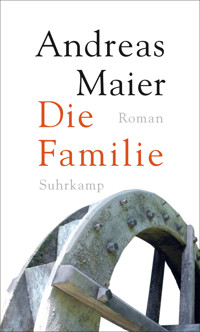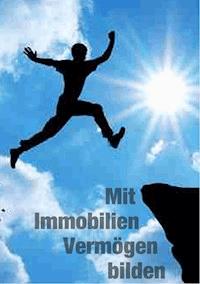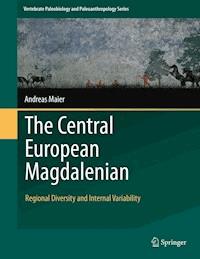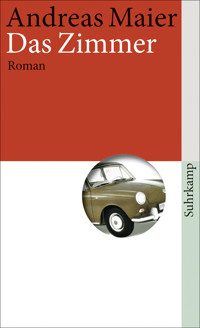
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ortsumgehung
- Sprache: Deutsch
Mit einem Bein steht er noch im Paradies, dafür hat die Geburtszange gesorgt. Immer ist er ein Kind geblieben, und wurde doch stets älter, und leben mußte er auch irgendwie. Nun ist er schon dreißig. Ein Tag im Leben Onkel J.s. Es ist das Jahr der ersten Mondlandung. 1969. Hin- und hergerissen zwischen Luis Trenker, der Begeisterung für Wehrmachtspanzer und den Frankfurter Nutten, wird J. plötzlich als ein Mensch erkennbar, der außerhalb jeden Schuldzusammenhangs steht, noch in den zweifelhaftesten Augenblicken. Einer, der nicht zugreift, weil er es gar nicht kann, während die Welt um ihn herum sich auf eine heillose Zukunft vorbereitet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 214
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Mit einem Bein steht er noch im Paradies, dafür hat die Geburtszange gesorgt. Immer ist er ein Kind geblieben und wurde doch stets älter, und leben mußte er auch irgendwie. Nun ist er schon Ende Dreißig und hat seine große Liebe, einen VW-Variant Typ 3, mit dem fährt er zwischen den blühenden Rapsfeldern umher. Es ist das Jahr der ersten Mondlandung, 1969, als man in Frankfurt am Main noch Treppen steigen geht in den Bordellaltbauten um den Bahnhof herum. Ein Tag im Leben Onkel J.s.
»Das Zimmer ist ein Heimatroman, in dem Andreas Maier den Muff in der Idylle auslotet und die Lieblosigkeit spürbar macht, die sie zusammenhält. Dass man den beginnenden Zerfall der Provinz als Leser trotzdem bedauert, ist die große Kunst dieses Schriftstellers.« Der Spiegel
Andreas Maier, geboren 1967 in Bad Nauheim, lebt in Frankfurt am Main. Zuletzt erschienen: Onkel J.Heimatkunde, 2010 (st 4261), Sanssouci. Roman, 2009 (st 4165), Kirillow. Roman, 2005 (st 3778), Ich. Frankfurter Poetikvorlesungen, 2006 (es 2492) und Bullau. Versuch über die Natur, mit Christine Büchner, 2008 (st 3947). Neben zahlreichen weiteren Auszeichnungen erhielt Andreas Maier den Wilhelm-Raabe-Literaturpreis, den Hugo-Ball-Preis, den »aspekte«-Literaturpreis und den Robert-Gernhardt-Preis.
Andreas Maier
Das Zimmer
Roman
Suhrkamp
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2012
Erste Auflage 2012
© Suhrkamp Verlag Berlin 2010
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlag: Göllner, Michels, Zegarzewski
eISBN 978-3-518-75530-3
www.suhrkamp.de
1
Das Zimmer meines Onkels J. liegt im ersten Stock links zur Uhlandstraße hin, direkt gegenüber dem Badezimmer, das mein Onkel wahrscheinlich gar nicht benutzen durfte. Meistens, wenn ich als Kind bei meiner Großmutter war, schlief er, dann stank das ganze Haus. War er weg, das heißt in Frankfurt, Pakete schleppen, blieb der Geruch dennoch. Im Grunde roch das Haus jahrelang nach dem Silagegeruch J.s. Das fing an, als ich acht, neun Jahre alt war. Vorher hatte er sich noch vergleichsweise regelmäßig gewaschen. Bis heute erinnert sich meine Nase jedesmal an J., wenn ich den Keller in der Uhlandstraße betrete, seinen Bezirk. Dort unten hatte man ihm eigens ein Badezimmer eingerichtet, mit Duschkabine und Toilette. Er führte dort eine Kellerexistenz als eingebildeter Handwerker. J. war in einer Steinmetzfamilie aufgewachsen, umgeben von Handwerkern. Der Betrieb hatte etwa dreißig Angestellte und war im drei Kilometer entfernten Friedberg ansässig. Als Jugendlicher war Onkel J. oft dort, man hämmerte und sägte und schnitt und polierte, riesige Lastkräne waren über das gesamte Gelände verstreut, und es gab Techniker, die die Maschinen instand hielten, Arbeiter, die schweißten und frästen, einen Schmied, der die Werkzeuge herstellte, Dinge paßgerecht machte, das faszinierte meinen Onkel, er hielt sich im folgenden selbst für einen Handwerker und begann, sich im Keller in der Uhlandstraße eine Werkstatt einzurichten, freilich nichts anderes als eine Phantasiewerkstatt, eine Scheinwerkstatt. Noch heute hängen dort Schraubenkästen an der Wand, es liegt immer noch diverses Werkzeug herum, auch wenn das allermeiste schon vor zwanzig Jahren weggeräumt wurde, nach seinem Auszug (J. mußte das Haus nach dem Tod seiner Mutter, meiner Großmutter, bei der er zeit ihres Lebens gewohnt hatte, bis über sein sechzigstes Lebensjahr hinaus, verlassen). Ein Spannbock ist noch da, und ich erinnere mich daran, wie J. einstmals in diesen Spannbock, als er noch lebte und noch in der Uhlandstraße wohnte und seine Mutter noch da war und die Welt für ihn in gewisser Weise also noch in Ordnung und nicht völlig beschädigt bzw. zerstört … wie er einstmals dort Schrauben einspannte, mit großer Sorgfalt eine unter mehreren Eisenfeilen auswählte, die Position der Schraube im Spannbock nach einer bestimmten Idee oder einem bestimmten handwerklichen System, das er sich einbildete, noch einmal überprüfte und korrigierte und dann zu feilen begann, wobei ich, das Kind, nie unterlassen konnte zu fragen, wozu er das gerade mache, d. h. zu welchem Zweck er zum Beispiel gerade an der Schraube feile. J. erklärte mir daraufhin mit einer gewissen verzweifelten Wut sämtliche Instrumente, die er gerade verwendete (»der Spannbock ist dazu da, eine Schraube einzuspannen, siehst du, hier öffnet man ihn, so schließt man ihn«), aber auf meine Frage ging er nicht ein, sie schien für ihn nicht zu existieren. Er merkte jedoch, daß etwas nicht stimmte, und das machte ihn wütend. Mit der Zeit begriff er, daß ich ihm sein Feilen an der Schraube nicht glaubte. Da stand er, der damals etwas über vierzigjährige Onkel J., mit mir als Kind im Keller, seinem Bezirk, in der Werkstatt, in der er sein durfte, was er nie war und auch nie hatte werden dürfen, und das Kind fragte nach, und Onkel J. feilte nur mit immer größerer Wut, bis er gänzlich in Gefluche und danach in Sprachlosigkeit verfiel.
Ich weiß, daß es mich immer gruselte, wenn ich den Keller betrat, da ich wußte, er ist, zumindest in Teilen, der Bereich des Onkels. Es gab dort unten auch die Waschküche, es gab den Raum zum Trocknen der Wäsche, den Weinkeller, J.s Werkstatt lag gleich neben dem Trockenraum, und man mußte durch die Werkstatt hindurchlaufen (genaugenommen handelt es sich um einen Raum von sechs oder sieben Quadratmetern), um zu der kühlen Kammer mit dem Wein zu gelangen. Somit war die Werkstatt ein öffentlich passierbarer Raum, anders als J.s Zimmer im ersten Stock. Ich habe J. meistens in der Werkstatt erlebt. Im Wohnzimmer hielt er sich zur damaligen Zeit selten auf, zumindest nicht dann, wenn jemand zugegen war im Haus meiner Großmutter. Die Werkstatt war sein Freizeitvergnügen, vielleicht auch sein Lebenssinn, abgesehen von den Frauen, über die ich nur Vermutungen habe, nur Vermutungen und einige allerdings deutliche Hinweise. Ich muß gestehen, die erste Zeit hielt ich J. tatsächlich für einen Handwerker, für einen Eisenspezialisten. Vielleicht dachte ich anfänglich sogar, er arbeite im Keller irgend etwas, das im Zusammenhang mit der Steinwerkefirma stehe. Später, als ich begriffen hatte, daß J. dort unten rein und ausschließlich »selbständig« arbeitete, ging ich aber immer noch davon aus, daß er tatsächlich etwas mache und irgend etwas schaffe oder zumindest repariere. Es lagen auch kleine Generatoren und Motoren und Schalter herum, und allein weil sie da herumlagen, dachte ich, J. kenne sich mit all diesen Dingen aus und begreife sie. Tatsächlich nahm er diese Gegenstände bloß mit, wenn sie in der Firma weggeworfen wurden, schraubte sie zu Hause auf, stierte hinein und begriff überhaupt nichts, denn er war hauptsächlich, auch wenn man es nicht auf den ersten Blick sah, ein Idiot. Er machte es nicht einmal wie gewisse Phantasiekünstler, die aus verschiedenen Materialien, Teilen und übriggebliebenen, für ganz anderes gedachten Gegenständen Collagen oder seltsame, funktionslose Apparaturen oder Mobiles zusammensetzen, die wenigstens durch ihre Größe oder durch die Anzahl der Einzelteile, aus denen sie bestehen, und durch ihre phantastische Form für ihre Schöpfer etwas Werkhaftes darstellen. Nein, ich glaubte damals bald und bin noch heute der festen Überzeugung, daß es für J. in seiner Werkstatt ausschließlich um eines ging: nämlich in der Welt dort oben, und insbesondere in der Welt des drei Kilometer entfernten Steinmetzbetriebs, dazuzugehören. Dem Bericht meiner Mutter zufolge war mein Onkel J. von seinem Vater, meinem Großvater, nie akzeptiert worden, was auch immer dieses Wort im Hinblick auf meinen Onkel bedeuten mochte. Ich selbst hatte Onkel J. damals ja nicht nur nie akzeptiert, er war vielmehr, so wie er aussah und sich verhielt, das Urbild des Grauens für mich in meiner Kindheit, und auch wenn ich inzwischen begriffen habe, daß mein Onkel ein Mensch war, der stets mit einem Fuß im Paradies geblieben ist, so ist mir trotzdem nach wie vor nur schwer vorstellbar, wie ich damals manchmal eine ganze halbe Stunde mit ihm im Keller verbringen konnte. Wahrscheinlich mußte ich zu ihm in den Keller, wenn meine Großmutter zum Schade & Füllgrabe einkaufen ging oder sich mit einer Freundin traf. Ich kann mich an meine Unruhe dort unten erinnern. Obgleich ich jedesmal inständig hoffte, bald wieder aus dem Keller herauszukommen, betrachtete ich trotzdem immer wieder J.s Feilen und Bohren und Schleifen, war verwundert und fragte am Ende doch wieder nach (es kam mir gar nicht in den Sinn, diese Fragen endlich einmal sein zu lassen). Anschließend ärgerte sich J. immer wütender in sich hinein – er machte währenddessen seltsame Zischlaute und schüttelte einen Schraubenschlüssel oder eine Rohrzange in seiner Hand, als wolle er auf irgend etwas eindreschen und am Ende auf mich – und irgendwann kam die Großmutter und erlöste mich.
Wie ungewöhnlich es war, daß dort unten im Keller ein ganzes Badezimmer für meinen Onkel eingerichtet war, begriff ich damals nicht. Der Ort, die Uhlandstraße, hatte für mich ja keine Geschichte, sondern war für mich, das Kind, schon seit Ewigkeit da (ich empfand mich selbst ja auch als schon immer da). Und weil schon alles immer da war, brauchte es für all das ebensowenig eine Begründung, wie man für die Sonne oder die Schwerkraft eine Begründung braucht. In den ersten Jahren meines Lebens geschahen auch noch zu wenige Veränderungen, um mich auf den Gedanken zu bringen, die Welt, insbesondere was die Menschen angehe, unterliege einem steten Wandel. Ich hatte keine Ahnung davon, wie sie sich von Generation zu Generation änderte. Meine Existenz war damals eine ewige, und ewig war jeder Tag, weil alles festgefügt war. Eine Frage wie »Warum ist da eigentlich im Keller ein ganzes Badezimmer mit Dusche, Wanne und Toilette eingerichtet?« konnte gar nicht aufkommen. Eigentlich verwunderte mich dieses Badezimmer erst, als ich erstmals nach mehr als zwanzig Jahren den Keller in der Uhlandstraße wieder betrat. Wie es aussah! Es war ein einigermaßen hell und vollständig gekachelter Raum im Souterrain, in dessen Bodenmitte sich ein Abfluß befand, ein kleines Fenster auf Kopfhöhe, nirgends Zierat, ich mußte sofort an Gestapokeller denken oder zumindest an Aki-Kaurismäki-Filme. Als Kind, als ich drei, vier Jahre alt war, existierten weder Gestapokeller noch Kaurismäkifilme, sondern eine totale, unveränderliche, unwiderrufliche Welt, in der alles festgefügt war außer mir, der ich mich nämlich durch diese ganze Welt bewegen konnte, wie ich wollte (bzw. sollte), und obgleich diese Welt eigentlich nur aus zwei Häusern bestand, aus meinem Elternhaus und dem Haus in der Uhlandstraße, in das ich viel später, 1999, selbst einziehen würde, als schon alle tot waren, war es dennoch die universalste Welt, die man sich denken kann. Übrigens erweiterte ich diesen Weltkreis im weiteren Verlauf meines Lebens kaum, eigentlich später nur noch um den Begriff Wetterau, und dabei ist es dann auch geblieben, vom Zimmer meines Onkels über den Keller und alles Weitere bis hin zur Wetterau, meiner Heimat. Selbst Rom und alle anderen Städte, in denen ich gelebt habe, sind heute Bestandteil der Welt, die die Wetterau ist.
Meines Erachtens hatte es mein Onkel nicht auf Jungens abgesehen, sonst hätte er irgend etwas mit mir dort unten im Keller gemacht. Vielleicht war er aber auch einfach zu sehr, selbst wie ein Kind, von Ehrfurcht vor seiner eigenen Mutter ergriffen, die ihn bis ins hohe Alter völlig selbstverständlich umsorgte bzw. ertrug. Vielleicht hätte er sich aufgrund dieser Ehrfurcht von allem zurückgehalten. Aber irgendwann mußte er wohl begriffen haben, daß sich an Frauen auszutoben wenigstens normaler war als an anderem (d. h. gesellschaftlich anerkannter und nicht in dem Maße mit Scham und Strafe behaftet). Vielleicht waren auf diese Weise die Frauen für ihn in den Mittelpunkt gerückt, obgleich für alle bis heute noch ein Rätsel ist, wie man sich das genau vorzustellen hatte bei ihm. Blieb deshalb sein Zimmer immer verschlossen? Ich meine »verschlossen« im metaphorischen Sinn, vielleicht schloß er ja nie ab und konnte sich darauf verlassen, daß zumindest jemand wie ich seinen Höllenhort nie betreten würde, auch wenn die Tür gar nicht abgesperrt war. Mit der Großmutter, seiner Mutter, hatte er wohl die unausgesprochene Übereinkunft, daß sie da nicht weiter herumstöbere, damit sie gar nicht erst finden konnte, was sie nicht finden und nicht wissen wollte. Ich selbst weiß nur, daß die Putzfrauen mit ihm Schwierigkeiten hatten (auch so ein Wort: Schwierigkeiten); er näherte sich, wird erzählt, immer von hinten, wenn diese sich bückten, und auch das Tante Lenchen hatte mit ihm Begegnungen dieser Art, obgleich sie zehn Jahre älter war als er und zum Schluß schon über siebzig. Tatsächlich stand er noch im hohen Alter hinter ihr und griff ihr, seinem inneren Wesen folgend und von Gott dafür geschaffen, an den Busen, was allerdings weder zu seinem noch dem Leben Tante Lenchens paßte, es hätte denn in freier Wildbahn stattfinden müssen. Und deshalb gab es natürlich den üblichen Aufruhr, als J. einmal mehr seiner Natur nachkam und dem Tante Lenchen von hinten an die Brüste faßte, als gehörten sie ihm und als habe er ein Anrecht darauf.
Ich habe das Zimmer J.s nie betreten. Wahrscheinlich hat auch das Tante Lenchen dieses Zimmer nie betreten. Ich vermute sogar, daß selbst J.s Mutter dieses Zimmer nur äußerst selten und nur in wirklichen Notfällen betreten hat, denn vielleicht war ja nicht einmal sie wirklich durch die besagte Ehrfurcht geschützt, die J. ihr gegenüber an den Tag legte. Auf seine Mutter ließ er nichts kommen, auf ihren Busen möglicherweise schon, das könnte sein. Und da hat man dann zu Hause so etwas wie einen Ziegenbock als eigenen Sohn, der immer noch bei einem wohnt und bereits ein alter Mann wird, und dennoch springt er herum und auf einen hinauf, wenn auch nur selten. Sein Zimmer war eine Art frühester Darkroom in meinem Bewußtsein. Als Kind war ich zwar oft im Haus meiner Großmutter, zumal nach dem Tod meiner Urgroßmutter Else, die sich hauptsächlich in den ersten Jahren um mich gekümmert hatte, aber von J.s Zimmer habe ich keinerlei Bild vor Augen. Ich weiß nicht, wo das Bett stand, und es muß doch eines gegeben haben, und was sich sonst so im Zimmer befand, weiß ich auch nicht. Ich kann mir dieses Zimmer einfach nicht vorstellen. In den Jahren des Gestanks in es einzutreten wäre die Hölle gewesen. Ich wäre vor Ekel gestorben. Ich hatte nicht einmal Angst davor: Da es völlig unvorstellbar war, dieses Zimmer zu betreten, lag das Vorhandensein dieses Zimmers sozusagen unter meiner Wahrnehmungsschwelle. Es war da und zugleich nicht da. Da J. meistens schlief, muß es fast immer schwarz in dem Zimmer gewesen sein. Heute ist es mein Arbeitszimmer. Immer habe ich Romane in diesem Zimmer geschrieben, aber ich bin bislang nie auf den Gedanken gekommen, über meinen geburtsbehinderten Onkel J. zu schreiben. Über ihn und sein Zimmer. Über das Haus und die Straße. Und über meine Familie. Und unsere Grabsteine. Und die Wetterau, die die ganze Welt ist. Die Wetterau, die für die meisten Menschen nach einer Autobahnraststätte benannt ist, A5, Raststätte Wetterau, und die heute in eine Ortsumgehungsstraße verwandelt wird. Die Wetterau ist eigentlich eine Ortsumgehungsstraße mit angeschlossener Raststätte. Wenn ich das sage, lachen sie. Und es war doch einmal meine Heimat. Meine Heimat, eine Straße. Und nun schreibe ich eine Ortsumgehung, während sie draußen meine Heimat ins Einstmals planieren, und ich beginne mit meinem Onkel in seinem Zimmer. Das ist der Anfang, aus dem sich alles ableitet. Das Zimmer, das Haus, der Ort, die Straße, die Städte, mein Leben, die Familie, die Wetterau und alles Weitere. Mein Onkel, der einzige Mensch ohne Schuld, den ich je kennengelernt habe. Eine Figur am Ausgang aus dem Paradies, noch mit einem Bein darin.
An meinem Onkel nahm man seine Behinderung (er war eine Zangengeburt) nicht sofort wahr. Er konnte sprechen, er sprach zwar nur einfache Sätze, aber das macht die gesamte Wetterau. Er kam bei gewissen Themen ins Reden. J. erzählte stets vom Wald, vom Forsthaus Winterstein, von den Jägern. Er konnte sämtliche Hirschgeweihe aufzählen, die im Jagdhaus Ossenheim an den Wänden hingen. Er kannte sich aus mit den Soundsoviel-Endern. J. trug überdies ständig einen jagdfarbenen Parka. Er erzählte auch mit Begeisterung vom Radio. Wenn etwas im Radio aus einer großen Stadt in Europa übertragen wurde, dann stand er vor der alten Radiotruhe (Telefunken), drehte den Empfangsknopf und kam sich dabei vor wie ein technischer Pionier, denn natürlich ist mein Onkel J. zeit seines Lebens ein Kind geblieben und empfand große Begeisterung für sämtliche technischen Dinge, wie ich nur ganz am Anfang meines Lebens, und auch nie in einem solchen Ausmaß. An Weihnachten suchte er Deutschlandfunk, da waren dann die Glocken des Stephansdoms aus Wien zu hören, und mein Onkel stand noch 1980 so vor dem Radio und den Glocken des Stephansdoms wie andere über zehn Jahre zuvor bereits vor dem Fernseher und der Mondlandung. Er rief dann geradezu andächtig, als müßten wir jetzt alle aufmerksam sein: Die Glocken des Stephansdoms! Tatsächlich taten ihm dann auch alle den Gefallen und hörten hin, aber freilich nur für wenige Sekunden. Mein Onkel stand auch gern vor Baustellen und schaute den Maschinen und den Arbeitern zu. Ins Gespräch mit den Arbeitern kam er nie, obgleich er gern mit ihnen gesprochen und gefachsimpelt hätte, als kenne auch er sich aus. So hatte er es oft in der Firma beobachtet: Zwei oder drei Arbeiter stehen beieinander und tauschen sich in Vokabeln aus, die allesamt etwas mit der Arbeit oder mit den Maschinen oder irgendeinem technischen Vorgang zu tun haben. Auf diese Weise dazuzugehören, das war die Sehnsucht seines Lebens. Als Jugendlicher durfte er kleine Tätigkeiten in der Firma verrichten, heißt es. Ich stelle mir Ablagetätigkeiten oder Botengänge vor. Mir wurde erzählt, mein Großvater habe ihn sogar Lohntüten transportieren lassen. Dennoch soll er ihn, ich weiß aber nicht zu welcher Zeit, mit einem Lederriemen traktiert haben. Mein Großvater Wilhelm, der musische Mensch mit dem Lederriemen. Über meinen Großvater Wilhelm heißt es zuerst immer: so ein musischer Mensch! Er, der letzte musische Mensch in unserer Familie (Klavierspieler, studierter Architekt), dann kam ich, ich gelte auch als musisch. Ja, musische Menschen stellen sie sich so vor wie mich oder meinen Großvater (den ich nicht kannte). Vielleicht gehört für sie der Lederriemen sogar unbedingt dazu, zum musischen Menschen. Mein Onkel war kein musischer Mensch, obgleich er Volksmusiksendungen sehr liebte und vor allem Heino. Heino war ein Mensch, der meinen Onkel glücklich machte, fast so glücklich wie manch andere der liebe Gott. J.s Augen begannen zu leuchten, wenn er Heino hörte, und seine Miene entspannte sich. Meistens hatte mein Onkel eine Grollmiene, er war ja auch meistens schlechter Laune oder stand kurz vor einem cholerischen Anfall, den wir als Kinder besonders gern auslösten, zu unserem eigenen Unglück, aber wenn er vor Baustellen stand oder Heino hörte oder Volksmusiksendungen schaute, die es damals noch nicht so zahlreich gab, dann war er gebannt und aufmerksam, wie in einer anderen Welt, und so ging er auch durch den Wald in seinem Jagdjäckchen. Er ging gebannt und aufmerksam durch den Wald, wie später ich. Onkel J. ist der einzige in der Familie, der Vögel erkennen konnte, das haben wir gemeinsam. Vielleicht wollte er auch hier dazugehören: nicht zu den Waldtieren, aber doch zu denen, die sie bejagen und sich mit ihnen auskennen und schießen dürfen, im Gegensatz zu ihm, der nie schießen durfte. Vielleicht ging J. sogar in den Wald, um dort Ruhe zu haben, vor sich und vor dem, was ihm in der Hose lag, die wohl wie immer ungewaschen war, denn er duschte in späteren Jahren, wie gesagt, nie und behaftete alles binnen kürzester Zeit mit seinem Geruch. Allerdings, wenn ich es recht bedenke, dann kann gar nicht stimmen, was immer erzählt wird. J. muß sich schon gewaschen haben, hin und wieder, auch in späteren Jahren, aber nicht, wenn er von seiner Arbeit am Frankfurter Hauptbahnhof zurückkam, und auch nicht, wenn er sich anschließend nach seinen Nachtschichten ausgeschlafen hatte und in die Küche oder ins Wohnzimmer kam oder gar die Oma mit seinem nazibraunen VW zu uns nach Friedberg fuhr, um unser Haus vollzustinken, nein. Aber nachher muß er sich doch gewaschen haben, nämlich bevor er in den Wald und anschließend in die Wirtschaft ging (oder auch nur in die Wirtschaft).
2
So stelle ich mir einen Tag im Leben meines Onkels J. vor: Gegen morgens um halb fünf läuft er in seinem jägerfarbenen Parka, im Winter mit Mütze, im Sommer ohne, die acht Minuten zum nahegelegenen Bad Nauheimer Bahnhof, der damals zwei Schalterbeamte hatte und in dem die Züge noch stets genau nach Fahrplan fuhren. Kaffee trinkt man aus einer Porzellantasse, und der Kiosk ist noch nicht begehbar, das heißt, ein Pornoheft kann man sich nur anschauen, wenn man es sich vom Kioskbediensteten vorlegen läßt. Kein verschämtes Herumstehen in der Ecke wie heutzutage mit freier Auswahl auf Busen- und Hinternmagazine, Anal und Die Nachbarin, seit langem auch auf Schwanzmagazine, denn die Geschlechter sind inzwischen durcheinandergekommen, auch in den Bahnhofkiosks, obgleich da alles immer zuletzt ankommt. Heute muß man genau wissen, was man will, damals dagegen hatte jemand wie mein Onkel noch eine vergleichsweise geringe Auswahl, die ihm aber gar nicht gering vorkam. Männer hätten ihn verwirrt. Heute wäre das vielleicht anders. Aber dafür ist er gerade noch rechtzeitig gestorben. Damals herrschten vergleichsweise klare Einteilungen. Man lebte die meiste Zeit ein ordentliches Leben, indem man arbeiten ging und Heino hörte oder ein zünftiges Bier in der Wirtschaft oder zu Hause am Kühlschrank trank, und das andere war geheim und fand höchstens am Kiosk statt, an den man zweimal die Woche ging, und es kostete ja auch noch alles Geld und mußte dann versteckt werden. Da war das Heftchen noch die Katharsis für unsere Gottesgeschöpflichkeit, da besah man die Bildchen und lebte damit und davon, und anschließend kehrte man unbeschädigt in den Hort der Gesellschaft und des Arbeitslebens zurück. Es gab noch Sitte, alles andere war in der Ecke. Heute wäre mein Onkel überfordert. Damals hatte er möglicherweise ein gutes geschäftliches Verhältnis zum Kiosk am Bad Nauheimer Bahnhof, überdies rauchte er sehr viel, R6, die kaufte er dort ebenfalls. Vielleicht hatte der Kioskbesitzer schon morgens um halb fünf geöffnet, wegen des Nachtschicht- oder Frühschichtverkehrs. Aber vielleicht war es auch ganz anders, und Onkel J. saß mit seinem Ledertäschchen ordentlich und gewaschen unter Kollegen und gehörte endlich dazu und war auch etwas, ein Pendler mit Arbeit, der etwas zu erzählen hatte, Erzählungen von seiner Arbeit, von seinem Vorgesetzten, seinen Kollegen, Erzählungen von besonders schweren Paketen oder besonders interessanten Lieferungen oder irgendwie außergewöhnlichen Vorkommnissen. Oder sie steckten alle unter einer Decke und sprachen von den Frauen. Vielleicht hatten sie damals schon ganz und gar begriffen, was und wer mein Onkel war, und ließen sich sämtliche Materialien von ihm kaufen und von seinem Lohn bezahlen. Und er kaufte und bezahlte, damit er dazugehörte und sich anerkannt glaubte unter seinen Kollegen morgens um halb fünf Uhr in der Früh in Bad Nauheim in der Wetterau.
Mein Onkel verkehrte ständig in Wirtschaften, und da setzte sich der eine oder andere automatisch auf seine Spur. Mein Onkel, der geburtsbehinderte, prahlte ständig mit seiner Existenz, also mit seiner Bollschen Existenz, seiner Existenz als Boll. Er saß in den Kneipen und erzählte von seinem Vater als großem Firmenchef mit Chauffeur und Hund. Daß er ihn mit dem Lederriemen schlug bzw. vor Zeiten geschlagen hatte, erzählte er natürlich nicht. Was den Vater betraf, kam ihm nie ein schlechtes Wort über die Lippen. Wahrscheinlich hielt J. alles, was passierte, sowieso für normal und für den ganz gewöhnlichen, naturhaften Gang der Welt. J. erzählte von der Firma, den Angestellten, den Löhnen, wahrscheinlich erzählte er auch, wo der Lohn aufbewahrt wurde, wie man am besten auf das Firmengelände gelangte und so weiter. Aber bevor irgendein Friedberger oder Bad Nauheimer auf den Gedanken kam, auf dem Firmengelände an der Usa einzubrechen, nahm man lieber den Weg über meinen Onkel, der für die Familie immer eine offene Stelle war, die offene finanzielle Wunde der Bolls, auch wenn er nur seinen eigenen Lohn ausgab. Die Familie jedoch wollte seinen Lohn natürlich nicht auf diese Weise verschleudert sehen. Man hätte es lieber gehabt, wenn er nicht so häufig in die Bierwirtschaften gegangen wäre.
Morgens am Bahnhof traf er bisweilen auf Gerd Bornträger. Bornträger etwa, stelle ich mir vor, hatte er im sogenannten Köpi kennengelernt, einer Königspilsenerkneipe in Bad Nauheim. Bornträger war natürlich völlig betrunken gewesen, als er die Bekanntschaft meines Onkels gemacht hatte, und hatte sich von ihm gleich ein paar Bier ausgeben lassen und anschließend noch ein paar Schnäpse. So lernte mein Onkel immer die Menschen kennen. Die Betrunkenen in unseren Kneipen in der Wetterau versuchen stets, mit dir zu trinken, Bier und Schnaps, um anschließend einfach das Zahlen zu vergessen oder so zu tun, als hätten sie gerade kein Geld dabei, und wehe, das hat Erfolg. Dann wirst du sie nicht mehr los. Dann laufen sie dir nach, bis vor deine Haustür und am Ende noch mit dir hinein, wenn du nicht vorsichtig bist. Das war bei J. im Köpi nicht nötig, er soff sich selbst so sehr unter den Tisch, daß er gar nicht merkte, daß er wieder einmal für jemanden mitzahlte. Im Grunde zahlte er immer für jemanden mit. Manchmal hing die ganze Wirtschaft an ihm, dann schmiß er zehn Runden am Stück. Natürlich geschah das nur in kleinen Kneipen, wo quasi alle am Tresen sitzen und nicht mehr als acht oder zehn Leute zu bewirten sind bei einer Lokalrunde. Deshalb versuchten sie ihn immer in genau solche Wirtschaften zu locken. Dort gehörte er zwar dazu, aber daß ihm das so hundertprozentig angenehm war, glaube ich nicht. Sonst wäre er nicht immer wieder ins Forsthaus Winterstein und zu den Jägern gegangen, die anständiger waren. Im Forsthaus hätte die Wirtin nie geduldet, daß mein Onkel derart ausgenommen wird. Und er selbst schwärmte am meisten immer vom Forsthaus. Das Forsthaus und der Winterstein waren seine liebsten Orte, abgesehen von seinem Darkroom zu Hause oder den Etablissements in Frankfurt, die aber auf bloßer Vermutung beruhen, auch wenn es gar nicht anders denkbar ist.