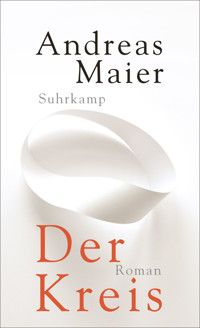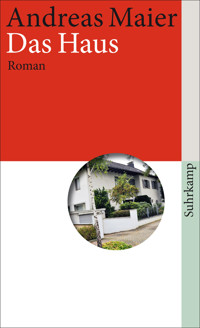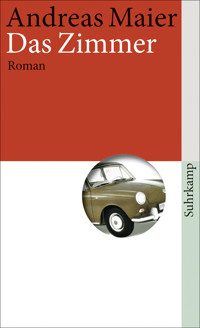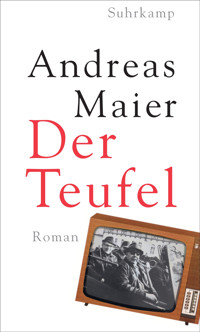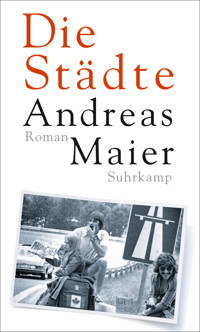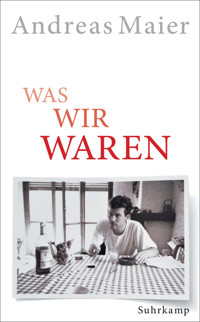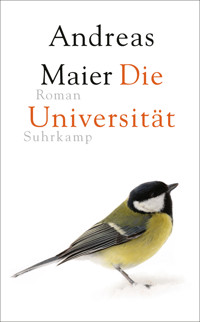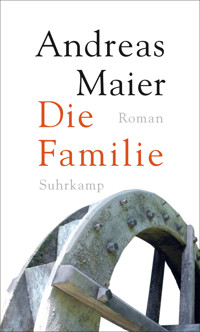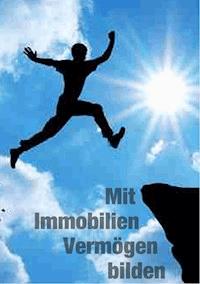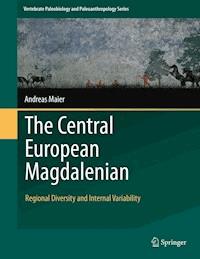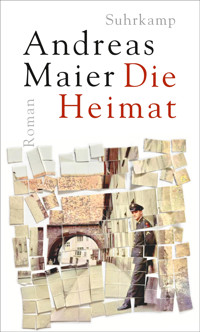
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ortsumgehung
- Sprache: Deutsch
Anfang der siebziger Jahre wirkt der einzige Italiener an der Schule wie ein außerirdisches Wesen. In den Achtzigern sind es die Türken, die zum ersten Mal die Tische vor die Wirtschaft stellen. Während die Wetterauer den ersten Döner im Landkreis als Widerstandsnahrung feiern, erobert der lange verschwundene Hitler den öffentlichen Raum in Funk und Fernsehen. In den Neunzigern träumt der Erzähler seinen großen Traum vom Wetterauer Land, verschwindet allerdings erst mal mit seiner Cousine unter einer Bettdecke am Ostrand der neuen Republik, während im Ort immerhin der Grundriss der 1938 niedergebrannten Synagoge wiederhergestellt wird. Aber noch im neuen Jahrtausend will niemand vom früheren Leben in der konkreten Heimat wissen, als es die noch gab, die es seit ihrer Deportation nicht mehr gab.
Mit untrüglichem Gespür für alles Abgründige erzählt Andreas Maier davon, wie es sich die Menschen gemütlich machen in vierzig Jahren Geschichte. Unbestechlich ist sein Blick auf eine Heimat, die seit jeher Fiktion ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 191
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cover
Titel
Andreas Maier
Die Heimat
Roman
Suhrkamp
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2023
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 5423.
© Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2023
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung und Illustration: Hermann Michels und Regina Göllner, unter Verwendung eines Fotos von Elvis Presley, Bad Nauheim, März 1959
eISBN 978-3-518-77548-6
www.suhrkamp.de
Widmung
Edgar Reitz gewidmet
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Motto
SIEBZIGER
ACHTZIGER
NEUNZIGER
NULLER
Epilog
Informationen zum Buch
Die Heimat
Motto
»Früher ging die Straß von Dorf zu Dorf zu Dorf. Heut geht sie dran vorbei.«
Glasisch (Heimat)
»Wir sind die Kinder der Schweigekinder.«
Buchhändlertochter (Ortsumgehung)
Die Heimat ist an einer Pißrinne geboren. Bei mir steht sie an Stelle Nummer 9. Draußen bauen sie die Ortsumgehung und planieren die Gegenwart in die Vergangenheit. Du schreibst dagegen deine eigene Ortsumgehung. Der Zettel mit den elf Titeln hängt dem Schreibtisch gegenüber an der Wand. Du umgehst im Zimmer deines verstorbenen Onkels noch einmal die Orte deiner Vergangenheit, die verschwinden, und nimmst auf diese Weise Rache an den Planern und Erbauern der B3a. Du setzt der Friedberger Ortsumgehung ein schwarzes Denkmal. Du setzt deiner Heimat ein schwarzes Denkmal. Ein Denkmal in elf Büchern. Heimat ist ein schwarzer Begriff.
Nun steht sie bald vor der »Vollendung«, diese Straße mit ihren Zubringern und Schluchten und Schneisen und Kurven und Kreiseln, die sie überall in die Landschaft geschlagen haben. Bald werden ganz neue Stadtgebiete an ihren Zubringern entstehen, von hier bis Bad Vilbel, und dann werden dort neue Menschen wohnen. Für sie wird alles normal sein und so, als sei es von jeher. Sie werden diese Straße befahren wie jede andere Straße, die sie in ihrem Leben benutzt haben. Sie werden auf dieser Straße nach Frankfurt fahren und um Friedberg nur noch herum. Genau genommen könnten sie die Ortsumgehung Heimat nennen. Die Ortsumgehung, ihr Auto, ihr Eigenheim und ihren Carport. In Friedberg werden sie nur noch schlafen. Sie werden nicht einmal die Bindernagelsche Buchhandlung kennenlernen. Meine Heimatbuchhandlung.
Du selbst mußt dich beeilen, wenn du noch rechtzeitig fertig werden willst. Dafür mußt du noch einmal zurück! An den Anfang der Begriffe.
SIEBZIGER
Das Wort Heimat habe ich in meiner Kindheit in Friedberg und Bad Nauheim selten gehört. Bezogen auf meine Herkunft und die nähere Umgebung wurde es gar nicht benutzt. Selbst mein geburtsbehinderter Onkel J., der Heimatsendungen ebenso wie Volksmusik liebte und in seinem lädierten Kopf voller patriotischer Gefühle war, wurde zwar rührselig, wenn er das Wort »daheim« hörte, womit er sein Zuhause, die Familie, vielleicht seine Kneipen und noch die umliegenden Wälder inklusive Forst- und Jagdhaus meinte. Aber von Heimat sprach er nicht. Es gab keinen Grund dazu.
Heimat wurde fast ausschließlich im Zusammenhang mit anderen, d. h. fremden Menschen verwendet, die zwar in unserer Stadt wohnten, aber nicht von dort stammten.
Damals gab es eine Gruppe Menschen, die zwar zum Stadtbild gehörten, aber dennoch als nicht wirklich zugehörig galten. Sie waren nicht absolut fremd wie die Italiener, Türken oder Rumänen, aber sie wurden eher geduldet als akzeptiert und schon gar nicht als gleichwertige Gesellschaftsmitglieder angesehen. Einige von ihnen wohnten im Karl-Wagner-Haus und hatten dort ein Bett und einen Spind.
Ich rede nicht von den »Seltsamen« bzw. denen, die »anders« waren. Mein Onkel J. etwa war seltsam und anders (so wurde das damals ausgedrückt). Er wurde als Kind stets verprügelt, hatte abstehende Ohren und kam in der Schule nie mit. Oder der Sohn vom Metzger Blum, der immer knatternd auf seinem Mofa herumfuhr, und stets rannte ihm der hauseigene kleine Mischlingshund hinterher. Wenn man über den Sohn vom Metzger Blum sprach, machte man grundsätzlich die wischende Handbewegung vor dem Kopf, um anzuzeigen, daß bei ihm da oben, ebenso wie bei meinem Onkel, etwas nicht stimme.
Bezeichnend, daß mir mein Onkel und der Sohn vom Metzger Blum einfallen, obwohl mir vielmehr eine Gruppe im Sinn lag, die im Gegensatz zu den beiden nichts mit geistigen oder körperlichen Gebrechen zu tun hatte. Aber offenbar wurde auch diesen Menschen ein ähnlicher Rang in der Friedberger Stadtgesellschaft zugewiesen. Man schleppte sie mit durch, tat ihnen zwar keinen Zwang an, aber sie waren das fünfte Rad am Wagen. Es handelte sich um die Heimatvertriebenen.
Natürlich verstand ich noch nicht, warum diese Menschen so eingeordnet wurden, das Wort blieb seltsam fremd im Raum stehen. Einiges war auffällig: Sie trugen schlechtere Kleidung, wirkten aus der Zeit gefallen, ich verbinde sie im nachhinein immer mit Sommer, Hitze und Sonnenlicht. Einen sehe ich vor mir in einem dieser Siebzigersommer, die Luft flirrt in der Stadt, er steht vor unserem Gartenzaun und fragt, ob es Arbeit für ihn gebe. Er trägt einen alten Anzug und legt das Sakko trotz Hitze nicht ab (das tut er erst, wenn er an die Arbeit geht). Alle von ihnen tragen in meiner Erinnerung diese Anzüge, grau, manchmal braun, zerbeult, abgetragen. Und sie haben einen Hut auf, immer den gleichen kleinen speckigen Herrenhut mit winziger Krempe, damals für mich, das Kind, ein untrügliches Zeichen von Armut.
Der Mann machte eine Weile Gartenarbeiten bei uns. Aber nach einigen Wochen wollten meine Eltern ihn nicht mehr beschäftigen. Er könne ihm keine Arbeit geben, sagte mein Vater jetzt, wenn der Mann vor dem Gartenzaun stand. Noch eine Weile kam der Mann trotzdem immer wieder und fragte. Obgleich er kaum hundert Meter von uns in der sogenannten Siedlung wohnte, legte man mir nahe, nicht weiter mit ihm zu sprechen. Später ging das Gerücht, er habe geklaut.
Natürlich war es ein Klischee, mit dem ich aufwuchs. Es war das Flüchtlings- und Ostaussiedler-Klischee. Nur wußte ich das nicht. Dieses Klischee war für meine ersten Lebensjahre noch ganz typisch.
Und es stimmte so auch gar nicht. Es können unmöglich alle Heimatvertriebenen gleich ausgesehen haben. Überdies hatten auch einige alte Friedberger, ich meine also: Eingeborene, dieselbe Erscheinung, die gleichen Anzüge, den gleichen Hut. Heute weiß ich zudem, daß es eine Menge Leute aus dem Osten gab, die überhaupt nicht als solche zu erkennen waren und ein ganz »normales« soziales Leben führten. Das Wort Ostaussiedler wurde aber stets für jene Klischeegruppe der einsamen Männer verwendet, man tuschelte es hinter vorgehaltener Hand. In dem Klischee war der Übergang vom alleinstehenden Heimatvertriebenen zum Tagelöhner und Bittsteller fließend. Daß wir alle in diesen Leuten unsere jüngere Vergangenheit vor uns hatten, davon war für mich nichts zu ahnen, es wurde nicht thematisiert. Geschichte wurde überhaupt nicht thematisiert, zumindest nicht die neuere. Nicht einmal die Geschichte des Grundstücks, auf dem ich aufwuchs, wurde thematisiert. Daß es in der Stadt keinerlei Juden gab, konnte gar nicht auffallen, da niemand darüber sprach. Alles wurde im unklaren gelassen. Wir Kinder wuchsen in völliger Geschichtslosigkeit auf, alle taten so, als sei alles schon immer so gewesen, wie es zu der Zeit, also Anfang der siebziger Jahre, war.
Im Kino hatte man in den Jahren vor meiner Geburt noch hauptsächlich Heimatfilme gesehen. Inzwischen waren sie im Fernsehen angekommen. Die Filme spielten nicht bei uns zu Hause in der Wetterau, sondern meist in bayerischen oder böhmischen Wäldern. Die Guten wirkten in diesen Filmen stets ausgesprochen arisch, die Bösen eher dunkel und verwildert. Von diesen Filmen, die mein Onkel J. liebte, ging eine grenzenlose Langeweile und Ödnis aus.
Noch fremder als die heimatvertriebenen Ostaussiedler waren die »Ausländer«. In meinem Grundschuljahrgang gab es genau zwei Ausländer. Dieses Wort grenzte messerscharf und ohne jeden Zweifel die Entitäten ab. Entweder man war Deutscher (inklusive Ostaussiedler), oder man war Ausländer, etwas anderes gab es nicht, wie bei einem logischen Axiom (tertium non datur). Bei uns war der eine Ausländer ein Junge, der andere ein Mädchen (sprachlich machte man keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern, alles war grundsätzlich männlich).
Mit dem ausländischen Jungen war ich längere Zeit in einer Klasse zusammen. Er sprach Deutsch wie alle anderen, sah aber eindeutig ausländisch aus, war auffällig schwarzhaarig und hatte einen vergleichsweise dunklen Teint, wie die eine Gruppe aus den Heimatfilmen. Seine Eltern sprachen nur gebrochen unsere Sprache. An der Schule gingen sie davon aus, wessen Eltern so radebrechten, der könne nicht besonders beschlagen sein. Die einen Lehrerinnen meinten daher, dem Jungen eine besondere Aufmerksamkeit und Förderung widmen zu müssen, andere hatten eine gewisse Gehemmtheit oder Vorurteile ihm gegenüber. Der einzige Lehrer in unserer Klasse, er unterrichtete im Fach Werken, pflegte einen geradezu glatten, schleimigen, ironischen Umgang mit dem Jungen, als halte er ihn ganz grundlegend für einen kommenden Schwerverbrecher.
Ein anderes Wort für »solche wie ihn« oder »so was wie ihn« war Gastarbeiterkind. Ich wußte nicht einmal, wo in Friedberg mein Klassenkamerad wohnte. Keine Ahnung, ob er Freunde hatte. Auf dem Pausenhof wurde er nicht gemieden, ihn umstrahlte aber eine Aura von Distanz. Er war eben anders als wir. Das bedeutete keine Ablehnung, aber verursachte eine Hemmung, andererseits eine gewisse Übertriebenheit im Umgang mit ihm. Es kostete immer Überwindung und war gleichsam verlockend abenteuerlich, wenn man etwas mit ihm zu tun hatte, ähnlich vielleicht, wie wenn man auf dem Pausenhof zu einem Mädchen hinging, für das man sich interessierte. Irgendetwas prickelte dann, der Boden unter den Füßen wurde weich.
Unser Schulkamerad hatte ein für uns nicht vorstellbares Leben. Fremde Sitten zu Hause sicherlich, eine andere Sprache, ein anderes Verhältnis der Familienmitglieder untereinander, überhaupt ein anderer Begriff von Familie und Gesellschaft. Ob er in Begriffen wie Treue, Stolz, Ehre dachte? Es gab damals einige offensiv deutschtümelnde Jungs auf dem Schulhof, sie waren Berufsschüler, deutlich älter als wir und brachten solche Begriffe ins Pausengespräch: Treue, Stolz, Ehre. Manche trugen in ihren Portemonnaies NPD-Aufkleber. Man klappte das Portemonnaie auf, indem man die eine Seite mit Schwung nach oben warf, woraufhin der Aufkleber sichtbar wurde, eine ähnliche Bewegung, wie man sie aus Fernsehkrimis kannte, wenn der Polizist seinen Ausweis zeigte. Ich konnte mir unter Treue, Stolz, Ehre nichts vorstellen. Ob sie unseren Klassenausländer hin und wieder verprügelten, weiß ich nicht. Die Jüngeren wurden ohnehin regelmäßig verhauen, ich auch, folglich werde ich kaum besonders darauf geachtet haben. Ohne weiteres vorstellbar, daß sie ihn Spießruten laufen ließen und ihn dabei Kanake und dergleichen nannten.
Nahmen wir Alterskameraden nun aber an, jener ausländische Junge stamme aus entferntesten Ländern und handle nach den fremdesten Gepflogenheiten, quasi wie jemand aus Tausendundeiner Nacht? Das ist kaum zu beantworten. Wir hatten sonst nie direkten Kontakt zu »Ausländern« und konnten folglich Fernheit und Fremdheit gar nicht untereinander abwägen. Fremd war alles, was nicht von hier war. Der Junge war übrigens kein Chinese, keiner von hinter den Karpaten und auch kein sagenhafter Mohr oder Inselbewohner. Er war schlichtweg Italiener, aber damit für uns dennoch einfach das insgesamt Fremde und Andere.
Deshalb fiel der zweite Ausländer in unserer Klasse, also das Mädchen, nicht als exotischer auf, obgleich sie aus einem deutlich ferneren Kulturkreis stammte, nämlich aus Bulgarien (oder war es Rumänien?). Sie trug seltsam folkloristisch wirkende Röcke, manchmal eine orientalisch aussehende Pluderhose, dann aber wieder zwar normale, aber völlig abgetragene Alltagskleidung, ärmlicher als bei jedem von uns, verfilzte Pullover und zerschlissene Cordhosen wie von der Altkleidersammlung. Manche glaubten, sie sei ungewaschen, aber das leiteten sie wohl eher aus ihrer Kleidung bzw. deren Abgewetztheit ab. Die Mädchen unserer Klasse hatten wenig Kontakt zu ihr. Sie war so schwarzhaarig, wie wir noch nie jemanden gesehen hatten. Balkenartige Augenbrauen mitsamt Augen, wie wir sie ebenfalls so dunkel nicht kannten. Sie war insgesamt relativ stark behaart und hatte eine ziemlich gelbliche Haut. Ein kleines, sehr schmächtiges, wie ausgezehrtes Wesen. Sie sprach im Vergleich zu dem Italiener wesentlich schlechter Deutsch, anfangs sogar so gut wie gar nicht, und blieb auch nicht lange in unserer Klasse.
Das Mädchen legte uns folgende Assoziation nahe.
Manchmal hieß es damals in der Stadt: »Die Zigeuner kommen.« Das war immer ein Ereignis. Die Leute kampierten dann mit ihrer Wohnwagenburg unter unserem Eisenbahnviadukt, etwa in der Mitte zwischen unserem Haus und dem meiner Urgroßmutter, also quasi direkt unter unseren Augen. Sie kamen unserer Vorstellung nach insgesamt irgendwie »vom Balkan« und wahrscheinlich aus den dortigen vorsintflutlichen Dörfern und Wäldern. Nur die Pferde und Kutschen schienen sie gegen Autos und Wohnwagen oder Bauwagenanhänger vertauscht zu haben. Vor den »Zigeunern« wurde grundlegend gewarnt, damals, etwas mehr als fünfundzwanzig Jahre nach dem Krieg.
Jene Leute (manchmal hießen sie auch fahrendes Volk oder einfach Landstreicher, sonst gab es keine Bezeichnung für sie) waren für uns nicht zu unterscheiden von dem Mädchen in unserer Klasse. Das betraf vor allem das teils Folkloristische und Abgehalfterte der Kleidung, aber auch die völlig fremdländische Gesichtsart und den eigenartigen, exotischen Sprachton.
Ein damals ebenfalls feststehender Begriff war »Zigeunermädchen«. Die hatten keine »Heimat«, die zogen herum, wurden in die Stadt ausgeschickt wie ein Expeditionscorps und sollten dort um Geld, Essen oder mindestens Wasser betteln. Das taten sie auch bei uns, wir wohnten ja nur 150 Meter von ihrem Lagerplatz entfernt.
Kamen die Fahrenden, ging ein Zittern durch unser Viertel. Meine Mutter öffnete grundsätzlich nicht, wenn sie schellten. Angespannt wurde die Situation vor allem, wenn die dreizehn-, vierzehn-, fünfzehn- oder sechzehnjährigen Mädchen am Hoftor klingelten und mein Vater – gegen den Willen meiner Mutter – öffnete und zu den Mädchen hinaustrat. Die jüngeren waren zu zweit, die älteren manchmal allein. Meine Mutter geriet dann in größte Anspannung. Vielleicht stand sie im Türrahmen, um mitzubekommen, was mein Vater mit den Mädchen verhandelte bzw. wie er überhaupt mit ihnen sprach und verkehrte. Mein Vater allein im Hof mit blutjungen, quasi vogelfreien, eigentlich wild geborenen Mädchen, die einfach am Hoftor klingelten! Ein für viele Ehefrauen im Viertel schier unglaubliches und für viele Ehemänner höchst verwirrendes und abenteuerliches Geschehen. Es kam ja sonst nie vor. Ein deutsches Mädchen wäre bei einem solchen Verhalten völlig verloren gewesen. Jene aber waren ja schon von vornherein Gesellschaftsparias! Sie lebten außerhalb jeder Norm. Wie sie sich wohl zu Zucht und Ordnung verhielten? Plötzlich verschwanden die jungen wilden Exotinnen, die am Hoftor geschellt hatten, bei fremden, ordentlichen Familien – plötzlich verschwanden sie mit den Familienvätern in der Garage! Die Mutter, voller Abscheu, steht nach wie vor im Hauseingang und sieht es: Der eigene Gatte entschwindet mit einer Fünfzehn- oder Sechzehnjährigen, jung und gertenschlank und mit langen schwarzen Haaren, aus dem Sichtfeld! In der Garage befindet sich der Wasserhahn, und die Zigeunermädchen wollen Wasser und haben vielleicht einen Kanister dabei. Oder er geht mit dem Mädchen hinter das Haus, dort ist nämlich auch noch ein Wasserhahn, und gerät so völlig aus dem Blick meiner Mutter. Vielleicht stehe ich neben ihr, und sie empört sich und schimpft über die gleichsam illegale Person.
Wahrnehmen konnte ich damals nur, daß die »Zigeunermädchen« als schmutzig, verrucht und gefährlich galten. Daß diese Gefahr aber nicht nur in Richtung Einbruch, Diebstahl oder vielleicht Raubmord ging, sondern auch noch in eine andere, nämlich insofern es die Männer in unserem Viertel betraf, konnte ich damals natürlich nicht ahnen. Keine Vorstellung, was es bedeuten mochte, wenn plötzlich gesellschaftlich anscheinend ungeregelte junge Mädchen vor ihnen standen und etwas von ihnen wollten, schwarzhaarig und dunkeläugig und zeugenlos.
In diese Sphäre gehörte also auch das bulgarische oder rumänische Mädchen in unserer Klasse. Sie wäre zwar zu jung gewesen, um von ihrer Wagenburg aus losgeschickt zu werden in die Höfe der deutschen Familien, sie war damals nicht älter als sieben oder acht Jahre. Zum anderen war sie ja gar keine Zigeunerin, und ihre Familie waren auch keine Zigeuner. Aber konnte man das so klar sagen? Selbst wenn sie, aus welchen Gründen auch immer, eine feste Wohnung hatten, so sagt mir meine Erinnerung, daß mindestens für uns Kinder das kein Kriterium war. Für uns gingen »solche« gleitend in die Menge des »fahrenden Volks« über, Aussehen/Kleidung/fremde Sprache/Haarfarbe, wir trennten das schlichtweg nicht. (Ich wußte ja, wie gesagt, nicht einmal genau, ob das Mädchen aus Bulgarien oder Rumänien stammte.)
Mit dem Mädchen kam es beim Spielen auf dem Pausenhof zu einem Zwischenfall. Eine Zeitlang wurden Huckepack-Kämpfe veranstaltet. Kleinere (meistens Mädchen) sprangen den Größeren auf den Rücken, dann mußten sich die Huckepack-Paare gegenseitig umrempeln. Es hing einem also ständig jemand auf dem Rücken, schlang die Arme um einen, und man selbst mußte Reiterin oder Reiter bei den Oberschenkeln unterhaken, während sich die Person von hinten an einen preßte.
An jenem Tag ging das Spiel wieder einmal los, die Paare strebten gegeneinander, das ausländische Mädchen stand (ebenso wie ich) wie immer abseits und betrachtete die Szenerie. Plötzlich sprang sie an einem Mitschüler hoch und klammerte sich an dessen Hals. Sie preßte ihre abgewetzten Cordhosenbeine, aus denen geringelte Socken hervorkamen, an die Flanken des Jungen. An den Füßen für den Sommer viel zu festes, schadhaftes Schuhwerk.
Das Mädchen war seltsam begeistert und atemlos. So kannte man sie nicht. Normalerweise wagte sie nicht, an solchen Spielen teilzunehmen. Jetzt aber warf sie plötzlich alles von sich. Dabei lachte sie seltsam jubelnd, fast hysterisch, machte reitende Bewegungen auf dem Rücken ihres »Pferdes«, spannte die Oberschenkel an und drückte sich auf und ab, während sie vor Begeisterung keuchte. Alles das passierte binnen wenigen Sekunden.
Dann warf der Junge das Mädchen ab, es knallte auf den Asphaltboden und brach sich dabei den Arm. Das wurde aber zunächst nicht bemerkt. Es gab keinen Auflauf, das Mädchen setzte sich mit Schmerzen in den Unterricht. Ob sie bis zum Ende des Schultages blieb, weiß ich nicht.
Das Mädchen trug danach eine Weile einen Gipsarm. Der Gipsarm, bei anderen normalerweise mit Filzstift-Namenszügen überhäuft, blieb bei ihr fast leer. Sie saß mit ihm dunkel hinter ihrem Tischchen in der äußersten Ecke des Saals, und nach einiger Zeit war sie aus unserer Klasse und von der Schule wieder verschwunden.
Bald darauf verschlug es auch den Italiener nach irgendwohin.
Die einzigen Fremdländischen, die in meinem Grundschuljahrgang jetzt noch Erwähnung fanden, waren die »Orientalen« und »Christenfeinde«, die im Religionsunterricht behandelt wurden. Da ging es allerdings richtig zur Sache.
Der Religionsunterricht war zweigeteilt, einmal für den protestantischen Nachwuchs, der in der Stadt weitaus zahlreicher war, und dann für den katholischen, der sich in einer kläglichen Minderheit befand, darunter ich. Wir wurden von einer Ordensschwester namens Adelheid unterrichtet. Schwester Adelheid war eine der ungewöhnlichsten Erscheinungen meiner Schulzeit. Ich hatte noch nie eine Ordensschwester aus der Nähe gesehen. Es handelte sich um eine für unsere damaligen Begriffe sehr alte Frau. Vor allem aber, und das war das eigentlich Außergewöhnliche an ihr, war sie die mit Sicherheit altmodischste Person meiner jungen Jahre. Gegen sie wirkte selbst meine Großmutter in Bad Nauheim geradezu frisch und modern. Oder erst meine Urgroßmutter! Diese war zweifellos steinalt und hatte Furchen und Falten im Gesicht, aber in ihrem Wesen und Verhalten erschien sie mir geradezu jugendlich. Schwester Adelheid dagegen wirkte wie gepudert in ihrer seltsamen Glatthäutigkeit. Ihr Teint war blaß bis weiß, ganz im Gegensatz zu meiner Urgroßmutter, die regelrecht sonnenverbrannt aussah. Schwester Adelheid trug immer Grau oder Blau, alle Oberteile hatten einen weißen Kragen. Natürlich trug sie – wiederum im Gegensatz zu meiner Urgroßmutter – niemals Hosen.
Mitunter verteilte Schwester Adelheid Strafarbeiten, wenn wir uns unangemessen verhielten. Aber es herrschte doch eher Ruhe in der Klasse, denn ihre Skurrilität machte uns Kinder atemlos. Alles, was sie mit viel zu hoher Stimme und stets deklamierend in ihrer einen Stunde pro Woche darbot, war monströs. Es ging in einem fort um Leiber, Sterben, Tote, um Zeugnisse inbrünstigen Glaubens, um Verklärung und Erlösung (unter der sich natürlich niemand etwas vorstellen konnte, abgesehen von der Erlösung durch die Pausenglocke).
Schwester Adelheid, obgleich eine grundtrockene Person, lieferte ein Maß an Inbrunst, das wir bis dahin nicht erlebt hatten. Kein Vergleich etwa zu unserem Pfarrer während des Gottesdienstes. Bei ihm nahm sich alles theoretisch und irgendwie teilnahmslos aus, sozusagen grau in grau. Bei ihr aber ging es stets ans Eingemachte.
Natürlich wußte ich aus den endlos zähen sonntäglichen Gottesdiensten, daß unser Glaube von Kreuzigung, Tod, Jesu Opfertod für die Menschen, Tod für uns (für mich!) handelte – es war ein Tod, für den ich der Theorie nach ungeheuer dankbar sein sollte und dem gegenüber wir allesamt irgendwie im Schuldzustand waren. Wirklich bildhaft anschaulich wurde uns das aber doch erst von Schwester Adelheid gemacht. Der Kreuzestod zum Beispiel wurde bei ihr mit naturwissenschaftlicher Genauigkeit aufgearbeitet, besonderen Anlaß dazu bot etwa der Speerstoß in die Rippen, worauf Blut austrat und Wasser, und nicht etwa nur Blut. Was aber war das Wasser? Es war das Körperwasser, die Lymphe. Deren Austritt aus der Wunde galt als Beweis für den eingetretenen Tod, quod erat demonstrandum. Die Form der Annagelung Christi war ebenso Lernstoff, also etwa die Position der Füße, übereinandergenagelt, und wo genau an den Händen oder Handgelenken (das weiß ich nicht mehr) die Nägel durchgeschlagen wurden. Die Ordensschwester trug vor, warum der Körper nicht von den Nägeln riß, nämlich weil immer zwischen irgendwelche Knochenspeichen genagelt wurde und so genügend Tragfähigkeit für die Zeit am Kreuz gegeben war. Denn bis zur neunten Stunde mußte der Herr leiden und bekam laut Lehrerin aus Spott auch noch Essig zu trinken, verabreicht mittels eines Schwammes, der auf einen Speer gespießt war (ein Speer wie derjenige mit der Lymphe). Wir mußten den Gekreuzigten zeichnen, um es uns einzuprägen. Der Schwamm war immer gelb, die Lymphe bestand aus durchsichtigen Tropfen, das Blut aus roten.
Ilona, woran ist nun also der Herr Jesus gestorben?
An einem Speerstich.
Nein, Ilona, das hast du nicht begriffen. Er starb durch die Kreuzigung, nicht durch einen Speerstich. Und warum ist der Herr gestorben?
Weil er zu lange am Kreuz hing?
Ilona, noch einmal. Der Herr ist gestorben, damit er wiederauferstehen konnte. Denn wäre er nicht gestorben, hätte er doch gar nicht wiederauferstehen können!
Nachdem aber die Grundlagen des Glaubens solcherart abgehandelt waren, kam es zur eigentlichen Glaubensprüfung. Natürlich lernten wir das Vaterunser und das Glaubensbekenntnis auswendig und mußten es immer wieder aufsagen, aber das war nur eine Überprüfung den Worten nach. Die eigentliche Prüfung war eine andere. Schwester Adelheid schwor uns darauf ein, niemals den Glauben an den Herrn zu verleugnen! Das war ihr allerwichtigstes Anliegen und das eigentliche Fundament ihres Unterrichts. Niemals Verleugnung!
Hier nun kamen die Märtyrertode und damit die Orientalen und die Krummschwerter ins Spiel. Freilich kamen noch Kochtöpfe, Scheiterhaufen, Steine, Fackeln, Räder und Messer dazu, mit den letzteren schnitt man den Menschen allerlei ab, um sie vom Glauben abzubringen. Die Mädchen in der Klasse hatten noch keine Brüste, es wird ihnen vielleicht nicht allzu anschaulich gewesen sein, worum es da mitunter ging.