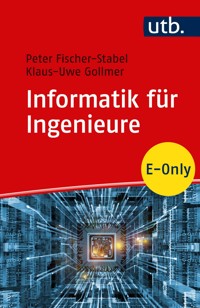28,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: UTB GmbH
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Techniken der Datenvisualisierung werden mittlerweile in allen Disziplinen eingesetzt. Mit ihnen kann einerseits die effiziente Aufbereitung und Analyse einer exponentiell gewachsenen Informationsmenge gewährleistet werden. Andererseits lassen sich so komplexe Informationsinhalte in einem visuellen Umfeld angemessen kommunizieren. Der Autor präsentiert die wesentlichen Felder der Computervisualistik und illustriert diese durch Anwendungsbeispiele: Das Spektrum reicht von elementaren Methoden zur Erstellung von Diagrammen, Infografiken und Kartenwerken, über geometrische Modellierung und Bildbearbeitung, bis hin zur Augmented- und Virtual Reality. Das Buch vermittelt so die Grundlagen der computergestützten Datenvisualisierung. utb+: Begleitend zum Buch steht ein E-Learning-Kurs mit Fragen und Antworten für die Prüfungsvorbereitung zur Verfügung. Erhältlich über utb.de.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 191
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
utb 5028
Eine Arbeitsgemeinschaft der Verlage
Brill | Schöningh – Fink · Paderborn
Brill | Vandenhoeck & Ruprecht · Göttingen – Böhlau · Wien · Köln
Verlag Barbara Budrich · Opladen · Toronto
facultas · Wien
Haupt Verlag · Bern
Verlag Julius Klinkhardt · Bad Heilbrunn
Mohr Siebeck · Tübingen
Narr Francke Attempto Verlag – expert verlag · Tübingen
Psychiatrie Verlag · Köln
Ernst Reinhardt Verlag · München
transcript Verlag · Bielefeld
Verlag Eugen Ulmer · Stuttgart
UVK Verlag · München
Waxmann · Münster · New York
wbv Publikation · Bielefeld
Wochenschau Verlag · Frankfurt am Main
Prof. Dr. Peter Fischer-Stabel ist Professor im Fachbereich Umweltplanung und -technik am Umwelt-Campus der Hochschule Trier und Direktor des Instituts für Softwaresysteme. Lehr- und Forschungsschwerpunkt sind Themen der Umwelt- und Geo-Informatik sowie im Bereich der Visualisierung.
Peter Fischer-Stabel
Datenvisualisierung
Vom Diagramm zur Virtual Reality
Unter Mitarbeit von Jens Schneider
2., überarbeitete und erweiterte Auflage
Umschlagmotiv: © iStockphoto · Vladimir Cetinski
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
1. Auflage 2018
2., überarbeitete und erweiterte Auflage 2024
DOI: https://doi.org/10.36198/9783838561677
© UVK Verlag 2024
– Ein Unternehmen der Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG
Dischingerweg 5 · D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.de
eMail: [email protected]
Einbandgestaltung: siegel konzeption | gestaltung
utb-Nr. 5028
ISBN 978-3-8252-6167-2 (Print)
ISBN 978-3-8385-6167-7 (ePDF)
ISBN 978-3-8463-6167-2 (ePub)
Vorwort
Datenvisualisierungen sind aus unserem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken: In allen Wissenschaftsdisziplinen, aber auch im Alltag treffen wir ständig auf grafische Darstellungen in Form von Diagrammen, Kartenwerken, Bildern, 3D-Modellen etc. die zu lesen und zu verstehen sind. Häufig sind wir auch selbst gefordert, die in umfassenden Datenreihen enthaltenen Sachverhalte grafisch aufzubereiten, um komplexe Informationen in ein visuelles Umfeld zu transportieren und so Informationen angemessen und effektiv kommunizieren zu können.
Die vorlegende Publikation will in ihrer 2. Auflage demzufolge wichtige Felder der Computervisualistik vorstellen, die sich mit der grafischen Aufbereitung von Daten auseinandersetzen. Das Spektrum reicht von elementaren Methoden zur Erstellung von Diagrammen, Infografiken und Kartenwerken über die geometrische Modellierung und Bildbearbeitung bis hin zum Immersive Computing sowie dem Einsatz von Chat Bot´s in der Visualisierung.
Der Schwerpunkt des Buches liegt dabei nicht auf der algorithmischen Beschreibung und Erläuterung von grundlegenden Techniken der grafischen Datenverarbeitung, sondern auf deren Anwendung in der Datenvisualisierung mittels entsprechender Softwaresysteme.
Da der Focus auf einer praxisorientierten Vermittlung des Stoffs liegt, ist das Werk geeignet für Studierende aller Studiengänge, aber auch für Praktiker, die sich in das hochdynamische Feld der grafischen Datenverarbeitung einarbeiten und praxisrelevante Visualisierungstechniken kennenlernen möchten. Weiterführende Literaturhinweise am Ende eines jeden Kapitels ermöglichen, bei Bedarf tiefer in das jeweilige Themenfeld einzutauchen. Begleitende Unterlagen, Übungsaufgaben und Beispieldaten finden sich zudem auf der Web-Seite zu diesem Buch.
Mein Dank gilt an dieser Stelle den Herren Jens Schneider (Beitrag Immersive Computing), Levin Zais und Christian Jiga sowie Frau Sabrina Abler, die über ihre Zuarbeit maßgeblich an der Entstehung dieser Publikation mitgewirkt haben.
Ich wünsche allen Lesern viel Erfolg bei der Beschäftigung mit dem spannenden Thema Datenvisualisierung.
Trier, im Mai 2024
Peter Fischer-Stabel
Hinweise zum Buch
Visualisierung ist ein kommunikativer Prozess: Die Eignung der gewählten Lösung kann am besten ein neutraler Betrachter liefern. Legen Sie Ihr Produkt einem Bekannten vor, der die Lesbarkeit beurteilen soll.
Durch die aufmerksame Lektüre von Grafiken in Tagespresse, von Web-Präsentationen, aber auch durch das Studium von Computerspielen sowie von AR- und VR-Anwendungen gewinnen Sie neue Ideen, die Sie ggf. später für eigene Visualisierungen nutzen können. Lassen sie sich inspirieren.
Mittels selbstständiger Anfertigung von Visualisierungen gleich welcher Sachverhalte und durch das Experimentieren mit alternativen Darstellungsmethoden lernen Sie sukzessive die Gestaltungsmöglichkeiten kennen, die Ihre Visualisierungssoftware bietet.
Die Übungsaufgaben sollten ohne vorherigen Blick in die Musterlösung bearbeitet werden.
Die zitierten Internetquellen wurden – falls nicht gesondert erwähnt – letztmalig am 4.4.2024 aufgerufen. Auf eine individuelle Datumsangabe wurde bei den Quellenangaben demzufolge verzichtet.
Zu diesem Buch gibt es einen ergänzenden eLearning-Kurs aus 100 Fragen.
Mithilfe des Kurses können Sie online überprüfen, inwieweit Sie die Themen des Buches verinnerlicht haben. Gleichzeitig festigt die Wiederholung in Quiz-Form den Lernstoff.
Der eLearning-Kurs kann Ihnen dabei helfen, sich gezielt auf Prüfungssituationen vorzubereiten.
Der eLearning-Kurs ist eng mit vorliegendem Buch verknüpft. Sie finden im Folgenden zu den wichtigen Kapiteln QR-Codes, die Sie direkt zum dazugehörigen Fragenkomplex bringen. Andersherum erhalten Sie innerhalb des eLearning-Kurses am Ende eines Fragendurchlaufs neben der Auswertung der Lernstandskontrolle auch konkrete Hinweise, wo Sie das Thema bei Bedarf genauer nachlesen bzw. vertiefen können. Diese enge Verzahnung von Buch und eLearning-Kurs soll Ihnen dabei helfen, unkompliziert zwischen den Medien zu wechseln, und unterstützt so einen gezielten Lernfortschritt.
Zusatzmaterial.
Begleitend zum Buch stellt der Autor unter
https://files.narr.digital/97825261672/Zusatzmaterial.zip
zusätzliche Materialien zur Verfügung.
Inhalt
Vorwort
Hinweise zum Buch
Abbildungsverzeichnis
1Einführung
1.1Raster- und Vektorgrafik
1.1.1Rastergrafik
1.1.2Vektorgrafik
1.2Anwendungsfelder der Visualisierung
1.3Literatur
2Computervisualistik
2.1Qualität einer Visualisierung
2.2Wahrnehmungskapazitäten des Menschen
2.2.1Visuelle Wahrnehmung und grafische Mindestgrößen
2.2.2Barrierefreiheit
2.3Der Visualisierungsprozess
2.4Datenorganisation
2.5Hinweise zum Visualisierungsdesign
2.6Storytelling mit Daten
2.7Literatur
3Diagrammtechniken
3.1Business-Charts
3.2Heatmaps
3.3Piktogramme
3.4Infografiken
3.5Nützliche Anmerkungen
3.5.1Farbwahl
3.5.2Koordinatensysteme und Achsen
3.6Literatur
4Geovisualisierung und Kartografie
4.1Geodaten
4.2Kartografische Grundlagen
4.2.1Grundsätze guter Kartengrafik
4.3Orts- und Gebietsdiagramm-Karten
4.4Kartogramme
4.4.1Nicht-zusammenhängende Kartogramme
4.4.2Zusammenhängende Kartogramme
4.4.3Dorling-Kartogramm
4.5Extrudierte Karten
4.6Partizipatorisches Mapping
4.7Literatur
5Generative Computergrafik
5.1Geometrische Modellierung
5.1.1Objekte in der Szene
5.2Modellierungsmethoden
5.2.1Kantenmodelle
5.2.2Flächenmodelle
5.2.3Volumenmodelle
5.3Oberflächeneigenschaften
5.4Bildsynthese (Rendering)
5.5Anwendungsbeispiel: 3D-Stadtmodelle
5.5.1Airborne Laser Scanning (ALS)
5.5.2Ableitung eines 3D-Stadtmodells aus ALS-Daten
5.6Photogrammetrie
5.6.1Stereophotogrammetrie
5.6.2Multiview-Photogrammetrie
5.7Haptischer Ausdruck / 3D-Druck
5.8Literatur
6Bildbearbeitung
6.1Datenerfassung Rasterdaten
6.2Workflow der Bildbearbeitung
6.2.1Punktoperatoren
6.2.2Lokale Operatoren / Filterung im Ortsbereich
6.2.3Globale Operatoren
6.3Bildanalyse und Mustererkennung
6.4Bildanalyse am Beispiel von Daten der Fernerkundung
6.4.1Pixelbasierte Klassifikation multispektraler Daten
6.4.2Grundprinzip der Klassifikationsverfahren
6.4.3Überwachte Klassifikation
6.4.4Anwendungsbeispiel: Gletscherschwund im Alpenraum
6.5Weitere ausgewählte Operationen mit Bildern
6.5.1Stitching
6.5.2Mosaicing
6.5.3High Dynamic Range (HDR)-Fotografie
6.5.4Morphing
6.6Weiterführende Literatur
7Immersive Computing
7.1Begriffsklärung
7.2Historische Entwicklung
7.3Anwendungsbeispiele
7.4Erstellung von Anwendungen
7.4.1Technische Aspekte und Entwicklungsframeworks
7.4.2Tracking und Erfassung der Umgebung
7.4.3Gestaltung der Benutzererfahrung
7.4.4Performance-Optimierung
7.4.5Beispiel: Interaktive VR-Historytainment-Anwendung
7.4.6Beispiel: Visualisierung von Flut-Ereignissen mittels VR
7.5Aktuelle Marktübersicht
7.5.1Virtual Reality
7.5.2Augmented Reality
7.5.3Mixed Reality
7.5.4Spatial Computing
7.6Was bringt die Zukunft?
7.7Literatur
8Visualisierung und Manipulation
8.1Stichproben mit systematischem Fehler
8.2Auswirkungen der Wahl des Lokationsmaßes
8.3Manipulation mit Diagrammen
8.4Manipulation mittels Piktogramme
8.5Manipulation mit Karten
8.6Manipulation mittels Bildbearbeitung
8.7Anmerkungen
8.8Weiterführende Literatur
9Chatbots in der Datenvisualisierung
9.1KI-gesteuerte virtuelle Assistenten
9.2Bildgeneratoren (Text-to-Image-Generatoren)
9.3Weiterführende Literatur
Index
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1
Teilgebiete der Grafischen Datenverarbeitung
Abb. 2
Schalenmodell zur Grafischen Datenverarbeitung
Abb. 3
Verlust von Strukturinformation bei der Abbildung von Anwendungsdaten auf die grafische Peripherie
Abb. 4
Beispiel einer 300 (horizontal) x 600 (vertikal) dpi-Bildauflösung
Abb. 5
Beispiel eines Binärbildes
Abb. 6
Beispiel einer Rastergrafik, bei der Höheninformation in den Bildpunkten codiert ist (digitales Geländemodell / Heightmap)
Abb. 7
Histogramm zur Verteilung der Bildpunktausprägung
Abb. 8
SVG-Code zur nachfolgenden Vektorgrafik
Abb. 9
SVG-Vektorgrafik, aufgebaut ausschließlich aus Kreiselementen
Abb. 10
Beispiel zur Datenexploration durch Visualisierung
Abb. 11
Plot der Abweichungen vom langjährigen Mittel mit geglätteter Trendlinie
Abb. 12
Effektive und ausdruckstarke Grafik, die ihr kommunikatives Ziel direkt erreicht
Abb. 13
Elektromagnetisches Spektrum und visuelle Adaption
Abb. 14
Form- und Tiefenwahrnehmung bei unterschiedlicher Beleuchtung
Abb. 15
Die Visualisierungspipeline
Abb. 16
Klimadiagramm für Saarbrücken nach Walter & Lieth
Abb. 17
Beispieltabelle, wie die Datenhaltung nicht gemacht werden sollte.
Abb. 18
Optimierte Tabelle aus obigem Beispiel
Abb. 19
Bevölkerungsgröße ausgewählter Länder, dargestellt mittels Blasendiagramm
Abb. 20
Jahreszeitliche Niederschlagsverteilung ausgewählter Städte
Abb. 21
Verteilung der vorherrschenden Windrichtungen am Umwelt-Campus im Jahre 2022
Abb. 22
Box- & Whiskerplot zur deskriptiven Darstellung der Variabilität von Temperaturverläufen (Monatsmittel)
Abb. 23
Flächengröße und Bevölkerungsdichte der Bundesländer dargestellt als Treemap
Abb. 24
Beispiel eines Gantt-Charts
Abb. 25
Beispiel einer Heatmap. Diskrete Darstellung monatlicher Durchschnittstemperaturen ausgewählter Städte
Abb. 26
Beispiel eines Piktogramms zur Höhe des Stromverbrauchs eines Haushaltes im jahreszeitlichen Verlauf
Abb. 27
Verteilungsdiagramm zur Flächennutzung im Landkreis Birkenfeld
Abb. 28
Beispiel einer einfachen Infografik
Abb. 29
Infografik zu Wasser-Extremereignissen gemessen am Pegel Trier
Abb. 30
Verwendung von Akzentfarben und einer Sortierung nach Größe der Werteausprägung
Abb. 31
Verwendung eines logarithmischen Achsensystems
Abb. 32
Verknüpfung von geometrischer und fachbezogener Information bei Geo-Daten
Abb. 33
Formale und inhaltliche Bestandteile von Karten nach Hake
Abb. 34
Beispiel einer einfachen thematischen Karte
Abb. 35
Beispiel einer Gebietsdiagramm-Karte
Abb. 36
Flächenproportionale (links) bzw. bevölkerungsproportionale Darstellung der Arbeitslosenquote in den verschiedenen Bundesländern
Abb. 37
Kartendarstellung mit extrudierten Geometrien der Landkreise bzw. kreisfreien Städte in Deutschland
Abb. 38
Konstruktion komplexer Objekte aus grafischen Primitiven
Abb. 39
Mögliche Interpretation eines Würfels im Kantenmodell
Abb. 40
Beschreibung eines Würfels im Flächenmodell
Abb. 41
Objektaufbau als Baumstruktur
Abb. 42
Verwaltung des Objektaufbaus in Tabellen
Abb. 43
Voxel-Modell
Abb. 44
Zusammensetzung der Rendering-Pipeline
Abb. 45
Fernerkundungsbasierte Ableitung eines 3D-Geländemodells des Vesuvs
Abb. 46
Funktionsprinzip Airborne Laser Scanning (ALS)
Abb. 47
Signal-Laufzeit in Abhängigkeit von der Oberflächenbedeckung
Abb. 48
Vergleich der Detailstufen im LoD-Konzept (LoD1 – LoD3)
Abb. 49
LoD-2-Modell kombiniert mit LAS-Dachpunktdaten
Abb. 50
Finales Stadtmodell mit Textur und Gebäudeöffnungen
Abb. 51
Zentralperspektivische Abbildung im Luftbild und Parallelprojektion bei der Kartenerstellung
Abb. 52
Smartphone-generiertes Modell der Merten-Säule
Abb. 53
Haptischer Ausdruck der modellierten Reichsburg Trifels
Abb. 54
Nachtaufnahme unter Verwendung einer für das menschliche Auge kaum wahrnehmbaren IR-LED-Ausleuchtung
Abb. 55
Thermografie-Aufnahme zur Visualisierung der Temperaturverteilung an einem Grundofen
Abb. 56
Röntgenaufnahmen einer Pferdezehe
Abb. 57
Ultraschallaufnahme der Blase eines Hundes
Abb. 58
Beispielaufnahme Computertomografie
Abb. 59
Pollen der Ringelblume, Aufnahme durch Rasterelektronenmikroskop
Abb. 60
Zusammenhang zwischen Variation der Tonwertmuster und der Bildinformation
Abb. 61
Bildoperatoren und Umgebungsinformation
Abb. 62
Häufigkeitsverteilung der Grauwerte eines Bildes
Abb. 63
Übliche Nachbarschaften lokaler Operatoren
Abb. 64
Beispiel zur Berechnung eines neuen Pixelwertes durch den Mittelwertoperator
Abb. 65
Bsp. Filteranwendung zur Kantendetektion; links: Ausgangsbild, rechts Ergebnis nach Anwendung des Sobel-Operators
Abb. 66
Prinzipielle Vorgehensweise bei der Mustererkennung
Abb. 67
Historische und rezente Aufnahmen der Stadt Rom
Abb. 68
Workflow der Klassifikation von Fernerkundungsdaten
Abb. 69
Reflexionsverhalten verschiedener Substrate
Abb. 70
Zweidimensionaler (multispektraler) Merkmalsraum
Abb. 71
Zusammenhang zwischen angestrebter Klassenhomogenität, bestmöglicher Klassentrennung und der vollständigen Zuordnung aller Pixel eines Bildes
Abb. 72
Spektrale Antwort ausgewählter Trainingsgebiete im Untersuchungsgebiet
Abb. 73
Ausdehnung Laaser Ferner mittels NDGI
Abb. 74
Dokumentation der Raum-Zeit-Dynamik des Laaser Ferner 1986-2023 als Ergebnis der Bildanalyse von Fernerkundungsdaten
Abb. 75
Landschaftspanorama als (vorläufiges) Ergebnis eines Stitching-Prozesses
Abb. 76
Beispiel Kontrastumfang 10 : 1
Abb. 77
Prinzip der Erzeugung von HDR-Bildern mittels einer LDR-Kamera
Abb. 78
Das Spektrum des Immerse Computings
Abb. 79
The Sword of Damocles VR (1968)
Abb. 80
Augmented Reality Sandbox zur spielerischen Sensibilisierung für Gefahren durch Hochwasserereignisse
Abb. 81
Optisches Tracking am Beispiel des Lighthouse Tracking Systems der HTC Vive
Abb. 82
Teil der Flowgraph-Logik der VR-Historytainment-Anwendung
Abb. 83
Screenshot der VR-Anwendung Moselhochwasser in Trier
Abb. 84
Der Cyberith Virtualizer ELITE 2 als Beispiel für ein omnidirektionales Laufband
Abb. 85
Zugelassene PKW pro 1000 Einwohner in den Landkreisen und kreisfreien Städten Deutschlands im Jahre 2016. Lage von arithmetischem Mittel, Median und Modalwert.
Abb. 86
Entwicklung der Jahresmitteltemperatur in Saarbrücken Variante 1
Abb. 87
Entwicklung der Jahresmitteltemperatur in Saarbrücken Variante 2
Abb. 88
Beispiel einer unterschiedlichen Darstellung des Temperaturanstiegs in Abhängigkeit von der Wahl des Referenzzeitraums
Abb. 89
Unterschiedliche Wahrnehmung von Kreisdiagrammen in Abhängigkeit von der Perspektive
Abb. 90
Nicht-flächenproportionale Darstellung der Entwicklung der Studierendenzahlen am Umwelt-Campus
Abb. 91
Leicht verständliche und flächenproportionale, realistische Darstellung der Entwicklung der Studierendenzahlen am Umwelt-Campus mittels Mengensymbolen
Abb. 92
Bedeutung der Klassenwahl auch bei kartographischen Darstellungen: Zweitstimmenanteil der Partei DIE LINKE bei der Bundestagswahl 2021
Abb. 93
Mittelalterliches Flutereignis in Trier im Stil von Johannes Vermeer
Abb. 94
Monatsbezogene Mittelwerte und extreme Tagesmittel der Lufttemperatur in Saarbrücken-Ensheim
Abb. 95
Infografik als Ergebnis folgender DALL-E Anfrage: „Erzeuge eine Infografik zum Thema Klimawandel“
1Einführung
Die Lernfragen zu diesem Kapitel finden Sie unter: https://narr.kwaest.io/s/1261
Lernziele
Nach der Durcharbeitung dieses Kapitels sollten Sie
die Bedeutung der Begriffe Grafische Datenverarbeitung, Computer Vision und Visual Computing kennen,
die zentralen Anwendungsfelder der grafischen Datenverarbeitung bzw. der Computergrafik benennen können,
die Unterschiede zwischen Vektor- und Rastergrafik kennen,
einen Überblick über die verschiedenen Anwendungsfelder der Datenvisualisierung haben.
Die Computergrafik bietet mittlerweile insbesondere im Bereich der Virtual Reality die Möglichkeit, Präsentationen zu erstellen und virtuelle Räume zu schaffen, in denen der Betrachter sich quasi in der realen Welt zu finden glaubt. Während der Kinofilm Matrix zum Zeitpunkt seiner Erscheinung im Jahre 1999 noch intensive Diskussionen ob der realen Möglichkeiten einer derartigen Immersion stimulierte, finden wir heute bereits eine Vielzahl von High-End-Anwendungen die Realität und Virtualität verschmelzen lassen. Aber auch auf dem Gebiet der „einfachen“ Visualisierung von Datenbeständen oder Sachverhalten bietet die Computergrafik aktuell ein Set an Methoden und Tools, professionelle und ansprechende Präsentationen zu erstellen.
Die Einsatzmöglichkeiten sind dabei fast unbegrenzt: Neben den bekannten traditionellen Anwendungsfeldern in der Informationswirtschaft (z.B. Infografiken in Offline- und Online-Medien) oder z.B. im Bereich Computerspiele nutzen auch Branchen wie z.B. die Regionalplanung, der Städtebau, die Medizin, die Tourismuswirtschaft oder auch Katastrophenmanagement und Umweltmonitoring in großem Umfang Visualisierungstechniken für ihre Zwecke.
Insbesondere raumplanerische Disziplinen sowie Anwendungen im Umweltbereich, zunehmend aber auch cyber-physische Applikationen wie z.B. roomscale VR-Anwendungen, nutzen hierbei Daten verschiedenster Quellen (z.B. Luftbilder, Gelände- und Oberflächenmodelle, Gebäudemodelle, topografische Informationen), um eine möglichst realitätsnahe Arbeits- bzw. Spielumgebung generieren zu können.
Aber auch die exponentiell wachsende Informationsmenge, die mit immer neuen Techniken und Sensoren akquiriert bzw. generiert wird (vgl. Entwicklungen im Bereich des Internets der Dinge IoT), erzwingen eine effiziente Aufbereitung und Analyse dieser Daten durch Mensch und Maschine. Techniken der Datenvisualisierung, als einem Teilbereich des weiten Feldes der Computergrafik, helfen hier den Akteuren der verschiedensten Disziplinen den Informationsgehalt geeignet zu entschlüsseln.
Aufgrund der Leistungssteigerungen in der Mikroelektronik hat sich die Grafische Datenverarbeitung (GDV) zu einem der dynamischsten Gebiete der Informatik entwickelt (z.B. Multi-Media-Anwendungen, Visualisierung, Mixed Reality, …). Sie bietet Verfahren, um Bilder zu produzieren und zu manipulieren, wobei Bilder als besondere Art der Ausgabe von rechnerinternen Darstellungen anzusehen sind.
Definition: Computer Graphics nach ISO82.a: Methods & techniques for converting data to and from graphics displays via Computer.
Im Bereich der Grafischen Datenverarbeitung unterscheiden wir historisch nach Enanacao, Strasser & Klein1 folgende Teilgebiete:
Generative Computergrafik (Bilderzeugung aus Modellen)
Bildverarbeitung (image processing)
Bildanalyse (image analysis)
Abb. 1:Teilgebiete der Grafischen Datenverarbeitung
Neben dem etwas in die Jahre gekommenen Begriff der Grafischen Datenverarbeitung finden heutzutage häufig die Termini „Visual Computing“ sowie „Computer Vision“ Verwendung.
Visual Computing stellt dabei den Oberbegriff für die verschiedenen Informatikdisziplinen dar, die sich mit Bildern, Bildinformationen und auch 3D-Modellen befassen. Entsprechend existiert unter dem Oberbegriff „Visual Computing“ auch die Einteilung in: Bildbearbeitung (e.g. künstlerische Darstellung), Bildverarbeitung (Extraktion von Daten aus Bildern; image processing incl. der Bildanalyse) sowie in die Computergrafik.
Computer Vision (e.g. maschinelles Sehen, Bildverstehen) stellt demgegenüber lediglich einen Teilbereich im weiten Feld des Visual Computing dar. Es beschäftigt sich im Schwerpunkt mit rechnergestützten Lösungen von Fragestellungen, die sich an den Fähigkeiten des menschlichen visuellen Systems orientieren (z.B. Qualitätssicherung, autonomes Fahren, Sicherheitstechnik). Computer Vision stellt demzufolge auch ein Technologiefeld im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) dar, welches ermöglicht, Informationen aus digitalen visuellen Datenbeständen automatisiert zu extrahieren.
Abb. 2:Schalenmodell zur Grafischen Datenverarbeitung
Die Grafische Datenverarbeitung kann man in Anlehnung an Krömker2 auch in Form eines Schalenmodells betrachten (vgl. Abb. 2). Der innere Kern beinhaltet dabei die technologischen Grundlagen der Disziplin, die äußere Schale stellt einen Ausschnitt der vielfältigen Anwendungsdisziplinen dar.
Wie im Titel bereits beschrieben, werden im vorliegenden Werk nicht alle Bereiche der grafischen Datenverarbeitung besprochen. Unser Focus liegt auf der Visualisierung von Daten unterschiedlichster Herkunft. Trotzdem fließen die Ergebnisse aus der Anwendung von Visualisierungstechniken selbstverständlich auch in die benachbarten Disziplinen ein. So sind bspw. Computerspiele oder Anwendungen im Bereich der Virtual Reality (VR) ohne eine vorlaufende geometrische Modellierung der Szenen nicht vorstellbar. Ebenso wenig kommt die Gestaltung von Web-Seiten oder Software-Oberflächen (Bereich HMI) nicht ohne Visualisierungstechniken aus, die automatisierte Objekterkennung nicht ohne eine vorherige geeignete Aufbereitung des Bildmaterials, um nur zwei Gebiete zu benennen.
Das Arbeiten mit grafischer Anwendungssoftware im Rahmen der Produktentwicklung, Simulation etc. erfordert hierbei ebenso ein Grundverständnis von der Bildsynthese, wie die Entwicklung gegenständlicher Produkte unter Verwendung von CAD-Software Grundkenntnisse der geometrischen Modellierung verlangt.
Auch wird durch den stetig steigenden Einsatz unterschiedlichster bildgebender Verfahren (z.B. Digitalfotografie, Thermographie, Sonographie, Rasterelektronenmikroskopie) ein grundlegendes Verständnis vom Aufbau und den Bearbeitungsmöglichkeiten digitalen Bildmaterials erwartet. Aufgrund der großen fachlichen Breite der Computergrafik (z.B. Grafik-Hardware, Psychophysik des visuellen Systems, geometrische und numerische Probleme, physikalische Modellbildung, Licht-Materie-Interaktion, algorithmische Probleme und Optimierungen etc.) können im vorliegenden Werk lediglich einige Grundlagen im Rahmen einer Einführung in die Thematik vermittelt werden. Der Besuch weiterführender Lehrveranstaltungen auf dem Gebiet der Grafischen Datenverarbeitung und der Computergrafik im Rahmen Ihres Studiums wird von den Autoren deshalb mit Nachdruck empfohlen.
1.1Raster- und Vektorgrafik
Das Anzeigen und Bearbeiten von Diagrammen, der Schnitt von Videos oder die Darstellung aufwändiger 3D-Animationen am Monitor erfordern ein hoch leistungsfähiges Grafiksystem, welches die Grafikoperationen quasi in Echtzeit zu verarbeiten und am Monitor darzustellen in der Lage ist. Das grafische System eines Rechnerarbeitsplatzes besteht dabei prinzipiell aus folgender Basiskonfiguration:
Anwendungssystem: Anwendungsproblematik wie Zeichnen, Entwerfen, Gestalten; (z.B. Modellierungssysteme, CAD, GIS, Bildverarbeitung etc.)
Grafiksystem: technische Aspekte wie 2D-, 3D-Darstellung, Interaktion; (z.B. Vulkan, Open GL, DirectX, …)
Grafische Peripherie: z.B. Ausgabe- und Eingabegeräte, die sich in Auflösung, Darstellungsgeschwindigkeit, Qualität, Farbgebung etc. differenzieren.
Grafische Systeme erzeugen dabei Bilder aus grafischen Objekten (Bildkomponenten), wobei diese Objekte mit Eigenschaften versehen sind (Sichtbarkeit, Identifizierbarkeit, Farbe …). Das grafische System definiert letztlich auch die Menge der ausführbaren grafischen Operationen auf diesen Bildkomponenten, wie Erzeugen, Löschen, Transformationen, Namensgebung etc.
Abb. 3:Verlust von Strukturinformation bei der Abbildung von Anwendungsdaten auf die grafische Peripherie
Die Datenstrukturen jeder Systemkomponente werden bei der Visualisierung auf Datenstrukturen des jeweils darunter befindlichen Systems abgebildet (vgl. obige Grafik in Anlehnung an3). Diese Abbildung geht mit einem Verlust an Strukturinformation, ausgehend von der Anwendungssoftware hin zur grafischen Peripherie, einher.
Daten des Anwendungssystems (Anwendungsmodell):
werden nicht nur zur grafischen Darstellung verwendet, sondern vor allem zur Analyse und zum besseren Verständnis von Sachverhalten
die Ableitung von geometrischen bzw. grafischen Daten ist möglich
Jede Datenstruktur des Anwendungssystems muss sich auf niedrigere Strukturen (grafische Objekte) und diese wiederum auf grafische Ausgabeeinheiten abbilden lassen.
Datenstrukturen und Datentypen grafischer Geräte:
Die Abbildung auf ein grafisches Gerät (z.B. Monitor) erfolgt durch Umsetzung des vom grafischen System übernommenen Anwendungsmodells. Dies beinhaltet in der Regel eine Abbildung auf niedrigere Strukturen (z.B. Kreis [funktion] im Anwendungssystem wird auf eine Folge von Bildpunkten des Kreisumfangs am Monitor abgebildet). Die Abbildung von Bildkomponenten (Objekten) des Anwendungsmodells (z.B. CAD-Software) über das grafische System (z.B. OpenGL) auf das grafische Gerät (z.B. Monitor) geht somit ‒ wie oben erwähnt ‒ mit einem Verlust an Strukturinformation der Modelldaten einher.
Unter grafischen Primitiva verstehen wir kleinste und unteilbare grafische Objekte. In Abhängigkeit von den zu verarbeitenden Primitiva kann die Computergrafik unterschieden werden in Vektor- und Rastergrafik.
1.1.1Rastergrafik
Die Anzahl an Bild- bzw. Rasterpunkten je Flächeneinheit definiert die Qualität der Bildauflösung.
Abb. 4:Beispiel einer 300 (horizontal) x 600 (vertikal) dpi-Bildauflösung
Die unterschiedlichen Bildformate enthalten Regelwerke, wie der Bildinhalt in eine Folge von Bytes übersetzt und in einer Datei abgespeichert wird. Ein sehr einfaches Format ist die Bitmap, in der jeder Bildpunkt mit dem gleichen Aufwand gespeichert wird. Als Binärbild enthalten die einzelnen Pixel einer Bitmap entweder den Wert 1 oder 0, d.h. schwarz oder weiß.
Abb. 5:Beispiel eines Binärbildes
Weitere Eigenschaften von Rasterdaten:
Beschreibung der Bildelemente / Objekte erfolgt durch die Ausprägung der Bildpunkte.
Die Bildpunktinformation kann dabei auch Fachinformation codieren, bspw. Höhenwerte (z.B. digitale Geländemodelle), Temperaturangaben (z.B. Thermografie) oder sonstige Messwerte (z.B. Schadstoffdeposition)
Nachbarschaftsinformation (Topologie) ist implizit vorhanden
leicht konvertierbar und wegen impliziter Topologie gut geeignet für Simulation und Modellbildung
Es existiert eine große Vielfalt von Dateiformaten mit Unterschieden in der Datenqualität (z.B. verlustfreie bzw. verlustbehaftete Ablage der Bildinformation), Speicherbedarf, zusätzlicher spezifischer Informationen (z.B. Metadaten, Ebenenkonzepte), Verbreitung etc.
Treppen- und Aliasing-Effekte als Darstellungsproblem z.B. bei Skalierungen
Aus gerätetechnischer Sicht (v.a. Ausgabe) gibt es heute fast nur noch Rastergrafik.
1.1.1.1Beispiel Rastergrafik: Geländemodell / Heightmap
Dass der Bildinhalt unterschiedlich interpretiert werden kann, zeigt nachfolgendes Beispiel. Während die Netzstruktur in Abbildung 6 für den einen Betrachter ein interessantes Kunstwerk darstellen mag, enthält das Bild für andere einfach nur Information über Geländehöhen, die z.B. im Rahmen einer Standortplanung Eingangsdaten für eine Raumanalyse liefern. Da im zweitgenannten Fall eine flächenhafte Datenerfassung im Bild codiert vorliegt, empfiehlt es sich, zur Vermeidung eines Informationsverlustes hier auch Bild-Datenformate zu wählen, die eine verlustfreie Komprimierung erlauben (z.B. TIFF).
Da Bilder wie beschrieben Beobachtern mit verschiedenen Interessen unterschiedliche Informationen liefern, können auch die auf das Bildmaterial angewendeten Operationen und Auswertealgorithmen völlig unterschiedlich sein.
Abb. 6:Beispiel einer Rastergrafik, bei der Höheninformation in den Bildpunkten codiert ist (digitales Geländemodell / Heightmap)