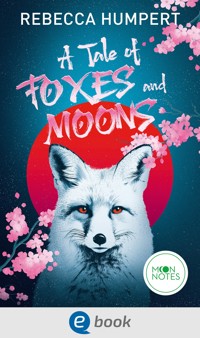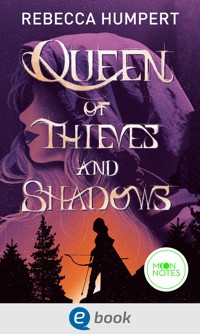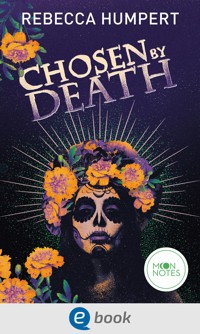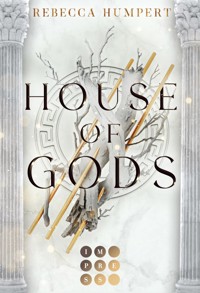7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Cove Story
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ich bin die Blutprinzessin – die Thronerbin und Tochter der gefürchteten Gottestöterin. Aber was, wenn mein Weg ein ganz anderer ist, als der meiner Mutter? Wenn ich mich in den Schützling eines Gottes verliebe? Als Prinzessin des letzten Wikingerstammes lastet eine gewaltige Verantwortung auf meinen Schultern. Ich muss mein Volk um jeden Preis schützen, auch wenn das bedeutet, mein eigenes Herz zu verschließen. Doch unter der eisigen Maske, die ich trage, sehne ich mich nach Freiheit und Liebe, nach dem Ende des Blutvergießens – Gefühle, die in einer Welt wie der meinen, Schwäche bedeuten. Als dieses Geheimnis auffliegt, scheint mein Schicksal besiegelt – ich soll den Mann töten, der mir vor Jahren mein Herz zerriss: Odins Schützling. Aber anstatt mich dem Unmöglichen zu stellen, gehe ich meinen ganz eigenen Weg: Ich schließe einen Pakt mit meinem Feind. Einen Pakt, der uns näherbringt, als ich je erwartet hätte … und der das Schicksal meines Volkes für immer verändern wird. Textauszug: »Du hasst mich«, raunte Fenrir. Seine Lippen waren den meinen so nah, dass ich wahrnahm, wie sie jede einzelne Silbe formten. »Nicht wahr?« Obwohl ich dagegen ankämpfte, wurden meine Lippen mit jedem Atemzug hungriger. Als er nach meinem Kinn griff und es sanft anhob, sandte diese kleine Berührung Feuer durch meine Adern. Göttin verzeih mir, aber das Einzige, was ich in diesem Moment wollte, war er. //»Daughter of Ruin. Götterblut« ist ein in sich abgeschlossener Einzelband.//
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
COVE Story
More than a feeling.
COVE Story ist ein Imprint des Carlsen Verlags und publiziert romantische und fantastische E-Books und Prints. Wenn du süchtig machende Romance- und Romantasyromane deutschsprachiger Autor*innen suchst, ob von Newcomer*innen oder Vielschreiber*innen, wirst du hier garantiert fündig. Jede Cove Story lässt dich durch die Seiten fliegen und ist auf ihre eigene Art und Weise einzigartig.
Jetzt anmelden!
Jetzt Fan werden!
Rebecca Humpert
Daughter of Ruin. Götterblut
Ich bin die Blutprinzessin – die Thronerbin und Tochter der gefürchteten Gottestöterin. Aber was, wenn mein Weg ein ganz anderer ist, als der meiner Mutter? Wenn ich mich in den Schützling eines Gottes verliebe?
Als Prinzessin des letzten Wikingerstammes lastet eine gewaltige Verantwortung auf meinen Schultern. Ich muss mein Volk um jeden Preis schützen, auch wenn das bedeutet, mein eigenes Herz zu verschließen. Doch unter der eisigen Maske, die ich trage, sehne ich mich nach Freiheit und Liebe, nach dem Ende des Blutvergießens – Gefühle, die in einer Welt wie der meinen, Schwäche bedeuten. Als dieses Geheimnis auffliegt, scheint mein Schicksal besiegelt – ich soll den Mann töten, der mir vor Jahren mein Herz zerriss: Odins Schützling. Aber anstatt mich dem Unmöglichen zu stellen, gehe ich meinen ganz eigenen Weg: Ich schließe einen Pakt mit meinem Feind. Einen Pakt, der uns näherbringt, als ich je erwartet hätte … und der das Schicksal meines Volkes für immer verändern wird.
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Vita
© privat
Rebecca Humpert wurde im Jahre 1995 als Tochter eines jordanischen Vaters und einer deutschen Mutter geboren. Nach ihrem Abitur studierte sie Psychologie und arbeitet heute als wissenschaftliche Mitarbeiterin an einer Uni in Baden-Württemberg. Ihren Kindheitstraum, Geschichten erzählen zu dürfen, hat sie bis heute jedoch nicht aufgegeben.
Kapitel1
Die Blutprinzessin vollführte den Todesstoß mit einer Präzision, die mich erschaudern ließ. Die Klinge des kunstvollen Dolches fand mühelos einen Riss im ledernen Brustpanzer ihres Gegners. Keinen Herzschlag später ertönte der Schmerzensschrei des Wikingers, als die königliche Klinge seine Brust durchdrang. Die Prinzessin setzte zum letzten Schlag an und verpasste dem rothaarigen stämmigen Mann einen gekonnten Tritt in die untere Magengegend. Mit einem dumpfen Laut sackte er auf den schneebedeckten Boden, die Klinge immer noch im Riss seines Brustpanzers versenkt.
Einige Atemzüge vergingen in beunruhigender Stille, dann brachen die Wikinger, die sich dicht um mich drängten, in Jubelrufe aus. Der offene runde Platz, in dessen Mitte die Blutduelle der Insel stattfanden und um den sich sichelförmig die Häuser unserer Siedlung aneinanderreihten, war zum Bersten mit grölenden Frauen und Männern gefüllt.
Ich seufzte leise, als die Menge endlich verstummte. Die junge Prinzessin, deren Gesicht bis auf die Augen vollständig unter einem wuchtigen, mit eingravierten Runen verzierten Helm verborgen lag, würde auch bei ihrem nächsten Gegner wie gewohnt kein Erbarmen zeigen. Ihre eleganten, sicheren Bewegungen und der aufrechte Gang ließen keinen Zweifel daran, dass die Blutprinzessin genau das war, wofür ihr Volk sie hielt – eine gnadenlose Kämpferin, die nicht innehielt, bis das Blut ihres Gegenübers an jeder ihrer Waffen klebte und den Schnee unter ihren Füßen tränkte.
»Wie ein Tier«, murmelte einer der Männer, der sich vor wenigen Augenblicken neben mich gedrängt hatte.
Unwillkürlich zog ich meine Kapuze noch ein Stück tiefer in die Stirn, obwohl niemand mir Beachtung schenkte. Für die Umstehenden glich ich, eingehüllt in die nachtschwarze Wolltunika, den grauen Rechteckmantel und die ebenfalls dunkle Kapuze, die mein hastig geflochtenes langes braunes Haar verbarg, einer entehrten Heilerin, einer Völva. Diese erfuhren schon seit Langem keinen Respekt mehr von den Angehörigen unseres Stammes. Und genau das war es, was ich mir während dieser Duelle zunutze machte. So verschmolz ich mit der Menge, ohne dass irgendjemand erkannte, wer ich wirklich war.
»Sie kommt ganz nach der Gottestöterin«, erwiderte nun ein graubärtiger Wikinger, der ein Stück vor mir kniete und gerade dabei war, seine Axt zu schärfen. Ab und an erhob sich der Mann und reckte den Kopf nach oben, um über die Menschenmenge zu spähen. »Aber wen sollte das bei so einer Mutter auch wundern.« Ein kehliges Lachen entschlüpfte seinen schmalen Lippen.
Ich schloss kurz die Augen, atmete tief ein und stieß die Luft geräuschlos aus. Schließlich wagte ich einen erneuten Blick über die Köpfe der Schaulustigen hinweg, von denen ich die meisten trotz meiner flachen Lederstiefel überragte.
Der nächste Mann betrat gerade die runde, mit einfachen Holzpfeilern abgegrenzte Kampffläche. Seine breitschultrige, hochgewachsene Statur verriet, dass dieser selbst für die Prinzessin ein ebenbürtiger Gegner sein würde. Über seine Brust spannte sich ein lederner Brustpanzer, der zweifellos jeder Klinge das Durchdringen verwehren würde. Dazu trug er einen markanten Helm, verziert mit zwei geschwungenen Hörnern. Trotz seiner aufrechten Haltung konnte er das leichte Zittern seiner Gliedmaßen nicht verbergen. Dieses verriet, dass auch er vom Gletscherfieber geschwächt war, das die Insel Bouvetøya seit mehreren Mondzyklen heimsuchte und der Grund für diese Duelle war. Weil man sich so auf spektakuläre Weise der Kranken entledigen wollte, für die es kein Heilmittel gab.
Die Prinzessin ließ den Mann näher treten. Eine andere Wahl blieb ihr nicht, denn sie war lediglich mit ihrem Dolch bewaffnet. Diese Waffe erforderte Nähe, doch gleichzeitig war es jene Nähe, die sie meiden sollte. Denn die Axt, die der Fremde gerade von seinem Rücken zog, besaß eine weitaus größere Reichweite als die königliche Klinge.
»Also stimmt es doch«, murmelte der Mann neben mir, während er sich an seinem struppigen, von Grau durchzogenen Bart kratzte. »Diese Schweine haben ihr verfluchtes Schiff verlassen. Der Bursche da«, er deutete auf den axtschwingenden Hünen, »ist eindeutig ein Berserker.«
»Wahrscheinlich hat ihm einer seiner Götter befohlen, anzutreten«, erwiderte der Mann vor uns, der verliebt seine frisch polierte Axt anstarrte.
Ich musterte den Gegner der Prinzessin noch einmal genauer. Nun glaubte auch ich, die markanten Bewegungen und die selbstsichere Haltung zu erkennen, die den Berserkern zu eigen waren. Gewöhnliche Wikinger, die am Gletscherfieber erkrankt waren, konnten sich meistens kaum auf den Beinen halten. Aber Berserker waren zäher als normale Wikinger. Manche vermuteten, dass sie dies ihrem Schutzgott Odin zu verdanken hatten.
Die Anwesenheit eines Berserkers konnte nur eines bedeuten – das Gletscherfieber hatte ihr Schiff, die Wolfsbrut, erreicht.
Verdammt.
»Mir soll’s recht sein«, knurrte der Graubärtige und unterbrach damit meine dunklen Gedanken. »Sie bringt schließlich alle unsere Männer um. Soll sie das doch stattdessen mit diesen wertlosen Berserkerschweinen tun und uns verschonen.«
Als mein Blick wieder den Gegner der Prinzessin suchte, konnte ich nicht umhin, ihn zu bemitleiden. Auch wenn ich alles andere als gut auf die Berserker zu sprechen war, wollte ich trotzdem nicht, dass sie zu Schaden kamen. Dass irgendein unschuldiger Mann oder eine unschuldige Frau zu Schaden kam, obwohl es seit einigen Wochen Tradition war, den schneebedeckten Boden dieser Insel mit dem Blut unserer Kranken zu tränken. Außerdem brauchten wir die Berserker. Sie versorgten unsere Insel mit Nahrung, seitdem unsere eigenen Ressourcen zur Neige gegangen waren. Ohne sie würden wir alle sterben.
Ich biss die Zähne aufeinander und blendete mein Mitleid für den Berserker aus. Die Prinzessin hatte mittlerweile Distanz zwischen sich und ihren Gegner gebracht. Ein kaum hörbares, animalisches Knurren verließ ihre Lippen, während sie sich umrundeten. Sie glichen zwei ausgehungerten Wölfen, lechzend nach dem Blut des Gegners. Darauf lauernd, dass der andere einen Fehler beging, unvorsichtig wurde. Schließlich tat die Prinzessin etwas, das auf den ersten Blick befremdlich wirkte. Sie täuschte einen Angriff vor, wich nach rechts aus, dann nach links, und zwang den Berserker so zu ruckartigen Bewegungen, um ihre vorgetäuschten Angriffe zu parieren. Zu spät bemerkte der Hüne, dass sich durch die abrupten Bewegungen sein Brustpanzer an der rechten Schulter gelockert hatte. Und genau das war es, was seine Gegnerin nun schamlos ausnutzte. Ihr Dolch flog durch die Luft, zielsicher auf jenes winzige Stückchen Brust gerichtet, das nun nur noch von einer Wolltunika beschützt wurde.
Augenblicklich ging der Mann zu Boden und ehe er sich den Dolch aus dem Fleisch unterhalb seiner Schulter ziehen konnte, stand die Blutprinzessin vor ihm. Ein Tritt ins Gesicht folgte, begleitet von einem ekelhaften, knackenden Geräusch.
In der erneuten Stille, die nun herrschte, hörte ich meinen eigenen viel zu hektischen Herzschlag.
Die Prinzessin wandte sich um und trotz ihres Helmes spürte ich, wie ihr Blick mich suchte und fand. Einen Fuß auf dem Genick des Mannes platziert, legte sie den Kopf leicht schief, dann wartete sie. Und fragte mich wortlos, ob sie ihm das Genick brechen sollte. Etwas in mir wollte nicken, aber schließlich schüttelte ich den Kopf, selbst erschrocken darüber, dass ich gezögert hatte.
Ein Moment verstrich, bevor die Prinzessin ihren Fuß vom Hals des Mannes entfernte, sich bückte und ihren Dolch aus dem reglosen Körper befreite. Sie steckte die Waffe in den schmalen, ledernen Gürtel, der um ihre Hüften geschlungen war, und wandte sich von der Menge ab. Kurz darauf verschwand sie in einer winzigen, aus hellem Kiefernholz erbauten Hütte, in der sie ihre Waffen und ihren Helm ablegen würde. Danach musste sie ein letztes Mal vor das Publikum treten, um sich im Jubel der blutdürstigen Wikinger zu sonnen. Um ihnen zu demonstrieren, dass sie die Prinzessin war, die sie sein musste, um auf der Gletscherinsel bestehen zu können.
Kaum jemand achtete auf mich, als ich mich durch die Menge drängte, die Kapuze tief in die Stirn gezogen, vorbei an schreienden und jubelnden Männern und Frauen, die ihre Prinzessin um eine Zugabe baten. Nur vereinzelt schnappte ich Beschimpfungen auf, die mir galten, aber inzwischen hatte ich mich daran gewöhnt, dass niemand mir in diesem Gewand Respekt zollte, dass niemand mich erkannte.
Ein hochgewachsener Wikinger, der vor der Waffenhütte postiert war, warf mir nur einen flüchtigen Blick zu, bevor er mich passieren ließ. Mittlerweile war allseits bekannt, dass die Prinzessin nach jedem Duell nach der Anwesenheit einer Völva verlangte. Niemand stellte das infrage, noch nicht einmal unser Oberhaupt, die Gottestöterin.
Kaum dass ich im Innern der Hütte verschwunden war und die Anwesenheit der übrigen Wikinger nicht mehr spürte, schob ich meine Kapuze zurück und öffnete mein langes, dunkles Haar. Die kleine Hütte war die einzige der Sichelsiedlung, die nicht bewohnt war und nur zur Vorbereitung der Blutprinzessin auf die Duelle diente. Dementsprechend karg war ihr Inneres. Eine einzelne hölzerne Bank zog sich an der Wand entlang, die der Tür gegenüberlag. Daneben standen ein Eimer mit etwas Wasser zum Waschen und eine kleine Öllampe, die bereits entzündet worden war.
»Gut gemacht«, murmelte ich und begann hastig, meine Kleidung bis auf das Unterkleid abzustreifen. Als ich aufsah, ertappte ich Astrid dabei, wie sie mich mit ihren hellblauen Augen nachdenklich musterte. Noch nicht einmal der kleinste Hauch von Erschöpfung lag in ihren Zügen.
Kurz darauf entledigte sie sich ebenfalls ihrer Kleidung, bestehend aus dem eleganten Helm, einem ledernen Brustpanzer und einer wadenlangen hellbraunen Tunika, und warf sie mir zu. Dann begann sie, ihr eigenes ebenfalls dunkles Haar mit geschickten Fingern zu flechten.
Einen Augenblick lang sah ich sie schweigend an und fragte mich, wie sie es schaffte, dass ihre Haut nach jedem Duelltag beinahe völlig schweißfrei war, während ich allein vom Zusehen in Schweiß gebadet wurde.
Seufzend riss ich mich von dem Gedanken los, schlüpfte in Astrids Kleidung und griff widerwillig nach dem Dolch, der nun in meinem Gürtel steckte. Unterdessen legte Astrid mein Völva-Gewand an. Glücklicherweise ähnelten wir uns von der Statur und dem Alter her sehr, sonst wäre unsere Scharade nicht möglich gewesen. Obwohl Astrid nicht genau wusste, wie alt sie war, weil sie vor vielen Jahren ohne Erinnerungen an unserer Küste angespült worden war, schätzte ich sie – ähnlich wie mich selbst – auf Mitte zwanzig.
Mein Blick fiel wieder auf den Dolch in meinen Händen. Seine Klinge war mit dem Blut von Astrids letztem Gegner überzogen.
Mit wild klopfendem Herzen tauchte ich meine Finger in das Blut und begann, meine Wangen damit zu bestreichen. Mittlerweile brauchte ich keinen Spiegel mehr, um Aegishjalmur zu zeichnen, das Siegessymbol unserer Vorfahren. Seit Beginn der Duelle forderte die Gottestöterin, dass die Prinzessin dieses Symbol mit dem Blut der Besiegten auf ihr Gesicht malte.
Der metallene Gestank, der mich nun einhüllte, würde mich diese Nacht vermutlich wieder einmal vom Schlaf abhalten.
Der Tod klebt an dir, Prinzessin.
»Deine Dreizacke sehen aus, als hätten sie einen Unfall gehabt«, brummte Astrid.
»Du bist die künstlerisch Begabte, nicht ich«, entgegnete ich, den Blick auf meine mit Blut verschmierten Finger gerichtet. Nur wenige Momente zuvor war dieses Blut durch die Adern eines Menschen geflossen, hatte ihn mit Leben erfüllt. Nun klebte es an mir, brandmarkte mich.
Gerade als ich meine Finger ein letztes Mal in das Blut tauchen wollte, spürte ich, dass es begann.
Nicht jetzt. Bitte nicht jetzt.
Der Dolch rutschte aus meinen klebrigen Fingern und landete mit einem dumpfen Geräusch auf dem Boden. Keinen Herzschlag später kniete ich neben ihm, spürte, wie sich meine Kehle quälend langsam zusammenzog, wie die altbekannte Panik wieder von mir Besitz zu ergreifen drohte. Ein pochender Schmerz breitete sich in meinem Magen aus. Haltsuchend schlang ich meine zitternden Arme um meine Körpermitte. Versuchte den Schmerz zu erdrücken, so wie er mich erdrücken wollte.
Einatmen, ausatmen. Etwas, das sonst so selbstverständlich schien, wurde auf einmal zu einer Herausforderung, der ich nicht gewachsen war.
Plötzlich legte sich eine Hand auf meine Schulter. Früher hatte ich mich geschämt, meine Schwäche irgendjemandem zu offenbaren, aber mittlerweile war Astrid genauso vertraut mit ihr wie ich selbst. Sie war die Einzige, die wusste, was ich in mir vergraben hatte. Die verstand, dass manche Wunden nicht verheilten.
Besonders jene, die niemand sehen konnte.
Der Druck auf meiner Schulter verschwand und im nächsten Moment kniete Astrid vor mir. »Atme, Frey.« Sie holte tief Luft, dann stieß sie sie geräuschvoll aus. Diesen Prozess wiederholte sie, bis ich in den Rhythmus ihres Atmens gefunden hatte. Bis wir im Einklang kalte Luft einsogen und ausstießen.
»Geht doch.« Astrid streckte eine Hand aus und wischte mir über die rechte Wange, dann über die linke. Als sie ihre Finger zurückzog, waren sie rot verfärbt.
Erst jetzt merkte ich, dass Tränen in meinen Augenwinkeln brannten.
»Blut gemischt mit königlichen Tränen.« Die Wikingerin säuberte ihre Hände an dem Mantel, den ich vor wenigen Momenten noch getragen hatte, dann hob sie den Dolch auf und begann, die blutigen Symbole auf meinem Gesicht zu erneuern. »Was meinst du, werde ich unsterblich, wenn ich das trinke?«
Ich zwang mich zu einem Lächeln, während ihre rauen Finger über meine Haut fuhren und die acht in einem Kreis angeordneten Dreizacke von Aegishjalmur nachzeichneten. »Unsterblich zu sein klingt nach einer beängstigenden Vorstellung«, murmelte ich. Besonders auf Bouvetøya, wo nur Schnee, Eis und Hunger über unseren Alltag bestimmten.
»Ich wüsste nicht, warum …« Astrid hielt inne, den Blick auf meine verbundene rechte Hand gerichtet.
Verdammt. Sofort versuchte ich sie hinter meinem Rücken zu verstecken, aber Astrid hatte mein Handgelenk bereits gepackt, so fest, dass ich zusammenzuckte. Dann warf sie den Dolch zur Seite und riss die blutgetränkte Bandage von meiner Hand. Zum Vorschein kam zerfetzte, aufgeschnittene Haut, die sich fast über meinen gesamten Handrücken zog.
»Bei den Göttern«, zischte Astrid. Mit einem Mal stahl sich etwas Mörderisches in ihre Augen. Hastig säuberte sie die frische Wunde notdürftig mit etwas Wasser aus einem hölzernen Eimer, der einen Schritt von uns entfernt stand. Sie fragte nicht, woher die Schnittwunde stammte, nicht, wer sie mir zugefügt hatte. Weil sie es schon wusste.
»Ich bringe sie um.« Ein Versprechen lag in Astrids dunkler Stimme. Ein Versprechen, das mir einen Schauer über den Rücken jagte. Denn bisher hatte sie noch keines ihrer Versprechen gebrochen.
Nachdem Astrid meine Hand mit einem sauberen Stück Stoff, das sie von ihrem Mantel abgeschnitten hatte, verbunden hatte, drückte sie mir den Dolch in die Hand und erhob sich.
Schließlich kämpfte auch ich mich zurück auf die Beine. Mein Atem hatte sich beruhigt, das ungute Gefühl in meiner Magengegend war jedoch geblieben.
Als ich aufsah, ertappte ich Astrid dabei, wie sie mich musterte, die dunklen Augenbrauen nachdenklich zusammengezogen.
»Stimmt irgendetwas nicht?«, fragte ich.
»Mit dir?« Ihre harten Züge entspannten sich kaum merklich, dann stieß sie ein leises Lachen aus. »Alles, Frey.« Ohne Vorwarnung trat sie einen Schritt auf mich zu, packte meine Schultern und zog mich an sich.
Erschrocken stolperte ich gegen sie und grub meine Finger zaghaft in ihren Rücken. Auch mehrere Wochen nach dem Beginn der Duelle suchte ich immer noch nach Worten, die gut genug waren, um Astrid zu danken. Die ihr zeigten, dass sie mich davor bewahrte, erneut zu zerbrechen.
Kaum dass sie mich in ihre Arme gezogen hatte, rückte sie schon wieder von mir ab und schenkte mir eine knappe Verbeugung. Mit einem letzten prüfenden Blick auf meine Gesichtsbemalung zerrte sie ihre Kapuze tief in die Stirn und trat hinaus ins Freie, nun als Völva, nicht mehr als angebliche Prinzessin.
Unwillkürlich fuhr meine Hand zu meiner rechten Wange hinauf, bis sie über der blutverschmierten Haut schwebte. Etwas in mir wollte das Rot abkratzen, wollte nicht hinaustreten müssen, getränkt in dem Blut meines Stammes. Aber mir blieb keine andere Wahl.
Schweren Schrittes setzte ich mich in Bewegung, doch als ich ins Freie trat und die Wache passierte, veränderte sich meine Haltung augenblicklich. Ich schlüpfte in die Rolle jener Wikingerin, die man dort draußen sehen wollte. In die Rolle der Prinzessin, die ich einst gewesen war, doch nun nicht mehr sein konnte.
Nicht mehr sein wollte.
Ich straffte die Schultern, hob das Kinn und sah weder nach links noch nach rechts, während ich ins Zentrum der nun leeren Kampffläche schritt. Der abendliche Wind, an guten Tagen nur kühl, an schlechten Tagen wie dem heutigen eisig, ließ das Nass auf meinen Wangen noch kälter wirken. Er mischte sich mit dem ohrenbetäubenden Lärm meines Stammes, mit dem tosenden Geschrei und dem Applaus, den ich nicht verdiente. Trotzdem zwang ich mich zu jenem Lächeln, das ich mir vor Jahren angeeignet hatte. Schon jetzt wusste ich, dass ich später die halbe Nacht damit verbringen würde, das Blut von meiner Haut zu schrubben, mich von dem Geruch des Todes zu befreien, der mich immerzu einhüllte, obwohl ich nicht diejenige war, die dieses Blut vergossen hatte. Vielleicht spielte das auch gar keine Rolle, weil alle, die mir zujubelten, es glaubten. Weil die Blutgier der Gottestöterin niemals versiegen, niemals gestillt sein würde. Das Gletscherfieber hatte ihr einen Grund für diese Duelle gegeben, die Blutprinzessin eine Waffe, die es zu schärfen galt. Nur ahnte die Gottestöterin nicht, dass sie die falsche Klinge schliff.
Mein Blick glitt über die versammelten Frauen und Männer, die beinahe unseren gesamten Stamm ausmachten. Sie waren die letzten Wikinger, die letzten Menschen, durch deren Adern noch der Durst nach Grausamkeit floss, vererbt von unseren Vorfahren. Wer von ihnen würde wohl beim nächsten Duell im Zentrum der Sichelsiedlung stehen? Wen würde das Gletscherfieber als Nächstes unfreiwillig zu Astrids Gegner auserwählen? Ich wusste es nicht. Aber eines wusste ich ganz sicher.
Keiner von ihnen durfte herausfinden, dass ich anders war als sie.
Niemand durfte je erfahren, dass die Tochter der Gottestöterin nicht töten konnte.
Kapitel2
Kaum dass Astrid und ich das Deck der Wolfsbrut betreten hatten, spürte ich, dass sich uns alle Anwesenden zuwandten. Die Maske der stoischen Prinzessin war seit den Duellen vor wenigen Stunden wieder an ihrem Platz. Ich konnte es nicht erwarten, sie zum Einbruch der Nacht endlich abzulegen.
Jetzt jedoch musste ich mich zusammenreißen, auch wenn ich das Gefühl hatte, dass sich eine knöchrige Hand um meine Kehle legte, wann immer ich dieses Schiff betrat. Die Erinnerungen, die an der Wolfsbrut klebten, waren die dunkelsten, die ich besaß. Trotzdem behielt ich meine Maske an Ort und Stelle, weigerte mich, sie loszulassen.
Mein Blick glitt die beiden gigantischen Masten empor, die in den wolkenlosen Himmel ragten, während der Gestank nach Schweiß, gemischt mit dem Duft nach Meerwasser und süßem Met, zu mir herüberwehte. Ich straffte meine Schultern etwas mehr. Ein einzelner Berserker war für Unerfahrene bereits angsteinflößend genug, aber die Mannschaft der Wolfsbrut war noch so viel mehr als das. Jedes Mitglied war größer, stärker und unerschrockener, als mein gesamter Stamm es jemals sein würde. Man erzählte sich zahllose Geschichten über sie. Über die vielen Narben, die sie angeblich bereits seit ihrer Geburt trugen. Über ihr Waffengeschick, ihre melancholischen Lieder, die in nebligen Nächten übers Meer trieben. Über all die Schlachten, in die sie für Odin, den mächtigsten der Götter, gezogen waren.
Ich wusste nicht, welche dieser Geschichten der Wahrheit entsprachen und welche nicht. Ich wusste nur eins: Ich hasste die Berserker mit jeder Faser meines Seins.
Trotzdem musste ich zugeben, dass die Wolfsbrut ein beeindruckendes Kunstwerk war. Das dunkle Holz zierten unzählige Schnitzereien, die von den Legenden der Götterwelt Asgard erzählten. Die Furcht, die mein Stamm vor den Göttern empfand, war der Mannschaft des Berserkerschiffes fremd. Sie hatten dem Göttervater Odin die Treue geschworen. Und dadurch Wikinger und Berserker, die einst Freunde gewesen waren, entzweit. Nun waren sie nichts weiter als unfreiwillige Geschäftspartner, ohne die wir verhungern würden.
Ich unterdrückte ein Seufzen und marschierte mit Astrid weiter über das Oberdeck, bis ich plötzlich eine Hand auf meiner Schulter spürte. Instinktiv griff ich nach meiner kurzen Blutklinge, aber als ich mich umwandte, stand mir nur ein alter Mann gegenüber. Sein schneeweißes Haar reichte ihm bis auf die Schultern. Gekleidet war er in der Tracht der Berserker, die aus hohen schwarzen Stiefeln, einer dunklen langen Hose und einem weißen, locker sitzenden Hemd bestand, über der er einen schwarzen wadenlangen Mantel trug. Ein Blick auf die verschlungenen Runentattoos, die seinen Hals emporrankten, genügte, um zu wissen, wer er war: Fjell, der Berserkerälteste. Die Geschichten über ihn waren in jede Ecke Bouvetøyas vorgedrungen, hatten sich zu Legenden entwickelt. Angeblich hatte die Midgardschlange selbst ihm das Augenlicht geraubt.
»Ein Sturm zieht auf«, sagte Fjell. Seine Stimme war ungewöhnlich tief und rau. »Spürst du ihn auch, Prinzessin?«
»Der Himmel ist klar.« Behutsam löste ich mich aus seinem Griff. »Die Völvas haben uns gutes Wetter versprochen.«
Der Alte hob einen Becher mit einer dampfend heißen Flüssigkeit an seinen Mund, ein amüsiertes Lächeln auf den Lippen. »Ich habe nicht vom Wetter gesprochen.«
Ehe ich mir Gedanken über seine kryptische Äußerung machen konnte, zerrte Astrid mich zu der Ansammlung von Kisten, die nahe dem Eingang zum Unterdeck aufgehäuft waren. Als Assassine der Gottestöterin hatte sie nach dieser und mir den dritthöchsten Rang im Stamm inne. Aber zu diesen Ausflügen begleitete Astrid mich nicht als Assassine, sondern als meine engste Vertraute. Wenn sie in meiner Nähe war, schlug mein Herz ruhiger, war mein Atem gleichmäßiger.
Mein Blick fiel auf die Kisten. Mehrmals pro Mondzyklus belieferten die Berserker uns mit Nahrung. Und seit jeher war es meine Aufgabe, die Lieferung zu begutachten. Andernfalls würde ich dieses Schiff niemals freiwillig betreten.
Ungeduldig riss Astrid den Deckel von der obersten Kiste und spähte hinein.
»Was zum …«
Statt des Getreides, das sonst die Kisten füllte, stapelten sich dort mehrere knallblaue, rechteckige Schachteln. Als ich eine Hand ausstreckte, um eine herauszufischen, spürte ich, wie sich mir jemand von hinten näherte. Kurz darauf ertönte eine dunkle Stimme, von der ich gehofft hatte, sie nie wieder hören zu müssen.
»Sieh an, die Blutprinzessin beehrt uns mit ihrer Anwesenheit.«
Seit Monaten war ich Fenrir, dem Kapitän der Berserker, erfolgreich aus dem Weg gegangen, doch irgendwann musste wohl auch meine Glückssträhne enden. Widerwillig wandte ich mich um.
Fenrir hatte sich verändert. Sein schwarzes Haar war nun lang genug, um es zurückbinden zu können, und der Schatten eines Barts hatte sich auf sein markantes, mit Narben gezeichnetes Gesicht gestohlen. Das Einzige, was sich nicht verändert zu haben schien, war der Hass in seinen dunklen Augen.
Der Berserkerkapitän musterte mich einen Augenblick lang schweigend, dann verneigte er sich vor mir, jede kleinste Bewegung nur so vor Spott triefend.
»Dein mangelnder Respekt wird dir eines Tages zum Verhängnis werden, Captain«, sagte Astrid, einen gefährlichen Unterton in der Stimme.
Fenrir verschränkte die Arme vor der breiten Brust. »Soll das eine Warnung sein?«
»Klingt eher wie ein Versprechen, Cap«, rief jemand hinter mir.
Als ich einen Blick über die Schulter warf, entdeckte ich Johann, der gerade an Deck kam. Fenrirs sehniger Steuermann schenkte Astrid und mir ein breites Grinsen, das keine von uns erwiderte. Sein kurzes hellblondes Haar erschien in der Sonne beinahe weiß.
»Eine Bitte, Freya. Wenn du dich mit Cap duellieren willst, mach das irgendwo anders«, bat mich Johann. »Blutlachen versauen die Planken.«
Astrid baute sich vor ihm auf und wedelte mit einer der blauen Schachteln vor seinem Gesicht herum. »Was soll das sein?«
Der Berserker strahlte. »Pop-Tarts.«
»Pop was?«
»Das sind Kekse mit flüssiger Füllung. Getoastet schmecken sie zwar besser, aber ich bezweifle, dass ihr in eurem Eisparadies Toaster habt.« Johann fischte zwei Schachteln aus der Kiste und hielt sie uns unter die Nase. »Was darf’s sein? Blaubeer- oder Schokofüllung?«
»Wir bezahlen euch dafür, dass ihr uns Nahrung beschafft und keinen Abfall«, knurrte Astrid, den Blick angewidert auf die Packungen gerichtet.
»Das ist Nahrung.«
»Für wen? Verräter? Todgeweihte?«
Ich nahm Johann eine der Packungen aus der Hand, riss sie auf und holte einen von diesen Pop-Tarts heraus. Misstrauisch beäugte ich das rechteckige, süßlich riechende Gebäck, bevor ich es samt Schachtel wieder in die Kiste warf.
»Was ist mit Met? Habt ihr wenigstens den beschaffen können?« Der herrische Ton, den ich mir für die Berserker angewöhnt hatte, fühlte sich auch nach all den Jahren noch fremd auf meiner Zunge an.
»Wir haben etwas Besseres.« Hastig schob Johann den Deckel von einer weiteren Kiste.
»Was meinst du, hört sich seine Stimme nicht etwas heiser an? Vielleicht sollte der Kerl unserer Arena mal einen Besuch abstatten«, raunte Astrid mir zu, während sie Johann finster anstarrte.
Ehe ich antworten konnte, hatte mir Fenrirs Steuermann eine rote metallene Dose mit einem weißen Schriftzug in die Hand gedrückt.
»Das ist kein Met«, bemerkte ich. Manchmal brachten uns die Berserker seltsame Dinge aus dem restlichen Midgard, mit denen wir nichts anfangen konnten. Mittlerweile hatte ich mich daran gewöhnt, aber es änderte nichts an der Tatsache, dass ich mich davor hütete, meinem Stamm irgendetwas von dieser fremdartigen Nahrung vorzusetzen. Die Berserker mochten damit vertraut sein, doch wir waren es nicht.
»Cola ist besser als Met, glaub mir«, erwiderte Johann strahlend.
Wortlos gab ich ihm das seltsame Getränk zurück, dann nickte ich in Richtung der kleinsten Kiste, die Astrid eben geöffnet hatte. Ein kümmerlicher Haufen gefrorener Fleischstücke verbarg sich darin.
»Das ist das einzige Fleisch, das ihr besorgen konntet? Wofür bezahlen wir euch eigentlich?«
»Eure Bezahlung ist miserabel«, knurrte Fenrir, doch ich ignorierte ihn.
Sichtlich widerwillig löste Astrid schließlich den Beutel, in dem sie unsere Silbermünzen bei sich trug, vom Gürtel, dann musterte sie mit ihren wachsamen Augen den Fleischvorrat. »Zwanzig.«
»Sechzig«, entgegnete Fenrir.
»Sechzig? Für das bisschen Fleisch?«
»Vergiss die Pop-Tarts nicht.« Johann zwinkerte uns zu.
»Dreißig, wenn du dieses Zeug wieder verschwinden lässt«, brummte Astrid. »Die grellen Farben tun einem ja in den Augen weh.«
»Vierzig. Wir müssen euer uraltes Silber noch verkaufen, da bleibt nicht viel übrig, glaub mir.«
Nach einer kurzen Diskussion überreichte Astrid Fenrir schließlich eine Handvoll Silbermünzen.
Der Berserker nahm die Münzen an sich und zählte sie durch, während er in Richtung der unteren Decks davonging. Als er mich passierte, blieb er kurz stehen. »Auf ein Wort, Prinzessin.«
Großartig. Das hatte mir gerade noch gefehlt. Astrid und ich wechselten einen schnellen Blick, dann folgten wir Fenrir widerwillig.
»Unter vier Augen«, fügte er hinzu, ohne sich umzudrehen. Im nächsten Moment war er unter Deck verschwunden.
Astrid knurrte irgendetwas Unverständliches. Sie machte keinerlei Anstalten, von meiner Seite zu weichen, bis ich ihr mit einem kurzen Nicken zu verstehen gab, dass es in Ordnung war.
Im Weggehen hörte ich noch, wie Johann versuchte, Astrid die Vorzüge seiner Pop-Tarts näherzubringen.
»Woher weißt du, dass es dir nicht schmeckt, wenn du es nicht wenigstens einmal versuchst?«, beklagte er sich.
»Woher weißt du, dass das Meer eiskalt ist, wenn ich dich nicht wenigstens einmal über Bord werfe?«, konterte Astrid.
Ehe ich Fenrir unter Deck folgte, fiel mein Blick ein letztes Mal auf den Berserkerältesten. Das seltsame Lächeln hatte seine Lippen noch immer nicht verlassen.
Ich wurde das Gefühl nicht los, dass er mehr sah, als er sehen sollte.
***
Fenrirs Kabine war noch genauso eingerichtet, wie ich sie in Erinnerung hatte. An der gegenüberliegenden Wand zog sich ein einfaches Bett entlang. Ein runder, aus dunklem Holz gefertigter Tisch stand unterhalb einer Fensterfront, durch die spärliches Sonnenlicht sickerte. Auf der Tischplatte lag zahlloses Werkzeug für das Metallhandwerk verstreut und hier und da entdeckte ich von Fenrir handgefertigte Kreationen. Halb fertige Klingen, vereinzelte Schmuckstücke. Sein Geschick in diesem Handwerk war das Einzige, was ich noch immer an ihm bewunderte, auch wenn ich es mir nur ungern eingestand.
Ich zwang mich, den Blick von seinem Tisch zu lösen, und begutachtete stattdessen die aus grob gewebtem Stoff bestehende Karte, die beinahe die gesamte Wand von Fenrirs ansonsten karger Kabine bedeckte. Ich trat an sie heran und berührte den winzigen, kaum sichtbaren Fleck, der meine abgelegene Insel kennzeichnete. Meine Heimat war hier, während die Berserker dort draußen zu Hause waren, im restlichen Midgard, das laut Fenrir nichts von der Existenz meines Stammes ahnte. Auf einmal wurde mir bewusst, dass es so viel jenseits der Grenzen Bouvetøyas gab. So viele Landmassen mit seltsamen Namen. So viele unentdeckte Gewässer. Mit meinem Finger zeichnete ich sie nach, einen winzigen Funken Wehmut in der Brust. Mein Vater hatte mir früher, als er noch gelebt hatte, oft von der Außenwelt erzählt. Von sagenumwobenen Städten, farbenprächtigen Landschaften. Mit den Jahren waren seine Geschichten verblichen, bis sie lediglich vage Erinnerungen waren an Orte, die ich niemals mit eigenen Augen sehen würde.
»Du kannst der Gottestöterin ausrichten, dass das die vorletzte Lieferung war«, sagte Fenrir auf einmal. »In vier Tagen kommen wir noch einmal und dann nie wieder.«
Mein Finger hielt mitten in der Bewegung inne. Ich musste mich gerade verhört haben. Sichtlich verwirrt warf ich dem Berserker einen Blick zu, der mittlerweile an seinem Tisch lehnte.
»Einer meiner Männer ist tot«, fuhr er fort. »Du glaubst nicht wirklich, dass ich das Risiko eingehe, noch mehr zu verlieren.«
Verdammt, das konnte nicht wahr sein. So ungern ich es auch zugab, waren wir auf die Wolfsbrut angewiesen. In mehr als nur einer Angelegenheit.
»Ihr müsst Bouvetøya verlassen«, fügte Fenrir hinzu, als ich schwieg. »Das Fieber hat etwas mit dieser götterverlassenen Insel zu tun.«
Bitter dachte ich an die unzähligen Male zurück, die ich schon versucht hatte, die Gottestöterin zum Gehen zu bewegen, aber jedes Mal war ich gescheitert. Sie wollte nicht, dass wir die Insel verließen. Weil sie anscheinend der festen Überzeugung war, dass wir nur hier vor der Außenwelt sicher waren. Dass wir nur hier überleben konnten, obwohl unser Stamm doch schon längst im Sterben lag und keine eigenen Ressourcen mehr besaß.
»Das können wir nicht«, antwortete ich schließlich.
»Dann werdet ihr hier verrotten, Prinzessin.«
Ich wandte mich erneut der Karte zu, musterte die eingezeichneten Routen der Berserker, die sie bereits mit der Wolfsbrut befahren hatten. Währenddessen rasten meine Gedanken durcheinander. Wenn die Berserker uns nicht mehr belieferten, würde das unser sicheres Todesurteil bedeuten.
»Grausame Worte, Captain«, erwiderte ich, ohne Fenrir anzusehen. »Aber etwas anderes ist man von euch Berserkern ja nicht gewohnt.«
Plötzlich hörte ich Schritte hinter mir und ehe ich wusste, was geschah, hatte Fenrir mich an den Schultern gepackt, umgedreht und gegen die Karte gepresst. Seine Finger gruben sich schmerzhaft in mein Fleisch. Instinktiv schnellte meine Hand zu meinem Gürtel und befreite meinen Dolch, der sich keinen Herzschlag später an Fenrirs Kehle presste.
»Erzähl mir nichts von Grausamkeit, Prinzessin.« Sein dunkler Blick fuhr zu meiner Blutklinge. »Wir wissen beide, dass das deine Spezialität ist.« Er trat einen Schritt nach vorn, forderte mich auf, die Klinge tiefer in seine Haut zu drücken.
Und ich gehorchte.
»Ich hasse dich«, zischte ich.
Fenrir stieß ein freudloses Lachen aus. »Das beruht auf Gegenseitigkeit, glaub mir.« Er musterte die Karte über meinen Kopf hinweg, dann verhärteten sich seine Züge, bevor sein Blick erneut den meinen fand.
»Heimdall ist verschwunden.« Seine Stimme war einen Hauch dunkler als zuvor. »Er bewacht den Eingang nach Asgard nicht mehr.« Fenrirs Finger gruben sich tiefer in meine Schultern. Als Antwort darauf presste ich meine Klinge stärker gegen seinen Hals. »Hast du etwas damit zu tun, Prinzessin?«
»Ich verkehre nicht mit Göttern«, knurrte ich. Mein Stamm hatte sich noch vor meiner Geburt von den Göttern Asgards abgewandt, beginnend mit dem Tod Lokis.
»Natürlich nicht.« Fenrirs Mundwinkel hoben sich zu einem abfälligen Lächeln, das ich ihm am liebsten aus dem Gesicht schneiden würde. »Ich habe vergessen, dass du deine kostbare Zeit nur für wehrlose Kranke opferst.« Er beugte sich zu mir hinunter, bis wir auf Augenhöhe waren und ich seinen heißen Atem auf meinen Wangen spürte.
Unwillkürlich suchte ich nach jener Narbe, die ich ihm einst zugefügt hatte. Sie zog sich einmal quer über seinen Hals, etwas unterhalb meiner Klinge. Es war die längste Narbe, die er besaß.
»Hast du ihn wenigstens schnell und schmerzlos getötet?«, fragte Fenrir leise. »Bei deinem letzten Blutduell.«
Keiner der Berserker ahnte etwas von meiner und Astrids Täuschung. Alle auf diesem Schiff glaubten, dass tatsächlich ich diejenige war, die in den Duellen antrat. Die Tatsache, dass ich selbst Fenrir, der mich seit meiner Kindheit kannte, täuschen konnte, erfüllte mich mit Genugtuung.
»Habt ihr noch mehr Kranke?«, wollte ich wissen, ohne auf seine Frage einzugehen.
»Jarl ist der Einzige.« Fenrir hielt inne und sah zur Seite. »War der Einzige.«
Astrids letzter Gegner stahl sich vor mein inneres Auge, seine aufrechte Haltung, sein kunstvoll geschmiedeter Helm, der ihn doch nicht hatte beschützen können.
Ein gequälter Ausdruck stahl sich in Fenrirs Gesicht, als er mich wieder ansah. »Vielleicht wäre ich als Nächster dran, wenn wir nicht in vier Tagen ein letztes Mal diese verdammte Insel ansteuern würden.«
»Das bezweifle ich.« Ich hob meine freie Hand und berührte die Narbe an seinem Hals, ein kaltes Lächeln auf den Lippen. »So viel Glück habe ich nicht.«
Der Blick des Berserkers war meiner Hand gefolgt. Vermutlich glaubte er, dass der Verband um meinen Handrücken von einer Wunde herrührte, die ich mir im Kampf mit einem der Männer zugezogen hatte. Vielleicht mit Jarl.
Fenrirs Griff um meine Schultern lockerte sich, dann ließ er von mir ab und trat einen Schritt zurück. »Wir müssen keine Feinde sein, Prinzessin.«
Ich stieß ein ungläubiges Lachen aus, das von den Wänden seiner Kabine widerhallte. »Dafür ist es längst zu spät, Captain.«
In Fenrirs Augen spiegelte sich mein eigener Hass wider. Ein Hass, der über die Jahre nicht erloschen, sondern hungriger geworden war. Irgendwann würde er uns beide verschlingen.
Plötzlich ertönte ein hektisches Klopfen an der Tür, dann wurde sie aufgerissen und Johann stürmte herein. »Cap?«
»Was willst du, Johann?« Fenrirs Blick ließ mich nicht los. Schließlich war ich diejenige, die sich abwandte.
»Astrid droht, unsere ganzen Pop-Tarts in Brand zu stecken, wenn wir ihnen nicht mehr Fleisch für ihre Silbermünzen geben. Darf ich sie über Bord werf– oh, hey, Prinzessin. Du bist auch noch hier.«
Wortlos drängte ich mich an Fenrir vorbei, während Johann hastig zurückwich.
»Ich kannte einmal eine Frau, die mich niemals mit einer Klinge bedroht hätte«, rief Fenrir mir hinterher. »Was ist mit ihr passiert?«
Meine Hand verharrte einen Moment lang an der Tür, ehe ich sie öffnete. Dann rückte ich die Maske der grausamen Blutprinzessin zurecht und vergewisserte mich, dass diese Lüge alles war, was die Berserker je von mir sehen würden.
Was Fenrir je von mir sehen würde.
»Sie ist tot, Captain.«
Kapitel3
Ein beißender Schmerz brannte sich in meine Haut und betäubte für den Bruchteil eines Moments den Hass in meinem Innern. Doch kurz darauf entflammte er erneut, lodernder als zuvor.
»Tut es weh?« Die Stimme der Gottestöterin war sanft, als sie zaghaft über meinen rechten, blutigen Handrücken strich. Der Geste wohnte eine Fürsorge inne, die sie nicht besaß, nie besessen hatte.
Ich wusste, dass sie keine Antwort erwartete, deshalb blieb ich still. Früher war ich in Tränen ausgebrochen, wann immer die Gottestöterin meinen Arm gepackt und die Spitze ihres Holzpflocks durch die zarte Kinderhaut gebohrt hatte. Jenes Pflocks namens Daudi, gefertigt aus dem Holz der Weltenesche Yggdrasil, mit dem meine Mutter den Gott Loki einst getötet hatte. Denn nur das Holz der Weltenesche vermochte es, ein unsterbliches Leben zu beenden. Und nun war ich diejenige, die mit ihrem Pflock gequält wurde, auch wenn es mittlerweile keine Tränen mehr gab, kein Flehen, kein Hoffen auf ein Ende dieser Bestrafung. Eine Strafe für meinen Ungehorsam, weil ich mich nach wie vor weigerte, das zu tun, was sie von mir verlangte. Weil ich mich weigerte, den Pflock anzunehmen und einen Gott zu töten, so wie sie es einst getan hatte.
»Du weißt, dass das jederzeit das letzte Mal sein könnte«, flüsterte meine Mutter in mein Ohr, während sie neben mir stand. »Beende sein Leben und das hier wird vorbei sein.« Ihre schlanken Finger fuhren über meinen blutverschmierten Handrücken, zeichneten verschlungene Runen auf meine nackte Haut, deren Bedeutung nur sie kannte. »Es macht mir keinen Spaß, dich zu verletzen.«
Mit zusammengebissenen Zähnen starrte ich ins Feuer, das in der Mitte der Kammer loderte, in der die Gottestöterin zu Hause war. Ich ertappte mich dabei, wie ich den Rauch beneidete, der durch eine Öffnung im Dach fliehen konnte. Ich würde alles dafür geben, es ihm gleichzutun.
Die Finger meiner Mutter verharrten weiterhin genau dort, wo eben noch die Spitze von Daudi durch meine Haut gedrungen war. Langsam, beinahe andächtig begann sie, ihre Fingernägel tiefer in das blutige Fleisch zu drücken. Ich presste die Lippen aufeinander, weigerte mich, nachzugeben, egal, wie tief sie mich verletzen würde. Ganz gleich, welche Bestrafung noch auf mich wartete. Ich kannte sie alle, hatte jede einzelne von ihnen schon mindestens einmal über mich ergehen lassen. Und ich würde es wieder tun. Schließlich war ich eine Wikingerin. Und wenn wir eines gut konnten, dann war es, zu überleben.
»Ich lasse dir eine Wahl.« Ein letzter schmerzhafter Druck auf meinen Handrücken folgte ihren fadenscheinigen Worten, dann ließ sie mich los. »Ich lasse dir immer eine Wahl, Tochter.«
Unwillkürlich huschte mein Blick zu dem bewegungslosen, an Handgelenken und Fußknöcheln gefesselten Gott, der auf einer der hölzernen Bänke lag, die sich an den Wänden entlangzogen. Die Gottestöterin hatte ihn vor wenigen Monaten gefangen genommen, als er überraschend auf unserer Insel aufgetaucht war. Es war das erste Mal gewesen, dass ich einem Gott begegnet war. Schon damals war ich überrascht gewesen, dass er so … so menschlich aussah.
Heimdalls schulterlanges hellblondes Haar war verfilzt, das markante Gesicht zu einer gequälten Grimasse verzerrt. Zahllose schlecht verheilte Wunden zierten seinen entblößten muskulösen Oberkörper. Anfangs hatte er ununterbrochen nach seinem Horn verlangt, hatte sich gewehrt, bis ihn irgendwann der Kampfgeist verlassen hatte und seine Schreie nach Gjallarhorn verstummt waren. Es ließ sich nicht länger leugnen. Heimdall, der Wächter der Götterwelt Asgard, lag im Sterben.
Unwillkürlich musste ich an Fenrirs anklagenden Blick denken, als er mich beschuldigt hatte, etwas mit Heimdalls Verschwinden zu tun zu haben. Er hatte nicht ahnen können, dass er recht gehabt hatte. Nur wenige wussten, dass der Gott hier war.
»Es sind nicht die Götter, die unseren Untergang besiegeln werden.« Ich wandte mich an meine Mutter. Zusammen mit ihren kristallblauen Augen, der schneeweißen Haut, dem langen silbrigen Haar, das zu einem kunstvollen Zopf geflochten war, und den makellosen Zügen war sie eine tödliche Schönheit durch und durch. Ihr Inneres war dafür umso hässlicher. »Das Gletscherfieber hat die Berserker erreicht«, fügte ich hinzu, während ich den Schmerz in meiner Hand ausblendete, so gut ich konnte. »Sie werden in ein paar Tagen zum letzten Mal kommen und uns danach nicht mehr mit Vorräten versorgen. Sie fliehen wie die Feiglinge, die sie sind.« Für einen kurzen Moment erlaubte ich mir, die Augen zu schließen. Hier ging es nicht um Fenrir und seine Mannschaft, hier ging es um etwas viel Wichtigeres. »Aber vielleicht sollten wir es ihnen gleichtun. Die letzten Wikinger liegen im Sterben, Mutter. Wir liegen im Sterben. Das Gletscherfieber ist ausgebrochen, nachdem du Heimdall gefangen genommen hast. Die Völvas sind sich sicher, dass das der Beginn Ragnaröks gewesen ist. Angeblich wurde in den Legenden vor einer schweren Krankheit gewarnt, die Ragnarök einläutet.«
Ich war selbst erschrocken über meine waghalsigen Worte bezüglich des Weltenbrandes, aber ich bereute sie nicht. Sie waren die Wahrheit und egal, wie viel Blut sie mir nehmen, wie viel Haut sie zerschneiden würde, ich würde nie das tun können, was sie von mir erwartete. Ich würde nie jemanden töten können, niemals fremdes Blut vergießen können.
»Vielleicht musst du den Gott gehen lassen«, fügte ich hinzu, als die Gottestöterin schwieg. »Vielleicht ist das die einzige Chance, Ragnarök und das Ende unseres Stammes aufzuhalten.«
»Der Gott ist in unser Zuhause eingedrungen. Er ist derjenige, der einen Fehler begangen hat, nicht ich«, entgegnete meine Mutter. »Und wir werden Bouvetøya nicht verlassen.« Sie schenkte mir ein Lächeln, das grausamer war als jede Wunde, die sie mir zufügen konnte. Dann beugte sie sich zu mir hinunter und hauchte einen Kuss auf mein Haar. »Eines Tages wirst du verstehen, dass die Götter allein der Ursprung Ragnaröks sind. Und dass wir nur hier vor ihnen in Sicherheit sind, Prinzessin.« Sie deutete mit ihrem Pflock auf den bewegungslosen Gott, der wenige Schritte entfernt auf der Bank lag.
»Sein Blut«, flüsterte meine Mutter, »oder deines?«
Sie stellte mir diese Frage jedes Mal, wenn ich ein unfreiwilliger Gast in ihrer Kammer war. Ich zögerte, den Blick erneut auf meine blutige Hand gerichtet. Die Haut, die sich über meinen Handrücken spannte, konnte nie richtig verheilen, weil sie immer wieder aus Neue aufgeschnitten wurde, weil ich gebrochen werden sollte. Manchmal fragte ich mich, ob es nicht einfacher wäre, nachzugeben. Die Frau zu werden, die diese Demütigung nicht mehr über sich ergehen lassen müsste. Endgültig in die Fußstapfen meiner Mutter zu treten, indem ich mir ebenfalls den Titel einer Gottestöterin verdiente.
»Mein Blut.« Meine Stimme war kaum mehr als ein Flüstern, aber ich wusste, dass sie mich trotzdem gehört hatte. Dass sie die Antwort verstanden hatte, die ich ihr jedes Mal aufs Neue gab. Lieber sollte sie mein Blut vergießen, als dass das Blut eines anderen an meinen Händen klebte.
Fast liebevoll fuhr meine Mutter mit ihrem rot verschmierten Finger die Länge ihrer kunstvoll geschnitzten Waffe entlang, bevor sie meinen Arm erneut packte und die Spitze von Daudi noch einmal in mein Fleisch trieb. Der Gestank ihres Atems nach herbem Met vermischte sich mit dem metallenen Geruch des Blutes, das sie mir nahm.
Ich biss erneut die Zähne zusammen, sah jedoch nicht weg. Weil die Verachtung in ihren Augen schon lange nicht mehr schmerzte.
Schließlich befreite sie ihren Pflock aus meinem zerfetzten Fleisch, wandte sich um und schritt zu dem reglosen Gott. Das stählerne Kettenhemd, das sie nie abzulegen schien, schmiegte sich dabei perfekt an ihren sehnigen, hochgewachsenen Körper.
Meine Mutter begutachtete ihren Gefangenen einen Augenblick lang schweigend, dann kniete sie sich neben ihn. Naiv wie ich war, hoffte ich, dass sie es nicht schon wieder tun würde, dass sie trotz allem einen Funken Menschlichkeit in ihrem Körper trug. Dass ihr Herz noch schlug, auch wenn es so kalt wie die Gletscher dieser Insel sein mochte.
Doch dann bohrte sie ihren Pflock mit einer blitzschnellen Bewegung in den Oberarm des Gottes. Heimdall stieß ein tiefes Knurren aus, öffnete die Augen jedoch nicht. Blut quoll aus der Wunde und durchtränkte das Holz der Bank, verfärbte es. Mit jedem Hieb ihres Pflocks raubte sie ihm ein Stückchen seiner Unsterblichkeit, ließ ihn qualvoll langsam sterben. So lange, bis ich ihre Waffe annehmen und den Gott endgültig töten würde, mit einem Stich mitten ins Herz.
Als meine Knie drohten nachzugeben, erhob sich meine Mutter. Einen Atemzug später stand sie wieder vor mir, packte mich am Arm, hielt mich fest.
»Würdest du das Leben des Gottes gegen etwas eintauschen, das dir nichts bedeutet?« Ihre blutigen Finger legten sich in mein Haar und begannen, es zu flechten. »Etwas, was du entbehren könntest? Dann würde all das hier enden.«
Ich nickte, den Blick starr auf den Wächter Asgards gerichtet. In diesem Moment würde ich alles tun, um diese Sitzungen nicht mehr über mich ergehen lassen zu müssen.
Die Gottestöterin beugte sich hinunter, bis ihre Lippen mein Ohr streiften.
»Dann töte den Kapitän der Berserker, Prinzessin.«
Kapitel4
Blut sickerte unaufhörlich durch die Stoffbinde, die ich notdürftig um meine verletzte Hand gewickelt hatte. Aber mein Blick galt nicht meiner Wunde, sondern den dichten Rauchschwaden, die in den nächtlichen kohleschwarzen Himmel flohen. Die etwa mannshohen Flammen leckten an der hölzernen Platte, die nur wenige Schritte entfernt von mir im eiskalten Meerwasser schwamm. Die Nacht war eine stille Zeugin, als die in dunkle Tücher gewickelten Leichname jener erkrankten Wikinger, die die heutigen Duelle verloren hatten, zu Asche wurden.
Ich stand etwa bis zu den Knien im Meer und starrte das Feuer an, das ich dem Brauch der Völvas nach entzündet hatte. Währenddessen stützte ich mich auf meinen langen, aus dunklem Holz gefertigten Stab, den ich stets bei mir trug, wenn ich in das Gewand einer Völva gehüllt war.
Obwohl ich diesen Anblick schon unzählige Male hatte mitansehen müssen, schnitt er sich jedes Mal von Neuem in mein Herz. Meine Hände zitterten leicht, als ich mir die Kapuze meines Umhangs tiefer in die Stirn zog. Dann verneigte ich mich vor den Flammen, wandte mich ab, um an Land zurückzukehren – und erstarrte.
Die schlanken, hölzernen Wachtürme, die an diesem Abschnitt der Küste postiert waren, waren wie gewohnt mit den treusten Männern der Gottestöterin besetzt. Aber vom Turm, der mir am nächsten war, sah mir kein Ergebener meiner Mutter entgegen.
Sondern die Gottestöterin selbst.
Für den Bruchteil eines Moments vergaß mein Herz, wie man schlug. Und ich vergaß, dass sie mich nicht erkennen konnte. Dass sie nicht wusste, dass ich des Nachts zur Völva ausgebildet wurde und für das Knüpfen von Lebensfäden brannte, nicht für das Zerreißen.
Für das Heilen, nicht das Töten.
Mit heftig klopfendem Herzen deutete ich eine leichte Verneigung an, bevor ich mich abwandte und an der Küste entlanglief. Solange ich den Blick meiner Mutter noch im Rücken spürte, blieb ich auf dem Weg, der zur Höhle der Völvas führte, die sich in einer kleinen Bucht befand. Erst als ich mir sicher sein konnte, dass ich außer Sichtweite ihres Turmes war, schlug ich eine andere Richtung ein. Ich steuerte nicht länger die Höhle an, sondern eine winzige hölzerne Hütte nahe der felsigen Küste. Astrids Zuhause war das einzige, das sich nicht innerhalb der Sichelsiedlung im Zentrum der Insel befand. Wenn mich jemand fragen würde, was mein Lieblingsort war, würde ich auf Astrids Hütte verweisen.
Ich klopfte mit meinem Stab zweimal schnell und einmal langsam an die Tür. Drei Atemzüge später wurde sie vorsichtig geöffnet und Astrid spähte durch den Spalt. Als sie mich entdeckte, öffnete sie die Tür ein Stück weiter und zog mich eilig hinein, bevor sie sie hinter mir wieder verschloss.
Wie immer glitt mein Blick zuerst zu dem steinernen Kasten voll Erde, der direkt an der Tür stand und von mehreren Öllampen erhellt wurde. Erde, in der schon unzählige Samen vergraben waren. Doch kein einziger von ihnen hatte bisher Wurzeln geschlagen, war zu einem Pflänzchen erblüht, von denen mein Vater mir früher so oft erzählt hatte.
»Pünktlichkeit war noch nie deine Stärke, Frey«, brummte Astrid und riss mich damit aus meinen Erinnerungen.
Kurz drückte ich ihre Schulter, dann legte ich meinen Stab ab und kniete mich neben die zwei regungslosen Männer, die mittig in Astrids Hütte auf dem Boden lagen. Nur das kaum merkliche Heben und Senken ihrer Brust verriet, dass der Wikinger und der Berserker noch am Leben waren. Für die Gottestöterin waren diese beiden bei den heutigen Duellen gestorben und nun lediglich Asche auf der See. Hoffte ich zumindest, denn noch gab es keinerlei Anzeichen dafür, dass sie von unserer Täuschung wusste.
Hör auf, an sie zu denken, ermahnte ich mich in Gedanken, ehe ich mich daran machte, die Wunden der Männer ein letztes Mal zu säubern und neu zu bandagieren, bevor sie ihre Reise antraten.
Glücklicherweise schaffte Astrid es, einen Dolchstoß absolut tödlich aussehen zu lassen, ohne mir die Möglichkeit zu nehmen, die Männer zu retten. Zumindest, was die Wunden anbelangte, die Astrid ihnen während der Duelle zufügte. Das Gletscherfieber, das sich durch bläulich verfärbte Haut und Atemprobleme bemerkbar machte, konnte ich nicht behandeln. Ich hatte es in den ersten Mondzyklen versucht, wochenlang. Aber die Erkrankten waren dem Fieber alle früher oder später erlegen, waren erstickt. Die Entscheidung, sie gegen Bezahlung heimlich an die Berserker zu übergeben, damit diese sie in die Außenwelt zu einem Heiler brachten, hatte mich unheimlich viel Überwindung gekostet. Doch Verzweiflung trieb einen dazu, Schritte ins Ungewisse zu gehen.
Behutsam schob ich die grob gewebte schwarze Tunika des rothaarigen Mannes beiseite, um die Schwellung an seinem Hals noch einmal zu kühlen. Und erstarrte.
»Was zum …« Ich hörte, wie sich Astrid über meine Schulter beugte und geräuschvoll die Luft einsog.
Ich hingegen musste für einen Moment die Augen schließen, bevor ich einen erneuten Blick auf den Hals des Mannes wagte. Der Ausschlag, den ich schon so oft an Erkrankten gesehen hatte, bedeckte beinahe seinen ganzen Hals und hatte statt der typisch bläulichen Färbung einen tiefvioletten Ton angenommen. Hastig zerrte ich den Stoff weiter nach unten und entblößte einen Teil seiner Brust. Verdammt. Ich grub meine Zähne in meine Unterlippe, während ich die dunkel verfärbte Haut musterte. Als ich seine Wunden vor wenigen Stunden zum ersten Mal gesäubert und verbunden hatte, war seine Haut lediglich leicht bläulich verfärbt gewesen. Aber jetzt … jetzt sah es so aus, als hätte dunkle Tinte ihren Weg auf seinen Körper gefunden.
»Es wird schlimmer«, murmelte ich, mehr zu mir selbst als zu Astrid. Wie lange der Mann wohl schon am Gletscherfieber litt? Hatte jemand ihn an die Gottestöterin verraten oder war er freiwillig hier? So viele Fragen, die mir auf der Zunge brannten, und doch traute ich mich nicht, eine von ihnen zu stellen. Meine Arbeit war einfacher, wenn die Männer nicht bei Bewusstsein waren, und ich wollte nicht riskieren, ihn zu wecken. Stattdessen begann ich schweigend damit, die Stichwunde, die sich im Bereich seiner Brust nahe der rechten Schulter ins Fleisch gegraben hatte, noch einmal zu säubern. Eine Infektion war das Letzte, was er auf seiner bevorstehenden Reise gebrauchen konnte.
»Ich glaube, ich muss das hier nähen.« Im Schein der Öllampe neben mir konnte ich erkennen, dass die Wunde weitaus tiefer war, als ich zunächst angenommen hatte.
»Musst du wirklich?«, fragte Astrid. »Fenrir kann jeden Moment hier sein. Und du weißt besser als jede andere, dass er nicht gerne wartet.«
Hastig kramte ich eine Nadel aus meinem Beutel hervor und erhitzte sie an der Lampe. »Er wird warten, wenn er seine Bezahlung will«, antwortete ich nur. Und das wollte er, das wusste ich. Silbermünzen waren das Einzige, was ihm etwas bedeutete.
Schnell konzentrierte ich mich wieder auf die Nadel in meinen zittrigen Fingern, auf die fiebrig heiße Haut unter meinen Händen, während ich flickte, was zerrissen worden war.
Schließlich legte ich die Nadel beiseite, richtete mich auf, griff nach meinem Stab und wartete angespannt auf den Teil, der mir auch jetzt noch Schweiß auf die Stirn und ein hektisches Pochen in meine Brust sandte. Als das Klopfen an Astrids Tür endlich ertönte, zuckte ich unwillkürlich zusammen und zog meine Kapuze tiefer in die Stirn, damit mein Gesicht komplett verborgen war.
Astrid griff sich ihre Axt und trat zur Tür. Sie lauschte am Holz, bevor sie sie einen Spaltbreit öffnete. Obwohl Fenrir genau wie ich ein spezielles Klopfsignal verwendete, damit wir wussten, dass er es war, blieb Astrid bei jedem Klopfen misstrauisch.
Als der Berserker endlich eintrat, glitt sein Blick automatisch zu mir. Ich war mir sicher, dass ich ihm nicht ganz geheuer war. Erkannte es an der Art, wie sich seine Züge verhärteten, wie er sich hastig abwandte und stattdessen die Kranken fokussierte, allen voran den Berserker. Wie würde er wohl reagieren, wenn er herausfand, wer sich unter meinem Umhang verbarg? Für einen kurzen Moment wünschte ich, dass er es tun würde.
Dass er einsehen würde, wie sehr ich ihn hinters Licht geführt hatte.
»Nur zwei?«, fragte Fenrir an Astrid gewandt.
»Du kannst zählen, Captain.« Astrid verschränkte die Arme vor der Brust. »Ich bin beeindruckt.«