
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Nobody Deserves to be Forgotten
Ein nie für die Augen anderer bestimmter Brief lässt Evan Hansen als engsten Freund eines toten Mitschülers erscheinen. Dem einsamen Evan eröffnet sich durch dieses Missverständnis die Chance seines Lebens: endlich dazuzugehören. Evan weiß natürlich, dass er falsch handelt, doch nun hat er plötzlich eine Aufgabe: Connors Andenken zu wahren und den Hintergründen seines Todes nachzuspüren. Alles, was er tun muss, ist weiter vorzugeben, Connor Murphy habe sich vor seinem Selbstmord allein ihm anvertraut. Plötzlich findet sich der unsicht- und unscheinbare Evan im Zentrum der Aufmerksamkeit. Sogar der des Mädchens seiner Träume – Connors Schwester.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 417
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Aus dem Amerikanischen von
Catrin Frischer
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Dieses Buch ist auch als E-Book erhältlich.
© 2019 der deutschsprachigen Ausgabe
cbj Kinder- und Jugendbuchverlag
in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
© 2018 Steven Levenson, Benj Pasek, Justin Paul
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel: »Dear Evan Hansen«
bei Poppy, einem Imprint von Little Brown and Company
Übersetzung: Catrin Frischer
Umschlagkonzeption: Geviert, Grafik & Typografie, Katharina Fußeder
unter Verwendung eines Fotos von © Shutterstock (3DMi)basierend auf dem Originaldesign von Sasha Illingworth
MP · Herstellung: AJ
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-24054-7V001
www.cbj-verlag.de
Ich bin abgetreten.
Better to burn out, than to fade away. Stimmt doch, oder? Das hat Kurt Cobain in seinem Abschiedsbrief geschrieben. Ich hab einen Film gesehen über all diese Berühmtheiten. Ernest Hemingway. Robin Williams. Virginia Woolf. Hunter S. Thompson. Sylvia Plath. David Foster Wallace. Van Gogh. Ich will mich nicht etwa mit denen vergleichen. Diese Leute haben tatsächlich was bewegt. Ich hab nichts gemacht. Ich konnte nicht mal einen lausigen Zettel hinterlassen.
Burning … verbrennen, das Wort trifft es. Du spürst, wie du heißläufst. Jeden Tag ein bisschen mehr. Heißer und heißer. Irgendwann ist das zu viel. Sogar für Sterne. An einem gewissen Punkt verpuffen sie oder explodieren. Hören auf zu existieren. Aber wenn du zum Himmel hochschaust, siehst du das nicht. Du glaubst, all diese Sterne seien noch da. Manche sind es aber nicht. Sie sind längst weg. Schon ewig. Ich jetzt vermutlich auch.
Mein Name. Das war das Letzte, das ich geschrieben habe. Auf den Gips eines Jungen. Kein richtiger Abschiedsbrief. Aber was soll’s, ich hab mein kleines Zeichen hinterlassen. Auf einer gebrochenen Gliedmaße. Passt doch eigentlich. Ist poetisch, wenn man mal drüber nachdenkt. Und nachdenken ist auch schon alles, was ich jetzt noch machen kann.
TEIL EINS
Kapitel 1
Lieber Evan Hansen,
So fangen alle meine Briefe an. Zuerst Lieber, weil das über jedem Brief steht. Das macht man so. Dann kommt der Name der Person, an die man schreibt. In diesem Fall bin ich das. Ich schreibe an mich. Also, ja, Evan Hansen.
Eigentlich ist Evan mein zweiter Vorname. Meine Mom wollte, dass ich Evan heiße. Mein Vater wollte, dass ich Mark heiße, so wie er. Laut Geburtsurkunde hat mein Dad die Schlacht gewonnen, aber den Krieg hat meine Mom gewonnen. Sie nennt mich immer nur Evan. Deshalb tut mein Vater das auch. (Achtung, Spoiler: Meine Eltern sind nicht mehr zusammen.)
Nur auf meinem (völlig ungenutzten) Führerschein heiße ich Mark – und wenn ich Bewerbungsbögen ausfülle oder am ersten Schultag, so wie heute. Meine neuen Lehrer werden bei der Anwesenheitsprüfung »Mark« rufen, und ich muss jeden einzelnen bitten, mich doch bei meinem zweiten Vornamen zu nennen. Selbstverständlich wird das erst passieren, wenn alle anderen den Raum verlassen haben.
Es gibt eine Million und zehn Sachen – vom Subatomarischen bis zum Kosmischen –, die täglich an meinen Nerven zerren, wie zum Beispiel meine Initialen M.E.H. Meh. Klingt wie Mäh. Meh ist im Grunde so was wie ein verbales Achselzucken, und das ist exakt die Reaktion, die ich bei anderen hervorrufe. Ganz das Gegenteil eines Überraschung verheißenden Oh. Oder dem Schwung eines Ah. Dem Zögern eines Äh. Oder der Verwirrtheit eines Häh? Meh drückt pure Gelangweiltheit aus. Nimm es oder lass es bleiben. Völlig egal. Interessiert keinen. Mark Evan Hansen? Meh.
Ich halte mich eher für einen Eh, das hat mehr so was davon, als würde man dabei nach Anerkennung suchen, auf Bestätigung warten. So etwa: Was ist denn nun mit diesem Evan Hansen, eh?
Meine Mom sagt, ich bin ein echter Fisch. Das Symbol dieses Sternbilds sind zwei miteinander verbundene Fische, die versuchen, in entgegengesetzte Richtungen zu schwimmen. Sie steht auf diesen ganzen Astrologie-Scheiß. Ich hab ihr eine App auf dem Handy installiert, da kann sie täglich ihr Horoskop lesen. Jetzt lässt sie überall im Haus handgeschriebene Zettel für mich liegen, auf denen Sachen stehen wie: Verlasse deine Komfortzone. Oder sie mogelt die Botschaft des Tages nebenbei in unsere Gespräche: Nimm eine neue Herausforderung an. Eine geschäftliche Unternehmung mit einem Freund verspricht Erfolg. Alles totaler Quatsch, wenn ihr mich fragt. Aber ich vermute, ihr Horoskop gibt meiner Mom Hoffnung und Orientierungshilfe – und genau das sollen meine Briefe mir auch verschaffen.
Wo wir gerade dabei sind. Nach der Anrede geht’s direkt ans Eingemachte: da beginnt der Hauptteil. Meine erste Zeile lautet immer:
Das wird heute ein ganz fantastischer Tag – und ich verrate dir auch, warum.
Eine positive Einstellung bewirkt positive Erfahrungen. Das ist der Gedanke hinter dieser ganzen Briefschreibaufgabe.
Zuerst habe ich versucht, drumherum zu kommen. »Ich glaube nicht, dass ein Brief an mich selbst mir viel helfen wird. Ich habe keine Ahnung, was ich da schreiben sollte«, habe ich zu Dr. Sherman gesagt.
Na, da wurde er aber munter und beugte sich auf seinem Lederstuhl vor, statt sich lässig zurückzulehnen wie sonst. »Das musst du gar nicht wissen. Genau darum geht es bei dieser Übung. Ums Erforschen. Du könntest zum Beispiel anfangen mit: Das wird heute ein ganz fantastischer Tag – und ich verrate dir auch, warum. Und dann machst du einfach weiter.«
Manchmal habe ich das Gefühl, Therapie ist absoluter Bullshit, dann wieder denke ich, das eigentliche Problem dabei ist, dass ich es nicht schaffe, mich vollständig darauf einzulassen. Aber letztendlich hab ich seinen Rat trotzdem angenommen – buchstäblich. (Eine Sache weniger, über die ich nachdenken muss.)
Danach wird’s dann aber erst so richtig schwierig. Diese erste Zeile ist nur eine Anfangsbehauptung, und im Anschluss muss ich diese steile These belegen. Ich muss beweisen, warum der Tag heute fantastisch werden wird, obwohl alle Tatsachen dagegen sprechen. Jeder Tag vor dem heutigen Tag war nämlich eindeutig nicht fantastisch, wie komme ich also bloß drauf, dass es ausgerechnet heute anders sein sollte?
Ganz ehrlich? Das glaub ich kein bisschen. Also wird es Zeit, meine Fantasie voll aufzudrehen, bis jedes einzelne Molekül meiner Kreativität topfit ist und losfeuert. (Es braucht ein molekulares Dorf, um eine fantastische Motivationsrede zu schreiben.)
Denn heute musst du nichts weiter tun, als du selbst zu sein. Aber auch voller Selbstvertrauen. Das ist wichtig. Und interessant. Jemand, mit dem man gern spricht. Sei also offen. Versteck dich nicht. Zeig dich anderen. Nicht auf ’ne perverse Art, die Hose bleibt zu. Sei einfach du selbst – dein wahres Ich. Sei, wer du bist. Steh zu dir.
Sei, wer du bist. Was soll das überhaupt heißen? Hört sich an wie einer von diesen pseudophilosophischen Instagram-Sprüchen vor coolem Schwarz-Weiß-Foto. Aber wie auch immer, wir wollen ja nicht vorschnell urteilen. Wir sind zum Erkunden hier, wie Dr. Sherman sagen würde.
Erkundung: Ich denke mal, dass dieses »wahre Ich« besser wäre … so insgesamt im Leben. Besser mit Leuten. Und nicht so schüchtern. Zum Beispiel hätte es sich garantiert nicht entgehen lassen, Zoe Murphy kennenzulernen – letztes Jahr beim Konzert der Schulband. Es hätte nicht ewig lange überlegt, welche Worte seine Gefühle nach ihrem Auftritt am besten ausdrücken würden – ohne gleich rüberzukommen wie ein Stalker – gut, großartig, spektakulär, strahlend, bezaubernd, solide –, um dann, nachdem die Wahl auf sehr gut gefallen war, doch nicht mit ihr zu sprechen, wegen der Sorgen um die eigenen verschwitzen Hände
Dabei war es doch völlig wurscht, dass meine Hände verschwitzt waren. Sie hätte ja wohl kaum darauf bestanden, mir die Hand zu schütteln. Außerdem war wahrscheinlich eher sie diejenige mit den verschwitzten Händen, nach all dem Gitarrespielen. Abgesehen davon, bekomme ich sowieso nur verschwitzte Hände, wenn ich denke, dass sie schwitzig werden. Also war es allein meine Schuld, dass sie verschwitzt waren – und so was Tieftrauriges würde diesem »wahren« Evan garantiert nie passieren.
Toll, ich tu’s schon wieder, ich bringe meine Hände zum Schwitzen. Nun muss ich die Tastatur mit meiner Bettdecke abwischen. Und ich hab nur csxldmrr xsmit sskegv getippt. Und jetzt schwitzt mein Arm auch noch. Der Schweiß wird sich unter meinem Gips sammeln, Luft kommt da nämlich nicht durch, und schon bald wird mein Gips müffeln, ein Müffeln, von dem niemand in der Schule Wind kriegen soll, schon gar nicht am ersten Tag meines Abschlussjahres. Geh zur Hölle, falscher Evan Hansen. Du bist echt anstrengend.
Tief einatmen.
Ich greife in meine Nachttischschublade. Meine Lexapro habe ich heute Morgen schon genommen, aber Dr. Sherman sagt, es ist in Ordnung, auch eine Ativan zu nehmen, wenn wirklich alles zu viel wird. Ich schlucke also die Ativan, das hilft dann schon.
Das ist das Problem mit diesen Briefen. Am Anfang schlage ich den direkten Weg ein, aber dann schweife ich immer ab, verirre mich in den schummrigen Gässchen meines Gehirns, in denen nie was Gutes passiert.
»Du hast gestern Abend also beschlossen, nichts zu essen?«
Das ist meine Mom, sie beugt sich über mich, mit dem Zwanzig-Dollar-Schein in der Hand, den ich nicht verwendet habe.
Ich klappe den Laptop zu und schiebe ihn unter mein Kissen. »Ich hatte keinen Hunger.«
»Hör mal, Schatz. Du musst es schaffen, dir was zum Abendessen zu bestellen, wenn ich bei der Arbeit bin. Das kann man jetzt alles online machen. Du musst nicht mal mit irgendwem reden.«
Aber das stimmt nicht. Ich muss mit dem Liefertypen reden, wenn der an die Tür kommt. Ich muss da rumstehen, während er das Wechselgeld zusammensucht. Und die tun immer so, als hätten sie nicht genug Kleingeld. Deshalb muss man spontan entscheiden, ob man weniger oder mehr Trinkgeld gibt als eigentlich geplant. Wenn man weniger gibt, weiß man, dass sie einen beim Weggehen leise verfluchen, also gibt man mehr und endet als armer Schlucker.
»Tut mir leid«, sagte ich.
»Das muss dir nicht leidtun. Aber das ist eine von den Sachen, an denen du mit Dr. Sherman arbeiten solltest. Mit Leuten reden. Dich einbringen. Und Dingen nicht aus dem Weg gehen.«
Ging es eben in meinem Brief nicht genau darum? Darum, mich zu zeigen? Nicht zu verstecken. Ich weiß das alles schon. Sie muss es nicht ständig wiederholen. Das ist wie die Sache mit den verschwitzten Händen: Je mehr Aufmerksamkeit man dem Problem schenkt, desto schlimmer wird es.
Jetzt läuft sie im Kreis um mein Bett herum, mit verschränkten Armen. Sie sieht sich prüfend im Zimmer um, so als hätte sich hier irgendwas geändert seit dem letzten Mal, als sie hier drinnen war, so als würde hier irgendwo eine neue Antwort auf das große Rätsel Evan schlummern – in meiner Kommode oder als Zeichen an der Wand. Als könnte sie darauf stoßen, wenn sie nur genau genug hinguckt.
Ich habe ziemlich viel Zeit in diesem Zimmer verbracht, ihr könnt mir also glauben: Wenn es hier eine Antwort gäbe, dann hätte ich sie längst gefunden.
Ich lasse die Beine vom Bett gleiten und ziehe meine Turnschuhe an.
»Wo wir gerade von Dr. Sherman reden«, sagte sie. »Ich hab dir einen Termin für heute Nachmittag gemacht.«
»Heute? Warum? Ich geh doch nächste Woche zu ihm.«
»Ich weiß«, antwortet sie und starrt auf den Zwanziger in ihren Händen. »Aber ich dachte, du brauchst es vielleicht ein bisschen früher.«
Weil ich ein Mal das Abendessen ausgelassen habe? Ich hätte das Geld einfach einstecken sollen, dann hätte sie es nicht gemerkt, aber das wäre so, als würde ich sie beklauen – und Karma ist ’ne Bitch.
Vielleicht ist es ja nicht nur der unbenutzte Zwanziger. Vielleicht sondere ich ja gerade besonders besorgniserregende Schwingungen ab, die mir nicht bewusst sind.
Ich stehe auf und gucke in den Spiegel. Versuche zu sehen, was sie sieht. Alles scheint in Ordnung zu sein. Das Hemd ist richtig geknöpft, die Haare liegen halbwegs okay. Gestern Abend habe ich sogar geduscht. In letzter Zeit habe ich nicht besonders häufig geduscht, weil es so nervt, den Gips zuerst in Plastikfolie zu wickeln, dann eine Einkaufstüte drüberzuziehen und das Ganze am Schluss mit Klebeband zu versiegeln. Außerdem werde ich sowieso nicht schmutzig. Seit das mit dem Arm passiert ist, hab ich mich eigentlich völlig in mein Zimmer zurückgezogen. Abgesehen davon achtet in der Schule sowieso keiner darauf, wie ich aussehe.
Im Spiegel ist noch was zu sehen, das bemerke ich jetzt erst. Ich kaue an den Nägeln. Schon die ganze Zeit. Okay, die Wahrheit ist, dass ich mich schon seit Wochen vor diesem Tag gefürchtet habe. Nach der sicheren Isolation der Sommerferien ist die Schule für mich immer so eine Art sensorische Überlastung. Zuzusehen, wie Freunde sich mit Bro-Hug und schrillem Gekreische begrüßen. Wie sich in den Ecken automatisch Cliquen bilden, ganz so, als wären alle Beteiligten auf geheimen Wegen über die diesjährigen In-Treffpunkte informiert worden. Wie sie sich vor Lachen nicht mehr einkriegen, über den wohl witzigsten Witz, der je erzählt worden ist. Durch all das hindurch finde ich meinen Weg, weil es mir mittlerweile vertraut ist. Aber was mir zu schaffen macht, sind die Sachen, die ich nicht vorhersehen kann. So gerade eben hatte ich die Regeln vom letzten Jahr gepeilt – und zack, schon ist wieder lauter neues Zeug angesagt. Neue Klamotten, Technik-Gadgets, Autos. Neue Frisuren, Farben, Haarlängen. Neue Piercings und Tattoos. Neue Paare. Ganz neue sexuelle Orientierungen und Identitäten. Neue Kurse, Schüler, Lehrer. So viel Veränderung. Und alle stiefeln da ganz lässig durch, als wäre alles wie immer, aber für mich fühlt sich jedes neue Jahr an, als würde ich wieder bei Null loslegen.
Meine Mom ist jetzt in meinem Spiegel zu sehen, die Quaste von ihrem Schlüsselbund baumelt aus ihrer Tasche. Ihr Name steht drauf. (Im Laufe der Jahre habe ich viele lausige Geschenke veredelt, indem ich einfach irgendwo Mom oder Heidi draufgepappt habe – Becher, Kugelschreiber, Handyhüllen.) Wenn sie in ihrem Kittel in meinem Zimmer herumstöbert, sieht sie nicht aus wie eine Krankenschwester, eher wie eine Tatortermittlerin. Eine sehr müde Tatortermittlerin. Sie ist immer eine jungeMutter gewesen, weil sie mich gleich nach dem College bekommen hat, aber ich bin mir nicht sicher, ob das immer noch passt. In letzter Zeit ist da so eine Dauermüdigkeit in ihren Augen, gegen die der Schlaf, den sie aus jeder Nacht rausquetscht, offenbar nichts ausrichten kann. So langsam sieht man ihr das Alter doch an.
»Was ist mit all deinen Pins passiert?«, sagt sie.
Ich drehe mich zu der Landkarte an der Wand um. Als ich diesen Sommer anfing im Ellison Nationalpark zu arbeiten, kam mir die Idee, irgendwann die besten Wanderwege im Land abzulaufen: den Precipice Trail in Maine, Angel’s Landing in Utah, den Kalalau Trail in Hawaii, das Harding Icefield in Alaska. Ich hatte sie alle mit Nadeln in verschiedenen Farben auf meiner Karte markiert. Aber nachdem der Sommer auf diese Weise zu Ende gegangen war, hatte ich beschlossen, alle Markierungen zu entfernen – mit einer Ausnahme.
»Ich dachte, ich konzentriere mich erst mal auf einen Trail«, sage ich. »Der erste, den ich hoffentlich gehen werde, ist der West Maroon Trail.«
»Und der ist in Colorado?«, fragt meine Mom.
Das kann sie auf der Karte sehen, trotzdem fragt sie. Ich gebe ihr, was sie will: »Ja.«
Qualvoll dramatisch holt sie Luft. Ihre Schultern heben sich und berühren praktisch die Ohren, ehe sie noch tiefer nach unten sinken als zuvor. In Colorado wohnt mein Dad. Mit dem Wort Dad muss man bei uns zu Hause vorsichtig umgehen, das gilt auch für jedes Wort, das an meinen Dad erinnert, wie Mark oder in diesem Fall Colorado.
Mom wendet sich ab von der Landkarte und präsentiert mir ein Gesicht, das tapfer und sorglos wirken soll, aber genau so nicht aussieht. Sie ist verwundet, liegt aber noch nicht am Boden. Damit wären wir schon zwei.
»Ich hole dich gleich nach der Schule ab«, sagt sie. »Hast du diese Briefe, die Dr. Sherman dich schreiben lässt? Diese Motivationsdinger? Du darfst das nicht schleifen lassen, Evan.«
Eine Zeitlang habe ich wirklich jeden Tag einen Brief geschrieben, aber im Laufe des Sommers habe ich nachgelassen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Dr. Sherman das meiner Mutter erzählt hat, und deshalb nörgelt sie in letzter Zeit immer darüber rum. »Ich hab gerade an einem gearbeitet«, sage ich, erleichtert, nicht lügen zu müssen.
»Gut. Dr. Sherman wird ihn sehen wollen.«
»Ich weiß. Ich mach ihn in der Schule fertig.«
»Diese Briefe sind wichtig, Schatz. Sie helfen dir, dein Selbstvertrauen zu stärken. Besonders am ersten Schultag.«
Ah ja. Ein weiterer klitzekleiner Hinweis darauf, warum ihr ein Besuch bei Dr. Sherman heute besonders angebracht scheint.
»Ich will dich nicht noch ein Jahr jeden Freitagabend allein zu Hause vor dem Computer sitzen sehen. Du musst irgendwie einen Weg finden, da draußen mitzumischen.«
Versuche ich ja. Ich streng mich doch an.
Sie entdeckt was auf meinem Schreibtisch. »Hey, ich weiß was.« Sie zieht einen Filzstift aus dem Becher. »Mach doch heute mal die Runde und frag deine Klassenkameraden, ob sie nicht was auf deinen Gips schreiben wollen? So was würde das Eis doch brechen, oder?«
Und ich ertrinke im See darunter. Das ist ja, als würde man um Freunde betteln. Vielleicht sollte ich mir einen verhungerten Welpen suchen und mich mit dem an die nächste Ecke setzen, da flippt jedes Mitleidsbarometer doch sofort aus.
Zu spät. Sie wird nicht locker lassen. »Evan.«
»Mom, das kann ich nicht.«
Sie reicht mir den Stift. »Nutze den Tag. Heute ist der Tag, den Tag zu nutzen.«
Mein Horoskop, perfekt. »Das Heute kannst du dir sparen. Nutze den Tag bedeutet ja schon das Gleiche.«
»Meinetwegen. Du bist hier der Wortakrobat. Ich mein ja nur, los, hol sie dir! Okay?«
Ohne ihr in die Augen zu sehen, seufze ich und nehme den Stift. »Okay.«
Sie geht auf die Tür zu und gerade als ich denke, ich hab’s hinter mir, dreht sie sich mit einem bangen Lächeln um. »Ich bin schon längst stolz auf dich.«
»Oh. Gut.«
Ihr Lächeln verrutscht ein bisschen und sie geht.
Was soll ich denn sonst sagen? Sie sagt mir, sie ist stolz, aber ihre Augen erzählen eine ganz andere Geschichte. Sie guckt mich grübelnd an, als wäre ich ein Fleck in der Badewanne, den sie nicht wegkriegt, egal, welches Putzmittel sie auch verwendet. Stolz auf mich? Wie soll das denn gehen? Also lügen wir uns doch einfach weiter an.
Es ist ja nicht so, als würden mir die Sitzungen mit Dr. Sherman total gegen den Strich gehen. Klar, unsere Gespräche sind geplant, inszeniert und naturgemäß einseitig, aber es hat was Tröstliches, sich hinzusetzen und mit einem anderen Menschen zu reden. Also, mit jemand anderem als meiner Mom, die so viel zu tun hat mit ihrer Arbeit und den Kursen, dass sie kaum da ist und nie so richtig hört, was ich sage, auch wenn sie zuhört (und meine Mutter ist sie obendrein).
Ab und zu rufe ich meinen Vater an, bei den seltenen Gelegenheiten, wenn es Neuigkeiten gibt, die es wert sind, mitgeteilt zu werden. Aber er hat ziemlich viel um die Ohren. Das Problem an den Gesprächen mit Dr. Sherman ist nur, dass ich echt schlecht darin bin, mit ihm zu sprechen. Ich sitze da und hab Mühe, die simpelsten einsilbigen Antworten aus mir rauszuquetschen. Ich nehme an, deshalb hat er vorgeschlagen, dass ich diese Briefe an mich selbst schreibe. Er hat gesagt, auf diese Art könne ich vielleicht besser Zugang zu meinen Gefühlen bekommen, und es könne mir auch helfen, nicht so streng mit mir zu sein, aber ich bin mir ziemlich sicher, für ihn ist es so auch leichter.
Ich klappe den Computer auf und lese, was ich bisher geschrieben habe.
Lieber Evan Hansen,
Manchmal bewirken diese Briefe das Gegenteil von dem, was beabsichtigt war. Sie sollten dafür sorgen, dass mein Glas halb voll bleibt, aber sie erinnern mich daran, dass ich nicht so bin wie alle anderen. Niemand sonst in meiner Schule bekommt von seinem Therapeuten so eine Aufgabe gestellt. Wahrscheinlich hat sowieso niemand sonst einen Therapeuten. Und Ativan nascht auch keiner. Keiner weicht aus oder zappelt rum, wenn Leute ihm zu nahe kommen, mit ihm reden oder ihn nur angucken. Und ganz bestimmt treibt keiner seiner Mutter die Tränen in die Augen, weil er einfach nur dasitzt und gar nichts macht.
Ich muss nicht dran erinnert werden. Ich weiß, dass ich nicht richtig bin. Glaubt mir, ich weiß es.
Das wird heute ein ganz fantastischer Tag.
Vielleicht – wenn ich einfach hier in meinem Zimmer bleibe – könnte das tatsächlich wahr werden.
Sei einfach du selbst.
Ja. Geht klar. Okay.
Kapitel 2
Ich bin fertig an meinem Spind, stehe aber immer noch davor und tu so, als würde ich was suchen. Es dauert noch viel zu lange bis zum Klingeln, und wenn ich jetzt die Spindtür zuklappe, bleibt mir nichts anderes übrig, als rumzuhängen. Und im Rumhängen bin ich echt ’ne Niete. Zum Rumhängen braucht man Selbstvertrauen, die richtigen Klamotten und ein dominantes, aber zugleich total entspanntes Auftreten.
Robbie Oxman (alias Rox) ist ein Meister des Rumhängens, immerzu schleudert er die Haare aus dem Gesicht und wahrt schulterbreiten Abstand zwischen den Beinen. Sogar mit seinen Händen weiß er was anzufangen: vier Finger in die Jeanstaschen, Daumen durch die Gürtelschlaufen. Genial.
Ich will ja tun, was Dr. Sherman und meine Mutter immer von mir verlangen – mich einbringen –, aber das liegt mir einfach nicht in den Genen. Heute Morgen, als ich in den Bus gestiegen bin, haben alle entweder mit ihren Freunden geredet oder auf ihre Handys geglotzt. Was soll ich da denn machen? Tatsache ist: Ich hab mal Wie man Freunde findet gegoogelt, dann eins der Videos angeklickt, die angezeigt wurden – und echt erst ganz am Ende gemerkt, dass ich Autowerbung gucke.
Deshalb halt ich mich lieber aus allem raus. Doch jetzt muss ich leider los in meinen Kurs.
Ich klappe die Spindtür zu und befehle meinem Körper eine Drehung um exakt 180 Grad. Den Kopf halte ich tief genug, um Blickkontakt zu vermeiden, aber doch so hoch, dass ich sehen kann, wo ich hinlaufe. Kayla Mitchell demonstriert Freddie Lin ihre neue, unsichtbare Zahnspange. (Ich könnte die beiden fragen, ob sie ihre Unterschrift auf meinen Gips setzen wollen, aber – ist nicht böse gemeint – Unterschriften von Leuten, die auf der Wichtigkeitsskala genauso tief unten rangieren wie ich, brauche ich nun wirklich nicht.) Ich gehe an den Zwillingen vorbei (die eigentlich keine sind, nur ständig identische Klamotten tragen) und dem Russischen Spion. (Wenigstens habe ich keinen Spitznamen – soweit ich weiß.) Vanessa Wilton telefoniert, wahrscheinlich mit ihrem Agenten. (Sie war mal Model in einer regionalen Werbeanzeige.) Ein Stück weiter wälzen sich tatsächlich zwei Sportskanonen ringend auf dem Boden. Und da – vor Mr Baileys Klassenzimmer – steht Rox. Er hat den einen Daumen in der Gürtelschnalle geparkt und die andere Hand auf Kristen Caballeros Hüfte. Ich war noch auf dem Stand, dass Kristen mit Mike Miller geht, aber der hat letztes Jahr seinen Abschluss gemacht. Rox ist dann wohl der Nachfolger. Jetzt machen sie rum. Und zwar sehr feucht. Nicht glotzen.
Am Wasserspender mache ich Halt. Meinen Plan habe ich schon vergessen: Zeig dich anderen. Wie denn nur? Soll ich Wunderkerzen schwenken? Gratis-Kondome verteilen? Ich bin einfach nicht der Nutze-den-Tag-Typ.
Durch das Wasserrauschen höre ich eine Stimme. Könnte sein, dass diese Stimme mit mir spricht. Ich höre auf zu trinken. Da steht tatsächlich jemand neben mir. Alana Beck.
»Wie war dein Sommer?«, fragt sie.
Alana hat letztes Jahr in Mathe vor mir gesessen, aber wir haben nie miteinander geredet. Reden wir jetzt etwa? Sicher bin ich mir nicht. »Mein Sommer?«
»Meiner war produktiv«, sagt Alana. »Ich habe drei Praktika absolviert und neunzig Stunden gemeinnützige Arbeit. Wow – ich weiß.«
»Ja. Das ist … wow. Das ist …«
»Obwohl ich so beschäftigt war, habe ich trotzdem tolle neue Freundschaften geschlossen. Na ja, Bekanntschaften, das trifft es wohl eher. Da war so ein Mädchen, Clarissa – oder Ca-rissa? –, ich hab’s nicht so genau verstanden. Und dann noch Bryan mit y. Und meine Beraterin beim National Black Women’s Leadership Training Council, Miss P. Und dann noch …«
Letztes Jahr habe ich Alanas Stimme nur gehört, wenn sie Fragen gestellt oder welche beantwortet hat – das macht sie ständig. Zuerst hat Mr Swathchild ihr Aufzeigen immer ignoriert, bis ihm klarwurde, dass sie die Einzige war, die sich meldete, und ihm nichts anderes übrig blieb, als sie dranzunehmen – wie immer.
Sie hat so was Todesmutiges, das ich niemals besitzen werde, ganz zu schweigen von einem sehr gewinnenden Lächeln. Aber auf andere Art und Weise haben Alana Beck und ich eine Menge gemeinsam. Obwohl sie sich im Unterricht so sehr reinhängt und mit ihrem Riesenrucksack andauernd Leute anrempelt, läuft sie in dieser Schule genauso herum wie ich: absolut unbemerkt.
Nutze den Tag, verlangt meine Mom. Also gut. Ich hebe meinen Gips. »Willst du vielleicht …«
»Oh mein Gott«, sagt Alana. »Was hast du mit deinem Arm gemacht?«
Ich ziehe den Reißverschluss von meinem Rucksack auf und krame nach dem Filzstift. »Ich hab ihn gebrochen. Ich war …«
»Ach, wirklich? Meine Oma hatte im Juli einen Oberschenkelhalsbruch, als sie in der Badewanne ausgerutscht ist. Das war der Anfang vom Ende, haben die Ärzte gesagt. Denn sie ist dann gestorben.«
»Oh … das ist ja schrecklich.«
»Ja, nicht?«, sagt sie, ihr Lächeln kommt keinen Moment ins Rutschen. »Einen glücklichen ersten Schultag!«
Sie dreht sich um und haut mir mit dem Rucksack den Stift aus der Hand. Ich bücke mich danach, und als ich mich wieder aufgerichtet habe, ist Alana weg und Jared Kleinman steht an ihrer Stelle.
»Ist das nicht bizarr, der erste Mensch in der Geschichte zu sein, der sich den Arm bricht, weil er zu viel wichst? Oder betrachtest du das eher als Auszeichnung?«, sagt Jared viel zu laut. »Wie darf ich mir das vorstellen? Du bist in deinem Zimmer. Das Licht ist aus. Im Hintergrund schmusige Jazzmusik. Und auf deinem komischen No-Name-Handy hast du dir Zoe Murphys Instagram Account hochgeladen.«
Jared und ich kennen uns schon ewig. Seine Mutter verkauft Immobilien. Sie hat damals für meine Mutter und mich was Neues zum Wohnen gefunden, als mein Vater gegangen ist. Ein paar Jahre lang haben die Kleinmans uns im Sommer immer in ihren Schwimmclub eingeladen und wir waren bei ihnen zu Hause zum Abendessen, einmal auch zu Rosh Hashanah. Ich war sogar auf Jareds Bar-Mizwa.
»Willst du wissen, was wirklich passiert ist?«, frage ich.
»Eigentlich nicht«, antwortet Jared.
Irgendwas drängt mich, es trotzdem zu sagen, es jemandem mitzuteilen, vielleicht nur, um was richtigzustellen. Nein, ich habe Zoe Murphys Instagram-Account nicht gestalkt. Jedenfalls nicht bei dieser Gelegenheit. »Das war nämlich so, ich bin auf einen Baum geklettert und runtergefallen.«
»Du bist aus einem Baum gefallen? Was bist du, eine Eichel?«
»Du weißt doch, dass ich diesen Sommer als Park-Ranger-Assistent gearbeitet habe?«
»Nein. Warum sollte ich das wissen?«
»Na, wie auch immer, jetzt bin ich so eine Art Baumexperte. Ich will ja nicht angeben. Aber ich hab da so eine unglaubliche zwölf Meter hohe Eiche gesehen und hab angefangen hochzuklettern und dann einfach …«
»Runtergefallen?«, sagt Jared.
»Ja, ist aber ’ne komische Geschichte, denn ich hab nach dem Sturz bestimmt geschlagene zehn Minuten einfach nur auf dem Boden gelegen und darauf gewartet, dass jemand kommt und mich findet. Jede Sekunde, hab ich mir immer gesagt. Nur noch eine Sekunde – dann kommen sie.«
»Und, sind sie gekommen?«
»Nein. Keiner ist gekommen. Das ist ja das Komische.«
»Verdammte Scheiße.«
Er sieht aus, als wäre ihm das echt peinlich für mich. Aber, hey, ist doch witzig, oder? Ich mein, ich weiß, wie jämmerlich sich das anhört, dass ich da auf dem Boden gelegen und gewartet habe, dass jemand kommt und mir hilft. Aber ich versuche, über meine eigene Unzulänglichkeit zu lachen. Doch wie üblich kommt das nicht rüber. Mir geht gerade ziemlich viel durch den Kopf. Omas sterben und ich habe dunkle Flecken auf dem Hemd, weil ich mich am Trinkbrunnen von oben bis unten mit Wasser bespritzt habe – und ich sitz noch nicht mal in der ersten Stunde, in der ich dann mindestens fünfundvierzig Minuten lang auf den Namen Mark hören muss.
Das hab ich davon, mit Jared Kleinman zu quatschen, der in einer Geschichtsstunde, in der es um den Holocaust ging, gelacht hat. Er hat geschworen, dass er über was gelacht hat, das in keinem Zusammenhang mit den grauenvollen Schwarz-Weiß-Fotos stand, die wir anderen mit offenem Mund anstarrten, und ich habe ihm geglaubt, irgendwie. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Typ absolut kein Gewissen hat.
Jared ist noch nicht weggegangen, deshalb stelle ich ihm eine Frage, die ich Alana Beck gestohlen habe. »Wie war dein Sommer?«
»Na ja, meine Gruppe hatte bei Erobert die Flagge die Nase vorn, und ich hab mich bei diesem Mädchen aus Israel, das irgendwie zur Armee gehen wird, bis in den BH vorgearbeitet. Und … beantwortet das deine Frage?«
»Übrigens.« Ich hab den Filzstift noch in der Hand. Keine Ahnung, warum ich mich mit dieser Gips-Sache abquäle, aber ich versuch’s trotzdem noch mal. »Willst du auf meinem Gips unterschreiben?«
Er lacht. Er lacht mir direkt ins Gesicht. »Warum fragst du mich?«
»Keine Ahnung. Weil wir Freunde sind?«
»Unsere Familien sind befreundet«, sagt Jared. »Das ist was ganz anderes, und das weißt du.«
Ach ja? Ich habe Videospiele auf Jareds Couch im Keller gespielt. Ich hab mir sogar vor ihm meine Badehose ausgezogen. Er ist derjenige, der mich darüber informiert hat, dass es nicht normal ist, Unterwäsche unter der Badehose zu tragen. Gut, auf diese Weise hängen wir nicht mehr miteinander ab und wir haben auch immer nur in Anwesenheit unserer Familien Zeit miteinander verbracht, aber diese gemeinsamen Momente sind schließlich auch was wert, oder nicht? Genau genommen sind Mitglieder einer befreundeten Familie doch trotz allem Freunde.
»Sag deiner Mom, sie soll meiner Mom sagen, dass ich nett zu dir war, sonst bezahlen meine Eltern die Versicherung für mein Auto nicht«, sagt Jared und geht davon.
Jared ist ein Arsch, aber er ist mein Arsch – also, nein, so meine ich das nicht, nicht so. Ich meine nur, dass er nicht das Allerletzte ist. Er führt sich auf wie ein Oberarsch, aber er ist dabei nicht total überzeugend. Seine Schildpattbrille und die lässigen Surfer-T-Shirts passen nicht so richtig zu ihm, und die megagroßen Kopfhörer, die er am Hals klemmen hat, sind nicht mal eingestöpselt. Aber selbst damit ist sein Look immer noch um Längen besser als alles, was ich je zustande kriegen könnte.
Beim Klingeln hab ich mein Klassenzimmer endlich erreicht und einen Platz gefunden. (Am liebsten sitze ich in der Reihe an der Tür oder ganz hinten im Raum, außer Sichtweite und nah am Ausgang.) Während ich mich einrichte, hab ich ein bisschen das Gefühl, was geschafft zu haben. Noch steht kein Name auf meinem Gips, aber ich habe jetzt schon mit mehr Leuten gequatscht als im ganzen ersten Monat des letzten Schuljahres. Läuft doch gar nicht so schlecht mit meinem Nutze den Tag.
Wer weiß. Vielleicht wird das doch noch ein ganz fantastischer Tag.
Kapitel 3
Nee. Absolut nicht fantastisch.
Die erste Stunde war gut, was heißen soll, es ist nichts Furchtbares passiert. Dasselbe galt für die nächsten paar Kurse. Alle Namenskorrekturen von Mark zu Evan waren erfolgreich. Ich fühlte mich ganz ordentlich, ich würde sogar sagen fast positiv.
Aber dann: Mittagspause.
Die Mittagspause mochte ich noch nie. Da fehlen mir die Regeln. Alle dürfen hingehen, wo sie wollen, und in meine Nähe wollen sie nie. Normalerweise setze ich mich auf einen Platz an einem abgelegenen Ecktisch bei den anderen Losern, zwangsernähre mich mit Erdnussbutter-Gelee-Sandwiches, die ich mir seit einem Jahrzehnt jeden Tag in die Schultasche packe. (Was ich esse, ist das Einzige, worüber ich in der Mittagspause die Kontrolle habe.) Aber in der Ecke zu sitzen, fühlt sich an, als würde ich mich verstecken – und ich hatte mir doch vorgenommen, genau das nicht zu tun. Nicht heute.
Ich entdecke Jared, der sich mit seinem Tablett durch die Menge schlängelt. Normalerweise bleibt er für sich und schreibt Programme auf seinem Laptop. Ich warte an der Kasse auf ihn. Er ist entzückt, mich zu sehen.
»Du schon wieder?«, fragt Jared.
Mein Instinkt rät mir, ihn ziehen zu lassen, aber ausnahmsweise sage ich meinem Instinkt mal, er soll sich verpissen. »Ich dachte, ich setz mich heute vielleicht zu dir?«
Jared scheint kurz vorm Kotzen zu sein. Aber bevor er noch versuchen kann, mich öffentlich zu verleugnen, verschwindet er hinter einer dunklen Silhouette. Zwischen uns hat sich das mysteriöse Wesen namens Connor Murphy geschoben. Connor pflügt wie ein Eisberg durch unser dahinplätscherndes Gespräch, mit gesenktem Kopf, ohne seine Umgebung wahrzunehmen. Jared und ich schauen ihm hinterher.
»Ich mag seinen neuen Haarschnitt«, murmelt Jared mir zu. »Total der Schulkillerstyle.«
Oh, scheiße.
Connor bleibt stehen, seine schweren Stiefel landen dumpf auf dem Boden. Seine Augen – das bisschen, was ich durch die wirren Haare sehen kann – feuern stahlblaue Todesstrahlen. Jede Wette, er hat Jared gehört. Vermutlich ist er doch nicht völlig blind und taub für seine Umwelt.
Connor rührt sich nicht, redet nicht, starrt nur. Dieser Typ ist echt gruselig. Er ist eiskalt. Vielleicht trägt er deshalb all diese dicken Klamottenschichten, obwohl genau genommen immer noch Sommer ist.
Jared mag ja dreist sein, blöd ist er nicht. »War nicht ernst gemeint«, sagt er zu Connor. »Das war ein Witz.«
»Ach ja, klar, saukomisch«, sagte Connor. »Ich lach mich tot.«
Jared guckt schon etwas weniger kackfrech.
»Du bist ja echt ein Komiker«, sagt Connor.
Jared stößt ein nervöses Kichern hervor, das bei mir ein nervöses Kichern auslöst. Ich kann nichts dagegen machen.
»Du bist ja so ein Freak«, ruft Jared Connor zu und zischt ab. Ich müsste hinter Jared her, aber meine Beine sind gelähmt.
Connor kommt zu mir. »Was findest du denn hier so lustig?«
Keine Ahnung. Ich mach blöden Scheiß, wenn ich nervös bin, was bedeutet, dass ich andauernd blöden Scheiß verzapfe.
»Hör verfickt noch mal auf, über mich zu lachen«, sagt Connor.
»Mach ich gar nicht«, sage ich, weil es wahr ist. Ich lache nicht mehr. Ich bin jetzt offiziell starr vor Angst.
»Du hältst mich für ’nen Freak.«
»Das hab ich nicht …«
»Du bist der verfickte Freak.«
BAM.
Ich lieg am Boden. Connor steht über mir.
Keine Bombenexplosion, sondern Connors Arme mit all diesen schwarzen Nietenarmbändern sind gegen meine Brust geknallt und haben mich aus den Socken gehauen.
Ehe er davonstürmt, sehe ich noch, dass er genauso erschüttert aussieht, wie ich mich fühle.
Ich setze mich auf, betrachte meine Hände. Der Staub von Millionen Turnschuhen klebt an meinen feuchten Handflächen.
Leute gehen vorbei, um mich herum, einige lassen wenig hilfreiche Kommentare vom Stapel, aber das spielt keine Rolle. Ich kann sie eh nicht hören. Ich kann mich nicht mal bewegen. Ich will nicht. Warum sollte ich auch? Es ist wie im Ellison Nationalpark, als ich aus diesem Baum gefallen bin. Ich hab nur so dagelegen. Ich hätte für immer unter diesem Baum liegen bleiben sollen. Genauso, wie ich heute hätte zu Hause bleiben sollen. Was ist denn verkehrt am Verstecken? Ist doch wenigstens sicher. Warum tu ich mir das immer wieder an?
»Bist du okay?«
Ich schaue auf.
Schock. Doppelschock. Erster Schock, weil das jetzt das zweite Mädchen ist, das heute mit mir spricht. Zweiter Schock, weil es Zoe Murphy ist. Ja, SIE, die allein Seligmachende.
»Mir geht’s gut«, antworte ich.
»Tut mir leid, das mit meinem Bruder«, sagt sie. »Er ist ein Psychopath.«
»Ja. Nein. Wir haben nur Quatsch gemacht.«
Sie nickt so wie meine Mutter, wenn sie es mit einem Patienten mit wahnhaften Störungen zu tun hat (z. B. mir). »Und«, sagt Zoe, »ist es gemütlich da unten auf dem Boden, oder …«
Ach ja, ich sitze auf dem Boden. Warum bin ich noch immer da? Ich stehe auf und wische mir die Hände an den Hosen ab.
»Evan, richtig?« sagt Zoe.
»Evan?«
»So heißt du doch?«
»Oh. Ja. Evan. Ich heiße Evan. Tut mir leid.«
»Was tut dir leid?«, sagt Zoe.
»Na, weil du Evan gesagt hast und ich das dann wiederholt hab. Und das nervt, wenn Leute so was machen.«
»Oh.« Sie streckt mir die Hand hin. »Ach so, ich bin Zoe.«
Ich winke, statt ihre Hand zu schütteln, wegen des Staubs, der an meiner verschwitzten Handfläche klebt, und sofort bereue ich es. Irgendwie habe ich diesen Dialog noch abgrundtief peinlicher gemacht, als er von vornherein schon war. »Nein, ich weiß.«
»Du weißt?«, sagt Zoe.
»Nein, ich meine, ich kenne dich. Ich weiß, wer du bist. Ich hab dich mit der Schulband spielen sehen, an der Gitarre. Ich liebe eure Jazzband. Ich liebe Jazz. Nicht allen Jazz, aber definitiv Jazzband-Jazz. Oh shit, klingt das bescheuert. Tut mir leid.«
»Du entschuldigst dich viel.«
Verdammt.
Sie lacht.
Keine Ahnung, warum ich so nervös bin, mal abgesehen davon, dass ich immer nervös bin und eben von einem Durchgeknallten zu Boden gestreckt wurde, der zufällig blutsverwandt mit Zoe ist. Aber warum hat ausgerechnet Zoe diese Wirkung auf mich? Schließlich ist sie nicht eine von diesen umwerfenden, total beliebten Mädchen. Sie ist einfach normal. Nicht normal im Sinne von langweilig. Normal im Sinne von real.
Ich glaube, es liegt daran, dass ich auf diesen Moment, die Gelegenheit mit ihr zu reden, so lange gewartet habe. Das lässt sich zurückverfolgen bis zu diesem Auftritt, bei dem ich sie das allererste Mal auf der Bühne gesehen habe. Ich wusste, dass sie eine Stufe unter mir ist. Ich hatte sie schon oft in der Schule gesehen. Aber bis zu diesem einen Konzert hatte ich sie nicht wirklich gesehen. Wenn man irgendjemand anders im Publikum – und es waren viele von uns da – fragen würde, wie sie an diesem Tag den Auftritt der Gitarristin fanden, würden sie wahrscheinlich fragen: »Wessen Auftritt?« Die Bläser sind die Stars, danach kommen der megalange Bassist und der obereitle Schlagzeuger. An dem Abend stand Zoe ganz am Rand. Sie hatte kein Solo oder sonst was. Sie tat sich nicht so offensichtlich hervor. Vielleicht habe ich mich, gerade weil sie im Hintergrund blieb, so stark mit ihr verbunden gefühlt. Für mich war niemand sonst auf der Bühne, als gäbe es nur diesen einen Scheinwerfer, der auf sie gerichtet war. Ich kann nicht erklären, warum, aber so war es.
Seitdem habe ich sie zig Mal auftreten sehen. Ich habe sie beobachtet. Ich weiß, dass ihre Gitarre eierschalenblau ist. Auf dem Gurt sieht man Blitze und die Umschläge ihrer Jeans sind voller Sterne, die mit Kugelschreiber auf den Stoff gekritzelt sind. Wenn sie spielt, tippt ihr rechter Fuß immer auf den Boden, sie hat die Augen fest geschlossen und so ein kleines Lächeln im Gesicht.
»Hab ich was an der Nase?«, sagt Zoe.
»Nein. Warum?«
»Du starrst mich an.«
»Oh. Tut mir leid.«
Ich hab es schon wieder gesagt.
Zoe nickt. »Mein Mittagessen wird kalt.«
Irgendwas sagt mir, dass sie das schon tausendmal gemacht hat, hingehen und den Mist in Ordnung bringen, den ihr Bruder angerichtet hat. Da sie jetzt die Bestätigung hat, dass mit mir alles in Ordnung ist, kann sie wieder ihrer Wege gehen. Aber ich will nicht bloß irgendein Mist für sie sein.
»Warte«, sage ich.
Sie dreht sich um. »Was denn?«
Offenbare dich, Evan. Sag was. Irgendwas. Sag ihr, dass du Miles Davis oder Django Reinhardt magst, diese berühmten Jazzmusiker. Frag sie, ob sie die auch gut findet. Erzähl ihr von dem Dokumentarfilm über Electronic Dance Music, den du vor Kurzem gestreamt hast, und wie du danach versucht hast, deinen eigenen EDM-Song zu machen, und der war natürlich ganz furchtbar, weil du total unmusikalisch bist. Gib ihr einfach irgendwas, woran sie sich festhalten kann, ein Stück von dir selbst, das sie mit sich herumtragen kann. Bitte sie, ihre Unterschrift auf deinen Gips zu setzen. Drück dich nicht davor. Sei nicht so verdammt meh. Und mach nicht das, was du jetzt gleich machen wirst. Du weißt genau, was.
Ich gucke auf den Boden. »Nichts«, sage ich.
Sie bleibt noch einen Moment stehen, dann scheinen ihre Zehen in den ausgetretenen Converse zum Abschied zu winken – und sie dreht sich um und geht weg. Ich sehe ihr dabei zu, Schritt für Schritt.
Als ich endlich zum Essen komme, stelle ich fest, dass mein Sturz nicht nur mein von vornherein schon dünnes Ego geplättet hat, sondern mein treues Erdnussbutter-Gelee-Sandwich auch.
•••
Mom schickt eine Nachricht, als ich im Computerraum bin, ich soll sie anrufen. Ich bin dankbar für die Störung. Seit zwanzig Minuten starre ich jetzt schon auf den leeren Bildschirm.
Ich versuche, diesen Brief für Dr. Sherman fertig zu kriegen. Als ich im April anfing zu ihm zu gehen, habe ich jeden Morgen vor der Schule einen Brief geschrieben. Das wurde zu einem festen Bestandteil meines Tagesablaufs. Jede Woche hab ich Dr. Sherman meine Briefe gezeigt, und obwohl ich nicht immer an das geglaubt habe, was ich geschrieben hatte, gab es mir irgendwie das Gefühl, was geschafft zu haben, wenn ich ihn den Packen Papier in den Händen halten sah. Das war ich, das da. Das war meine Arbeit. Das, was ich geschrieben hatte. Doch nach einer Weile wollte Dr. Sherman meine Briefe anscheinend nicht mehr sehen, und ich hab dann auch ziemlich bald aufgehört, welche zu schreiben. Hat ja auch nicht richtig funktioniert. Einen echten Sinneswandel haben die Briefe eigentlich nicht bewirkt.
Der Sommer brachte dann andere Routinen mit sich – und diese Briefe zu schreiben, gehörte nicht dazu. Dr. Sherman hat gespürt, dass ich meine Aufgaben hatte unter den Tisch fallen lassen. Jetzt will er meine Briefe wieder sehen, und wenn ich den hier nicht fertig kriege, habe ich heute nichts vorzuzeigen. Das hab ich schon mitgemacht, da ohne einen Brief in der Hand aufzutauchen, wenn er einen erwartet hatte. Einmal hatte ich meinen Brief zu Hause vergessen, und ich werde nie vergessen, wie Dr. Sherman mich angesehen hat. Er hat sich um einen ganz neutralen Gesichtsausdruck bemüht, aber mir konnte er nichts vormachen. Nach all diesen Jahren bin ich absoluter Spezialist darin, auch den leisesten Anflug von Enttäuschung bei anderen wahrzunehmen, und selbst der allerkleinste Hauch davon ist unerträglich.
Ich werde Dr. Sherman etwas zeigen müssen – und bis jetzt bin ich noch nicht weiter als Lieber Evan Hansen. Das ganze Zeug von heute Morgen habe ich gelöscht. Das hatte ich nur geschrieben, weil ich fand, dass es sich gut anhört.
Natürlich hörte es sich gut an. Fantasien hören sich immer gut an, aber sie helfen nicht, wenn die Realität kommt und dich zu Boden haut. Wenn sie deine Zunge zum Stolpern bringt und die richtigen Worte im Kopf einsperrt. Und wenn du dein Sandwich allein essen musst.
Einen Silberstreifen hatte dieser Tag aber doch. Zoe Murphy hatte nicht nur mit mir geredet, sie wusste jetzt auch, wer ich bin. Sie – kannte – meinen – Namen. Genau wie die Sache mit den Schwarzen Löchern, oder magische 3-D-Bilder ergibt das für mein Gehirn keinen Sinn. Nach unserem kurzen Austausch habe ich mich so hoffnungsvoll gefühlt, aber jetzt sorge ich mich, dass ich den Moment vergeudet habe und es so einen nie wieder geben wird.
Ich rufe meine Mutter an. Nachdem es ein paarmal geklingelt hat, will ich schon auflegen, aber dann geht sie ran.
»Schatz, hi«, sagt sie. »Hör mal, ich weiß, dass ich dich eigentlich zu deinem Termin bringen wollte, aber ich sitze im Krankenhaus fest. Erica hat sich wegen Grippe krankgemeldet, und ich bin die einzige Schwesternhelferin, die heute Dienst hat, also hab ich angeboten, ihre Schicht zu übernehmen. Eigentlich nur wegen der weiteren Budgetkürzungen, die heute Morgen angekündigt worden sind. Ich muss alles tun, um zu zeigen, dass ich zum Team gehöre, verstehst du?«
Klar, versteh ich.
Sie gehört immer zum Team. Das Problem ist nur, dass sie zu meinem Team gehören sollte. Meine Mutter ist eher so was wie ein Trainer, der vor dem Spiel eindrucksvolle Reden hält und dann, wenn angepfiffen wird und ich das Spielfeld betrete, nirgendwo zu finden ist.
»Alles gut«, sage ich. »Ich nehme den Bus.«
»Perfekt. Das ist perfekt.«
Vielleicht schwänze ich die Sitzung mit Dr. Sherman. Ich hab sowieso nie drum gebeten, da hingehen zu dürfen. Ich bin durch mit Nutze den Tag.
»Ich gehe von hier direkt zu meinem Kurs, ich bin erst spät zu Hause, also bitte, iss was. Im Gefrierschrank sind diese Klöße von Trader Joe.«
»Vielleicht.«
»Bist du mit diesem Brief schon fertig? Dr. Sherman erwartet, dass du einen mitbringst.«
Es ist glasklar. Die beiden reden miteinander über mich, kein Zweifel. »Tja, nein, ich hab ihn fertig. Ich bin gerade im Computerraum und drucke ihn aus.«
»Ich hoffe, das war ein guter Tag, Schatz.«
»Jaja. War es. Richtig toll.« Nur noch zwei Stunden heute.
»Großartig. Das ist großartig. Ich hoffe, das ist der Anfang eines großartigen Jahres. Ich glaube, so eines können wir beide gut gebrauchen, oder?«
Ja, lautet die Antwort, aber mir bleibt kaum Zeit, das zu denken, es auszusprechen schon gar nicht.
»Mist, Schatz. Ich muss laufen. Tschüss. Ich hab dich lieb.«
Ihre Stimme verschwindet.
Und ich bleibe zurück mit einer Einsamkeit, die so überwältigend ist, dass sie mir aus den Augen zu rinnen droht. Ich habe niemanden. Unglücklicherweise ist das keine Einbildung. Es ist die hundertprozentig natürliche, ungeschminkte Realität. Dr. Sherman ist da, aber der lässt sich dafür pro Stunde bezahlen. Und mein Vater ist da. Aber wäre er wirklich ans andere Ende des Landes gezogen, wenn ich ihn auch nur einen Scheiß interessieren würde? Meine Mom ist da, aber nicht heute Abend oder gestern Abend oder den Abend davor. Mal im Ernst, wer ist da, wenn es wirklich drauf ankommt?
Vor mir auf dem Computerbildschirm steht nur ein Name: Evan Hansen. Ich. Sonst hab ich keinen.
Ich lege die Finger auf die Tastatur. Keine Lügen mehr.
Lieber Evan Hansen,
es hat sich herausgestellt, dass dies doch kein ganz fantastischer Tag gewesen ist. Das wird auch keine ganz fantastische Woche oder ein ganz fantastisches Jahr werden. Warum auch?
Ach, ich weiß, weil es Zoe gibt. Und all meine Hoffnung hängt an Zoe. Die ich nicht mal kenne und die mich nicht kennt. Aber vielleicht, wenn ich es tun würde. Wenn ich vielleicht einfach mit ihr reden könnte, so richtig reden, dann vielleicht – dann wäre vielleicht trotzdem nichts anders.
Ich wünschte, alles wäre anders. Ich wünschte, ich wäre Teil von irgendwas. Ich wünschte, irgendwas, das ich sage, wäre von Bedeutung – für irgendwen. Denn – sehen wir den Tatsachen ins Gesicht: Würde es jemand merken, wenn ich morgen verschwunden wäre?
Herzliche Grüße,
dein bester und allerliebster Freund, Ich
Ich mache mir nicht die Mühe, das noch mal durchzulesen. Ich klicke auf Drucken und springe vom Stuhl auf, mit frischer Energie.
Eben beim Schreiben ist irgendwas passiert. Was für eine irre Idee, genau das zu sagen, was man fühlt, ohne innezuhalten und gleich daran rumzukritisieren. Okay, jetzt kritisiere ich dran rum, aber als ich es geschrieben habe und zum Drucker geschickt habe, da gab es kein Zögern, da war alles einfach im Fluss.
Nur ist ziemlich klar, dass der Brief umgehend zerrissen und in den Müll geworfen werden muss. Den kann ich Dr. Sherman nicht zeigen. Er verlangt immer Optimismus von mir und dieser Brief ist nichts als Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung. Ich weiß, dass ich Dr. Sherman meine Gefühle mitteilen und meine Mom glücklich machen sollte, aber meine echten Gefühle interessieren die nicht. Sie wollen nur, dass mit mir alles okay ist – oder dass ich wenigstens behaupte, dass es so ist.
Ich drehe mich um, will zum Drucker, aber stattdessen renne ich beinahe Connor Murphy über den Haufen. Ich zucke zusammen und mache mich darauf gefasst, wieder geschubst zu werden, aber er behält seine Hände bei sich.
»Also«, sagt Connor. »Was ist passiert?«
»Wie bitte?«
Sein Blick geht nach unten. »Dein Arm.«
Ich guck auch runter, so als wollte ich nachschauen, worauf er anspielt. Ach, das?
»Na ja«, sage ich, »ich hab diesen Sommer als Park-Ranger-Assistent im Ellison Nationalpark gearbeitet und eines Morgens auf meiner Runde habe ich diese tolle zwölf Meter hohe Eiche gesehen – und ich bin raufgeklettert und einfach … runtergefallen. Aber eigentlich ist das eine ziemlich witzige Geschichte, denn ich hab nach meinem Sturz bestimmt geschlagene zehn Minuten einfach so auf dem Boden gelegen und darauf gewartet, dass jemand kommt und mich holt. Jede Sekunde, hab ich mir immer gesagt. Nur noch eine Sekunde – dann kommen sie. Aber, na ja, es ist keiner gekommen, also …«
Connor starrt mich bloß an. Dann, als ihm aufgeht, dass ich fertig bin, fängt er an zu lachen. Das ist die Reaktion auf meine Geschichte, die ich hatte haben wollen, aber ich muss zugeben, dass sie jetzt, wo ich sie bekomme, überhaupt nicht das ist, worauf ich aus war. Vielleicht ist das die Vergeltung dafür, dass ich vorhin über Connor gelacht habe, aber irgendwie klingt sein Lachen nicht rachsüchtig.
»Du bist aus einem Baum gefallen?«, sagt Connor. »Das ist das beschissen Traurigste, was ich je gehört habe.«
Das kann ich nicht bestreiten.
Vielleicht liegt es an dem Flaum an seinem Kinn oder daran, dass sein Kapuzenshirt nach Rauch riecht, vielleicht ist es auch der schwarze Nagellack, oder dass ich gehört habe, er sei wegen Drogen von seiner letzten Schule geflogen, jedenfalls kommt mir Connor viel älter vor, als ich es bin, so als wäre ich ein Junge und er ein Mann. Und das ist irgendwie seltsam, denn als ich hier neben ihm stehe, wird mir klar, dass er ziemlich dürr ist. Und wenn er nicht diese Stiefel tragen würde, wäre ich vielleicht sogar größer als er.
»Ich geb dir einen Rat«, sagt Connor. »Denk dir lieber eine gescheitere Geschichte aus.«
»Ja, ist wohl besser«, gebe ich zu.
Connor senkt den Blick zum Boden. Ich auch.
»Sag doch einfach, du hast gegen irgendeinen Rassistentypen gekämpft.« Seine Stimme ist ganz leise.
»Was?«
»Wer die Nachtigall stört«, sagt er.
»Wer … oh, du meinst das Buch?«
»Ja«, sagte Connor. »Am Ende, erinnerst du dich? Jem und Scott rennen vor diesem Rassistenarsch weg. Der bricht Jem den Arm. Das ist so was wie eine Kriegsverletzung.«
Wer die Nachtigall stört stand bei den meisten von uns im ersten Highschool-Jahr auf der Lektüreliste. Mich überrascht nur, dass Connor das Buch tatsächlich gelesen hat und mit mir darüber reden will, gerade jetzt und so ruhig.
Nachdem er seine Haare hinters Ohr gestrichen hat, fällt ihm was auf. »Auf deinem Gips hat keiner unterschrieben.«


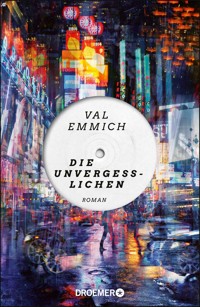














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)











