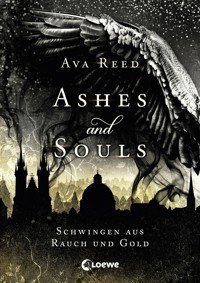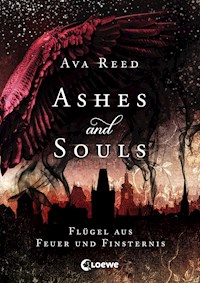9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: In Love
- Sprache: Deutsch
Manchmal müssen wir loslassen, um etwas zu bewahren
Schon viel zu lange hat Zoey sich wegen eines schrecklichen Erlebnisses in ihrer Vergangenheit versteckt. Jetzt will sie ihr Leben endlich wieder in die Hand nehmen und einen Neuanfang wagen. Für ihr Psychologiestudium zieht sie nach Seattle in die WG ihres Bruders. Einer ihrer neuen Mitbewohner ist Dylan - freundlich, aber verschlossen und mit einem Geheimnis, das nur wenige Menschen kennen. Doch Zoey zieht ihn magisch an, und so kommen sich die beiden langsam näher. Dabei müssen sie erfahren, wie schwer es ist, für sich selbst einzustehen und die eigene schmerzhafte Vergangenheit mit jemand anderem zu teilen ...
"Deeply ist wie eine tiefe Berührung voller Hoffnung auf Liebe, Akzeptanz und Heilung. Dieser Roman fesselt durch beeindruckende Charaktere, die für die ein oder andere bittersüße Wendung sorgen." DINA VON DINABLOGSY
Abschluss der IN-LOVE-Trilogie von Erfolgsautorin und Leser-Liebling Ava Reed
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 502
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
Widmung
Vorwort & Triggerwarnung
Soundtrack Zoey & Dylan
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Epilog
Danksagung
Rezept Zoeys Apfelstreuselkuchen
Die Autorin
Die Romane von Ava Reed bei LYX
Impressum
Ava Reed
Deeply
Roman
Zu diesem Buch
Fast fünf Jahre ist es her, dass ein schreckliches Ereignis Zoeys Leben für immer veränderte. Seitdem ist nichts mehr, wie es war, doch Zoey weiß, dass sie sich nicht ewig verstecken kann. Nun ist sie so weit, ihre Zukunft in die Hand zu nehmen und einen Neuanfang zu wagen. Um anderen, die etwas Ähnliches wie sie erleiden mussten, zu helfen, will sie Psychologie studieren – an der Harbor Hill in Seattle, wo auch ihr Bruder Cooper lebt. Hinter dem Rücken ihrer Eltern, die ihm die Schuld an dem Geschehenen geben und Zoey noch immer wie ein kleines Kind beschützen wollen, zieht sie in seine WG. Einer ihrer neuen Mitbewohner ist Dylan: groß, hilfsbereit und freundlich, allerdings recht schweigsam. Zwischen ihnen besteht von Anfang an eine besondere Verbindung, doch Dylan hütet ein Geheimnis. Eines, das ihn dazu bringt, Menschen nicht zu dicht an sich heranzulassen. Zoey hingegen zieht ihn magisch an, und so kommen sich die beiden näher, lernen sich kennen und zu vertrauen. Dabei müssen sie erfahren, wie schwer es ist, für sich selbst einzustehen und die eigene schmerzhafte Vergangenheit mit jemand anderem zu teilen …
Für jeden, dem das Leben auf die eine oder andere Weise gezeigt hat, dass es nicht fair ist. Und für jeden, der für sich, sein Leben und seine Träume kämpft.
Für Tami und Bianca, ohne die ich dieses Buch nicht hätte zu Ende schreiben können.
Und für Jil, die mir stets den Rücken stärkt.
Vorwort & Triggerwarnung
In Deeply werden Themen behandelt, die triggern können.
Dieses Buch wird sich in Bezug auf Zoey mit dem Thema sexuelle Nötigung / Vergewaltigung auseinandersetzen.
(Spoiler) Bei Dylan spielen die Themen Amputation und Prothese eine wichtige Rolle sowie ein Unfalltrauma. Beide Protagonisten befinden sich jedoch in oder jenseits der Heilungsphase.
Wie bereits in Madly möchte ich euch auch hier in Erinnerung rufen: Eure Gefühle sind wichtig. Wenn ihr euch unwohl fühlt mit diesen Themen oder beim Lesen, hört auf euch. Gefühle sind dazu da, gefühlt zu werden. Sie gehören zu euch, und niemand sollte sie kleinreden.
Ein kurzer Gedanke vorab: Sollten euch Sätze durch den Kopf gehen wie »Warum hat er / sie nicht sofort etwas gesagt …«, »Also ich hätte anders gehandelt …«, »Sie war mir zu schwach …«, »Damit kommt sie aber gut klar, das ist unrealistisch«, überlegt euch, sie zu überdenken. Jeder Mensch reagiert anders, jede Situation ist anders, und solange ihr nicht drinsteckt, wisst ihr nicht, was ihr tun würdet. Jedenfalls nicht wirklich.
Starke Frauen, schwache Frauen – es gibt nur Frauen. Das gilt ebenso für Männer. Es gibt Entscheidungen. Und das Recht, jede zu treffen, die wir treffen können oder wollen. Mit Sätzen wie den genannten erschaffen Menschen Schubladen für andere Menschen. Besonders Frauen für Frauen. Solche, aus denen wir ausbrechen wollen und sollten.
Denn was bedeutet es eigentlich, stark zu sein?
Soundtrack Zoey & Dylan
Harry Styles – Falling
Shawn Mendes – Use Somebody (Spotify Studios)
Fink – Looking too closely
Tom Walker – Leave a Light On (acoustic)
Nea – Some say
Kaleo – Way Down We Go (Stripped)
Harry Styles – Girl Crush
Jaymes Young – Stone
WILDES – Bare
Tender – Smoke
Sinéad Harnett – Unconditional (acoustic)
Abi Ocia – Running
Jessie Ware – Say You Love Me
Dan Owen – Stay Awake with Me (acoustic)
Hozier – Almost
Vance Joy – We’re Going Home
Isak Danielson – Power
Florence + The Machine – Stand By Me
Maren Morris ft. Hozier – The Bones
Beyoncé – If I Were a Boy
4 Non Blondes – What’s Up?
Tina Turner – What’s Love Got to Do with It
Imagine Dragons – Birds
Lewis Capaldi – Bruises
Mozart – Klaviersonate Nr. 11
»Sometimes good things fall apart so better things can fall together.«
Marilyn Monroe
Prolog
Manchmal müssen wir loslassen.
Zoey
Dylan ist eingenickt, kurz nachdem wir die Interstate erreicht haben. Zwar atmet er gleichmäßig und schnarcht dabei leise, aber er sieht sogar im Schlaf noch beunruhigt aus.
Er macht sich Sorgen.
Zum Glück habe ich ihn vorhin gebeten, die Ziel-Adresse ins Navi einzugeben, sonst wäre ich jetzt verloren. Bereits daheim wirkte er so mitgenommen, dass ich mir schon dachte, dass er irgendwann während der Fahrt einschlafen würde. Vielleicht habe ich auch nachgeholfen, der Kaffee war ein Placebo, er war koffeinfrei. Es hätte nichts gebracht, Dylan aufzuputschen, wo er doch ganz eindeutig Ruhe braucht.
Vor einigen Minuten habe ich den Wagen vom Highway gelenkt, Bellingham zog bereits an uns vorbei, jetzt fahre ich auf einer alten, nicht ganz so gut asphaltierten Straße, die von unendlich vielen winterkargen Bäumen gerahmt wird. Überall Wald und Grünflächen, nur vereinzelt Häuser und Farmen – bis wir bei der Adresse ankommen, ich den Wagen vor das Haus mit der Nummer vier lenke und am Straßenrand abstelle. Hier stehen ein paar Häuser mehr, aber das alles wirkt eher wie eine verwunschene Siedlung mitten im Nirgendwo als ein Vorort von Bellingham. Bisher habe ich nur eine Tankstelle ganz am Anfang der Straße und einen unscheinbaren Kiosk gesehen. Ich frage mich, welche kleinen Geschäfte weiter hinten verborgen liegen und was es sonst zu entdecken gibt.
Für einen Moment bleibe ich noch im Wagen sitzen, schaue mich von hier aus etwas um. Dabei erkenne ich einen dunkelroten Briefkasten an der Straße, an dem vorne in teils abgeblätterten Buchstaben der Familienname Anderson steht.
Der Weg zum Haus ist älter, einige Steine sind gebrochen, und das Gras hat seine besten Tage bereits hinter sich, dennoch ist es wirklich schön hier. Abgelegen, aber schön. Das Holzhaus wirkt urig und gemütlich, die Veranda ist ein Traum, obwohl sie nicht viel Platz bietet. Zumindest nicht, soweit ich das von hier aus erkennen kann.
Nach und nach lasse ich alles auf mich wirken, bevor mein Blick wieder zu Dylan wandert, der noch immer tief und fest schläft. Auch wenn ich ihn am liebsten nicht wecken würde, wird es Zeit, genau das zu tun. Sicher möchte er so schnell wie möglich nach dem Rechten sehen.
Ich bin ziemlich erledigt nach der langen Fahrt, aber verdammt froh, dass ich ihn nicht allein habe fahren lassen.
»Dylan?«, frage ich zaghaft und natürlich viel zu leise. Ich will ihn nicht erschrecken, aber irgendwie muss ich ihn wach kriegen, deshalb gebe ich meiner Stimme mehr Kraft. Leider bringt das wenig.
Vorsichtig lege ich meine Hand an seinen Oberarm und stupse ihn an. Erst sanft, dann immer heftiger. »Dylan, wir sind da«, sage ich ein weiteres Mal und rüttle noch einmal an seinem Arm.
Er wird langsam wach, räuspert sich und reibt sich über die Augen, bevor er sie blinzelnd aufschlägt.
»Alles okay?« Seine verschlafene und belegte Stimme bringt mich unwillkürlich zum Lächeln.
»Ja, alles okay. Wir sind bei dir zu Hause. Ich habe gerade geparkt.«
»Habe ich echt gepennt? Die ganze Fahrt über? Mist. Warum hast du mich nicht früher geweckt?« Er richtet sich auf, schaut mich aufmerksam an.
»Weil es nicht nötig war. Ich kam gut zurecht, und du sahst aus, als hättest du diese Pause bitter nötig.«
»Ich habe heute Nacht beschissen geschlafen. Und deshalb zu wenig. Also … Danke.« Er legt seine Hand auf meine, die noch immer – ohne dass ich es gemerkt habe – auf seinem Oberarm verharrt.
»Gern geschehen«, murmle ich und versinke in seinen Augen, in seinem Blick – und mein verräterisches Herz klopft viel zu laut und viel zu schnell. Der Wagen kommt mir auf einmal zu eng vor.
»Zoey, ich …«
»Wir sollten aussteigen«, unterbreche ich ihn sofort und ziehe mich zurück, während sich etwas in meiner Brust schmerzhaft zusammenzieht und ich zu ersticken drohe.
Nein!, schreit eine Stimme in meinem Kopf. Nein, ich kann das jetzt nicht hören. Das ist nicht der richtige Moment, nicht die richtige Zeit. Dabei ignoriere ich den Gedanken oder auch die Angst, dass es das vielleicht nie sein wird.
Es würde nur wehtun.
1
Auch Menschen, die dich lieben, können dir wehtun und dir das Leben schwer machen. Ganz besonders sie.
Zoey
»Bist du sicher, dass du das tun willst?«
Ganz abgesehen davon, dass Montag die Uni beginnt, wäre es ziemlich spät, sich erst jetzt darüber Gedanken zu machen, aber das behalte ich für mich. Meine Mom hat mir diese Frage in den letzten Tagen bereits so oft gestellt, dass ich sie nicht mehr hören kann, und es kostet mich unendlich viel Kraft, nicht frustriert aufzustöhnen oder ganz offensichtlich die Augen zu verdrehen. Natürlich meint sie es nur gut, das tut sie immer, ich weiß das, und ich liebe sie. Aber aus irgendeinem Grund raubt mir diese Fragerei seit Wochen mehr und mehr die Luft zum Atmen.
Statt einer genervten Erwiderung, die ich nur über die Lippen bringen würde, weil ich so nervös bin, und die ich später bereuen würde, setze ich mich auf meinen in die Jahre gekommenen Koffer, puste mir eine verirrte Strähne aus der Stirn und versuche angestrengt, den Reißverschluss zu schließen, ohne dass mir mein ganzes Zeug entgegenfliegt. Das ist der dritte Versuch, zuvor habe ich immer etwas vergessen. Jedes Mal wurde es schwieriger, das Ding wieder zu schließen. Wird es ein vierter, und das gegen neun Uhr morgens, bekomme ich nicht nur einen Nervenzusammenbruch, sondern verpasse auch meinen Zug.
»Ja, Mom. Ich bin sicher. Das bin ich, seit ich beschlossen habe, mich an der Harbor Hill zu bewerben«, betone ich, aber das Gesicht meiner Mom sieht weiterhin sehr leidend aus. Es macht keinen Unterschied. Meine Pläne stehen fest, und ich werde sie nicht ändern, nur weil sie meinen Eltern Bauchschmerzen bereiten.
Angespannt bemühe ich mich um ein Lächeln, und sie tut es mir gleich. »Ich bin nicht aus der Welt, und in den Semesterferien komme ich euch besuchen. Versprochen. Die nächsten sind schon im Frühsommer.«
»Wir schaffen das bestimmt schon vorher, Zoey.«
Dabei bin ich nur für meine Eltern so lange daheimgeblieben, sonst wäre ich bereits vor einigen Tagen nach Seattle aufgebrochen, um genügend Zeit zu haben, richtig anzukommen.
»Bestimmt. Die Zeit wird verfliegen, du wirst sehen.«
»Egal, was ist, vergiss nicht: Du passt bitte immer gut auf dich auf.« Das betont sie sehr nachdrücklich. Wären es Worte auf Papier, hätte meine Mom sie ganz sicher mit Edding und in Großbuchstaben geschrieben, unterstrichen und fett angemalt. Mit Ausrufezeichen dahinter.
»Werde ich.« Ich senke den Kopf ein wenig, damit sie nicht sieht, wie ich angestrengt die Lippen zusammenpresse.
Mir nicht anmerken zu lassen, dass mich dieser eine Satz von ihr auf gewisse Art verletzt, ist schwieriger als gedacht.
Mom sorgt sich um mich und würde alles dafür tun, die Zeit zurückzudrehen. Da ist sie nicht die Einzige. Aber mir so nachdrücklich zu sagen, dass ich auf mich aufpassen soll, und zwar immer und gut, das klingt, als hätte ich das damals nicht getan oder versucht. Als wäre es meine Schuld und als wäre mir meine Sicherheit egal gewesen. Es hört sich an, als hätte man mir das auf keinen Fall angetan, wäre ich nur vorsichtiger gewesen. Dann hätte man es mir nicht antun können. Doch von diesen Gedanken und der Wirkung ihrer Worte ahnt Mom nichts.
»Dass es ausgerechnet Seattle sein muss. Ausgerechnet diese Stadt …«, reißt mich ihre Stimme aus meinen Überlegungen, und jetzt kneife ich die Augen zusammen, bevor ich den Blick wieder hebe und einmal kräftig schlucke. Nicht nur Spucke, sondern erneut eine Erwiderung auf das Gesagte.
Genervt murre ich. Wegen des Koffers, der einfach nicht mit mir zusammenarbeiten will, und ganz besonders wegen Mom.
Ich gehe nach Seattle, weil diese Stadt für mich heute nicht mehr ewige Angst und Reue symbolisiert, sondern nichts weiter als einen Schritt nach vorne. Sie bedeutet für mich Heilung, einen Abschluss und einen Neuanfang. Ich werde nicht länger vor meiner Zukunft oder dieser Stadt davonlaufen. Und ich passe auf mich auf, das habe ich immer getan. Ich bin kein kleines Kind mehr und erst recht nicht die Zoey von früher. Mom will das anscheinend nicht begreifen, egal, wie oft ich es ihr erkläre. Sie kann die Vergangenheit nicht loslassen, dabei ist sie zu schmerzhaft, um sich an ihr festzuhalten. Irgendwann versteht sie das hoffentlich und meine Entscheidung ebenso. Besonders die, mich nicht von ihr aufhalten zu lassen.
Als ich Cooper vor ein paar Monaten besucht habe, bin ich nicht zusammengebrochen. Weder jene Nacht vor einigen Jahren noch die Stadt haben mich gebrochen. Sie haben mich nur verändert.
Ich werde das schaffen.
»Na, wie sieht es bei euch aus? Alles in Ordnung?« Dad stellt sich zu Mom in den Türrahmen meines Zimmers, während ich den Reißverschluss mit einem letzten Ruck zuziehe und mir mit dem Handrücken über die Stirn fahre. Endlich geschafft.
»Natürlich«, antwortet sie. »Ich kann es nur immer noch nicht glauben, dass unsere Tochter auszieht und studiert.«
»Wenigstens zieht sie in ein Mädchenwohnheim.« Mein Dad drückt meine Mom an sich und haucht ihr einen Kuss auf die Schläfe. Er ist fest davon überzeugt, man würde da schon auf mich achtgeben, immerhin gelten dort Regeln, und der Bereich gehört zusätzlich zum Unigelände. Ich glaube, dass er verdrängt, wie das mit Gefahren im echten Leben funktioniert, sonst könnte er mich nicht gehen lassen. Ist vielleicht ganz gut so.
Derweil schießt mir aufgrund seiner Worte die Röte ins Gesicht, und ich bekomme augenblicklich ein schlechtes Gewissen.
Ja, ich habe meine Eltern angelogen. Nachdem ich den Platz an der Harbor Hill bekommen habe und sie mir mein Sparkonto zur freien Verfügung übertrugen, habe ich ihnen gesagt, ich würde ins Wohnheim ziehen. Sie dachten also, das von ihnen und mir ersparte Collegegeld wäre in guten Händen und würde in eine sichere kleine Mädchen-WG mitten auf dem Campus fließen und nicht in eine Mietwohnung, in der zwei Männer wohnen. Einen kennen sie nicht, den anderen mögen sie nicht.
Wenn sie also wüssten, dass ich die neuen Möbel und alles, was ich brauche, zu ihrem ausgestoßenen Sohn und einem weiteren männlichen Mitbewohner liefern lasse, würden sie mich vermutlich nie gehen lassen oder mir den Abschied zur Hölle machen. Es war nicht gerade ein Kinderspiel, sie davon zu überzeugen, mich allein fahren zu lassen, anstatt mich zu bringen, aber nach tagelangem Diskutieren haben sie nachgegeben. Meine Möbel werden direkt geliefert, ich kann den Rest allein stemmen. Nicht nur wegen meiner Vorsätze, meiner Ziele und Wünsche, sondern auch wegen der Sache mit der Wohnung.
Deshalb bleibe ich still. Es ist noch nicht an der Zeit, das alles anzusprechen. Ich bin zwar kein Feigling, aber blöd bin ich auch nicht.
Das eben war außerdem eindeutig eine Anspielung auf meinen Bruder. Eine von unzähligen in den letzten Jahren, und das, obwohl sie nie von ihm oder über ihn reden wollen. Nicht direkt. Nicht wirklich. Es ist unfassbar, dass sie ihm nicht verzeihen, geschweige denn seinen Namen über die Lippen bringen. Nicht, dass es da überhaupt etwas zu verzeihen gäbe. Nicht für mich. Es sollte für niemanden so sein.
Es ist bald fünf Jahre her. Ob sie es akzeptieren wollen oder nicht: Seattle kann nichts dafür. Cooper hat ebenso wenig Schuld an dem, was an jenem Abend passiert ist, wie ich oder sie.
Trotzdem will ich das nicht immer wieder aufwärmen, mit ihnen streiten und ihnen wehtun, genauso wenig wie Coop. Ich habe alles versucht, habe über die Jahre geredet und geredet, habe sogar Milly hergebeten, doch meine Eltern haben nur abgeblockt, und so langsam weiß ich nicht mehr weiter. Mom und Dad tragen den Schmerz jeden Tag unaufhörlich mit sich, als wäre er festgewachsen und sie nicht bereit, ihn zu vergessen – aber sie müssen lernen, dass ich dazu bereit bin. Dass ich es sein muss. Wenn ich dieser Stadt, die ich mag, weiter aus dem Weg gehe, wird da immer etwas sein, das mich zurückhält. Das mir Angst macht.
Und das kann ich nicht zulassen. Ich gebe mich nicht auf, für nichts und niemanden, und ich werde mich trauen, der Angst ins Gesicht zu schauen, egal, wie groß sie ist. Das hat man mir in jener Nacht nicht nehmen können, selbst wenn ich es nicht sofort erkannt habe. Auch in Zukunft lasse ich mir das nicht nehmen.
Nein, das lasse ich nicht zu …
Ich stehe auf, schaue mich um, und das erste Mal, seit feststeht, dass ich an der Harbor Hill für ein Psychologie-Studium angenommen wurde, wird mir ganz schwer ums Herz. Ich hoffe, das neue Bett wird genauso bequem sein, dennoch wird mir mein altes mit der durchgelegenen Matratze und der darüber angebrachten blauen Himmeltapete samt Wolken fehlen. Ebenso wie der schlichte Holzschreibtisch, auf dessen Unterseite Cooper, Mason und ich unsere Namen eingeritzt und seltsame Comics gezeichnet haben, die keiner von uns mehr versteht. Oder mein flauschiger bunter Rundteppich, der die meisten der Kerben auf dem Parkett verdeckt. Am Ende vermisse ich wahrscheinlich sogar die Hitze, die einen hier an heißen Sommertagen umhüllt und niederdrückt, und die Schräge über meinem Bett, an der ich mir über all die Jahre viel zu oft den Kopf gestoßen habe. Oder Coop, wenn er in meinem Zimmer geschlafen hat, weil Mom und Dad nicht mitbekommen sollten, dass er zu spät zu Hause war. Dann ist er über das riesige Spalier an der Hauswand auf die Garage geklettert und von da aus weiter in mein Zimmer. Seines liegt auf der anderen Seite des Hauses, direkt neben dem unserer Eltern. Da gibt oder gab es für ihn keine Möglichkeit, unbemerkt hinein- oder herauszukommen. Dafür hat er mein Zimmer benutzt. Ständig hat er den Efeu oder anderes Grünzeug auf dem Boden verteilt, wenn er heimkam. Meine Eltern haben Coops Zimmer seit dem Tag, der alles veränderte, nicht mehr betreten …
Mason und Cooper haben unzählige Male mit mir vor dem Fernseher gesessen oder mir ausgedachte Geschichten erzählt. Mase war oft hier. Er ist wie ein zweiter großer Bruder für mich.
Diese alten Erinnerungen branden gegen mich wie Wellen an eine felsige Küste, und ich atme ihren Duft ein, weil er nach Geborgenheit riecht. Weil er mich für einen Moment vergessen lässt, dass es nicht mehr ist wie früher.
Cooper spielt kein Football mehr, sondern steht kurz vor seinem Abschluss in Kunst und Kunstgeschichte und tut endlich das, was er liebt. Dad ist nicht mehr stolz auf ihn, und Mom sorgt dafür, dass ich nicht vergessen kann, was ich gerne vergessen würde. Mason kommt nicht mehr zu Besuch und ich habe hier gewohnt – die ganze Zeit über. Irgendwie allein. Mein Bruder hat mir gefehlt, und ich denke, nicht nur, dass er nicht da war, hat mich diese Einsamkeit fühlen lassen, sondern auch das Wissen, dass es meinen Eltern nicht so geht. Auch in meiner Einsamkeit war ich allein.
»Zoey?« Die Hand meines Dads an meiner Schulter lässt mich aufschrecken. Ich blinzle heftig.
»Entschuldige, ich war in Gedanken versunken. Was hast du gesagt?«
»Wann wir dich zum Bahnhof fahren sollen – und ob mit den Möbeln alles in Ordnung geht? Sie kommen doch morgen an, nicht wahr?« Dad lächelt warm, und mir steigen die Tränen in die Augen. Cooper sieht wie eine jüngere Version von ihm aus, nur mit etwas mehr Haar, Bart und einen Kopf größer. Dunkelbraunes Haar, markante Gesichtszüge, braune Augen, ähnliche Statur. Man sieht Dad an, dass er früher viel Sport getrieben hat. Dass er viel gelacht und dass er gelebt hat. Die tiefen Fältchen um die Augen stehen ihm.
Und jetzt? Am liebsten würde ich Dad anschreien dafür, dass er mich behandelt, als wäre ich der größte Schatz der Welt, und meinen Bruder wie jemanden, der alles nur kaputt macht. Träume, Wünsche, und wenn es nach ihm gehen würde, ebenso mein Leben.
Mein Räuspern erfüllt den Raum, und ich reiße mich zusammen.
»Wenn nichts schiefgeht, ja. Ansonsten kommen sie am Montag, das kriege ich schon hin.«
»Ich bin so froh, dass du so lange hier warst, aber … reichen die wenigen Tage zur Eingewöhnung, mein Schatz?« Mom tritt vor. Heute trägt sie ein stilvolles graues Wollkleid und dazu dunklen Lippenstift. Ich finde schon immer, dass sie wie Grace Kelly aussieht.
»Macht euch nicht so viele Sorgen. Ich komme zurecht. Und falls etwas sein sollte, rufe ich an.« Jetzt bringe ich ein ehrliches, breites Lächeln zustande, und Mom tut es mir gleich. Dad nickt nur und klopft mir auf die Schulter.
»Gut. Das ist gut.«
»Außerdem ist ja …«, rutscht es mir raus, und sofort beiße ich mir auf die Unterlippe.
Es ist still im Raum. Bis ich seufze, tief Luft hole und den Satz zu Ende bringe, den ich nie beginnen wollte. »Lane ist auch noch da. Genau wie Mason. Ich bin nicht allein. Und ich werde neue Freunde finden.«
Moms Ausdruck wird ernst, und ihr Blick wandert zu meinem Vater, der seine Hand zurückzieht und sein Gesicht leicht abwendet. Dads Kiefer mahlen, ich kann es genau erkennen, und die Freundlichkeit und Warmherzigkeit von eben sind aus seinem Gesicht verschwunden. Es wirkt mit einem Mal schmerzverzerrt, und mein ganzer Körper spannt sich an, um sich auf seine nächsten Worte vorzubereiten. Jene, die immer kommen.
Du solltest ihn nicht sehen. Er macht alles nur schlimmer. Er hat schon damals nicht auf dich aufgepasst, er war nicht da, er wird es auch heute nicht sein. Es ist alles seine Schuld! Ich will seinen Namen nicht mehr hören – nie wieder.
Aber ich warte vergebens. Dad greift lediglich stumm nach meinem Koffer, und obwohl er Rollen hat, trägt er ihn.
»Wir sollten gleich los, sonst verpasst Zoey den Zug. Ich warte unten am Auto auf euch.«
Nachdem er mein Zimmer verlassen hat, reibe ich mir über die Arme und stehe unschlüssig meiner Mom gegenüber.
»Dein Dad hat recht, wir sollten gehen.«
»Mom?«
»Ja?«
»Ich wollte es nicht ansprechen. Aber … er ist doch mein Bruder«, wispere ich, und meine Stimme bricht. Er ist mein Bruder, will ich schreien. Euer Sohn.
Ihr macht mehr kaputt, als ihr ahnt.
»Ich weiß«, gibt sie sanft zurück, als hätte sie meine unausgesprochenen Gedanken laut und deutlich gehört. »Ich weiß …« Dann geht auch sie, und ich kann nicht anders. Ich lasse den Tränen freien Lauf.
2
Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Egal, wie sehr wir sie planen, egal, wie sehr wir sie zurechtbiegen wollen: Sie wird stets einen Weg finden, uns auf gute oder schlechte Weise zu überraschen. Unsere Vergangenheit ist der beste Beweis dafür …
Zoey
Mein Pulli ist vollkommen durchgeschwitzt. Es war zu kalt draußen und zu heiß im Auto, und ich war aufgewühlt von dem Gespräch mit meinen Eltern und dem Abschied, der daraufhin folgte. Es war bedrückend und zugleich befreiend.
Irgendwie kroch auf dem Weg zum Zug, den ich tatsächlich beinah verpasst hätte, das erste Mal richtige Angst in mir hoch. Davor, dass meine Eltern recht haben mit dem, was sie mir seit Wochen ununterbrochen sagen: dass ich noch nicht so weit bin, dass ich diese Stadt vielleicht wirklich nicht verkrafte oder das Studium. Und am meisten Angst habe ich davor, dass es zwischen uns nicht so sein wird wie früher, wenn ich bei Cooper wohne. Dass wir uns entfremdet haben durch diese Sache, die nie hätte passieren dürfen.
Ich will nicht, dass es meinem Bruder wieder schlechter geht, nur weil ich ein Zimmer nebendran wohne.
Für einen kurzen Moment überrollen mich diese Sorgen und das schlechte Gewissen, denn Mase war derjenige, der Cooper letztlich dazu überredet hat, Ja zu sagen zu meinem Einzug in die Wohnung. Zuerst wollte er mich fernhalten von sich, Seattle und dem Studium. Er hatte sich bereits wenig begeistert gezeigt, als ich ihm letztes Jahr beim Frühstück mit Andie und June beiläufig davon erzählt habe.
Aber schließlich haben sie ihn alle dazu gebracht, seine Meinung zu ändern. Coop kann eben nicht aus seiner Haut. Er sorgt sich um mich, wie meine Eltern, aber das muss er nicht. In der letzten Zeit ist er zumindest etwas lockerer geworden, was ziemlich toll ist.
Ein Lächeln stiehlt sich auf mein Gesicht.
Ich freue mich auf Coop und die anderen. Besonders auf Mase, den ich bei meinem letzten Besuch leider verpasst habe.
Mein Bruder hat mir in der Zwischenzeit sogar Fotos von Dylan geschickt, damit ich weiß, wie er aussieht, bevor ich einziehe. Sie waren oft verwaschen, unklar oder zu klein. Dafür, dass mein Bruder so gut zeichnen kann und ein Auge für schöne Dinge hat, ist die Fotografie definitiv nichts für ihn.
Das Erste, was mir bei den Bildern von Dylan durch den Kopf geschossen ist, war: Er sieht ihnen nicht ähnlich.Das ist gut. Zuerst war ich erleichtert, im Anschluss daran bin ich für zwei Tage in ein Loch gefallen. Er sieht ihnen nicht ähnlich – den Gesichtern, die ich nicht nur in jener Nacht vor mir hatte, sondern in unzähligen weiteren in meinen Träumen. Und ich habe mich geschämt, dass ich einen Menschen danach beurteile. Dass es so tief in mir sitzt. So verwurzelt, dass ich es nicht immer unterdrücken oder kontrollieren kann.
Meine Finger fangen an zu zittern, deshalb reibe ich meine Hände fest aneinander und lenke meine Gedanken auf das Bild hinter dem großen Fenster. Die Landschaft zieht schnell an mir vorüber, in Portland hat es vor wenigen Tagen sogar geschneit. Jetzt ist es noch kalt draußen, aber von Eis und Schnee ist auf dem Weg nach Seattle bislang nichts mehr zu erkennen. Dunkle Wolken sammeln sich am Himmel, türmen sich am Horizont wie Berge auf. Aber auch dieser faszinierende Anblick kann mich gerade nicht von meinen Sorgen und Gedanken ablenken oder gar beruhigen.
Ich fange wieder an zu schwitzen.
Es wird Zeit, ich sollte etwas Musik hören, dann geht es mir besser. Musik hilft. Seit dieser Sache halte ich es nur selten lange in vollkommener Stille aus, ohne mit jemandem zu reden, ohne etwas zu tun. Ich bin froh, wenigstens nachts keine mehr zu brauchen. Das ist ein Fortschritt.
Meine Finger finden mein Handy in dem großen Rucksack neben mir, sodass ich es herausziehen kann. Ich drücke den Button an der Seite, damit das Display angeht und …
Akkustand niedrig. Bitte laden.
Mist. Keine drei Prozent mehr. Wie konnte das passieren? Und wo ist mein Ladekabel? Ich greife nochmals in den Rucksack und wühle dieses Mal richtig darin herum. Ein Buch, meine Kopfhörer, ein selbst gemachtes Sandwich von Mom, Wasser, das Ticket … aber wo ist das verfluchte Kabel?
Mein Blick fällt auf den großen Koffer, den ich zwischen dem Sitz neben mir und dem davor eingeklemmt habe. Oh nein. Falls es drin ist, werde ich auf keinen Fall den Versuch wagen, es zu suchen und damit die Tore der Hölle öffnen. Oder die meiner Unterhosen – je nachdem, ob mir zuerst Dämonen oder meine Slips entgegenfliegen, sobald der Koffer explodiert und ich ihn nicht mehr zukriege.
»Guten Tag, Ihre Fahrkarte«, bittet mich der Kontrolleur, und ich komme seiner Anweisung nach. Ein fies klingender Piepton dringt währenddessen an mein Ohr, und ich weiß, was er bedeutet. Und zwar bevor der Schaffner mein Ticket entwertet, ich mich bedanke und einen Blick auf mein Handy werfe.
Akku leer, der Bildschirm ist schwarz.
Murrend packe ich es wieder weg. Nicht nur, dass ich ohne Musik auskommen muss, ich kann auch Cooper nicht schreiben, wann genau ich ankomme. Nicht, dass ich das nicht längst getan hätte, aber sicher ist sicher. Sonst muss ich mir wohl ein Taxi nehmen, was auch okay wäre. Mir wird nichts passieren … mir wird nichts passieren!
Ich schließe die Augen und denke an Millys Worte: »Die Zukunft liegt nur teilweise in deiner Hand, die Vergangenheit gar nicht mehr. Aber das Hier und Jetzt, das kannst du beeinflussen. Atme tief durch. Zähl runter, Zoey. Von irgendeiner beliebigen Zahl unter zehn. Und nach jeder Zahl sagst du dir etwas Positives, etwas Gutes. Denk dir die Sätze, oder sag sie laut, damit dein Körper und deine Seele sie hören, damit eine Verbindung entsteht. Damit du sie begreifst.«
Vier …
Es ist vorbei.
Drei …
Ich habe es überlebt und alles richtig gemacht.
Zwei …
Es war nicht meine Schuld.
Eins …
Ich kann atmen. Ich bin frei.
Keine zehn Atemzüge später merke ich, wie sich dieses Mantra auf meinen Körper legt, wie eine Decke, und mich beruhigt. Es zeigt Wirkung. Es tut gut. Und es ist nichts dabei, sich das immer wieder zu sagen.
Ich bin da! Hallo, Seattle.
Froh darüber, endlich aus diesem Zug ausgestiegen und am Ziel zu sein, strecke ich mich ausgiebig, bevor ich meinen Rucksack richte und meinen Koffer ins Rollen bringe.
Aus einem Reflex heraus wollte ich schon wieder auf mein Handy schauen, aber Akkus laden sich leider nicht wie von Zauberhand auf, deshalb ist es immer noch gut verstaut im Rucksack und das Display mit Sicherheit weiterhin stockdunkel. Ich kann nur hoffen, dass sich das Ladekabel tatsächlich im Koffer befindet, sonst muss ich mir morgen ein neues besorgen. Egal wie oft ich darüber nachdenke, ich kann mich nicht erinnern, wann ich es wohin gepackt habe. Noch weniger, dass mich ein so winziges Kabel jemals derart in Unruhe versetzt hat.
Während ich das Gleis verlasse, zeigt die große Uhr im Bahnhof vierzehn Uhr zehn an. Der Zug hatte ein wenig Verspätung, und Coop wollte draußen vorm Haupteingang auf mich warten.
Eilig bahne ich mir meinen Weg, schlängle mich zwischen den vielen Reisenden hindurch, bis ich durch die Haupttüren trete und den Bahnhof verlasse. Kalte Stadtluft schlägt mir entgegen, und ich sauge sie tief und willkommen heißend in meine Lungen ein. Beim Ausatmen bilden sich vor meinem Gesicht kleine Wolken, die sofort wieder verblassen. Ein Frösteln durchzieht mich, und ich greife nach meiner Kapuze, ziehe sie über meine Haare bis hinunter in mein Gesicht. Danach schließe ich eilig die Jacke, obwohl mir bis eben noch viel zu warm war, aber hier draußen ist es um einiges kälter als im Zug, und es regnet in Strömen. Das scheint es seit Stunden zu tun, wenn ich mir die Gehwege und Straßen betrachte. Das Wasser fließt nicht mehr richtig ab, Dreck und Schlamm sammeln sich an einigen Stellen in Pfützen, Rinnen und Unebenheiten. Trotzdem gehe ich weiter, trete von dem schützenden Gebäude des Bahnhofs weg, obwohl ich bereits spüre, wie die Wassertropfen sich in meinen Jeans festsetzen und diese ganz klamm werden lassen. Ich halte nach meinem Bruder Ausschau, aber er ist nirgendwo zu sehen. Einen Moment später lasse ich es mir nicht nehmen, einen Blick zurück zu werfen, wie beim letzten Mal. Und zwar nach oben zum Glockenturm der King Street Station, der mit seinen rotbraunen Backsteinen in den verdunkelten grauen Himmel ragt. Unzählige Regentropfen fallen auf mein Gesicht und kitzeln meine Nase. Obwohl Portland mit Sicherheit kein Dorf ist, hat Seattle ein ganz anderes Flair als meine Heimatstadt. Vielleicht fühle ich mich hier mehr daheim als dort. Vielleicht habe ich das schon immer getan, trotz …
»Schau an, wer da ist.« Ich kenne diese Stimme. Unwillkürlich lächle ich so breit, dass meine Wangen schmerzen, und drehe mich dabei um. »Meine Sister from another Mister.« Mase grinst, breitet den Arm aus, mit dem er nicht den großen dunklen Regenschirm festhält, und ich lasse den Koffer stehen, um ihn kräftig zu umarmen.
»Uff, nicht so stürmisch!«, stöhnt Mase, und ich spüre sein Lachen an meiner Wange, während ich mich an ihn drücke.
Ein erstes Gefühl von Zu-Hause-angekommen-Sein überfällt mich.
Vorsichtig löse ich mich von ihm und mustere sein Gesicht.
»Na, Bruderherz?«, scherze ich. »Du siehst gut aus.« Das stimmt. Er sieht nicht nur fantastisch aus wie immer, sondern vor allem happy und sehr zufrieden.
»Mir wird es viel besser gehen, wenn ich meine neuen Schuhe aus diesem Wassertümpel rauskriege und dich nach Hause. Lass uns gehen. Auf, auf, Knirps.«
»Hey! Ich bin schon lange kein Knirps mehr.« Mase hatte mir den Spitznamen gegeben, da waren wir jung und ich tatsächlich klein und schmächtig. Das ist eine halbe Ewigkeit her.
Sichtlich amüsiert schnappt er sich meinen Koffer und hält den Schirm über uns beide. »Du wirst immer mein Knirps bleiben. Tut mir leid.«
»Es tut dir kein Stück leid.«
»Erwischt. Aber da ich dich abhole und zu Coop bringe, musst du da durch.«
»Wo ist er eigentlich?« Ich schaue mich erneut um, bevor ich mich bei Mase einhake und er uns auf die andere Seite des Bahnhofs lotst, an der er seinen Wagen abgestellt hat. Ich kann ihn schon von Weitem erkennen. Den eleganten dunklen Sportwagen, zu dem auch James Bond nicht Nein sagen würde, mit den im Regen glänzenden Chromfelgen.
»Er hat versucht, dich zu erreichen, um dir Bescheid zu geben, dass er es nicht schafft. Ich habe es auf dem Weg hierher auch versucht, aber es ging nur die Mailbox dran. Alles okay mit deinem Handy?«
»Der Akku hat den Geist aufgegeben. Anscheinend habe ich es über Nacht nicht geladen, und das Kabel steckt irgendwo in diesem Monstrum.« Vage deute ich auf das Ungetüm an Masons Seite.
»Verstehe. Wir sind in ein paar Minuten da, dann kannst du alles auspacken.«
»Wie nervös war er deswegen?« Dass mein Bruder mich nicht erreicht hat, war bestimmt nicht beruhigend oder leicht für ihn.
»Auf einer Skala von eins bis zehn?«
»Zwölf?«, rate ich, und Mase verzieht das Gesicht.
»Könnte man sagen. Aber er hat sich wacker gehalten. Äußerlich hätte man ihm nur eine Acht gegeben, aber wir kennen Coop. Glaub mir, er wird es überleben. Unser Riesenbaby.« Damit bringt Mason mich zum Lachen. »So, da sind wir.« Er schließt das Auto auf und geht zum Kofferraum. »Scheiße, ist der schwer.« Er hebt mein Gepäck in den Wagen, während ich den Schirm halte.
»Du brauchst ein größeres Auto, Mase, mit viel größerem Stauraum. Eine Familienkutsche.«
Er schlägt den Kofferraum zu und lacht.
»Weißt du mehr als ich, oder warum sollte ich ein größeres Auto brauchen?«
»Womöglich gibt es bald kleine Junes und Masons. Das wäre doch schön.« Ich dachte, er würde sich ob meiner Worte erschrecken, aber Mase lächelt weiter, und für eine Sekunde sieht es so aus, als würde er den Gedanken an Kinder genießen.
»Ich liebe diesen Wagen, das weißt du. Wenn es irgendwann nötig wird, besorge ich mir einen anderen und stelle den hier in die Garage, bis die Zeit gekommen ist, die Familienkutsche einzumotten.«
»Klingt nach einem Plan.«
Mase zwinkert mir zu und hält mir die Tür auf, ganz der Gentleman, der er seit jeher war. Im Anschluss verstaut er den Schirm, den er kräftig ausgeschüttelt hat, und steigt selbst ein. Ein paar Regentropfen haben sich auf seinem schiefergrauen Mantel gesammelt, ansonsten hat er nichts von dem miesen Wetter abbekommen. Lächelnd reibt er ein paarmal die Hände aneinander, bevor er sich anschnallt und den Schlüssel in der Zündung dreht. Als der Motor aufröhrt, schiebe ich den Rucksack in den Fußraum und die nasse Kapuze endlich von meinem Kopf.
»Aber hallo! Was sehen meine Augen da?«
Nervös fahre ich mir über die Haare. »Was sagst du?«
»Steht dir gut. Haben deine Eltern einen Herzinfarkt erlitten oder einen Schlaganfall?« Ich boxe ihm gegen die Schulter.
»Ein bisschen was von beidem«, gestehe ich, während Mason das Auto in Bewegung setzt und die Scheibenwischer das Wasser zur Seite drücken. Ich drehe die Heizung etwas höher und lasse mich mit einem wohligen Seufzer in den Sitz sinken.
»Das glaube ich. Ich will dabei sein, wenn Coop es sieht.«
»Es sind nur Haare, Mase. Ich hab nicht mal eine richtige Farbe genommen, es ist nur weißgrau gefärbt.«
»Mir musst du das nicht erklären, aber du kennst deinen Bruder. Für ihn wirst du nie erwachsen sein.«
»Wenn er das mit dem ausgeschalteten Handy verkraftet, dann auch meine Haare. Du hast mir übrigens immer noch nicht verraten, warum er mich nicht selbst abholen konnte. Sind June und Andie eigentlich auch da, wenn wir in der Wohnung ankommen?«
»Das wirst du schon sehen.«
»Ziemlich kryptisch.«
»Du kennst mich, Knirps.« Lachend schüttle ich in gespielter Verzweiflung den Kopf, während Mase weiterspricht. »Und was June und Andie angeht: leider nein. Heute ist Freitag, und die beiden haben einen langen letzten Unitag wegen eines dämlichen intensiven Ferienkurses zum Thema Marketing oder so. Sonst würde June mit Sicherheit bei Andie im Zimmer sitzen und auf dich warten. Ich soll dich aber schon mal von beiden lieb grüßen. Du musst June sagen, dass ich es dir ausgerichtet habe, sie hat gedroht, mir wehzutun, sollte ich es vergessen.«
»Sie tut dir gut, weißt du das?«
Sein Ausdruck wird ganz verträumt. Mase hat es richtig erwischt. »Ich weiß.«
»Trotzdem sehr schade«, erwidere ich enttäuschter als gedacht und lausche dem Regen, der ununterbrochen auf das Auto prasselt.
»Du wirst sie nachher zu Gesicht bekommen oder spätestens am Sonntag, da bin ich sicher. June und ich haben zwar ein paar Termine, und Andie muss arbeiten, aber sie nimmt sich bestimmt Zeit für dich. Vielleicht steht sie Sonntag gar nicht im Plan. Du kannst auch in den Club kommen und sie da besuchen.«
Auf keinen Fall. Dazu bin ich noch nicht bereit – oder? Doch das sage ich nicht.
Stattdessen tue ich es ihm gleich und grinse, während sich unsere Blicke einen Moment begegnen. »Nur, wenn du willst, dass Cooper am Ende wegen mir auch graue Haare bekommt …«
3
Auf einmal schlägt dein Leben ein neues Kapitel auf – und du merkst es nicht einmal.
Dylan
»Verfluchter Dreck, Kacke, so ein Mist.« Cooper beißt die Zähne fest zusammen und schafft es trotzdem, klar und deutlich zu fluchen. Eine Kunst für sich, wie ich finde. Socke sitzt neben ihm und fängt an zu jaulen, einfach aus Solidarität.
Ich liebe den kleinen Kerl.
»Du hast echt kein Händchen für Kisten und Möbel und so ’n Zeug, oder? Wie hast du damals Andies Bett aufbauen können, ohne dass es direkt danach wieder zusammengebrochen ist?«
»Witzig, wirklich witzig«, gibt er brummend zurück, während er sich weiter die Hand reibt, auf die er gerade mit dem Hammer gehauen hat. Nagel knapp verfehlt, würde ich sagen.
Ich streichle Socke derweil den Kopf. Er hechelt, seine Zunge hängt ihm seitlich aus dem Maul, und er sieht aus, als würde er sich köstlich über Cooper amüsieren.
Ich grinse und schaue mich im Zimmer um. Der Schreibtisch steht und wenn Coop noch den letzten Nagel in die Rückwand hämmert, ohne sich was zu brechen, bald auch der Kleiderschrank. Der Schreibtischstuhl ist noch verpackt, genau wie die Matratze für das große Bett. Das Bettgestell ist als Nächstes dran. Ich checke noch einmal die Anleitung dafür, um direkt damit weitermachen zu können.
»Du solltest das kühlen«, gebe ich zu bedenken, während ich versuche, die seltsamen Bilder der Instruktion zu verstehen. Diese schlampige Arbeit würde ich nicht mal einem Praktikanten unterstellen. Wenn wir das so zusammenbauen, ähnelt es am Ende mehr einem Werk von Picasso als einem Bett …
»Geht schon.« Mit mehr Schwung als nötig hämmert Coop den letzten Nagel ins Holz, und danach blitzt so etwas wie Genugtuung in seinen Augen auf. »Zoey hat gesagt, der ganze Kram würde erst morgen ankommen. Zum Glück waren wir hier, sonst hätten sie alles vor die Garage in den Regen gestellt, und das wäre eine riesige Sauerei geworden.«
»Hatten die eine Abstellgenehmigung?«
»Frag mich was anderes. Wenn nicht, hätten sie es wieder mitgenommen, und wir hätten das Zeug aus irgendeinem Lager herschaffen müssen. Das ist nicht besser.«
»Andie macht aus dir ’ne richtige Plaudertasche, was?« Schmunzelnd fahre ich mir durch den Bart.
»Bei dir ist es nicht anders. Du kannst mittlerweile sogar richtige Unterhaltungen führen. Ich bin beeindruckt.«
»Und Chili kochen!«
»Es war auch ein harter Weg. Mit Mac’n’Cheese sind das jetzt ganze zwei Gerichte, ohne dass jemand im Anschluss daran stirbt.« Er applaudiert, und ich lache auf. Damit hat er nicht ganz unrecht. Seit Mason ausgezogen ist und sich am Anfang mit June ein wenig zurückgezogen hat, haben Andie und ich alle zwei Wochen sonntags gekocht. Dabei hat sie mir einige neue Gerichte gezeigt und ein paar Dinge beigebracht. Das Chili ihrer Mom ist der Wahnsinn, und mittlerweile kriege ich es hin, ohne dass es zu fad ist, mir etwas anbrennt oder jemand einen Schärfetod stirbt. Einmal war es sogar so schlimm, dass Coop nach einem großen Löffel davon eine Flasche Milch runtergeschüttet und wie ein Baby geweint hat. Ganz zur Belustigung von Mason, der mit June zu Besuch war und zu seinem Glück noch nicht probiert hatte. June war ganz sie selbst. Sie hat geschimpft, sie seien alle unhöflich und Memmen. Anschließend hat sie ganze drei Löffel geschafft, bevor sie keuchend und tränenüberströmt meinte, dass sie sich gleich die Eingeweide rausreißen müsste, wenn man ihr das Chili nicht operativ entfernen würde.
Andie hat mir die Schulter getätschelt und uns danach Pizza bestellt. Es war einer der besten Tage seit langer Zeit. Außerdem hat es Spaß gemacht, und das, obwohl ich kein geborener Koch bin. Leider ist Andie momentan so eingespannt mit der Uni und der Arbeit, dass wir es nicht mehr schaffen, zusammen zu kochen. Cooper ist ja auch noch da und hätte gern was von seiner Freundin.
»Das Chili wirst du nie vergessen, oder?«
»Ich weiß nicht, wovon du redest. Und jetzt lass uns das Bett fertig machen.«
Amüsiert schüttle ich den Kopf und helfe ihm, den Bettkasten zusammenzubauen. Und zwar ohne diese selten dämliche Anleitung.
Keine halbe Stunde später sind wir fertig und die Möbel stehen. Nur das Bett muss noch an die Seite geschoben werden.
»Bei drei«, sagt Coop und zählt an. Gemeinsam heben wir das Ding hoch und gehen Richtung Wand. An dieselbe Stelle, wo vorher Masons Bett stand.
»Woher willst du wissen, dass sie es dort stehen haben will?«
»Wird schon passen. Sonst stell ich es ihr halt wieder um. Aber wie ich sie kenne, schafft sie das auch allein. Als wir jünger waren, hat sie einmal im Jahr ihr komplettes Zimmer umgeräumt, weil es ihr zu langweilig wurde. Und zwar ohne Hilfe.«
»Klingt spannend.«
»Eher nervtötend. Sie hat das immer abends gemacht, bis in die Nacht hinein und hat jedes Mal das ganze Haus geweckt.«
»Soll ich dir ’ne Tüte Mitleid kaufen?«, scherze ich. In dem Versuch, mir den Mittelfinger zu zeigen und den Rahmen des Bettes nur mit einer Hand zu halten, fängt dieser an zu wackeln, und wir geraten aus dem Takt. Vor allem, weil Coop das mit dem Mittelfinger trotzdem inbrünstig durchzieht.
Mit Schwung und da ich versuche, dagegenzuhalten und das Gewicht auszubalancieren, knallt die scharfe Kante knapp unterhalb meines Knies an mein Bein, und ich beiße die Zähne zusammen, weil sie mir – trotz Liner – nicht nur etwas der empfindlichen Haut zwischen Holz und Carbon einklemmt, sondern direkt einen Nerv trifft. Shit.
Ohne das Gesicht allzu stark zu verziehen, aber mit verkrampfter Körperhaltung stelle ich den Rahmen genau dort ab, wo er hingehört, und hieve mit Coop den Lattenrost sowie die neue Matratze hinein. Mit aller Macht halte ich mich davon ab, mir über das Bein zu reiben, um den Schmerz zu vertreiben.
Als wir endlich alles fertig haben, springt Socke aufs Bett und bleibt glückselig in der Mitte sitzen.
»Du bist keine große Hilfe«, teilt Cooper ihm klar und deutlich mit, was Socke sofort den Kopf neigen lässt. Ganz so, als könne er ihn verstehen.
Ich schnappe mir den kleinen Kerl, nehme ihn auf den Arm und kraule ihn hinter den Ohren.
»Hör nicht auf den Griesgram. Er ist nur neidisch, weil er nicht so niedlich ist wie du.«
Cooper nuschelt irgendwas vor sich hin, und bevor ich richtig kontern kann, nehmen wir das Geklimper von Schlüsseln und leise Stimmen wahr. Die Haustür knallt zu.
Mase und Zoey sind da.
Ich lasse Socke runter, der nun freudig mit dem Schwanz wedelnd aus dem Zimmer rennt, vermutlich direkt zu Mason.
»Hey, mein Kleiner«, höre ich ihn, und Zoey gibt verzückte Laute von sich. Der Hund wickelt wirklich jeden um den Finger. Würde mich nicht wundern, wenn in wenigen Tagen auch in diesem Zimmer ein Bettchen für ihn bereitsteht.
Als ich mich zu Cooper umdrehe und in sein Gesicht schaue, mache ich die unterschiedlichsten Gefühle bei ihm aus. Die, die der Grund dafür waren, weshalb er einerseits alles wollte, nur nicht, dass Zoey hierherzieht, und andererseits jene, weshalb er es wollte und sich freute.
Vor einigen Monaten habe ich Zoeys Besuch verpasst, ich war bei Granny daheim, weil sie etwas Hilfe brauchte. Sie ist nicht mehr die Jüngste, auch wenn sie das weder zugibt noch gerne hört. Zu der Zeit hat Zoey ihrem Bruder wohl auch verkündet, dass sie nach Seattle ziehen will, sobald sie eine Zusage der Harbor Hill bekommt.
Ich glaube, Cooper hat das erst nicht richtig greifen können. Aber spätestens ein paar Tage nach Masons Auszug, als das Zimmer leer war und Andie auf einmal sagte, Zoey könne ja hier einziehen, hat es bei ihm klick gemacht.
Mir sind nicht alle Details bekannt, ich kenne nicht die ganze Geschichte, aber ich bin kein Vollidiot. Ich weiß, was mit ihr passiert ist, warum Coop in Therapie war und auch, dass es hier passierte. In dieser Stadt. Mehr als das muss ich gar nicht wissen …
Und das führt wiederum dazu, dass ich durchaus verstehen kann, warum Cooper durchgedreht ist – zwischen dem Wunsch, seine Schwester bei sich zu haben, und dem Drang, eine meterhohe Mauer um diese Stadt zu ziehen, damit sie nie wieder reinkommen kann.
Die Schritte werden lauter, und in der Sekunde, in der Coopers Mund sich zu einem Grinsen verzieht und ich mich der Tür zuwende, kommt zuerst Socke hineingestürmt, danach tritt Zoey ein, während Mason sich seitlich an den Türrahmen lehnt. Sie fällt ihrem Bruder um den Hals, gibt ihm einen Kuss auf die Wange und begrüßt ihn fröhlich, bevor sie mir zurückhaltend zuwinkt und ein zartes »Hey« herausbringt. Sie hat eine angenehme Stimme.
Ich grüße zurück, richte jedoch meine Aufmerksamkeit sofort auf den Hund, der hechelnd an meiner Seite hochspringt. Also nehme ich ihn wieder auf den Arm, von wo aus er alle gut im Blick hat, und streichle ihn. Der kleine Scheißer ist eindeutig viel zu verwöhnt. Ein Umstand, den ich jedes Mal betone, aber June meint immer bloß, ich sei Teil des Problems. Keine Ahnung, was das heißen soll …
Unhöflich zu sein ist übrigens nicht meine Absicht, aber ich gestehe, dass es mir in diesem Moment schwerer fällt als gedacht, vollkommen unbefangen mit Zoey umzugehen. Einer der Gründe, warum ich meinen Blick eher auf Socke gerichtet halte als auf sie. Innerlich fluche ich und ärgere mich, dass ich eben nicht offener und freundlicher war, aber es ist das erste Mal, dass ich ihr begegne, und ich hatte nicht erwartet, dass … Keine Ahnung, was genau ich erwartet habe. Dass man es ihr ansieht? Anmerkt? Das klingt so bescheuert, dass es wehtut.
»Du bist nicht an dein Handy gegangen, das hat mich mindestens zehn Jahre meines Lebens gekostet, das weißt du, oder?« Ich blicke auf und erkenne, dass Zoey Luft holt, um zu antworten, aber Cooper hat bereits ganz andere Probleme. »Oh mein Gott, was ist mit deinen Haaren passiert?«, fragt er irritiert. Oder auch verstört, und das bringt mich nun doch dazu, sie von der Seite zu mustern. Es ist ein helles Silber- oder Weißgrau, und die glatten Strähnen fallen ihr in Stufen weich über die Schultern.
»Ich werde alt«, sagt sie lachend, aber Coop hält sich erschrocken die Hand vor den Mund, was sie nur noch mehr zum Lachen bringt. »Du hattest recht, es ist anscheinend sehr schockierend für ihn«, wendet sie sich an Mason, der nickt und sich danach in seinem alten Zimmer umsieht.
»Ich merke schon, es tut euch kein bisschen weh, dass ich ausgezogen bin«, unterbricht er vollkommen entspannt das Haarthema sowie meine wirren Gedanken über Zoeys Vergangenheit, und ich bin dankbar dafür. Ich bin so verkrampft wie lange nicht mehr – und mein Bein schmerzt immer noch. Danke für nichts, Coop.
Masons Worte lenken auch Cooper von Zoeys neuer Frisur ab.
»Endlich hab ich mal meine Ruhe.« Dabei wissen wir alle, dass Cooper das nicht so meint und es den beiden nicht leichtgefallen ist in den letzten Wochen. Sie sind wie ein altes Ehepaar, das man auseinandergerissen hat.
»Coop stand am Anfang jeden Tag in deinem Zimmer, und Andie hat ihn getröstet«, bringe ich ein und genieße es, wie Coopers Ausdruck von geschockt zu verärgert wechselt.
»Erzähl keinen Scheiß«, murmelt er, aber Mase ist längst lauthals am Lachen.
»Keine Sorge, dem da ging es ähnlich.« Ich zeige vage auf Mason, der sofort innehält.
»Hat June etwa angerufen? Ich bestreite alles! Ich hatte nur was im Auge …«
Das bringt uns alle endgültig zum Lachen – und ihres dringt am lautesten zu mir. Es fesselt mich. Das erste Mal gestatte ich es mir, nicht nur ihre Haare genauer zu betrachten, während sie keine drei Meter von mir entfernt steht.
Sie ist vielleicht eins fünfundsechzig groß und begegnet meinem Blick mit einem unergründlichen, aber zugleich offenen, und hält ihn ohne Scheu fest. Als würde sie wissen, dass ich sie genau in diesem Moment von oben bis unten mustere.
Sie hat wunderschöne Augen, schießt es mir durch den Kopf, und ich muss schwer schlucken, weil dieser Gedanke vollkommen unerwartet kommt. Schöne und besondere Augen. Eines ist braun, wie die von Cooper. Der gleiche Ton, die gleiche Wärme. Aber das andere, das sieht aus, als wäre es ins Meer gefallen und hätte dessen tiefes, kaltes Blau angenommen.
Mir ist bewusst, dass sich Coop und Mase unterhalten und sticheln und Zoey mich noch immer neugierig ansieht, ganz genau so, wie ich sie anstarre. Nur kann ich jetzt im Gegensatz zu eben nicht mehr wegschauen. Ich betrachte ihre schmale Nase, die zart gebräunte Haut und das markante Kinn, das helle Haar, das all das einrahmt. Und am Ende wandert mein Blick zurück zu ihren Augen. Bleibt an ihnen hängen, gleich einer Fliege im Netz einer Spinne. Ich kann mich nicht davon lösen …
Doch in der Sekunde, in der Socke plötzlich direkt an meinem Ohr zu bellen anfängt, zucke ich zusammen und breche den Blickkontakt ab. Dabei verlagere ich unüberlegt das Gewicht und muss mich konzentrieren, mir meinen Schmerz nicht anmerken zu lassen.
Ich räuspere mich. Hätten der Schmerz und der Hund mich nicht zur Besinnung gebracht, wäre ich am Ende vielleicht auch noch rot geworden. Einfach so.
Verdammt, das ist Coops kleine Schwester!, ermahne ich mich.
»Entschuldigt mich, Socke muss mal raus.« Keine Ahnung, ob das stimmt, aber der Kleine hebt auch so das Bein.
Ich nicke allen schnell zu und setze mich in Bewegung.
»Danke für deine Hilfe, das war echt klasse«, sagt Coop.
»Keine Ursache.« Ich verabschiede mich von Mase, der mich durchlässt und mir auf die Schulter klopft, verlasse eilig den Raum und verschwinde samt Hund in meinem Zimmer.
Gleich gehe ich mit ihm Gassi, das war keine Lüge, aber vorher muss ich mich setzen. Ich brauche nur einen Moment.
Socke beobachtet mich und hockt sich brav in sein Bettchen, während ich das irgendwie auch tue. Mit schmerzverzerrtem Gesicht lege ich kurz den Kopf in den Nacken, schließe die Augen und atme kräftig durch, als meine Beine entlastet werden.
Es ist relativ duster hier drin, die zugezogenen dunklen Vorhänge lassen nur wenig Licht rein, und draußen ist es ohnehin nicht besonders hell. Ich höre, wie der Regen gegen die Fensterscheibe prasselt. Monoton, in einem entspannenden Rhythmus. Ich liebe dieses Geräusch, besonders im Winter. Es erdet mich, sorgt dafür, dass ich meine Gedanken besser ordnen oder zur Ruhe kommen kann.
Leider kann es mich nicht genug ablenken oder mir meinen Schmerz nehmen.
Coop hat mich mit der Bettkante ganz schön erwischt. Noch heftiger und unvorteilhafter als zuvor gedacht. Verdammter Dreck. Zum Glück waren wir da fast fertig mit allem, und am Ende darf ich wohl dem Hund neben mir danken, dass ich mir eben keine allzu dumme Ausrede überlegen musste, um abhauen zu können. Auch wenn ich wegen Zoey einen kleinen Moment vergessen habe, dass mein Bein überhaupt wehtut.
Ich schlage die Augen auf, setze mich aufrecht hin und knöpfe meine Jeans auf. Der Reißschluss gibt ein leises Ratschen von sich, als ich ihn öffne und mir meine dunkle Boxershorts entgegenspringt. Ich ziehe erst das rechte Bein aus der Hose, danach wesentlich vorsichtiger das linke.
Die Jeans landet raschelnd auf dem Boden, und ich rolle das Sleeve langsam und konzentriert von meinem Bein runter, schließlich über das Knie und die Prothese, um diese abzulegen. Erleichtert lehne ich sie neben mich an das Bett und streiche über den ziehenden und pochenden Stumpf, der noch immer von dem Liner umschlossen ist. Leise fluchend und mit zusammengepressten Zähnen mache ich weiter, hebe den Strumpf über meiner Haut zuerst etwas an, danach rolle ich ihn auch runter, um besser nachsehen zu können, wie schlimm es ist.
Ich muss mein Knie und meinen Stumpf nicht lange betrachten, um zu wissen, dass das wahrscheinlich einen blauen Fleck geben wird. Zumindest ist die Stelle ziemlich gerötet. Keine Seltenheit bei diesem Bein. Genauso wenig wie die Schmerzen – egal, ob reale oder Phantomschmerzen. Der Unfall und die OP sind zwar lange her, aber das ändert nichts mehr. Die Schmerzen werden bleiben. Zumindest bei mir.
Meine Finger massieren meine Haut und Muskeln, fahren über die Narben und Unebenheiten, bis ich das Gefühl habe, dass es wenigstens etwas besser wird und ich erneut eine Prothese anziehen kann.
Eine Prothese, ja, aber ganz sicher nicht die von eben. Ich habe schon vor Wochen gemerkt, dass sie nicht mehr gut sitzt, dass sie zu viel Luft hat und sich nicht länger bestmöglich an mein Bein schmiegt. Insgesamt hat sie ihre guten Zeiten hinter sich, der Verschleiß macht sich bemerkbar, und nach drei Jahren wird es Zeit für eine neue Alltagsprothese.
Kraftvoll stoße ich mich vom Bett ab und bewege mich – halb gehend, halb hüpfend – um Socke herum auf die große Kiste mir gegenüber zu. Das Zahlenschloss mag auf den ersten Blick albern wirken, gibt mir aber das Gefühl von Sicherheit. Vielleicht auch von Kontrolle, wer weiß. Vor allem aber lässt es mich ruhig schlafen, genau wie der Schlüssel an meiner Zimmertür.
Sie wissen es nicht. Weder Cooper noch Mason und schon gar nicht June oder Andie, die ich erst halb so lange kenne. Natürlich sind sie alle zu Freunden geworden, und ich bin sicher, sie würden es irgendwie verstehen, nicht lachen oder sonst einen Scheiß abziehen, denn jeder von ihnen hat seine eigenen Probleme, aber … Ich schüttle den Kopf. Ich bin dennoch sicher, das hier ist zu groß. Das ist es manchmal noch für mich. Selbst wenn sie es nicht wollen würden, zweifle ich daran, dass sie mich danach weiter so sehen würden wie jetzt.
Ich will kein Mitleid mehr. Ich will nicht mehr diesen Blick, das Getuschel, all diesen ganzen Der-arme-Dylan-Quatsch. Wenn sie einen Bruchteil der Geschichte kennen würden, wenn sie hören würden, dass es ein Unfall war, wäre es unumgänglich. Wenn aus diesem Bruchteil die ganze Geschichte werden würde, wäre es mehr als Mitleid. Es wäre Unverständnis, und das will ich erst recht nicht. Deshalb bin ich fortgezogen und hab Granny alleingelassen, obwohl es mir das Herz gebrochen hat und ich auch in ihrer Nähe einen Platz an einem College gefunden hätte, aber eben nicht für das Fach, was mir seit der Reha etwas bedeutet und das ich studieren wollte. Deshalb bin ich hier.
Wütend hebe ich den Deckel der Kiste an, bis er an der Wand anliegt, und betrachte den Inhalt. Hier verbergen sich keine Erinnerungsstücke, Hanteln oder Footballzeug. Letzteres habe ich längst verbrannt. Hier liegen meine Beine. Klingt erst mal wie ein Witz, aber es ist keiner. Natürlich liegen hier nicht alle meine Beine, aber zumindest ganz unten findet sich meine erste Prothese. Ich werde es wohl nie schaffen, sie wegzuschmeißen. Darüber stapeln sich ein paar ältere Modelle und ganz oben meine aktuellen Prothesen, die mich durch den Alltag bringen oder den Sport mit Elliott. Verschiedene Aufsätze, unterschiedliche Legierungen und Füße. Daneben lagern meine Strümpfe, die Liner, Cremes und so ein Zeug.
Ich ziehe eine PVC-Prothese mit Carbon-Überzug und beweglichem Federfuß heraus und lasse meine Finger über die Legierung gleiten. Diese Prothese ist eine derjenigen, die an meine Beinstärke angepasst wurden, damit man den Unterschied beider Beine nicht bemerkt. Heißt, die Wade ist genauso dick wie meine eigene. Durch den jahrelangen Sport, das Footballspielen und das Fitnessprogramm, das ich auch heute noch so gut wie möglich durchziehe, ist mein rechtes Bein nicht gerade eine Stelze. Und eine Prothese, die einem Streichholz ähnelt, würde garantiert unter der Jeans oder Jogginghose auffallen.
Mit dem neuen Ersatzbein hüpfe ich zurück, setze mich wieder aufs Bett und ziehe zuerst den Liner über den Stumpf, ohne Luft darin einzuschließen. Den Fehler habe ich einmal gemacht und die Blasen und roten Stellen, die ich davongetragen habe, waren die Hölle. Mit der Zeit hat man Übung darin, es geht schneller, und man weiß, wie man ihn ansetzen muss, damit das nicht passiert. Danach folgen die Prothese und der Check, ob alles an seinem Platz ist.
»So, jetzt ist es etwas besser, was Kumpel?«, murmle ich und schaue dabei zu Socke, der sich auf den Rücken gedreht hat und mich mit heraushängender Zunge beobachtet.
Ich stehe wieder auf, bewege mich etwas und schaue, ob die Prothese richtig sitzt und ich mein volles Gewicht darauf verlagern kann.
Cooper hat die dämliche Kante echt an der ungünstigsten Stelle gegen mein Bein gehauen. Ganz abgesehen von dem Phantomschmerz, der mich seit den frühen Morgenstunden begleitet und in Wellen über mich hereinbricht, ist nun auch die Haut am und um den Stumpf empfindlich. Natürlich gibt es Medikamente gegen alles, weil Schmerz eben Schmerz ist und manchmal nicht auszuhalten, aber ich versuche, ohne sie auszukommen. Nein, das ist falsch. Ich bemühe mich, mit so wenig wie möglich auszukommen. Das trifft es eher. Ich will nicht davon abhängig werden, jeden Tag was einwerfen. Und ich will wissen, dass ich es auch ohne aushalten kann. Zumindest die meiste Zeit. Aber manchmal komme auch ich nicht drum herum.
Trotz der kleinen Pause und dem Wechseln der Prothese treibt mir der Gedanke, sie jetzt weiterhin zu tragen, spazieren zu gehen und nachher kurz zu Elliott für einen neuen Trainingsplan zu müssen, den Schweiß auf die Stirn und lässt mich Bauchschmerzen bekommen.
Deshalb schließe ich nicht sofort den Deckel der Kiste und bringe das Schloss erneut an, sondern schnappe mir zuerst die Schmerzmittel, die darin liegen. An der rechten Seite. So viel zu, ich bemühe mich, ohne auszukommen …
Ach, verdammte Kacke.
Mit den Tabletten in der Hand fühle ich mich beschissen, fast schuldig. Ich fühle mich schwach. Es ist egal, ich schlucke sie runter und mache die Kiste endlich zu. Lauter und fester als beabsichtigt.
Es ist nicht mehr so, dass ich mich grundsätzlich für mein Bein schäme. Früher ja, ständig. Aber heute? Nein. Dennoch ist der Zug, reinen Tisch zu machen, irgendwie abgefahren. Ich bin nach Seattle gezogen, habe Mason und Cooper kennengelernt und nichts gesagt. Es verging ein Tag, eine Woche, ein Monat. Sie merkten nichts und ich sagte immer noch nichts. Heute, nach mehr als drei Jahren, erscheint es mir unmöglich.
Und ganz ehrlich? Es macht keinen Unterschied.
»Komm, wir gehen Gassi, Kleiner.«
4
Neuanfänge sind berauschend. Sie sind neu, und sie sind ein Anfang. Sie sind eine zweite Chance. Was kann es Schöneres geben?
Zoey
Obwohl Dylan bereits aus dem Zimmer gegangen ist und wir uns von Mase verabschiedet haben, der mittlerweile nach Hause gefahren ist, starrt mein Bruder mich immer noch an, als hätte ich eben einen lebenden Frosch verschluckt.
»Lane! Es ist nicht mal eine Farbe«, wiederhole ich ernst und belustigt zugleich, weil er seit meiner Ankunft nicht darüber hinwegkommt, dass sich meine Haarfarbe das erste Mal in meinem Leben verändert hat.
Er schnaubt. »Du siehst eben anders aus. Und hör damit auf, mich Lane zu nennen, dann denke ich immer, ich hab was ausgefressen.«