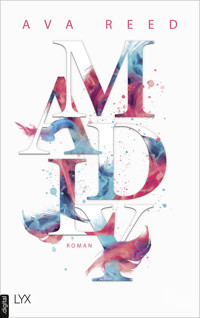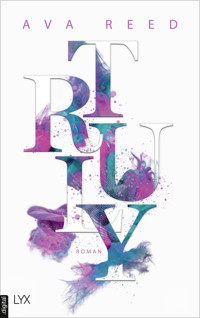Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ueberreuter Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Wenn Worte fehlen, dann beginnt eine Geschichte über Verlust, Mut und Selbstfindung Hannah hat ihre Worte verloren. In der Nacht, als ihre Zwillingsschwester Izzy stirbt. Niemand beendet mehr ihre Sätze, niemand denkt ihre Gedanken zu Ende, niemand vervollständigt ihr Lachen. Egal, was ihre Eltern versuchen – Hannah schweigt. Um Izzy festzuhalten, schreibt sie Briefe an sie. Schreibt. Verbrennt. Immer wieder. Doch der Schmerz bleibt, und die Stille wird zu ihrem einzigen Zufluchtsort. Bis Levi in ihr Leben tritt. Er drängt nicht. Er hört zu, auch wenn Hannah kein Wort spricht. Und er stellt die Frage, die alles verändert: Wer ist Hannah – jenseits des Verlustes? - Emotional tiefgehend – Eine Geschichte über Trauer und Heilung - Große Gefühle – Sprachlosigkeit, Hoffnung und erste Liebe - Authentische Charaktere – Nahbar, ehrlich und berührend - Mut machende Botschaft – Auch aus Stille wächst neue Stärke - Jugendbuch ab 12 Jahren – Für junge Leser*innen und Erwachsene gleichermaßen Mit großer Sensibilität zeigt Ava Reed, dass selbst aus tiefster Stille neue Stärke wachsen kann. Ein Buch, das berührt. Und lange nachklingt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 329
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
»Ich finde Worte, ich finde Tausende davon und sie alle sind in meinem Kopf. Sie finden nur den Weg nicht hinaus.«
Hannahs Worte sind verstummt – in der Nacht, in der ihre Zwillingsschwester Izzy ums Leben kam. Wer soll nun ihre Gedanken weiterdenken, ihre Sätze beenden und ihr Lachen vervollständigen? Niemand kann das. Hannah ist in der Stille ihrer Worte gefangen. Bis sie Levi trifft, der mit aller Macht versucht herauszufinden, wer sie wirklich ist …
Ava Reed
DieStillemeinerWorte
Inhalt
Über das Buch
Musikliste
Brief an Izzy
Kapitel 1 – Hannah
Kapitel 2 – Hannah
Kapitel 3 – Hannah
Kapitel 4 – Levi
Kapitel 5 – Hannah
Kapitel 6 – Hannah
Kapitel 7 – Levi
Kapitel 8 – Hannah
Kapitel 9 – Levi
Kapitel 10 – Hannah
Kapitel 11 – Hannah
Kapitel 12 – Levi
Kapitel 13 – Hannah
Kapitel 14 – Hannah
Kapitel 15 – Levi
Kapitel 16 – Hannah
Kapitel 17 – Levi
Kapitel 18 – Hannah
Kapitel 19 – Levi
Kapitel 20 – Hannah
Kapitel 21 – Levi
Kapitel 22 – Hannah
Kapitel 23 – Hannah
Kapitel 24 – Hannah
Kapitel 25 – Levi
Kapitel 26 – Hannah
Kapitel 27 – Hannah
Kapitel 28 – Levi
Kapitel 29 – Hannah
Kapitel 30 – Levi
Kapitel 31 – Hannah
Kapitel 32 – Hannah
Kapitel 33 – Levi
Kapitel 34 – Hannah
Kapitel 35 – Levi
Kapitel 36 – Hannah
Kapitel 37 – Levi
Kapitel 38 – Hannah
Kapitel 39 – Levi
Kapitel 40 – Hannah
Kapitel 41 – Hannah
Kapitel 42 – Levi
Kapitel 43 – Hannah
Epilog – Hannah
Nachwort & Danksagung
Leseprobe: Wir fliegen, wenn wir fallen
Über das Buch
7 YARA Erinnerungen sind Segen und Fluch zugleich
8 NOEL Du bist, wer du bist – nicht mehr und nicht weniger
9 YARA Nur ein Stück Papier
Über die Autorin
Musikliste
Adele – Water Under the Bridge
Andra Day – Rise up
AnnenMayKantereit – Barfuß am Klavier
Ben Cocks – So Cold
Birdy – Wings
Birdy & Rhodes – Let it all go
Chord Overstreet – Hold On
Cloves – Don’t Forget About Me
Coldplay – Fix you
Ella Henderson – Yours
Fleurie – Breathe
Imagine Dragons – Dream
Imagine Dragons – Not Today
James Bay – Incomplete
Jessie J – Who You Are
Katelyn Tarver – You Don’t Know
Of monsters and men – Little talks
One Republic – Let’s hurt tonight
Susie Suh – Here with me
The Chainsmokers & Coldplay – Something Just Like This
The Chainsmokers ft. Halsey – Closer
Tom Odell – True Colours
Tracy Chapman – Fast car
Sister Hazel – Your Winter
Für Jacquelin Stumpe
Weil du mir gezeigt hast, was es bedeutet, sich selbst treu zu bleiben, und dass man alles, was man verliert, wiederfinden kann. Auch sich selbst.
Für Lisa Herrmann
Weil du mir beigebracht hast, dass die leisen Worte manchmal die lautesten sind und die des Herzens die schönsten.
Für Nicci, Samy, Jennie, Hannah und Binia
Weil euer Herz so unglaublich groß ist und ihr mir eure Freundschaft schenkt.
Für dich
Weil du das hier liest.
Vergiss nicht, dass es okay ist, auch mal nicht okay zu sein.
Brief an Izzy
All die ungesagten Worte in mir sind Verständnis und Unverständnis zugleich, sie sind Einsamkeit und Gesellschaft, sie sind mein Gefängnis und meine Freiheit. Sie sind wie Fremde, die mich umarmen, und wie Freunde, die mir den Rücken kehren. Sie sind da und sie können nicht heraus – sie sind wie ich.
Uns umgeben die gleichen Mauern, uns halten die gleichen Grenzen. Ich weiß, woher sie kommen, ich spüre, dass sie da sind, aber ich weiß nicht, wie ich sie einreißen kann. Ob ich das möchte.
Ich habe Angst. Ich habe Angst vor der Stille meiner Worte.
Und so ist es, Tag für Tag, Kampf und Tanz zugleich.
Jeden Tag, seit du nicht mehr da bist, Izzy.
Kapitel 1 – Hannah
Die Stille kann lauter seinals der Sturm.
Das war sie – die letzte Kiste, die mein altes Leben in mein neues bringt. Die letzte Kiste voller Erinnerungen.
Mein Blick schweift durch das Zimmer, über das fröhliche Pastellgelb der Wände und den alten Holzboden, bis hin zu meinem neuen Bett und den Kommoden in Weiß, die Dad bereits aufgestellt hat. In Gedanken höre ich ihn und Mum sagen: Neuer Ort, neues Heim, neuer Anfang. Alles wird besser werden, Hannah!
Aber heißt neu auch immer besser?
Mit zitternder Hand wische ich mir eine Träne aus dem Augenwinkel, schiebe einzelne Strähnen meines Haares zur Seite und atme tief ein, denn eines ist sicher: Es gibt keine Möglichkeit, dass all das noch schlimmer werden könnte. Es ist bereits schlimm, es tut weh und es ist real. Mein Leben ist die Steigerung von allem Schlechten, der Superlativ von einsam und verloren sein. Weil Izzy weg ist und weil auch ein neues Haus, ein neues Zimmer und ein neues Leben daran nichts ändern können. Erinnerungen kann man nicht löschen. Man kann sie nicht einfach vergessen. Man kann sie nicht ändern. So wenig, wie ich das mit diesem einen Tag kann. Egal, wie neu alles um mich herum ist – ich werde es nie sein.
Dutzende von Kartons stehen wild durcheinander, voll mit Dingen, die mir mal etwas bedeuteten. Jetzt sind es nur noch irgendwelche Dinge. Austauschbar, bedeutungslos, zerbrechlich.
Nur eine Kiste ist die Ausnahme. Eine einzige. Sie enthält nichts, außer eines von Izzys Lieblingsshirts mit der Aufschrift Hakuna Matata, meinen Notizblock samt Füller, ein gerahmtes Bild von Izzy und mir, eine Kerze und Streichhölzer.
Langsam steuere ich auf sie zu, sie steht etwas abseits. Vor ihr sinke ich auf die Knie und schiebe die zwei Hälften des Deckels auseinander, ziehe sie nach oben. Die Pappe knarzt dabei und gibt nur widerwillig nach.
Ich greife vorsichtig hinein, lege meinen Block und den Füller neben mich, ebenso das Shirt mit seinen Löchern, in das ich kurz mein Gesicht vergrabe. Es riecht längst nicht mehr nach Izzy. Das gerahmte Bild wiegt schwer in meinen Händen, wirkt, als wäre es aus einer anderen Welt, aus ferner, vergangener Zeit. Meine Fingerspitzen berühren den weißen, verschnörkelten Rahmen, den ich erst neu kaufen musste, und das kühle, glatte Glas darüber. Ich erinnere mich an den Tag, an dem das Bild geschossen wurde, und es ist fast, als könnte ich Izzys Lachen hören. Ich sehe sie und ich sehe mich – ich sehe sie in mir und mich in ihr. Meine Hand legt sich wie von selbst flach auf das Glas, auf das Stück über Izzy. Sie verschwindet. Nein, sie ist schon seit Monaten fort.
Schwer atmend kneife ich die Augen zusammen, schlucke den Kloß in meinem Hals herunter und vertreibe die Gedanken, die so viele Gefühle und Worte hervorrufen. So vieles, das sowieso nie hinauskann.
Alles in mir schmerzt. Es ist die Art von Schmerz, die so stark ist, dass man ihn nicht mehr zeigen kann, weil er eine Grenze überschritten hat. Die Art, die man nicht herauslassen kann, weil jeder Schrei, jedes Wort und jede Träne zu wenig wären für ihn.
Als etwas Weiches meinen Arm streift, zucke ich zusammen. Meine Augen finden die von Mo, der mich neugierig ansieht. Mo ist Izzys Kater. War es. Und ich kann über die Ironie nicht lachen, dass er aufgrund seines gemusterten Fells und seiner drei Farben als Glückskatze gilt. Vielleicht brauchte er es selbst, vielleicht hatte er Glück, weil er nur ein halbes Ohr verloren hat und etwas Fell und es ihm sonst gut geht.
Maunzend setzt er sich neben mich und beginnt zu schnurren. Manchmal beruhigt es mich und vertreibt alles in meinem Kopf, bis nur noch eine Leere darin ist, in der sich das Echo des Schnurrens sammelt und zu einer Melodie wird. Manchmal hilft es. Und dieses Manchmal ist nicht mehr als ein bunter Punkt auf einer monochromen Leinwand. Ein Stück Farbe, das in dem Meer aus Schwarz und Weiß zu ertrinken droht.
Die Schritte und das Knarzen der Treppe dringen an mein Ohr und geben mir Zeit, mich zu fassen, bevor es dreimal an der Tür klopft, die ohnehin offen ist. Ich lasse meine Hand weiter über Mos Fell streichen, spüre, wie meine Muskeln sich anspannen, wie jede Zelle meines Körpers sich wünscht, dass Izzy zurückkommt, nie wieder alleine zu sein. Weil allein sein nichts anderes bedeutet, als ohne Izzy zu sein. Für immer. Ohne daran etwas ändern zu können. Ohne es anders verdient zu haben.
Mein Vater steht unschlüssig im Türrahmen, ich kann es aus dem Augenwinkel sehen. Was möchtest du?, schießt es mir durch den Kopf, aber ich sage nichts. Ich kann nicht.
»Gefällt dir das Zimmer?« Er klingt erschöpft und dennoch bemüht fröhlich. Sein lautes Räuspern und seine zaghaften Schritte in meine Richtung verraten ihn. Er will nicht hier sein. Nicht wirklich. Nicht nach dem, was war.
»Das Bett sieht fast so aus wie dein altes und in den Kommoden hast du jetzt mehr Platz. Deine Mutter und ich sind unten dabei, die ersten Kisten auszuräumen. Möchtest du uns vielleicht helfen?«
Ich kann nicht anders, ich hebe den Blick, lege den Kopf in den Nacken und erforsche sein Gesicht. Er sieht blass aus, die ersten grauen Strähnen durchziehen sein dunkelblondes Haar. Mit den Händen in den Hosentaschen steht er vor mir, versucht sich an einem Lächeln. An einem bittenden, flehenden Lächeln, von dem er weiß, dass es zu nichts führt. Ich frage mich, was mehr wehtut: das Scheitern an sich oder das Wissen, dass man scheitern wird, noch während man es versucht. Ich frage mich, was ihm durch den Kopf geht und wie sehr es ihn schmerzt, mich anzusehen. Hannah, nicht Izzy. Und ob es die gleiche Art von Schmerz ist, die ich kenne.
In diesem Moment wünsche ich mir, die Mauern in mir wären fort, damit ich ihn anschreien kann. Ihn und die ganze Welt. Aber es funktioniert nicht, weil ich nicht weiß, was ich sagen soll. Weil keines der unzähligen Worte etwas ändern würde. Kein einziges! Nichts, außer dass sie gesagt wurden und nicht zurückgenommen werden können. Sind sie einmal gesprochen, hallen sie nach und verklingen nie, denn Worte sind Kinder der Ewigkeit.
»Vielleicht … Vielleicht ist es besser, du kommst erst richtig an und packst deine Sachen aus.« Unbeholfen fährt er sich über die Haare, weicht meinem Blick aus und geht schließlich.
Enttäuschung. Sie wabert in meinem Zimmer umher und erdrückt mich, treibt mir erneut die Tränen in die Augen. Izzy und mein Bild gleitet von meinen Beinen, die ich an mich ziehe, um meinen Kopf darauf zu betten. Ich weine leise, aber deshalb tut es nicht weniger weh.
Ich sitze auf dem Boden meines neuen Lebens – und zerbreche. Immer und immer weiter wird jede Scherbe gebrochen, die mich ausmacht. Sie werden kleiner und kleiner, denn es gibt nichts und niemanden, der sie zusammenflickt. Seit Izzy weg ist, kann ich das besonders gut – das Zerbrechen. Seit Izzy weg ist, weiß ich, wie das ist.
Irgendwann versiegen die Tränen, werden zu einem dumpfen Gefühl, zu etwas, das sich schlafen legt. Wenigstens für einige Stunden. Mo schnurrt noch immer neben mir und ich drücke ihn sanft weg, bevor ich aufstehe, mir einmal übers Gesicht wische und nach meinem Notizbuch samt Stift greife.
Es ist Zeit.
Mo hebt sofort verschlafen den Kopf, maunzt laut, folgt mir zum Bett und lässt sich erneut neben mir nieder. Seit Izzy fort ist, weicht er nicht von meiner Seite. Ich weiß nicht, ob er versteht, dass ich nicht sie bin.
Als ich das Büchlein öffne, schlägt mir eine gähnende Leere entgegen. Weiße Seiten ohne Inhalt. So, als hätte ich Izzy noch nie geschrieben, dabei waren es bereits Dutzende Briefe. Dutzende Sätze, Worte und Gedanken. Dutzende Gefühle und Dinge, die ich ihr nicht sagen konnte.
Ich ziehe den Deckel des Füllers ab, atme tief ein und setze ihn auf das Papier, bis der erste blaue Fleck entsteht, das erste bisschen Farbe. Das leichte Schaben der Füllfeder auf Papier beruhigt mich ebenso wie die Tinte, die sich in geschwungenen Linien ausbreitet. Zeile um Zeile füllt sich und es fühlt sich gut an, es ist mehr als eine Regelmäßigkeit, mehr als etwas, an dem ich mich festhalte. Es wird zum Rausch. Es ist ein Stück Hoffnung. Darauf, dass Izzy auf irgendeine Art und Weise diese Worte liest. Irgendwann. Dass diese Worte sie finden und umarmen, ihr Wärme schenken, wo auch immer sie ist. Dass diese Worte nicht ungesagt bleiben.
Sterben müssen wir alle und wahrscheinlich macht uns diese Gewissheit mehr Angst als der Tod selbst. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann würde ich mir nicht einfach Izzys Leben zurückwünschen, nein, ich würde mir wünschen, mehr Zeit mit ihr gehabt zu haben.
Ich würde mir Zeit wünschen. Unendlich viel davon.
Wenn du hier wärst, würden wir zusammen lachen und zusammen weinen, wir würden streiten und uns nerven. Ich würde über Mo schimpfen, weil er mal wieder in meinem Bett liegt anstatt in deinem, und du würdest ihn voller Inbrunst verteidigen. Oh, Izzy! Du bist gegangen und du hast so viel mitgenommen. Es ist, als hättest du mir meine Worte genommen, meine Sprache und Stimme. Als hättest du mir einen Flügel zum Fliegen geraubt. Zusammen waren wir eins. Deshalb fühlt es sich so leer an ohne dich.
Kapitel 2 – Hannah
Nicht jedes Ende ist ein neuer Anfangund nicht jeder Neuanfangbedeutet das Ende.
Mum und Dad haben gesagt, alles würde anders werden. Sie wollten neu anfangen, nein, sie mussten es, weil sie es sonst nicht ausgehalten hätten. Aber ich denke, sie wissen wie ich, dass es nichts gebracht hat. Dass alles eine große Lüge war – dass es das noch ist. Es wird mir richtig klar, als wir das erste Mal zusammen zu Abend essen. Genau jetzt. An diesem neuen Ort, in diesem neuen Haus. Es gibt Lasagne. Izzys Lieblingsessen. Und genau da liegt das Problem: Izzy ist fort und doch immer noch hier und wir werden nicht weit und schnell genug rennen können, um das zu vergessen.
Izzys Geschichte ist geschrieben und sie kann nicht gelöscht werden. Sie steckt tief in uns und jede Erinnerung, jeder Moment ist eingebrannt, jedes Wort und jedes Lachen wurde gehört, jeder Streit gespeichert, jede Träne geteilt und jede Angst. Als Izzy da war, war mein Leben wie eine Fahrradfahrt mit Stützrädern – jetzt muss ich lernen, wie man ohne sie fährt …
Gedankenverloren stochere ich in den verschiedenen Nudellagen herum, zwischen der Béchamel- und Bolognesesoße. Die letzten Sonnenstrahlen scheinen durch das große Esszimmerfenster. Das Licht spielt mit den Schatten, während ich darum kämpfe, Gabel um Gabel zum Mund zu führen und etwas herunterzuschlucken.
Ich denke an mein neues Zimmer. Alle Kisten sind leer, alles ist eingeräumt. Alles, bis auf diese eine Kerze in dieser einen Kiste.
»Hast du keinen Hunger? Ist etwas nicht okay?« Meine Mutter sieht mich besorgt an und irgendwie beschämt, denn sie weiß, wie blöd diese Frage klingt. Sie ist so einfach, wie sie schwer ist. Natürlich ist nichts okay. Das wird es nie wieder sein. Ich habe einen Teil von mir verloren – und sie? Sie mussten ihr eigenes Kind begraben. Das ist nicht richtig!
Die Gabel entgleitet mir, fällt mir aus der Hand und klirrend auf den Teller. Einzelne Tropfen der Soße landen auf der Tischdecke. Rot beißt sich mit Orange und ich kann meinen Blick nicht abwenden von diesem Gemisch, das nicht zusammenpasst, aber gerade keine andere Wahl hat, als zusammen zu sein.
Es ist so still. Wenn es nur nicht so still wäre.
Ich knete meine schweißnassen Hände, versuche mich zu beruhigen. Eins, zwei, drei, klingt es in meinem Kopf, zählen und atmen – und versuchen zu vergessen.
»Iss schneller! Sonst schnappe ich dir deine Lasagne vor der Nase weg«, höre ich Izzy mit vollem Mund sagen. Sie hat einen grässlichen Bolognesesoßenbart und die Wangen vollgestopft wie ein Hamster. Dass sie noch mit vollem Mund kauen kann, gleicht einem Wunder.
»Niemals! Finger weg!« Mein Essen verteidigend beuge ich mich leicht über den Teller und schiebe meinen Arm vor. Und dann grinsen wir. Wir beide. Dabei fällt Izzy ein Stück Lasagne aus dem Mund und landet klatschend auf Mums neuer Decke. Wir prusten los, bis wir kaum noch Luft bekommen, und halten unsere Bäuche vor Lachen.
»Wie wäre es, wenn du dir eine neue Mannschaft suchst?«, fragt Dad und reißt mich damit aus meiner Erinnerung. Er sagt es so, als wäre nichts passiert. Als hätte Mum nicht gefragt, ob alles okay wäre, als hätte ich nicht meine Gabel fallen lassen und als wäre alles normal, während er sich ein fettes Stück Lasagne in den Mund schiebt. Meine Mutter sieht ihn dankbar von der gegenüberliegenden Seite an mit einem leichten Lächeln auf den Lippen. Ihre Züge werden erkennbar weicher, die Spannung verschwindet aus ihrem Gesicht.
»Ja, das wäre vielleicht eine gute Idee! Schließlich sind Sommerferien, das Wetter ist perfekt und es sind noch fünf Wochen, bevor die Schule wieder beginnt.«
Unmerklich schüttle ich den Kopf, meine Finger verkrampfen sich, meine Lippen sind fest aufeinandergepresst. In meinem Kopf geht alles drunter und drüber, weitere Erinnerungen wollen an die Oberfläche kommen. Aber ich kämpfe dagegen an.
»Es würde dir guttun! Du spielst gut, hast Spaß daran. Du könntest sofort neue Freunde finden.« Ein weiteres Stück Lasagne landet in seinem Mund, seine Miene ist ausdruckslos. Schwer schluckend starre ich auf den Tisch, vorbei an dem orange-roten Fleckduett, auf die besondere Struktur des Leinentischtuchs. Und das Einzige, was ich denke, ist: Es hat mir gutgetan! Ich habe gut gespielt und hatte Spaß daran. Ja, das hatte ich. Aber manche Dinge sind einfach vorbei. Nicht jedes Ende birgt einen neuen Anfang.
»Hörst du mir überhaupt zu? Izzy!«
Ruckartig hebe ich den Kopf, blicke meinem Vater in die Augen. Mein Atem stockt, meine Augen sind weit aufgerissen. Ich kann nicht glauben, was er gesagt hat – wie er mich genannt hat. Diese vier Buchstaben, die alleine keinen Sinn ergeben. Diese vier Buchstaben, die zusammen für mich die Welt bedeuten. Izzy.
Ich bin nicht sie.
Meine Mutter zieht hörbar die Luft ein, aber ich kann nicht ablassen vom Gesicht meines Vaters. Ich atme schwer, in mir tobt ein Sturm aus Wut und Trauer, aus Enttäuschung und Schuld, aus Unglauben und Schmerz.
Er lässt die Gabel sinken und ich sehe es ihm an – die Erkenntnis, dass gerade etwas schiefgelaufen ist, trifft ihn wie ein Schlag in die Magengrube. Seine Augen wandern unruhig umher, seine Schultern verspannen, sein Gesichtsausdruck ändert sich. Aber welche Erkenntnis ist es wohl genau? Dass Izzy tot ist oder dass er mich eben verletzt hat? Mehr als ich zugeben will.
Ich warte. Auf irgendeine Reaktion. Kurz schaue ich zu meiner Mutter, der es genauso geht, die meinen Vater beinahe flehend ansieht. Aber nichts geschieht. Nein, überhaupt nichts. Er schafft es nicht einmal mehr, mich anzusehen, und für den Moment könnte man glauben, dass er seine Sprache verloren hat – er und nicht ich.
Die Sekunden verrinnen, aber sie fühlen sich wie Minuten an. Wie eine quälende Ewigkeit, in der Izzys Name gesprochen widerhallt, immer wieder, und in der Dad es nicht schafft, ihn zurückzunehmen.
Laut und schnell schabt der Stuhl über das Parkett, als ich ruckartig aufstehe. Mir ist schwindlig und schlecht, mein Brustkorb droht zu explodieren, weil dahinter all meine aufgestauten Gefühle sitzen und darauf warten, ausbrechen zu können. Aber ich kann nicht schreien, nichts sagen. Also können sie nur auf einem Wege hinaus und das Letzte, was ich jetzt will, ist, dass jemand meine Tränen sieht. In diesem Moment schäme ich mich dafür, ich selbst zu sein, und ich kann nicht glauben, dass mein eigener Vater daran schuld ist.
Fast über meine eigenen Füße stolpernd laufe ich die Treppen hinauf, höre die Stimme meiner Mutter wie ein Hintergrundrauschen, das Zerbrechen von Geschirr wie eine schiefe Melodie. Keuchend lande ich in meinem Zimmer, schließe die Tür hinter mir und versuche, zu Atem zu kommen. Ich raufe mir die Haare, gebe ein leises Wimmern von mir und breche zusammen.
Hannah, Hannah, Hannah. Das ist mein Name. Auch wenn ich mir gewünscht habe, Izzy zu sein. Auch wenn ich alles tun würde, um mit ihr tauschen zu können … Jetzt schmerzt es einfach nur, dass man mich angeblickt und sie gesehen hat.
Es fühlt sich so an wie an dem Tag, an dem man mir sagte, dass man Izzy nicht retten konnte. Ich spüre die gleiche Schwere, den gleichen Schmerz. Ich spüre wieder diese tiefe Verlorenheit und Machtlosigkeit.
Irgendwann finde ich die Kraft aufzustehen. Meine Beine sind taub, meine Augen brennen, sie sind trocken, genauso wie mein Hals. Die Sonne ist untergegangen, doch das Dämmerlicht genügt. Mit kribbelnden und wackligen Beinen schwanke ich zu dem großen Spiegel am anderen Ende des Zimmers. Und ich sehe genau hin. Leicht gebräunte Haut, blondes langes Haar, blaue Augen. Eine Stupsnase. Ich sehe Izzy so ähnlich, dass es wehtut.
Während ich mein zerzaustes Haar zur Seite streiche, das letzte Licht des Tages mein Zimmer erhellt und ich die Spuren meiner Tränen von meinem Gesicht wische, ändert sich plötzlich etwas. Ich stelle mich aufrecht hin, hebe das Kinn, straffe die Schultern und zum ersten Mal, seit Izzy nicht mehr da ist, habe ich einen inneren Antrieb. Ich weiß, was ich tun muss. Morgen früh werde ich das tun, was meine Eltern wollten: neu anfangen.
Ein Lächeln zupft an meinen Lippen, ich kann es nicht nur spüren, sondern sehe es vor mir im Spiegel. Ein Funken nistet plötzlich in mir. Und es ist mir egal, woraus er besteht. Es ist ein Funke. Mehr als jemals da war, seit Izzy fortging.
Meine Beine tragen mich zum Bett, meine Hand greift mechanisch nach dem Block und dem Füller. Ich schalte die Nachttischlampe an und streiche Mo übers Fell, der sofort anfängt zu schnurren.
Kurz verharre ich, hole zitternd Luft. Dann spüre ich das vertraute Gefühl, sehe Tinte auf Papier, höre Worte, die geschrieben und nicht gesagt werden.
Ein großer Tintenfleck prangt auf dem Papier, der Füller ruhte zu lange an dieser Stelle. Ich war in Gedanken versunken. Entschlossen lege ich ihn weg, reiße die Seite mit einem Ruck heraus, genauso wie die Seiten davor, die ich heute Morgen schrieb, und lege den Block aufs Bett. Er ist jetzt wieder leer und unbeschrieben. So als hätte er nichts zu erzählen und als wäre ihm nie etwas erzählt worden. Doch der Schein trügt. Ich habe ihm schon so vieles anvertraut, habe es niedergeschrieben, nur um es ihm Stück für Stück wieder zu entreißen. Habe ihn für einen Moment vervollständigt, nur, um ihm danach so viel mehr zu nehmen. Und manchmal, wenn ich ihn ansehe, sehe ich mich. Ich bin der Block. Ich bin das weiße Papier. Mir hat das Leben etwas erzählt, mir hat das Leben Izzy geschenkt – und dann mit einem Ruck genommen. Stück für Stück reißt es etwas aus mir hinaus, ohne dass ich es verhindern kann …
Mit all den Worten in meiner Hand gehe ich zur Kommode und greife nach den Streichhölzern. Im schwachen Licht der Nachttischlampe öffne ich die Tür zu meinem kleinen Balkon. Noch immer ist es angenehm warm, nur eine leichte Brise weht mir um die Nase und lässt mich kurz die Augen schließen. Ich gehe in die Knie, lege die Blätter auf den Boden. Woche um Woche tue ich das bereits und trotzdem wird mir jedes Mal schwer ums Herz. Jedes Mal zittern meine Hände. Jedes Mal, wenn die Flamme auf das Papier trifft, wenn sie sich ausbreitet, hell aufleuchtet und all meine Worte an Izzy zerstört.
Ein Ratschen, das Streichholz geht an, die Flamme lodert, so klein und trotzdem so mächtig. Sie züngelt, als ich sie an das Papier halte, und dann beobachte ich, wie sie ihr Werk tut. Wie nichts als Asche bleibt. Aus meinen Gedanken wurden Worte, die nun verbrennen und wieder zu Gedanken werden. Aber jetzt habe ich das Gefühl, sie gesagt zu haben. Still und doch so laut.
Als die letzte Flamme erlischt und mich im Halbdunkel zurücklässt, als ein Windhauch die letzten Fetzen mit sich fortträgt, gehe ich zurück ins Zimmer. Lauschend stehe ich da, aber es ist vollkommen ruhig im Haus. Meine Eltern haben nicht versucht, mit mir zu reden, sie kamen nicht nach oben. Vielleicht geben sie es jetzt auf, weil ich sowieso nicht antworte. Weil ich es nicht kann. Ich glaube, ich kann meine Gedanken nicht mehr aussprechen, ich glaube, ich würde die Töne nicht mehr finden. Ich weiß nicht mehr, wie man spricht, es fühlt sich an, als hätte ich es nie gewusst. Es ist kein Automatismus mehr. Nein, es ist etwas, für das mir die Anleitung fehlt.
Wir sind hier an diesem fremden Ort, ich sitze auf einem fremden Bett, in einem fremden Zimmer, weil alles, was wir hatten, mit dir ging. Morgen werde ich auch zu etwas Fremdem werden. Morgen werde ich etwas ändern. Vielleicht passe ich dann hierhin. Vielleicht wird aus fremd und fremd etwas Bekanntes.
Es tut mir leid, Izzy. Es tut mir leid, dass ich nicht du bin. Heute wurde mir gezeigt, dass es auch anderen so geht.
Ich sehe dir so ähnlich. Aber jetzt, da du fort bist, frage ich mich immerzu, wer ich eigentlich bin. Ich weiß, wer ich mit dir war. Ein Teil von etwas, eine Hälfte einer anderen. Aber was bin ich für mich alleine? Ich weiß es nicht. Mum und Dad wissen es wahrscheinlich auch nicht. Sie sagten, ich solle mir eine Mannschaft suchen und wieder spielen. Eine Mannschaft suchen bedeutet, einen neuen Partner suchen. Eine neue Hälfte, von der ich ein Teil sein kann.
Aber, Izzy, wie soll das gehen?
Nicht alles, was kaputtgeht, kann repariert werden. Manche Dinge bleiben kaputt, für immer.
Kapitel 3 – Hannah
Nicht jede Veränderungändert auch etwas.
Meine Augen sind geschwollen, weil ich heute Nacht keine Ruhe gefunden habe. Stundenlang habe ich am Laptop gehangen und im Internet gesurft. Zwischendurch habe ich Mo gefüttert oder einfach mit ihm auf dem Boden gelegen und aus dem Fenster gestarrt. Jetzt geht die Sonne auf und ich bin müder, als ich dachte. Gähnend strecke ich mich vor dem Spiegel, dann binde ich meine Haare zu einem Dutt. Die Jeans von gestern klebt noch an mir, das Top ist leicht zerknittert. Ich habe keine Kraft, mich umzuziehen, nur den Willen, heute etwas zu ändern.
Ich schleiche auf Zehenspitzen in das Bad, das direkt neben meinem Zimmer liegt, dicht gefolgt von Mo, der sich zu meinen Füßen vor dem Waschbecken niederlässt. Das Bad gehört nur mir, das meiner Eltern ist unten. Während ich mir die Zähne putze, versuche ich wach zu bleiben, auch danach, als ich mein Gesicht eincreme und wenigstens die dunklen Augenringe überschminke. Ich sehe grauenvoll aus. Es ist mir egal. Es wird sich ändern.
Mo steht auf und reckt sich mir entgegen, als ich meine Arme nach ihm ausstrecke. Behutsam lege ich ihn über meine Schulter und schleiche mit ihm zurück ins Zimmer. Dort warten wir, still und leise, ich zähle die Sekunden und beobachte, wie die Sonne sich immer weiter nach oben schiebt.
Schließlich wird es Zeit. Ich lege Mo aufs Bett, schnappe mir meine Sandalen, den Schnipsel mit der Adresse und dem Bild neben dem Laptop, mein Portemonnaie, meinen Schlüssel und will gehen. Mo folgt mir, und ich seufze. Fragend sieht er mich an, legt den Kopf schief und ich schüttle den Kopf. Nein, Mo, heute kannst du nicht mit. Ich setze ihn erneut aufs Bett, streichle ihn sanft und gehe wieder zur Tür, die ich schnell hinter mir schließe. Dieses Mal so, dass Mo zurückbleibt.
Im Haus rührt sich nichts und niemand. Ich gehe die Holztreppe nach unten und überspringe die vorletzte Stufe, die sonst furchtbar laut knarzen würde.
Kurz wandert mein Blick zum Schlafzimmer meiner Eltern, ich spüre, wie sich ein Zögern in mir ausbreitet, die Frage, warum ich das tun will und ob es notwendig ist, aber meine Hand drückt bereits die Klinke der Haustür nach unten und meine Beine tragen mich hinaus. Ich habe mich längst entschieden.
Ich atme die frische und noch einigermaßen kühle Luft ein, umschließe den Zettel in meiner Hand fester und fester. Ich werde keinen Rückzieher machen. Für Rückzieher ist es zu spät.
Ritsch, ratsch, ritsch, ratsch. In regelmäßigen Abständen fährt die Schere durch mein langes, schweres Haar und mit jeder Strähne, die zu Boden fällt, fühle ich mich leichter. Ja, das hier ist richtig. Ja, es ist notwendig.
Gestern Abend, als ich mich im Spiegel sah und Izzy mich anblickte, wusste ich, dass sich etwas ändern muss. Ich vermisse Izzy, mehr als alles andere, aber ich bin nicht sie. Und ich will nicht länger so aussehen – wie ein Teil von etwas Ganzem, von etwas, das es so nicht mehr gibt.
Im Internet suchte ich nachts nach etwas, das am wenigsten nach mir aussah und dennoch irgendwie mir entsprach – und druckte das Foto aus.
Ich bin mit dem Fahrrad hier und seitdem ich den Friseurladen betreten habe, umklammere ich das Bild von meinem neuen Ich wie einen Anker. Man hat mich freundlich begrüßt, aber ich hielt nur zitternd das Bild hoch und zeigte darauf. Auf das Bild, dann auf mich.
Jetzt sitze ich auf einem dieser roten Friseursitze aus Leder und werde von Fanny zu einem neuen Menschen gemacht, wie sie mir zu Beginn freudig mitteilte. Sie merkte schnell, dass ich nicht rede, und hat es deshalb selbst ebenso gelassen. Sie lächelt mich nur ab und zu an, was mir ein wenig die Anspannung nimmt, auch wenn sie das nicht weiß. Fanny ist etwas größer als ich, kräftig gebaut, mit knallrotem Haar und einigen Piercings im Gesicht. Sie wirkt freundlich und so, als könne sie keiner Fliege etwas zuleide tun. Sie ist so unbeschwert und fröhlich – sie erinnert mich an Izzy.
Mit sicheren Bewegungen schwingt sie Kamm und Schere zu der Musik aus dem Radio. Plötzlich wächst ein Kloß in meinem Hals, aber ich ignoriere ihn, denn mein Bauch sagt mir, dass ich das hier tun muss. Wenn ich dafür einen Grund nennen müsste, könnte ich es nicht. Vielleicht ist es ein letzter Rest des Menschen, der ich einmal war, der gegen all das, was ich jetzt bin, rebelliert. Vielleicht kann ich mich aber auch einfach nicht mehr ansehen, weil mich sehen, Izzy sehen bedeutet.
»So, das war’s! Ich bin fertig. Wie findest du es?« Stunden später ist es so weit. Fanny fährt durch meine Haare, ich begegne ihrem Blick im Spiegel und erst jetzt schaue ich mich richtig an. Erst jetzt traue ich mich, meinem anderen, meinem neuen Ich zu begegnen. Vor Überraschung keuche ich auf, atme schneller. Ich sehe, wie sich meine Augen weiten, mein Mund sich zu einem kleinen O formt. Langsam hebe ich meine Hand, die leicht zittert. Fanny lässt von mir ab, gibt mir etwas Raum.
Meine Hand berührt mein Haar, das sich anfühlt wie immer, nur ist es jetzt so viel kürzer. Ich wusste, was mich erwartet – und irgendwie nicht. Immer wieder lasse ich die Strähnen durch die Finger gleiten. Sie sind weich, fühlen sich ungewohnt fremd an, der Duft des Shampoos weht zu mir herüber, er ist blumig und frisch. Dann hebe ich meine linke Hand ebenfalls und fahre an der linken Seite meines Kopfes entlang. Hier fühlt es sich stoppelig an, aber nicht kratzig oder rau. Meine lange blonde Mähne ist nun weg, meine Haare sind kurz und schwarz, schimmern im Licht leicht blau und lassen meine Augen größer und heller wirken. Rechts fallen sie bis zu meinem Kinn, werden nach hinten etwas kürzer, links ist nichts mehr übrig. Ein sauberer Sidecut. Das Blauschwarz meiner Haare lässt meine Haut strahlen und ebenso meine blauen Augen. Leider auch meine Augenringe, die ich von heute Nacht davongetragen habe.
Der Kontrast ist riesig.
»Ich finde es wunderschön! Es steht dir«, sagt Fanny aufmunternd, weil ich keinen Ton von mir gebe. Sie weiß nicht, dass es nicht an ihr liegt. Dankbar sehe ich sie an und hoffe, sie versteht. Ich glaube fest daran, dass man manchmal Dinge einfach so verstehen kann. Ohne sie erklären zu können. Ohne zu wissen, mit welchem Teil von uns wir es verstehen. Wir wissen nur, dass es so ist. Und ich bete, dass Fanny das auch irgendwie tut. Dass sie begreift, dass das hier für mich mehr ist als ein Haarschnitt. Dass ich damit mehr verloren und gewonnen habe, als sie je ahnen kann.
»Komm, vorne kannst du dir noch ein Pflegeshampoo mitnehmen.« Fanny geht zum Tresen und ich folge ihr langsam. Dabei sucht mein Blick andauernd nach einem Spiegel, um mir zu bestätigen, dass es echt ist. Dass ich nun anders aussehe. Nicht mehr wie Izzy, aber auch nicht mehr wie Hannah. Und ich frage mich, ob diese Veränderung wirklich irgendetwas verändert hat.
Nachdem ich bezahlt habe, trete ich aus dem Laden. Ohne es verhindern zu können, fahre ich erneut über meinen freiliegenden Nacken, bewege meinen Kopf, der sich leicht, beinahe nackt anfühlt. Ich warte auf etwas. Vielleicht auf das Gefühl von Freude oder Aufregung oder auch auf den Anflug eines schlechten Gewissens. Aber da ist nichts. Nur die Worte in meinem Kopf. Unaufhörlich wiederholen sie: Es hat sich nichts geändert! Und ich nicke, weil sie recht haben.
Ich lasse das Pflegeshampoo in den Korb vor mir plumpsen. Meine Hände greifen den Lenker meines bunten Fahrrads und mein rechtes Bein schwingt über den Sitz auf die andere Seite. Tief einatmend setze ich mich mit einem Ruck in Bewegung. Das Treten funktioniert wie von selbst, ich kann es nicht stoppen. Und das, obwohl mein Atem immer schneller wird, sich mein Innerstes immer weiter zusammenzieht. Alles in mir schreit: Du fährst in die falsche Richtung! Ich möchte weg und nicht nach Hause.
Angst. Es ist Angst. Aber sie selbst ist nicht das Schlimme. Nein, Angst ist am schlimmsten, wenn man nicht weiß, wovor man sich fürchtet. Wenn sie einfach da ist und dich wie ein alter Freund umarmt – dabei fesselt sie dich, anstatt dich zu beschützen.
Schweißgebadet komme ich zu Hause an, umfasse das Lenkrad mit so einer Kraft, dass sich meine Finger verkrampfen. Ich schaffe es nicht, mich zu bewegen, mich vom Fahrrad zu lösen und hineinzugehen. Vor ein paar Stunden erschien mir die Idee eines neuen Ichs wie eine Offenbarung, wie ein Funken Rebellion. Der Funken von überhaupt irgendetwas.
Jetzt? Jetzt fühlt es sich falsch an. Als hätte ich allem Fremden, was mich umgibt, ein weiteres Stück hinzugefügt. Und nein, es wurde nichts Bekanntes daraus.
Ich rede mir gut zu, schließe für einen Moment fest die Augen, drücke sie zu, bis es schmerzt.
Du kannst das. Du musst nur einen Fuß vor den anderen setzen, Hannah. Langsam, einen Schritt nach dem anderen. Zuerst musst du das Fahrrad loslassen. Du weißt, du kannst gehen, du weißt, wie es funktioniert. Dann musst du die Tür erreichen, es sind nur wenige Meter, und sie öffnen. Du hast das schon mal gemacht, du schaffst das. Du gehst hinein …
Ich schnaufe kurz, öffne meine Augen, bevor sich meine Hand fester um das Lenkrad krampft. Es wird immer wärmer, die Sonne lässt alles leuchten, blendet mich, der Himmel ist klar und hellblau, keine Wolke ist zu sehen.
Selbst wenn ich noch reden könnte, wäre ich nicht in der Lage zu erklären, warum ich das gerade getan habe. Der kleine Funken steckt noch in mir, ich kann ihn spüren in den hintersten Winkeln, aber er reicht nicht aus. Weil weder ihm noch mir klar ist, warum er da ist und wogegen wir eigentlich rebellieren: Izzys Tod, meinen Vater, die Schuld, dieses Leben? Egal, was es ist, der Funken ist eben nur das, ein Funken. Und er ist zu schwach, um gegen all das zu kämpfen, wogegen ich kämpfen müsste. Er trägt mich nicht hinein, er bringt mich nicht zum Reden und meinen Vater nicht dazu, zu verstehen, wie weh er mir getan hat. Am wenigsten bringt er Izzy zurück.
»Endlich! Wo warst du, wir haben uns Sorgen gemacht! Wir …«
Während ich mich, vollkommen in Gedanken versunken, keinen Zentimeter von der Stelle gerührt habe, öffnet sich die große, mattweiße Haustür unter dem schön geschwungenen Eingang. Mein Vater stoppt abrupt, beendet seinen Satz nicht, bleibt wie angewurzelt stehen und starrt mich an. Sein Mund steht ungewohnt offen, seine Augen könnten kaum größer sein und alle Farbe weicht aus seinem Gesicht. Ich hatte erwartet, er würde schreien, toben und fluchen. Ich dachte nicht, dass er schweigen würde. Die Sekunden verrinnen, während wir uns einfach nur ansehen. In diesem Moment spüre ich, dass ich mehr verändert habe als meine Haare. Vielleicht etwas anderes, als ich verändern wollte.
»Ist sie da? Ist etwas passiert?« Meine Mum kommt hinzu, bleibt beinahe schlitternd neben Dad stehen. Ihre Augen suchen und finden mich, sie schlägt sich eine Hand vor den Mund und ich sehe, wie sich ihre Brust heftig und unregelmäßig unter ihrem mintfarbenen Top hebt und senkt. Für einen Moment sind wir alle stumm. Ich schlucke schwer, mir steigen Tränen in die Augen. Vor Trotz, vor Wut und verflucht, einfach, weil ich es nicht verhindern und ändern kann. Durch den Schleier erkenne ich, dass meine Mutter ihre Tränen längst nicht mehr zurückhalten kann und ebenso wenig den lauten Schluchzer, der ihr entfährt. Sie rührt sich als Erste, macht einfach kehrt und stürmt zurück ins Haus, während mein Vater wie ein Fels in der Brandung stehen bleibt. Unverwüstlich.
Wenn es nur so wäre …
Sein Mund schließt und öffnet sich. Dann dreht auch er sich um und geht, lässt mich stehen ohne ein Wort. Dass er mir den Rücken gekehrt hat, dass er mich so angesehen hat und nichts gesagt hat … es tut mehr weh, als ich für möglich gehalten habe.
Der Schweiß rinnt mir den Rücken hinunter, die Härchen am Nacken kleben an der Haut. Ich verharre eine Ewigkeit wie angewurzelt in der prallen Sonne und blicke zur Tür, aber sie bleibt leer. Irgendwann schaffe ich es, meine schmerzenden Finger vom Lenker zu lösen, einen nach dem anderen. Sie sind an der Handfläche rot und haben Abdrücke vom Griff. Ich ziehe eine Grimasse und hebe mein Bein über das Fahrrad, um es bis zur Hauswand zu schieben. Eigentlich will ich es dort anlehnen, vorsichtig, weil alles so neu ist, aber im letzten Moment knalle ich es einfach hin, weil mir das alles nichts bedeutet. Weil es guttut! Weil ich diese Stille nicht mehr ertrage und auch nicht das laute Klopfen meines Herzens, das mich begleitet wie eine Hintergrundmusik. Das Fahrrad knallt an die Wand, rutscht ab und während meine Fahrradklingel laut ertönt, kommt es mit einem lauten Krachen auf dem Boden an. Ich straffe meine verkrampften Schultern, spüre jeden Muskel in ihnen und gehe hinein.
Ich sollte hoch in mein Zimmer gehen, stattdessen tragen mich meine Füße in die Küche. Die Atmosphäre im Haus erdrückt mich, die ganze Luft scheint sich zusammenzuziehen.