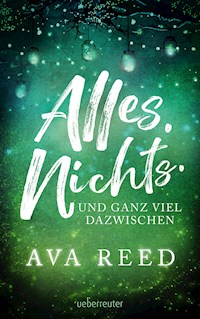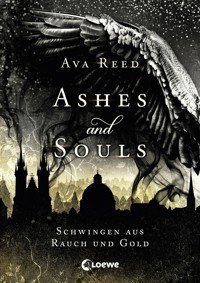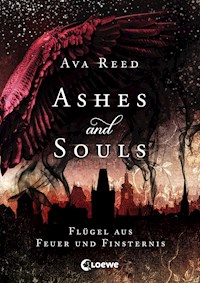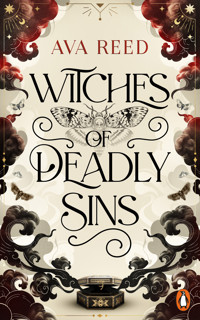
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Hexenerbe-Dilogie
- Sprache: Deutsch
Wir sind Hexen.
Und wir beugen uns niemandem.
Nie wollte Sasha nach Amsterdam zurückkehren. Sie schätzt ihr Leben fernab von uralten Verschwörungen und dem hiesigen Hexenrat. Doch als sie eine erschütternde Nachricht erhält, bleibt ihr keine Wahl. Widerwillig schließt sie einen Deal: Ein Jahr lang hilft sie bei der fieberhaften Suche nach Pandoras Büchse – dafür erhält sie die Freiheit, ein unabhängiges Leben zu führen. Das mächtige Artefakt, das seit Jahrtausenden verschollen ist, birgt die Macht, das entfesselte Unheil der Welt zu bannen. Als Sasha mit ihren Nachforschungen beginnt, geschehen seltsame Dinge, und plötzlich steht auch noch ein Alchemist vor ihrer Tür, mit einer Anziehungskraft, der sich Sasha kaum entziehen kann. Er bietet an, ihr zu helfen. Aber kann sie ihm wirklich vertrauen? Mehr noch: Kann sie sich selbst trauen?
Der Start der einzigartigen slow burn Urban-Fantasy-Dilogie der Bestsellerautorin Ava Reed: eine unvergleichliche Welt, reich an Magie und Hexen. Die Kombination aus griechischer Mythologie und moderner Fantasy im heutigen Amsterdam macht diese Geschichte unwiderstehlich!
Durch die exklusive Hardcover-Ausstattung wird dieses Buch mit mehrfach veredeltem Wendeumschlag, tollen Illustrationen und exklusivem Farbschnitt in limitierter Erstauflage zu einem absoluten Schmuckstück im Regal! (Coverdesign @alexanderkopainski; illustrierter Wendeumschlag @imjenndove; Illustrationen @gabriella.bujdoso)
Enthaltene Tropes: slow burn, the quest, ancient artifacts, who did this to you, you came? you called!
Spice-Level: 1 von 5
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 476
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Ava Reed liebt es, Bücher zu schreiben und zu lesen. Kurzum, alles am geschriebenen Wort macht sie glücklich – noch mehr als Erdbeeren, lange zu schlafen und K-Dramen zu schauen. Nach dem Abitur zog es sie ins schöne Hessen, wo sie nicht nur studiert, sondern auch ihren Mann kennengelernt hat. Heute lebt sie mit ihm und ihrer gemeinsamen Tochter in der Nähe von Frankfurt am Main und hat ihre Leidenschaft für Bücher zum Beruf gemacht.
www.penguin-verlag.de
AVA REED
WITCHES
OF
DEADLY
SINS
Roman
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Copyright © Ava Reed
Copyright © 2025 Penguin Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich
Pflichtinformationen nach GPSR.)
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Textbaby Medienagentur,
www.textbaby.de
Redaktion: Jil Aimée Bayer
Illustrationen: Gabriella Bujdoso
Umschlaggestaltung: Alexander Kopainski
Illustrierter Wendeumschlag: @ImJennDove
Innenillustrationen: Adobe Stock: 283490463, 713566193
Satz: KCFG – Medienagentur, Neuss
ISBN 978-3-641-32497-1V002
www.penguin-verlag.de
Contentnote
Ich möchte hiermit darauf hinweisen, dass es in diesem Buch Themen gibt, die unter Umständen triggern können. In Witches of Deadly Sins sind es unter anderem Suizid, Blut, Gewalt, Trauer, Alkoholkonsum, sedierende Mittel, emotionaler Missbrauch und toxische (familiäre) Beziehungen. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Bitte achtet auf euch und eure Gefühle.
Witch, oh witch, be well aware,
monsters linger everywhere.
Even in brightness, darkness may seep,
so keep your tarots where secrets sleep.
Witch, oh witch, truth lies behind,
be one sneaky moth deep down at night.
The light may lure, but don’t be fooled
its flames are hungry, dark and cruel.
Witch, oh witch, fear the night,
your nightmare hunts – just out of sight.
PART ONE
Every dawn finds its dusk.
Das erste Grimoire der Hexen.
Erster Eintrag. Wintersonnenwende. Eine Stunde nach Sonnenuntergang.
Die letzte aller Gottheiten ist tot.
Vernichtet durch Kronos und ihre eigene Hoffnung.
Mit ihrem letzten Atemzug hatte Artemis uns geformt und uns unsere Bestimmung offenbart. Wir sahen ihre Vergangenheit und Teile unserer Zukunft, wurden geschaffen, um das einzusperren, was nicht auf diese Welt gehört. Als Wesen zwischen Himmel und Erde, geboren aus Sternenstaub, Magie und göttlichem Blut, werden wir unser Schicksal erfüllen.
Unsere Art versteckt sich nicht, doch sie handelt mit Bedacht. Der Versuch, ein Unheil aus der Büchse zu fangen, schlug fehl. Daher mehren wir unsere Kräfte und werden bereit sein, um im richtigen Moment zuzuschlagen.
Wir sind fleischgewordene Magie, genau wie es jene sein werden, die nach uns kommen.
Wir sind Jägerinnen.
Wir sind nicht weniger als Kinder einer Göttin.
Und wir beugen uns niemandem.
(Übersetzung aus der Sprache der alten Gottheiten)
Kapitel 1
Scharfe Krallen klammerten sich an meine linke Schulter und Flügelspitzen touchierten meine Wange. Ihr Schlag weckte den Wind und wehte mir eine meiner Haarsträhnen ins Gesicht, während ich den Sonnenuntergang betrachtete. Die Luft war frisch, ein Hauch von Wildbeeren und Kräutern lag darin verborgen, und ein Unterton, der Moder glich. Doch nichts davon konnte den einen Geruch übertünchen, der wie ein Mantel über allem anderen lag: Magie. Sie haftete an diesem Ort und durchdrang jeden Winkel, sodass sie wohl nie mehr entfernt werden konnte.
Selbst durch die Sohlen meiner Schuhe spürte ich die Erde, nahm nicht nur das Wasser des Sees, sondern ebenso die Wasseradern im Boden und die zarten Bewegungen der tiefen Wurzeln der alten Bäume wahr. Ich hörte sie meinen Namen flüstern, als würden sie mich wiedererkennen.
Amsterdam war wunderschön, selbst in den äußeren Regionen. Es war eigen, besonders. Aber vor allem war Amsterdam magisch. Eine der zehn Städte der Welt, in denen sich in den letzten fünfhundert Jahren die meisten Hexenfamilien niedergelassen hatten.
So wie meine.
Und nach all den Jahren meiner Abwesenheit blickte ich nun auf das charmante, große Haus, in das ich nie zurückkehren wollte. Nie …
»Ku-witt«, drang es leise und vorwurfsvoll von der Seite an mein Ohr und sofort drehte ich meinen Kopf ein Stück nach links, schaute zu Atlas, der mich in alter Steinkauz-Manier musterte.
Dieses Mal wiederholte er seinen Ruf deutlich grimmiger. Er rügte mich und hatte allen Grund dazu.
Wir sollten nicht hier sein. Auch wenn man uns darum gebeten hat, hätten wir nicht zurückkommen sollen!, schrie mir sein Blick förmlich zu, und es war nicht das erste Mal, dass er meine Gedanken zu lesen schien.
Unwillkürlich verzog ich das Gesicht, bevor ich seufzte und ihm den flauschigen, kleinen Kopf kraulte.
»Ich weiß.« Meine Kehle war trocken, mein Atem ging schwer. »Aber ich habe keine Wahl.« Nicht bei diesem Ruf. Brenna hatte ein Finde-mich geschickt. Einen verzauberten Vogel aus Papier, der darauf geprägt worden war, mich zu finden und mir eine Nachricht zu überbringen, egal, wo auf der Welt ich mich befand oder versteckt hatte. Diese Art von Zauber war stark und starke Magie forderte einen Preis. Das bedeutete, meine Tante hatte mich nicht aus einer Laune heraus gerufen, und Atlas wusste trotz seiner Skepsis, dass wir aus einem guten Grund zurück waren. Aus dem einzigen, bei dem ich es je auch nur in Betracht gezogen hätte.
Und ich hätte nie gedacht, dass dieser Tag so schnell eintreffen würde. Ich würde es erst glauben, wenn ich es mit eigenen Augen gesehen hatte.
Atlas rückte sich auf meiner Schulter in eine bequemere Position und zog seine Krallen ein Stück weit aus meiner verschlissenen schwarzen Lederjacke, während mein Herz immer lauter und heftiger gegen meine Rippen schlug. Es glich einem Trommeln, einem kläglichen Versuch, mich zur Umkehr zu bewegen. Doch ich ignorierte meine Unsicherheit, wandte mich von dem tiefroten Himmel ab, der sich über und zwischen den Bäumen am Horizont abzeichnete, und bewegte mich zurück in ein anderes Leben. Dabei umklammerte ich meine Reisetasche so fest, dass meine Knöchel weiß hervorstachen.
Die Treppenstufen der großen Veranda knarzten unter jedem meiner Schritte. Die Haustür mit den bunten Gläsern und Motiven leuchtete nahezu in ihrem walnussfarbenen Rahmen, und ich erkannte die Zauber, die darauf lagen und die sich wie eine lebendige Aura um sie herumwanden. Genauso wie die Sprüche, die den Rahmen zierten, und die nur von jenen, die sie schrieben, und deren Blutlinie ohne Weiteres wahrgenommen werden konnten.
Für einen Moment schloss ich die Augen. Alles war so fremd und so vertraut zugleich. Hier draußen duftete es nach Nelken, Holunder und Myrrhe. Der Schaukelstuhl meiner Mutter stand noch immer da, mit einer von Grans bunten Decken, in die unzählige Schutzzauber gewebt waren. Der Anblick ließ einen Kloß in meinem Hals wachsen. Ich seufzte. Alles war wie vorher – und doch war nichts davon gleich.
Die meisten Hexen taten sich schwer damit, Dinge loszulassen, und ich bildete da keine Ausnahme. Ich hatte nur vergessen, wie weh es tat …
Atlas schmiegte seinen weichen Kopf an meine Wange, weil er meine Gefühle wahrnahm und mir Trost spenden wollte. Währenddessen stand ich weiter da und machte mir nicht die Mühe, mich zu beeilen oder gar zu klopfen. Das Haus hatte mit Sicherheit längst bemerkt, dass jemand mit der Magie der Bishop- und der Osborn-Familie im Blut angekommen war, und die Anwesenden auf seine Art benachrichtigt. Ich konnte es atmen hören, wenn ich mich konzentrierte. Konnte seinen Herzschlag spüren, als wäre es lebendig. Es war nicht wie bei uns Hexen oder anderen lebenden Geschöpfen, aber es war da. Ein leises Pulsieren in den Wänden, ein Windhauch, der einem Atem glich. Die meisten Hexenhäuser waren mehr als ein Zuhause, sie waren selbst auf gewisse Art magisch.
Deshalb wartete ich.
Keine zehn Atemzüge später hörte ich Schritte, die Tür schwang auf. Das Lächeln der Frau vor mir versiegte bei meinem Anblick, ihr Mund verzog sich zu einem überraschtem O und ihre Augen wurden glasig. Mein Herz zog sich zusammen. Sie sah mir so ähnlich. Goldblondes Haar, das in Wellen über ihre Schultern fiel, vielleicht etwas lockiger und definitiv kürzer, aber genauso wild. Die gleichen graublauen Augen, die grün wurden, wenn die Wut uns übermannte, oder hellblau bei Freude. Schmale, geschwungene Lippen. Die Sommersprossen, die über meine Nase und meine obere Wangenpartie liefen, hatte sie nicht, dafür eine Narbe zwischen ihren Brauen, die meine Mutter in jungen Jahren durch einen ungewollten Schlag mit einem Stößel zu verantworten hatte. Sie hatte ein Grübchen in der linken Wange, das man sogar entdeckte, wenn sie nicht lachte – aber vor allem hatte sie ein Hexenmal, das sich bei ihr an ihrem rechten Handgelenk gezeigt hatte und das ich bis heute nicht besaß. Ich war die Einzige aus unserer Familie, bei der es sich nicht gezeigt hatte. Das Mal, das nicht nur unseren Charakter und in abstrakter Form unsere Bestimmung aufzeigte, sondern als Segen der Göttin Artemis galt. Der Schöpferin der ersten drei Hexen. Es war, als wäre ich ohne das Hexenmal nicht genug. Nicht für Artemis und nicht für meine Familie. Zumindest einen Teil davon …
»Hi, Tante Brenna«, wisperte ich und spürte, wie meine Kehle sich vor Sehnsucht zuzog. Denn meine Tante sah nicht nur mir, sondern damit auch meiner Mutter ähnlich und sie nach zehn Jahren wiederzusehen, war unbeschreiblich.
»Sasha.« Ihre Stimme war weniger als ein Hauchen und trotzdem jagte sie eine Gänsehaut über meine Arme und sorgte dafür, dass sich meine Augen mit Tränen füllten. Tränen, die ich nie vergießen wollte, an einem Ort, den ich nie wieder hatte betreten wollen.
»Lange nicht gesehen.« Es war nicht mehr als ein Wimpernschlag für eine Hexe, trotzdem hatten sich die Jahre meiner Abwesenheit wie eine Ewigkeit angefühlt.
Meine Tante keuchte auf, schloss die Lücke zwischen uns mit zwei großen Schritten und umarmte mich so stürmisch, dass Atlas kaum Zeit blieb, seine Flügel auszubreiten und ihr laut kreischend auszuweichen. Der Aufprall entlockte mir ein leises »Uff«, die Reisetasche glitt aus meiner Hand und in der Sekunde, in der sich Brennas Arme fest um mich schlangen und ich ihr Schluchzen vernahm, konnte ich nicht anders, als sie ebenfalls fest an mich zu drücken. Sie roch nach frischer Erde und unzähligen Kräutern, mit denen sie wohl kurz vor meinem Eintreffen in der Küche oder dem Wintergarten hantiert hatte.
Ich wurde wehmütig.
Ich wurde wütend.
Auf so viele Dinge, dass ich zu zittern begann.
»Du hast meine Nachricht erhalten.« Brenna lehnte sich zurück, machte sich nicht die Mühe, ihre Trauer und auch ihre Freude zu verstecken, sondern strahlte mich mit nassen Wangen breit an. Ihre vordere Zahnlücke kam zum Vorschein, die ich schon als Kind wunderschön fand, und sie umfasste mein Gesicht, als wäre ich ein verlorener Schatz, den sie endlich gefunden hatte. Vermutlich war ich das für sie auch in gewisser Weise. »Du bist zurück, meine Kleine«, brachte sie fast ungläubig heraus und ich schaffte es nicht, sie zu korrigieren. Ihr zu erklären, dass ich nicht bleiben würde, egal, wie sehr ich sie vermisst hatte. Dass ich, nachdem ich bei Gran war, wieder gehen würde. Dieses Mal für immer. Oder zumindest bis zu Brennas letztem Tag. Doch ich war mir sicher, tief im Inneren wusste meine Tante das bereits, auch wenn sie es nicht wahrhaben wollte.
»Du bist so erwachsen geworden.«
»Ich bin kein Teenager mehr, falls du das meinst.«
Meine Tante lachte auf und wischte ihre Tränen weg.
»Nein, das bist du nicht. Dein sechsundzwanzigster Geburtstag war vor sechs Wochen und ich wünschte, du wärst hier gewesen, damit wir darauf anstoßen.« Nein, deswegen war ich nicht hier.
Ich räusperte mich. »Also ist es wahr?«
»Komm erst mal rein. Sie ist oben«, erwiderte Brenna schlicht und mir wurde schlecht.
Seit ihre Nachricht mich gefunden hatte, gab ich alles, um ihren Inhalt zu verdrängen, ihn schönzureden oder zu denken, dass das, was darin stand, schlicht falsch war. Aber es war keine Lüge gewesen. Kein Vorwand, um mich aus dem Exil herzulocken. Nicht, dass ich das geglaubt hatte, denn es war verboten, aber die Wahrheit konnte ich genauso wenig glauben.
Meine Großmutter war krank. Sehr krank. Dabei passierte das nur selten, weil wir gegen die meisten menschlichen Krankheiten immun waren.
Tante Brenna führte mich mit ihrer Hand auf meinem unteren Rücken zur Tür. Der Zauber, der auf dem Haus lag, fühlte sich beim Eintreten an, als würden Ameisen über meine Haut laufen. Schnell rieb ich mir die Arme, um das Gefühl zu vertreiben. Atlas blieb lieber draußen und machte es sich auf Mutters Stuhl gemütlich. So war er etwas weniger empfänglich für meine Emotionen und konnte alles im Blick behalten. Brenna entging meine Reaktion nicht.
»Entschuldige. Alaric hat die Schutzbarriere erneuert.« Brenna verdrehte die Augen und fügte murrend hinzu: »Mal wieder.« Eine Art Rumpeln ertönte.
»Das Haus ist anscheinend genauso genervt wie du.«
»Oh ja.«
»Erwartet er, ausgeraubt zu werden?« Meine Stimme klang spöttisch. Das Haus würde ohnehin reinlassen, wen es wollte, ungeachtet dieser Zauber. Natürlich konnten sie mehr Schutz bieten, aber nur, wenn das Haus auch der Meinung war, dass das, was draußen war, auch draußen bleiben sollte.
Meine Tante zuckte mit den Schultern.
»Der Hexenrat und …« Im nächsten Augenblick winkte sie jedoch ab und sprach nicht weiter. »Eigentlich ist es nicht so wichtig.«
Ich verkniff mir ein Schnauben und einen bissigen Kommentar, denn ich war nicht hergekommen, um auch nur einen Gedanken an meinen Vater oder den Rat zu verschwenden. Das hatten beide nicht verdient.
Stattdessen sah ich mich um. Das Haus hatte sich kaum verändert. Die Einbauschränke quollen über vor Büchern, hauptsächlich Hexen- und Familiengeschichte, alte Grimoires, Kräuterwissen und allgemeine Formeln, natürlich jedes durch spezielle Zauber geschützt, damit die Bücher weder gestohlen noch von den falschen Personen gelesen werden konnten. An jeder Ecke standen Pflanzen und Blumen, es fühlte sich warm und nach einem Heim an. Und ich war sicher, sowohl dafür als auch für die langen gelben Vorhänge und bunten Teppiche auf dem alten dunklen Parkett war meine Tante verantwortlich – nicht Alaric.
Gedankenverloren trat ich an den offenen Kamin und betrachtete die unzähligen gerahmten Bilder darauf. Ich fand mich nur auf zweien. Das eine zeigte Brenna, meine Mutter und mich als Baby während einer Sommersonnenwendfeier, das andere Brenna und mich, als ich ungefähr acht war beim Kuchenbacken, voller Mehl im Gesicht und mit einem breiten Lächeln. Mir wurde so schwer ums Herz, als ich es betrachtete, dass ich für einen Augenblick dachte, ich könnte keine Sekunde länger bleiben und müsste sofort verschwinden. Weg von all dem, was ich verlassen musste, um hinter mir zu lassen, was mich innerlich kaputtmachte. Also wandte ich meinen Blick ab und sah mir die anderen Fotos an. Auf einem waren meine Mutter, Brenna und Gran, ein anderes war das Hochzeitsfoto meiner Eltern. Der Rest war nichts weiter als eine lieblose Ansammlung, die meinen Vater und seine Mutter mit wichtigen Mitgliedern des Rates oder auf Ratsversammlungen zeigte.
»Ist er hier?« Meine Stimme war ruhig, doch selbst in meinen Ohren klang die Frage, als würde ich mir lieber ein Bein abhacken, als ihn zu sehen. Und es wäre nicht ganz gelogen.
»Nein«, ertönte es leise und schneidend zugleich, sodass ich mich versteifte, bevor ich mich der Stimme zuwandte, die eindeutig nicht meiner Tante gehörte. »Dein Vater hat wichtigere Dinge zu tun, als das Haus zu hüten oder dich in Empfang zu nehmen.«
»Cassandra.« Mehr sagte ich nicht, stattdessen zwang ich mich zu einer Art Kopfneigen. Ich wollte zwar nicht, dass wir uns sofort an die Gurgel gingen, aber noch weniger wollte ich ihr in den Arsch kriechen. Am besten wäre es gewesen, wir hätten uns gar nicht erst getroffen, aber das Glück hatte ich eindeutig nicht.
Meine Großmutter väterlicherseits schnaubte über meine Geste, mit der ich sie ihrer Ansicht nach wohl doch eher verspottete, als Respekt zu zeigen. Es war kein Geheimnis, dass wir nie viel füreinander übriggehabt hatten. Selbst meine Magie krümmte sich in ihrer Gegenwart, war hin- und hergerissen, sich entweder auf sie zu stürzen oder sich so weit wie möglich von ihr zu entfernen.
»Und du solltest auch nicht hier sein. Du darfst nicht und das weißt du. Das hier ist nicht länger dein Zuhause, du hast an diesem Ort nichts zu suchen.«
»Dieses Haus wird immer ihr Zuhause sein«, erwiderte Brenna wütend und ballte die Hände zu Fäusten, als ich mich zu ihr drehte. Durch das Haus wehte eine Brise, als wollte es ihr zustimmen.
Cassandra lachte höhnisch. »Du kennst die Gesetze.«
Ja, Brenna kannte sie, genauso wie ich, und sie waren für Ratsfamilien weitaus schlimmer als für andere. Wenn man nicht für den Rat war und sein Leben nicht ihren Zielen widmete, wartete das Exil auf einen. Man war frei, ohne frei zu sein. Ich musste dieses Haus und all seine Erinnerungen hinter mir lassen, genau wie Gran und Brenna. Kein Kontakt. Kein Besuch. Bestattungen waren die Ausnahme, aber da Gran zum Glück noch lebte, war das hier wohl eher eine Grauzone. Eine sehr dunkle Grauzone. Nur war mir das egal. Scheiß auf die Konsequenzen. Ich wollte zu Gran. Zu der, die ich wirklich als solche verstand, die mich kannte und liebte, und es spielte keine Rolle, ob mich der Rat dafür bestrafen würde.
»Keine Sorge, ich verschwinde bald wieder. Und danke, dass du stattdessen das Empfangskomitee bildest. Allerdings bin ich weder wegen dir noch wegen meines Vaters hier. Ich habe wichtigere Dinge zu erledigen.«
Ich wollte mich wegdrehen, sie mitten im Raum stehen lassen, doch sie reagierte auf meine Worte schneller als erwartet.
Die Ohrfeige traf mich hart und schnell, schleuderte meinen Kopf nach rechts und hallte nach. Das Haus erzitterte, Bücher wackelten in den Regalen und Brenna keuchte auf. Nicht nur wegen des Schlags, der Reaktion des Hauses oder wegen Atlas’ Ruf, der von draußen zu uns hereindrang, sondern weil meine Magie derart ruckartig ausbrach und um mich herumwaberte, dass selbst Cassandra die Zähne fletschte und einen Schritt zurückwich. Wasser begann sich durch das Parkett zu drücken, es hier und da zu brechen. Es bebte und rumorte unter meinen Füßen. Würde ich dem keinen Einhalt gebieten, würde ich den ganzen Boden aufreißen. Ein kleiner Teil von mir wollte den Preis bezahlen, wollte das Wohnzimmer zerstören, das Heim meiner Mutter, von Gran und Brenna, nur um Cassandra wehzutun. Um meiner Wut und Trauer ein Ventil zu geben.
Aber sie war es nicht wert. Nicht jetzt. Nicht heute. Also atmete ich tief durch, konzentrierte mich auf nichts anderes als auf meine Magie und rief sie zurück. Das Haus beruhigte sich und die Bücher rückten an ihren Platz. Brenna war bereits dabei, mit Sprüchen und ihrer Magie den leichten Schaden an den Dielen zu beheben. Während sie das Wasser aus dem Holz zog, betrachtete ich Cassandra eindringlich. Ihr schwarzes Haar mit der grauen Strähne vorne, das sie zu einem strengen Dutt gebunden hatte. Ihre harten Züge, die Aristokratennase und hohen Wangenknochen. Die dunkelbraunen Augen. Nein, ich hatte nichts von ihr. Nicht von ihr und nicht von meinem Vater und ich war verdammt dankbar dafür. Sie war etwas kleiner als ich, jedoch deutlich schlanker. Deutlich älter.
Aber nicht deutlich mächtiger …
»Dein Vater hat wegen dir viel durchgemacht. Die ganze Familie muss weiterhin mit der Schmach leben, dass es dich gibt. Eine Hexe aus dem Hause Asteris, die sich von dem Oberhaupt der Familie abwendet und ins Exil verschwindet. Eine Hexe ohne Hexenmal. Unwürdig und …«
»Cassandra«, zischte Brenna und wollte ihr sichtlich Einhalt gebieten, doch ich hob nur meine Hand, um sie zu stoppen. Meine Tante sollte nicht auch noch ihren Hass auf sich lenken, schließlich war hier ihr Zuhause. Sie musste nicht meine Kämpfe führen. Ich jedoch würde Cassandra unter die Erde ziehen oder sie im nächsten Fluss ertränken, sollte sie mich je wieder anrühren. Ich war jung, aber ich war kein Kind mehr.
Cassandra schob sich eine Strähne aus der Stirn und kräuselte die Lippen.
»So viel verschenktes Potenzial. Meine Blutlinie, die ganze Magie meiner Vorfahren … einfach vergeudet. Für den Abklatsch einer Hexe.« Das Schnalzen ihrer Zunge klang wie ein Peitschenhieb. »Die erste Hexe würde sich im Grabe umdrehen, hätte sie eines.« Asteris, eine der ersten drei Hexen. Die Linie, aus der sowohl die Osborn- als auch die Bishop-Linie hervorging. Sie alle hatten ihr Leben gehabt, aber dieses war meines und ich war es leid, mich dafür zu entschuldigen.
Grimmig sah ich Cassandra an. Meine Wange brannte noch immer. Irgendwann würde sie dafür bezahlen.
»Und ich«, begann ich und trat ganz dicht vor sie – beinahe Nase an Nase –, »muss damit klarkommen, dich als Großmutter zu haben. Eine Frau, die sich von ihrer eigenen Schwiegertochter verdrängt gefühlt hat und die, genauso wie ihr Sohn, nach nichts mehr strebte als Ansehen, Geld und Macht. Weder damals noch heute. Mein Vater hat ein altes Artefakt und den Rat seiner Tochter vorgezogen und ist besessen von etwas, das er nicht finden wird. Das seid ihr beide. Ich denke, wir sind quitt, was Enttäuschungen angeht.« Ich ging nicht auf mein Hexenmal ein und legte erst recht keine Rechenschaft ab, warum ich damals mit nichts weiter als einem großen Rucksack, etwas Geld, einem Foto meiner Mutter und meinen Tarotkarten Amsterdam verlassen hatte.
Eindringlich musterte ich ihr Gesicht, dann trat ich zurück. Luft war nicht mein Hauptelement. Es gehörte nicht, wie Wasser oder Erde, zu den Elementen, die ich gut beherrschte, doch ich schaffte es mit viel Anstrengung, sie für ein paar Sekunden zu kontrollieren. Nur kurz, nur leicht. Aber lange genug, um Cassandra gerade so viel Luft vorzuenthalten, dass sie für einen Moment zu röcheln begann und ihre Augen sich ungläubig weiteten.
»Oh, und … rühr mich nie wieder an. Falls doch, zeige ich dir gerne, wie viel Magie ich in mir trage – trotz deiner Blutlinie.«
Kapitel 2
Jade Bishop war eine begnadete Hexe. Dass sie nun mit nur zweihundertdrei Jahren krank vor mir im Bett lag, kaum älter aussehend als eine Frau in ihren Vierzigern, wollten weder mein Herz noch mein Verstand begreifen.
»Du hättest nicht herkommen sollen.« Grans Stimme klang dünn, ihr Gesicht wirkte eingefallen. So, als hätte ihre Magie sie längst verlassen.
Ich schluckte schwer. Mein Herz, nein, mein ganzer Brustkorb zog sich zusammen bei ihrem Anblick. Das hier durfte nicht passieren. Ja, Gran war krank, sehr sogar, doch sie würde wieder gesund werden. Sie musste gesund werden. Die Karten hatten mir nichts verraten, ich hatte keine schlechten Träume gehabt, nicht mal ein ungewöhnliches Gefühl. Grans Zustand kam für mich derart plötzlich, dass er keinerlei Sinn ergab. Es sei denn …
Ich rutschte im Sessel ein Stück nach vorne und griff nach ihrer rechten Hand. »Warum liegst du hier? Verdammt, was ist passiert? Hast du dich vor mir verborgen?« Meine Stimme klang gefasst, weil ich Angst hatte, jeder zu laute Ton könnte die Frau vor mir brechen.
Auf dem Nachttisch brannte Salbei, ein altes Hexenbuch mit Gedichten lag aufgeschlagen daneben. Eines der drei Fenster war offen, die Vorhänge waren jedoch zugezogen. Der schwache Schein von ein paar Kerzen, die auf der bunt bemalten Kommode standen, spendete Licht und Trost.
Gran tätschelte meine Hand.
»Du siehst deiner Mutter immer ähnlicher. Und du bist so erwachsen geworden.«
»Ich weiß«, wiederholte ich die Worte, die ich zu Brenna gesagt hatte, und nickte.
»Geht es dir gut? Legst du immer noch die Karten? Die deiner Mutter? Sie wäre stolz. So stolz. Und ich … ich habe immerzu nach dir gesehen.« Mit ihrer Magie. Und das Wissen darüber schnürte mir den Hals zu. Sie hatte mich nie gehen lassen wollen, aber sie hatte bemerkt, wie sehr ich in der Gegenwart meines Vaters und der von Cassandra gelitten hatte. Und als mein Hexenmal mit sechzehn Jahren immer noch nicht zu sehen gewesen war und mir damit klargemacht wurde, welche Schmach ich der Familie brachte, sagte Gran mir, ich solle meinen eigenen Weg gehen und meinen Frieden finden. Obwohl sie wusste, was das bedeutete. Mein Vater hatte mir nur erklärt, es wäre vielleicht besser so. Ein klarer Schnitt. Damit alle erkannten, was für eine Enttäuschung seine einzige Tochter war und niemand mehr seine Zeit damit verschwendete, Hoffnung zu hegen, ich könnte dem Rat beitreten oder gar nützlich sein, indem ich dazu beitrug, die Büchse der Pandora zu finden, damit endlich alles Unheil, das aus ihr entkommen war, wieder eingesperrt werden konnte. Ich hatte nie geglaubt, dass das Unheil aus der Büchse die Menschen zu schlimmen Dingen verleitet hatte, sondern vielmehr, dass sie das Schlimme bereits in sich trugen. Das Unheil verstärkte es vielleicht, aber es würde nie eine Welt geben ohne das Böse. Ohne niederträchtige Gedanken und Taten. Außerdem hielt ich dieses Artefakt nicht für ein Macht- oder Prestigeobjekt. Mehr davon war nichts, was wir anstreben sollten, denn wir besaßen bereits genug.
Wie konnte eine Hexe so denken?
Eine Schande.
Egal, wie sehr ich versuchte, es zu verdrängen, der Gedanke, dass Cassandra womöglich recht behalten hatte, schlich sich selbst nach zehn Jahren noch in meinen Kopf. Eine Hexe ohne Mal, die kein Interesse hatte, das Erbe ihrer Vorfahren fortzuführen, ihre Magie und ihr Wissen mit dem Rat und der Gemeinschaft zu teilen und sich der heiligen Aufgabe der Hexen zu verschreiben? Demütigend. Entehrend. Schließlich war das allein der Grund unserer Existenz.
Ich biss mir auf die Innenseite der Wange, um Schmerz durch Schmerz zu ersetzen und diese Gedanken beiseitezuschieben.
»Du hast gesagt, mein Schicksal würde mich überall auf der Welt finden und ich dürfe gehen, wenn mich das glücklicher macht«, murmelte ich, bevor ich immer schneller redete und die Worte unaufhaltsam aus mir herausbrachen. »Und das habe ich getan. Ich bin gegangen und nie zurückkommen. Habe niemandem verraten, wo ich bin, und meine Schutzzauber gründlich ausgeführt. Meine Identität war danach eine andere, ich war nicht die verschmähte Tochter eines angesehenen Ratsmitglieds, sondern lediglich eine wenig begabte Hexe mit einem Dartmouth-Abschluss, die nach Boston zog, dort ihr eigenes Geschäft eröffnete und etwas Geschick im Legen von Karten bewies.« Weil meine Gefühle mich zu übermannen drohten, machte ich eine Pause und befeuchtete meine Lippen.
»Du konntest frei leben, und zwar so, wie du es wolltest.« Grans Mimik und das Funkeln in den Augen zeigten ihren Stolz und zugleich ihre Wehmut.
»Ich dachte, er würde mich irgendwann zurückschleifen.«
»Du wolltest gehen und niemand hatte das Recht, dich aufzuhalten.«
»So einfach ist es nicht, das weißt du.« Bei Ratsmitgliedern war man strenger.
Meine Großmutter seufzte und drückte meine Hand. »Sie können dich rügen, sie können dir sagen, du hättest unverantwortlich und egoistisch gehandelt und dieses Haus sei nicht mehr dein Zuhause. Aber das ist Unfug. Manche Gesetze und Moralvorstellungen sind es nicht wert, gelebt zu werden. Niemand sollte seine eigene Freiheit aufgeben.«
»Aber ich musste euch aufgeben.« Meine Brust fühlte sich schwer an, meine Lunge, als würde sie gequetscht werden. Seit ich gegangen war, war alles anstrengend gewesen und zugleich leichter. »Und hätte er wenigstens versucht, mich aufzuhalten oder mich zurückzurufen, hätte ich mir einreden können, dass er mich vielleicht liebt.« Das auszusprechen tat weh. Es war das erste Mal, dass ich diesen Gedanken zu Worten formte.
»Du bist seine einzige Tochter. Natürlich bedeutest du ihm etwas.« Jedoch beteuerte Gran nicht, dass mein Vater sein Handeln mit Sicherheit bereute. Sie log mich nicht an und sie spekulierte nicht. Eigenschaften, die ich schätzte. Was nützte eine Lüge? Egal, wie schön sie sein mochte, egal, wie gut sie tat, sie blieb am Ende, was sie war: eine Illusion. Etwas, das nicht existierte.
»Statt mich aufzuhalten und mich von meinen Aufgaben zu entbinden, hat er mich ins Exil gehen lassen. Er hätte mir die Freiheit schenken können, hier, bei uns daheim, und zwar ohne mir meine Familie zu nehmen. Als Ratsmitglied hätte er einen anderen Weg finden können. Es sind mehr als zweitausend Jahre vergangen, in denen Hexen und Hexer die Büchse gesucht haben. Niemand hat sie gefunden. Wir sollten uns und unsere Gesetze an die heutige Zeit anpassen. Gesetze können geändert werden.« Ich war ihm das nicht wert gewesen.
Gran öffnete den Mund und schloss ihn sofort wieder. Anscheinend wusste sie nicht, was sie dazu noch sagen sollte, und ich ebenso wenig. Also saßen wir da, schwiegen uns an und hingen unseren Gedanken nach. Bis ich die Stille nicht mehr ertrug.
»Ich wollte nie fort, aber ich konnte auch nicht bleiben. Früher oder später wäre ich an diesem Ort erstickt«, brachte ich hervor und schluckte die Trauer hinunter, die in mir bei diesem Geständnis aufkam. »Ich habe dich und Tante Brenna sehr vermisst.«
Gran lächelte mich sanft an. »Ich weiß, mein Schatz. Ich weiß …«
Ich räusperte mich. »Ich habe mich aus der Familienpolitik, den Zielen des Zirkels und aus all den Problemen und Intrigen herausgehalten und es hat mir gutgetan. Stück für Stück habe ich mir etwas aufgebaut, und als ich endlich das Gefühl hatte, ich könnte glücklich werden, bekomme ich von Brenna die Nachricht, du seist krank?« Ich sprang auf, tigerte im Raum auf und ab, weil ich das Sitzen nicht mehr ertrug. »Du! Von allen Wesen ausgerechnet du? Das kann nicht sein. Sag mir, dass das nicht euer Ernst ist. Du bist nicht krank, Gran! Du warst es nie.«
»Brenna hätte das nicht tun dürfen. Es ist nicht so wichtig, dass …«
»Nicht so wichtig?« Meine Stimme hob sich, ohne dass ich es verhindern konnte, und die Magie des Wassers rauschte wie ein wilder Fluss durch meine Adern. Kühl und gewaltig.
Wie konnte sie das sagen? Wie konnte sie das herunterspielen? Sie war neben Brenna und Atlas die Einzige, die mir wirklich etwas bedeutete. Ich hatte sie im Stich gelassen, war gegangen und nach all den Jahren sah ich sie wieder, nur um ein zweites Mal Lebewohl zu sagen? Das konnte nicht sein.
»Oh, Sasha.« Eine Träne rann über ihre Wange. Sie streckte ihre Hand nach mir aus und ich setzte mich erneut hin, ließ sie meine Hand tätscheln, ein-, zweimal, bevor das Licht im Zimmer flackerte, als würde jemand versuchen, es zu löschen. Grans Blick wurde ernst und eindringlich, wobei sich eine tiefe Falte zwischen ihren Brauen bildete. Ihre Stimme war kaum mehr ein Wispern. »Ich bereue nicht viel im Leben, aber dass wir getrennte Wege gehen mussten, schon.«
»Bei Artemis!« Ich war frustriert und wütend. Ich war unendlich traurig.
»Es tut mir so leid, meine Kleine. Ich wünschte, ich könnte es dir erklären, aber …« Ihre Stimme brach, sie sprach nicht weiter, sondern biss sich auf die Zähne. Es sah aus, als hätte sie Krämpfe. Ein Zittern durchfuhr ihre Hände und Arme und auch wenn sie es gut überspielte, entging es mir nicht.
»Warum geht es dir so schlecht?«, fragte ich erneut, weil ich das Gefühl nicht loswurde, dass mehr dahintersteckte. Ich schluckte schwer.
Alles an dieser Situation fühlte sich falsch an.
»Lass uns morgen weiterreden, ja?«
Ein Schnauben entfuhr mir und ich strich mir erschöpft über die Stirn. Sie wich der Frage aus.
»Gran …«
»Morgen«, insistierte sie und lächelte mich an, bevor sie einen heftigen Hustenanfall bekam. Einen Moment später verzog sie das Gesicht, atmete schwerer und schneller und konnte die Augen kaum noch offen halten.
Ich wollte sie anschreien, ihr erneut all die Fragen stellen, die mir auf der Seele brannten, aber das würde warten müssen. Gran brauchte Ruhe.
»Soll ich dir etwas bringen? Hast du Schmerzen?«
»Nein, nein. Es geht schon. Wir sehen uns beim Frühstück. Deine Tante wird mit Sicherheit etwas Leckeres backen und … Cassandra wird außer Haus sein. Mabon steht bevor, sie hat keine Zeit, sich mit dir zu beschäftigen, selbst wenn sie wollte.«
»Du hast es also mitbekommen? Das vorhin.« Nachdem ich Gran ordentlich zugedeckt hatte, lehnte ich mich in meinem Stuhl zurück.
»Natürlich. Das Haus hat sofort auf deine Magie reagiert.« Gran gab alles, um mich anzusehen und nicht einzuschlafen. Ihre Lider wurden schwerer und schwerer. »Das Haus mag Cassandra nicht, sosehr sie auch versucht, es zu ihrem zu machen. Magie ist …«
»… nicht gleich Magie«, beendete ich mit ihr den Satz, den sie mir in meiner Kindheit eingebläut hatte. Sie nickte lächelnd.
»Außerdem habe ich deinen Begleiter gehört. So wie er klang, war er kurz davor, dir zu Hilfe zu eilen, um Cassandra die Augen auszuhacken und ihr Gesicht mit seinen scharfen Krallen zu verunstalten. Ich mochte das Käuzchen schon immer.« Das ließ mich schmunzeln.
Gran schloss die Augen und ich erinnerte sie nicht daran, dass Atlas es nicht ausstehen konnte, wenn man solche Verniedlichungen für ihn benutzte.
»Bis morgen, Gran. Ich liebe dich.« Doch sie war bereits eingeschlafen und hörte mein Flüstern nicht mehr.
Kapitel 3
»Es ist alles so, wie du es hinterlassen hast.« Brenna deutete auf mein altes Holzbett, das unter dem großen Dachfenster stand. »Selbst die unordentliche Decke. Zum Glück hattest du kein Essen hier drin, es hätte über die Jahre furchtbar gestunken.«
»Niemand hat mein Zimmer betreten?«, hakte ich geschockt nach und spürte, wie mich alte Erinnerungen fluteten. Ich sah Ella und mich, wie wir bis spät in die Nacht auf dem Boden gesessen hatten, um Popcorn zu essen und uns die Karten zu legen und ich sah Atlas, wie er mich getröstet hatte, als ich den ersten Geburtstag ohne meine Mutter feiern musste. Das alles war längst vorbei und trotzdem für immer ein Teil von mir.
»Cassandra wollte es direkt am nächsten Tag renovieren und ausräuchern lassen, aber das Haus hat ihr die Tür vor der Nase zugeschlagen.« Brennas Lächeln wirkte schadenfroh und zufrieden, während sie die Hände vor der Brust verschränkte.
»Das Haus?« Verwundert hob ich die Brauen und erwiderte ihren Blick. Sie nickte, als wäre sie stolz auf diese vier Wände.
»Ja. Es hat die Tür verschlossen und nicht mal dein Vater konnte sie öffnen. Beide haben es über Wochen versucht, mit jedem möglichen Schlüssel und Zauberspruch. Irgendwann haben sie es aufgegeben.« Sie zuckte mit den Schultern und ich sah mich um. Mein kleiner Schreibtisch stand in der Ecke, Staub hatte sich über ihn und meine Lieblingslampe gelegt. Meine Kristallsammlung auf dem Regal darüber funkelte hingegen, als wäre die Zeit spurlos an ihr vorübergezogen. Es roch nach abgestandener Luft und einem Hauch getrockneter Minze. Meine Mutter hatte Minze geliebt und ich auch. Nachdem ich weggegangen war, konnte ich diesen Duft nicht mehr ertragen, doch jetzt schnürte er mir den Hals zu und fühlte sich wie eine Umarmung an. Ich war dem Haus dankbar, dass es all das für mich bewahrt hatte.
Bedächtig fuhr ich mit den Fingern über den Globus auf dem Tisch, nahm die abgebrannte Kerze in die Hand und mir fiel ein, dass Brenna sie mir gemacht hatte. Eines ihrer vielen Talente.
»Ich erinnere mich noch gut daran, wie Rylee das Haus damals gefunden hat. Wer weiß, vielleicht hat das Haus auch deine Mutter gefunden. Sie hat all ihre Magie und ihr Herz reingesteckt, um es zu renovieren und zu einem Ort zu machen, der Schutz und Rückzug bietet. Es sollte mehr sein. Sie wollte für dich ein richtiges Heim schaffen.«
Ich stellte die Kerze zurück und wandte mich meiner Tante zu, die mich eindringlich ansah.
»Meine Schwester ist nicht mehr da, aber dieses Haus wird immer einen Teil von ihr bewahren. Egal, wie lange sie bereits tot ist, und egal, was dein Vater oder dieses Biest behaupten, dieses Haus gehört Rylee – und es ist deines.«
»Es ist nur ein Haus«, erwiderte ich mit belegter Stimme, obwohl ich tief im Inneren wusste, dass das nicht stimmte. Denn Hexenhäuser waren wie Katzen, sehr eigen und sehr starrsinnig, aber auch loyal. Sie suchten sich ihre Familien und Bezugspersonen aus und konnten durchaus einen speziellen Charakter besitzen. Dieses Haus war nicht nur das. Es lebte. Und es hatte das, was mir wichtig war, über all die Jahre erhalten. Kein Wunder also, dass, keine Sekunde nachdem ich die Worte ausgesprochen hatte, die Dielen wackelten und sich sogar das Fenster öffnete. Ein heftiger Windstoß fegte durchs Zimmer und ließ ein gerahmtes Bild auf meiner Kommode umkippen. Meine Füße trugen mich hin, wie von selbst, ich hob es auf, wischte den Staub vom Glas und spürte, wie der Kloß in meinem Hals wuchs. Mutter, Gran und Brenna lagen mit mir auf dem großen Teppich im Wohnzimmer. Sie hatten mir einen Blumenkranz aufgesetzt. Wir waren barfuß, trugen bunte Kleider. An meinem und Brennas Mund klebte Schokolade. Ich war noch jung, aber ich kann mich an diesen Moment erinnern, als wäre er gestern gewesen. Es war Sommersonnenwende und wenige Tage vor meinem siebten Geburtstag, wir hatten uns Geschichten erzählt, hatten gesungen und waren zusammen eingeschlafen und das Haus hatte uns in der Nacht das Feuer im Kamin entfacht.
In jenem Jahr war sie gestorben …
In jenem Jahr hatte sich alles verändert.
»Nur ein Haus«, wiederholte ich wispernd und blinzelte die Tränen weg, die sich in meinen Augen sammelten. Ein Windhauch streichelte mir die Wange zum Trost.
Ich fragte mich, ob es weniger schmerzhaft gewesen wäre, wäre ich geblieben. Hätte ich mich meinem Vater gebeugt, statt allem den Rücken zu kehren, nur um jetzt erneut damit konfrontiert zu werden.
Dieses Zimmer war wie eine Reise in der Zeit.
»Ich … hole dir ein paar frische Sachen«, sagte Brenna, die wohl gemerkt hatte, was dieser Moment mit mir machte, und mir einen Augenblick für mich gab. Denn sie hätte alles, was sie brauchte, einfach herrufen können. Jede Hexe und jeder Hexer beherrschte die Fähigkeit, Dinge zu bewegen und zu sich zu rufen. Wir alle waren Fadenlenkerinnen und Fadenlenker. Manche konnten es intuitiv, andere benutzten Zaubersprüche, die einen konnten nur zu sich ziehen, was sie sahen, andere wiederum alles, was sie je gesehen hatten – solange es beweglich und nicht zu groß war.
Nachdem Brennas Schritte langsam verklungen waren, schnappte ich mir meine Reisetasche aus dem Flur und nahm die schwarze Box, die mit Sternen, Ranken, Monden und verschiedenen Kräuterblumen bemalt worden war, heraus. In ihr fanden sich meine Tarotkarten, eingehüllt in schwarzes Seidenpapier. Mit ihnen hatte ich bisher niemandem die Karten gelegt, nur mir selbst.
Als ich mich auf das Bett setzte, versank ich in meiner weichen Matratze, wobei überraschenderweise keine Staubschicht aufpuffte. Dann breitete ich das Deck darauf aus. Ich gab dem Drang nach, die Karten aufzudecken, darüberzustreichen, und es fühlte sich an, als würde ich meiner Mutter dadurch das erste Mal seit meinem Fortgehen wieder richtig nahe sein. Hier und jetzt.
Mit diesen Karten hatte sie mir Rat gegeben und Mut gemacht, hatte mir Tarot beigebracht, ihre Art zu deuten, zu fühlen und denken und dabei trotzdem meine eigene zu bewahren. Die Karten waren robust, fast so groß wie meine Hand, doch das Besondere daran waren definitiv die Motive. Meine Mutter hatte sie eigenhändig illustriert. Jede einzelne. Die Hauptkarten in Farbe, die restlichen in Schwarz-weiß. Auf dem Rücken war eine Motte zu sehen, ein Totenkopfschwärmer vor einem Sichelmond und einem tiefschwarzen Nachthimmel. Dutzende Sterne umrahmten ihn.
Die Dielen knarzten.
»Ist das Rylees Set?« Tante Brenna hielt frisches Bettzeug im Arm und betrachtete die Illustrationen. Sie schmunzelte und deutete auf eine der Karten. Auf die Liebenden. »Ja, das ist es. Diese musste sie neu machen, weil du als Baby so gern damit gespielt hast. Einmal hast du sogar dran genuckelt und eine der Kanten abgelutscht.«
Ich schnaubte belustigt. »Unmöglich!«
»Doch! Das war deine Lieblingskarte. Genau wie diese hier.« Sie zog Pandoras Box hervor, die Karte, die ich jedes Mal aus dem Deck nehmen musste, weil sie eigentlich nicht hineingehörte. »Die hast du unzählige Male geknickt, aber Rylee konnte sie immer wieder retten.«
Ich wünschte, ich könnte mich daran erinnern … und dass ich es nicht konnte, tat an manchen Tagen mehr weh als an anderen.
»Und die hier.« Brenna tippte auf das Rad des Schicksals. »Ehrlicherweise ging die auf das Konto von Atlas, er hat sie gern durch die Luft geschleudert.«
Ich musste bei dem Gedanken grinsen.
»Los.« Tante Brenna ruckte mit dem Kopf und bedeutete mir damit, mich zu bewegen. »Lass mich dein Bett machen.«
»Das kann ich selbst erledigen.« Ich sammelte die Karten ein und legte sie auf den Nachttisch, bevor ich aufstand und Brenna die Arme hinstreckte, um die Decke und das Kissen entgegenzunehmen. Doch sie kniff nur ihre Augen und Lippen zusammen.
»Nein, tut mir leid, das wird nicht passieren.«
Seufzend schüttelte ich den Kopf. »Fein, du Dickkopf. Dann ziehe ich wenigstens alles ab.«
Zuerst die alte Bettwäsche auf den Boden, die Laken folgten danach. Die frische Luft, die dank des Hauses durch das offene Fenster drang, tat gut und half dabei, den Staub zu vertreiben.
»Du könntest hexen«, erwähnte ich beiläufig, während ich mit meiner Magie den restlichen Staub entfernte.
»So ist es persönlicher.« Und ich wusste genau, wie sie das meinte. Meine Tante schien es zu genießen, die Dinge mit den eigenen Händen zu machen. Zumindest in diesem Moment. Mir ging es genauso.
»So, fertig.« Plötzlich spürte ich Brennas Magie. Meine Tante murmelte ein paar Worte und die dreckigen Sachen schwebten aus dem Zimmer in Richtung Waschküche. Fröhlich stemmte sie die Hände in die Hüften.
»Persönlich ist vorbei?«, zog ich sie auf.
»Das zählt nicht. Ich hab wirklich keine Lust, heute noch in den Keller zu gehen.«
»Spürst du schon das Alter in den Knochen?«, neckte ich sie.
»Hey! Werd nicht frech, ich bin erst hundertzehn.«
Amüsiert trat ich auf sie zu. »Danke für deine Hilfe.« Ich nahm sie in den Arm, drückte sie fest an mich. »Danke, dass du mich hergerufen hast.« Ich meinte es ehrlich. Es stimmte, dass ich nie zurückkommen wollte, aber das hatte nichts mit Gran oder Brenna zu tun.
Mit ihrer linken Hand strich sie mir beruhigend über den Rücken.
»Hätte ich es nicht getan, hätte deine Mutter mir, wo immer ihre Seele auch sein mag, den Hintern aufgerissen. Das ist Schmerz, auf den ich durchaus verzichten kann.« Ich lachte leise, bis Brenna weiterredete und ihre Stimme dabei ernster klang. »Ich werde immer auf deiner Seite sein, Sasha. Immer.«
»Es kann sein, dass man dir das übel nehmen wird.«
Ein entrüsteter Ton drang an mein Ohr, bevor sie mich sanft zurückschob, um mir ins Gesicht sehen zu können.
»Lass das meine Sorge sein. Und komm nachher noch mal runter, um etwas zu essen, ja? Ich mache dir deinen liebsten Kürbiseintopf, er sollte gegen neun fertig sein. Falls du vorher Hunger bekommst, nimm dir etwas Brot. Ich habe es heute früh frisch gebacken.«
»Ohne Kümmel?« Ich rümpfte die Nase und sie verdrehte amüsiert die Augen.
»Du hast tatsächlich Glück. Da ist kein Kümmel drin.«
»Danke, Brenna.«
»Bis später, kleine Hexe.«
So hatte mich meine Mutter immer genannt …
Meine Tante schloss die Tür hinter sich. Ich war allein in meinem alten Zimmer mit meinen Karten und Dutzenden von Erinnerungen.
Atlas war am liebsten draußen. Falls etwas sein sollte, würde er sich bemerkbar machen. Ich entspannte mich ein wenig, auch wenn sich meine Gedanken unaufhörlich darum drehten, was ich für Gran tun konnte und wann ich wohl meinem Vater begegnen würde.
Manchmal erinnerte ich mich daran, dass er nicht immer so verschlossen und distanziert gewesen war. Als meine Mutter noch lebte, hatte er oft gelacht. War ausgeglichener gewesen.
Aber was brachte es, an Vergangenem festzuhalten? Manchmal barg das Halten mehr Schmerz als das Loslassen.
Ich würde nicht bleiben. Sobald es Gran besser ging, würde ich zurück nach Boston gehen. Dort hatte ich meinen Laden, mein ruhiges Leben, meine Routinen. Und obwohl dieser Entschluss feststand, nahm ich meine Karten, um sie um Rat zu fragen.
Zuerst prüfte ich sie auf Vollständigkeit, ordnete sie, beginnend mit dem Großen Arkana, bevor ich sie und ihre Energie reinigte.
Die Menschen dachten, Tarot sei irgendwann um 1430 n. Chr. erfunden worden. Eine Weiterentwicklung eines einfachen Kartenspiels, das erst im 17. Jahrhundert für die Wahrsagerei genutzt wurde. Doch wie immer sahen Menschen nur, was sie sehen wollten. Tarot gab es bereits seit den ersten drei Hexen: Asteris, Orphea und Helios. Die Karten waren verewigt in der hexischen Geschichte. Früher nannte man sie Schicksalshand oder Schicksalskarten, manche nannten sie Artemis’ Stimme, später übernahmen allerdings die meisten Hexen die Bezeichnung Tarot.
Wenn Menschen Tarot legten, war das Ergebnis falsch. Wenn Alchemistinnen Tarot legten, konnte es der Wahrheit nahekommen, doch es blieb vage und allzu oft fehlerhaft. Die Gaben der Alchemisten und Alchemistinnen waren ohnehin oft willkürlich. Legten jedoch Hexen Tarot, war es ein wahrhaftiger Blick in die Zukunft. Ob man es deuten konnte oder nicht: Legte eine Hexe die Karten, legte sie eine mögliche Wahrheit. Nur Frauen wurde diese Gabe vererbt, Männern offenbarten sich die Karten nicht. Warum, wusste niemand. Man ging davon aus, dass es daran lag, dass Artemis drei Hexen schuf – Frauen und keine Männer – und die göttliche Linie in weiblicher Form stärker war. Aber das war reine Spekulation.
Ich legte den Stapel verborgen vor mich auf das Bett und hob meine Hände darüber. An meiner linken Hand trug ich am Zeigefinger einen goldenen Ring mit zwei Steinen: Bergkristall und Turmalin. Bergkristalle hatten klärende und spirituelle Eigenschaften und halfen dabei, Karten zu reinigen. Vor allem, weil ich nicht ständig Salbei oder Myrrhe bei mir hatte und gerade auch keine Lust verspürte, runter in Brennas Küche oder Kräutergarten zu gehen, um zu schauen, ob sie welche getrocknet vorrätig hielt. Der Stein konnte negative Energien abwehren und sogar ins Positive wandeln. Turmaline galten als Steine der Beruhigung, konnten die Entspannung fördern, die Muskeln und das Nervensystem beruhigen. An meiner rechten Hand trug ich an gleicher Stelle einen Goldring mit einem ovalen schwarzen Obsidian, einem der stärksten Schutzheilsteine für Hexen. Am Ringfinger trug ich einen Ring, der ähnlich einer Krone geformt war, geschmückt mit sieben kleinen weißen Mondsteinen. Der Ring meiner Mutter. Eine Hommage an den Mond, den ich genauso sehr liebte, wie sie es getan hatte, und gleichzeitig auf gewisse Art ironisch, denn Mondsteine galten als Symbol der Göttin Artemis.
Mit geschlossenen Augen erdete ich mich mithilfe des Turmalins, atmete tief durch und ließ meine Hände weiter über den Karten schweben. Ich konzentrierte mich auf meine Magie. Sie floss in sie hinein und ich konnte vor meinem inneren Auge sehen, wie die Karten darin badeten und aufleuchteten.
Die Reinigung war wichtig, weil das Deck lange nicht an diesem Ort war und er so voll war von alten Emotionen und Erinnerungen, dass es Einfluss haben konnte auf die Legung. Wer nicht klar sah, sah oft falsch.
Ich öffnete die Lider. Zweimal klopfte ich mit dem Finger auf das Deck, bevor ich es in die Hand nahm. Zweimal, weil es sich für mich richtig anfühlte. Wie ein Anklopfen, bevor man ein Haus betrat. Es war ein Ritual, aber auch eine Sache der Höflichkeit gegenüber der Kraft, die mir mithilfe der Karten eine oder mehrere mögliche Seiten meines Schicksals offenbaren würde.
Konzentriert mischte ich die Karten und stellte in Gedanken die eine Frage, die immer wieder aufkam. In meinem Kopf und meinem Herzen. Und obwohl ich nicht müde wurde zu betonen, dass die Antwort darauf längst feststand, gab es etwas in mir, das aus irgendwelchen Gründen zweifelte, deshalb fragte ich: Sollte ich meine Familie und Amsterdam ein weiteres Mal verlassen?
Ich zog die erste Karte und legte sie vor mir auf das Bett. Sie stand für den gegenwärtigen Zustand. Ich hatte den Eremiten gezogen. Keine Überraschung in Anbetracht meiner Lage und der Frage, die ich gestellt hatte. Der Eremit stand für Selbstreflexion, Einsamkeit, Weisheit und die Reise nach innen. Eine Karte, die mir sagte, ich solle mich von der Außenwelt zurückziehen und den Blick nach innen richten, um Antworten zu bekommen. Meist zeigte der Eremit, dass man sich nach Zeit für sich selbst sehnte, nach Wahrheit und Klarheit. Man sollte sich auf den eigenen Lebensweg besinnen.
Die zweite Karte stand dafür, welche Auswirkungen es auf mich und mein Leben hatte, sollte ich in Amsterdam bleiben.
Der Hierophant. Er symbolisierte Tradition, Spiritualität und Weisheit und stand für den Zugang zu höherem Wissen, das durch gelebte Traditionen und Rituale erlangt wurde, aber eben auch Hierarchie und moralische Gerechtigkeit. Auch passend, schließlich wäre das wieder ein Teil von mir, würde ich hierbleiben. Der Rat, der Coven, mein Vater. Amsterdam stand demnach für alte Werte und Traditionen, was allerdings zu Einschränkungen führen könnte.
Die dritte Karte stand dafür, welche Auswirkungen es auf mich und mein Leben hatte, sollte ich Amsterdam verlassen.
Ich legte sie vor mir ab. Der Wagen stand für Bewegung, Entschlossenheit und Kontrolle. Für den eigenen Triumph. Alles würde bleiben, wie es war, es würde kaum Veränderungen geben. Wieder von hier fortzugehen, hätte wohl kaum Auswirkungen auf mein Leben.
Ich seufzte. Das alles verriet mir nichts, was ich nicht längst wusste.
Die vierte Karte stand für verborgene Einflüsse.
Die Hohepriesterin. Eine Karte, die für Intuition, Weisheit, Geheimnisse und spirituelle Erkenntnis stand. Wie auch beim Eremiten war die Sicht nach innen gerichtet. Letztlich forderte sie mich auf, meinem Bauchgefühl zu folgen. Vielleicht existierten verborgene Aspekte meiner Entscheidung, derer ich mir nicht bewusst war. Sie könnte mir auch schlicht sagen, dass die Entscheidung, ob ich blieb oder ging, weniger wichtig war, als ich glaubte.
Die fünfte Karte: das Ergebnis.
Die Gerechtigkeit. Was auch sonst? Sie stand für Gleichgewicht und eine objektive Wahrheit. Ein Hinweis darauf, dass ich meine Gefühle zurücknehmen sollte, um meine Entscheidung mit dem Verstand zu fällen, statt mit dem Herzen, und mich nochmals zu fragen, ob das Gehen oder Bleiben einen echten Unterschied machen würde.
Wieder seufzte ich frustriert.
Das, was ich vor mir sah, war weder kompliziert noch aufregend. Es war ein wenig vage und kam gleichzeitig genau auf den Punkt.
Ohne Besonderheiten.
Eine Wahrheit von vielen.
Es war wie immer.
Ich musste mich nur fragen, was mich am Ende wirklich glücklicher machen würde – und wie hoch der Preis für dieses Glück sein durfte.
Kapitel 4
Sasha!
Keuchend wachte ich auf. Meine Haut war klamm und meine Finger zitterten. Drei Atemzüge lang kniff ich meine Augen zusammen, um mich zu erinnern, ob ich etwas Spezifisches geträumt hatte, aber es wollte sich nichts formen. Kein Bild, keine Erinnerung. Ich wusste nur, dass jemand meinen Namen gerufen hatte, und es war derart Gänsehaut erzeugend gewesen, dass ich aus dem Schlaf gerissen wurde.
Mein Mund war trocken, ich atmete schwer und meine Brust hob und senkte sich, als wäre ich einen Marathon gelaufen. Das fühlte sich falsch an. Das alles. Normalerweise wachte ich nicht mitten in der Nacht auf und träumte Dinge, an die ich mich danach nicht erinnern konnte, die mir aber trotzdem in den Knochen saßen. Normalerweise schlief ich durch. Seltsam.
Die Matratze knarzte leicht, als ich mich aufsetzte und mit einer Bewegung aus dem Handgelenk das Licht anschaltete. Alles war ruhig. Das Haus und die Bewohner darin.
Ein Blick auf meinen blauen Wecker, den mir Ella mal zu Weihnachten geschenkt hatte, weil ein Kauz drauf war, verriet mir, dass es gleich drei sein würde.
Mit meiner rechten Hand strich ich mir ein paar verirrte Strähnen aus der Stirn. Ich fühlte mich gerädert. So müde, als hätte ich nicht bereits ein paar Stunden geschlafen. Dabei war ich, nachdem ich einen Teller von Brennas leckerem Eintopf gegessen und mich im Bad fertig gemacht hatte, sofort ins Bett gegangen.
Vielleicht war es dieser Ort, vielleicht die Reise und die Aufregung, möglicherweise die Sorgen. Egal, was davon zutraf und mich aus dem Schlaf gerissen hatte, ich sollte mich noch ein wenig ausruhen.
Meine Lider wurden immer schwerer.
Es war nur ein Traum, dachte ich und ließ mich zurückfallen, kuschelte mich erneut unter der Decke ein und war dabei, das seltsame Gefühl abzuschütteln.
»Sasha!«
Wieder mein Name. Doch dieses Mal war die Stimme nicht in meinem Kopf und ich riss die Augen auf, als mir klar wurde, von wem sie stammte.
»Gran«, hauchte ich und sprang eine Sekunde später aus dem Bett. Das Haus öffnete meine Tür für mich, ich rannte barfuß über den Flur, aus der zweiten Etage die Treppe hinunter. Ihr Zimmer lag direkt unter meinem.
Ich schlitterte in den Raum, schaltete das Licht an und sah, wie Gran mit offenen Augen im Bett hin- und herschaukelte. Schweiß glänzte auf ihrer Stirn, ihr Blick wirkte glasig, ihre Wangen glühten. Sie murmelte Worte, die ich kaum verstand, Sätze, die keinen Sinn ergaben.
»Hexe, oh Hexe«, raunte sie wie im Singsang, während ich versuchte, ihre Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Die Decke war halb von der Matratze gerutscht, es war stickig im Zimmer, obwohl das Fenster offen stand. Ich rief nach Brenna, laut und aus vollem Halse, in der Hoffnung, das Haus würde meine Stimme bis zu ihr tragen. Danach strich ich Gran sanft über die heißen und geröteten Wangen und nahm ihr Gesicht in meine Hände. Eben hatte sie meinen Namen gerufen, klar und deutlich, doch sie war nicht hier bei mir. Nicht wirklich. Es war, als würde sie in einem Traum oder einer Vision feststecken. Halb schlafend, halb wach.
»Gib acht, kleine Hexe, auch bei Licht dringt Dunkelheit ein, drum lass deine Karten im Verborgenen sein.« Ihre Stimme klang rau, ihr Blick war entrückt und beides zusammen bescherte mir eine Gänsehaut. Nur mit Mühe konnte ich sie aufrecht hinsetzen und sofort sank sie in meine Arme, schunkelte sich dabei jedoch unermüdlich vor und zurück. Was passierte mit ihr?
»Gran!« Ich rüttelte sanft an ihr. Die Worte, die sie sprach, kannte ich nicht. Und ich machte mir zu große Sorgen, als dass ich sie in diesem Moment wirklich hätte verstehen können. Hatte sie das öfter gehabt oder war es das erste Mal? Ging es vorüber? Was, wenn nicht? Wo blieb Brenna?
»Die Wahrheit …« Gran lachte auf, ihre Haut war mittlerweile so heiß, dass ich meine Magie einsetzte, um einen kühlen, nassen Lappen zu rufen, mit dem ich sofort über ihr Gesicht strich.
»Versteckt, versteckt, versteckt!«, schrie Gran und bäumte sich auf. Ihr Körper krampfte. Mist!
Während ich selbst mit meinen Gefühlen kämpfte, versuchte ich, sie zu beruhigen. »Sch. Ich bin da. Alles wird gut.« Ich hoffte, ich hatte recht.
Kurz hörte sie auf, sich zu bewegen, dann schnappte sie mit ihrer Hand schnell und ohne Vorwarnung nach meinem Handgelenk. Umklammerte es ein wenig zu fest, ein wenig zu unnachgiebig. Ihr Kopf drehte sich zu mir, ihr Blick hielt meinen fest. Mein Atem stockte und Tränen schossen mir in die Augen. Sie so zu sehen, machte mir Angst, aber ich gab alles, um sie beiseitezuschieben und für Gran da zu sein. Ich musste ihr helfen, aus dieser Vision, diesem Traum, oder was auch immer es war, herauszukommen. Sie hatte mich gerufen, wollte, dass ich bei ihr war.
Das hier war ich ihr schuldig.
»Er darf sie nicht kriegen«, presste sie plötzlich hervor. Gran krallte ihre Nägel in meine Haut und kam mit ihrem Gesicht meinem so nah, dass ich ihren Atem auf meinem spüren konnte. »Niemals. Hörst du? Nie.«
»Was soll das bedeuten? Was hast du gesehen? Verdammt, Gran! Hörst du mich? Rede mit mir!« Doch sie driftete erneut weg, ich erkannte es an ihrem Ausdruck und der Art, wie ihre Augen nach hinten rollten.
»Jade! Sasha! Was ist los?« Schwer atmend kam Brenna endlich bei uns an, aber meine Aufmerksamkeit lag auf meiner Großmutter, und …
Die Atmosphäre änderte sich, es wurde kälter.
Ich keuchte.
Grans Züge wurden unerwartet sanft, ihr Griff weniger stark, sie teilte die Lippen und öffnete den Mund, nur kamen keine Wörter mehr heraus, sondern ein Schmerzensschrei. So erschütternd, dass ich zusammenzuckte. Dann kniff sie die Augen zusammen und stemmte sich gegen mich. Ich konnte sie kaum halten, fiel mit ihr aufs Bett, nur um mich sofort mit Brennas Hilfe wieder aufzurappeln. Ein Schauer lief über meinen Rücken, Panik flutete meinen Körper.
Ich rief ihren Namen, nahm ihre Hand, während meine Tante lautstark fluchte und ihre Hände über ihre Mutter hielt. Brennas Magie floss aus ihr heraus, um zu helfen. Der Raum leuchtete hell auf, Grans Körper wurde von Licht geflutet … doch es war zu spät.
Es war kalt im Zimmer. Zu kalt. Zu still.
»Nein«, flüsterte ich mit brechender Stimme und schluchzte. Schmerzerfüllt und tief und oft. »Gran! Wach auf.«
Es war sinnlos. Mein Verstand wusste das, aber mein Herz wollte nicht begreifen, dass ihres nicht mehr schlug.
Jade Bishop war in meinen Armen gestorben.
Brennas Mutter war weg.
Meine Gran war fort.
Ihre Hand entglitt mir, ich brach zusammen. Meine Knie knallten auf den Boden und der Aufprall erschütterte meinen ganzen Körper. Mein Blick war nach innen gerichtet. Meine ganze Welt hielt für einen Moment den Atem an.
Ich war eine junge Hexe und hatte bereits jetzt keine Mutter und keine Großmutter mehr – zumindest keine, die ich liebte. Zwei von vier Wesen, die mir alles bedeuteten, waren weg. Einfach nicht mehr da. Und egal, wie viel Macht ich besaß, der Tod war etwas, das selbst wir Hexen nicht ändern konnten. Nicht ohne Konsequenzen. Was tot war, blieb tot – es sei denn, man gab sein eigenes Leben für ein anderes. Aber es war nicht nur das. Dieser Zauber gehörte zu jenen, die einen Preis verlangten. Wenn man diesen Schritt ging, verwehrte man seiner Magie und seiner Seele die Möglichkeit, weiterhin Teil dieser Welt zu sein. Wasser, Erde, Feuer, Luft. Man war danach nichts mehr. Man war fort. Noch dazu benötigte man dafür jedwede Kraft und Magie, die man besaß, man gab alles von sich und am Ende musste man hoffen, dass es funktionierte. Ein Wimpernschlag zu spät und …
»Sasha.« Tante Brenna schluchzte. Ich hörte sie dumpf, als wäre sie weit weg. Eine Berührung an meinen Armen ließ mich zusammenzucken. Dann eine weitere und ich merkte, wie meine Sicht klarer wurde. Brenna hielt mich, rieb mir über die Arme, während sie selbst bitterlich weinte. Träne um Träne rann über unsere Wangen, während unsere Blicke sich verhakten.