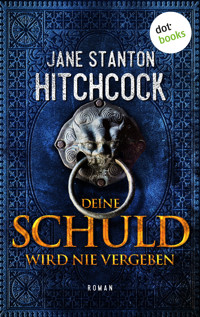
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ihr ganzes Leben – eine Lüge? Der abgründige Roman »Deine Schuld wird nie vergeben« von Jane Stanton Hitchcock jetzt als eBook bei dotbooks. Die Malerin Faith Crowell erhält einen Auftrag, der zu verlockend scheint, um ihn abzulehnen: Die enigmatische Kunstsammlerin Frances Griffin lädt Faith ein, für ein paar Wochen auf ihrem abgelegenen Anwesen in Long Island zu wohnen. Dort soll Faith einen Ballsaal mit neuen Wandgemälden schmücken, der dem Andenken der vor Jahren verstorbenen Tochter gewidmet ist. Doch was wie ein lukrativer Auftrag aussieht, entwickelt sich schnell zu einem finsteren Katz-und-Maus-Spiel: Faith erfährt, dass die Tochter unter mysteriösen Umständen ums Leben kam – und dass sie ihr verblüffend ähnelt. Sie schwört sich, die Wahrheit über die Vergangenheit herauszufinden … aber bald ist nicht mehr sicher, wer Jägerin und wer Gejagte ist. Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der fesselnde Spannungsroman »Deine Schuld wird nie vergeben« von Jane Stanton Hitchcock. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 465
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Die Malerin Faith Crowell erhält einen Auftrag, der zu verlockend scheint, um ihn abzulehnen: Die enigmatische Kunstsammlerin Frances Griffin lädt Faith ein, für ein paar Wochen auf ihrem abgelegenen Anwesen in Long Island zu wohnen. Dort soll Faith einen Ballsaal mit neuen Wandgemälden schmücken, der dem Andenken der vor Jahren verstorbenen Tochter gewidmet ist. Doch was wie ein lukrativer Auftrag aussieht, entwickelt sich schnell zu einem finsteren Katz-und-Maus-Spiel: Faith erfährt, dass die Tochter unter mysteriösen Umständen ums Leben kam – und dass sie ihr verblüffend ähnelt. Sie schwört sich, die Wahrheit über die Vergangenheit herauszufinden … aber bald ist nicht mehr sicher, wer Jägerin und wer Gejagte ist.
Über die Autorin:
Jane Stanton Hitchcock, in New York geboren und aufgewachsen, ist erfolgreiche Autorin von Bühnenstücken, Filmproduktionen und preisgekrönten Romanen. Neben dem Schreiben ist das Pokerspiel ihre große Leidenschaft: Jane Stanton Hitchcock nimmt regelmäßig an der World Poker Tour sowie den World Series of Poker teil.
Bei dotbooks erscheinen ihre mörderisch guten High-Society-Romane »Park Avenue Killings« und »Park Avenue Murders«, sowie der Vatikan-Thriller »Das schwarze Buch«.
***
eBook-Neuausgabe Februar 2021
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1992 unter dem Originaltitel »Trick of the Eye« bei Dutton, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 1994 unter dem Titel »Trügerischer Blick« bei Blanvalet.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1992 by Jane Stanton Hitchcock
TRICK OF THE EYE by Jane Stanton Hitchcock. Copyright © 1992, 2003 by Jane Stanton Hitchcock.
By arrangement with the author. All rights reserved.
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1994 Blanvalet Verlag GmbH, München
Copyright © der Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: © HildenDesign unter Verwendung mehrerer Motive von Shutterstock.com
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (CG)
ISBN 978-3-96655-169-4
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Deine Schuld wird nie vergeben« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Jane Stanton Hitchcock
Deine Schuld wird nie vergeben
Roman
Aus dem Amerikanischen von Christa Seibicke
dotbooks.
Kapitel 1
Auf dem Schild an meiner Tür steht: TROMPE-L'ŒIL, INC. Ich verkleide jeden geeigneten Untergrund mittels illusionistischer Malerei, und das zu einem annehmbaren Preis. Zur Auswahl biete ich Imitate – Marmor, Holz, Schildpatt, Bambus – und architektonische Effekte wie Nischen, Säulen, Fenster oder Türen. Ich kann einen Raum mit Tieren, Vögeln und Menschen bevölkern oder ihn auflockern mit Girlanden, Festons, Wolkenhimmel. Ich möchte den Betrachter auf unterhaltsame Weise dazu bringen, aus der Realität herauszutreten, um sich, und sei's auch nur für einen Augenblick, einzulassen auf den Zauber der Illusion.
Mein Beruf erfordert Augenmaß und Akkuratesse, vor allem aber eine ruhige Hand. Ich kleckse nicht wahllos unbehandelte Leinwand in Bettlakengröße mit Farben voll. Die Kunst ist für mich kein Mittel zur Selbstfindung, weshalb ich auch nicht herumsitze und auf Inspirationen warte. Ich schiele weder nach Ruhm noch nach Unsterblichkeit. Ich übe ein Handwerk aus, und ich bemühe mich Tag für Tag, gute Arbeit zu leisten. Mit der Anonymität habe ich mich abgefunden. Ich bin vielleicht nicht glücklich, aber doch zufrieden.
Ich heiße Faith Crowell, bin neununddreißig Jahre alt und, um es mit einem Wort zu sagen, das meinem etwas verschrobenen Faible fürs Archaische und Anachronistische entgegenkommt, eine alte Jungfer. Ich habe nie geheiratet, auch wenn ich einmal so nahe dran war, daß ich schon das Brautkleid gekauft hatte. Aber das ist eine andere Geschichte. In der Dämmerung, auf dem Heimweg in eine leere Wohnung, habe ich mitunter schon daran gedacht, wie anders mein Leben verlaufen wäre, wenn diese Hochzeit stattgefunden hätte. Aber sobald ich dann zu Hause bin, geborgen zwischen Chintz, Katze und Nippes, dem bevorzugten Ambiente alleinstehender Frauen in der Großstadt, ist die Welt gleich wieder in Ordnung. Ich koche mir was Leichtes, genehmige mir ein Glas Wein und lese, bis ich über meinen Träumen einschlafe.
Punkt sieben stehe ich auf. Einen Wecker brauche ich nicht, denn Regelmäßigkeit ist immer noch die beste Weckuhr. Nach einem leichten Frühstück nehme ich ein Bad, ziehe mich an und stelle der Katze ihr Futter raus. Spätestens Viertel nach acht bin ich auf dem Weg ins Atelier.
Mein Atelier liegt im dritten Stock eines bescheidenen, kommunal vermieteten Brownstones, eines dieser typischen New Yorker Reihenhäuser mit rötlichbrauner Sandsteinfassade. Von meiner Wohnung sind es nur zehn Blocks bis dorthin, und frühmorgens, wenn die Passanten noch zielstrebig und energiegeladen wirken, gehe ich das kurze Stück gern zu Fuß. Ich sehe tagein, tagaus die gleichen Leute – Ladenbesitzer, Pflegekräfte, Pendler. Manchmal erkennt man sich und nickt einander freundlich, aber wortlos zu, was ich sehr angenehm finde.
Von den anderen Mietern im Haus bekomme ich nur selten jemanden zu Gesicht. Und trifft man sich doch einmal auf der Treppe, dann grüße ich ihn oder sie prinzipiell sehr freundlich. In einer Stadt wie New York City schaut man nicht spontan beim Nachbarn vorbei, um eine Tasse Zucker zu borgen oder einen Kaffee zu trinken, und deshalb habe ich kaum Kontakt zu meinen Mitbewohnern – was mir ebenfalls sehr angenehm ist.
Ich wohne in der City, weil ich hier meine Arbeit habe, aber ich könnte ohne weiteres auf dem Land leben, und irgendwann möchte ich auch rausziehen. Bis es soweit ist, zehre ich von der Vorfreude. Mein Leben, das ist meine Arbeit und ein paar Freunde. Ich bin ziemlich abgekapselt, ja, aber wenn man bedenkt, wie es heute überall auf der Welt gärt und die Neurosen wuchern, geht es mir eigentlich recht gut, finde ich.
Vor ein paar Jahren hatte ich einmal eine Phase, wo ich mitten in der Nacht ohne ersichtlichen Grund aufwachte und einfach nicht wieder einschlafen konnte. Fiebrige Angst wütete in meinen Eingeweiden, indes ich über die Sinnlosigkeit des Lebens – insbesondere meines eigenen – nachgrübelte. Irgendwann stand ich auf und wanderte im Zimmer herum, bis ich mich im Halbdunkel an den Spiegel heranpirschte und ihn fragte, wer dieses furchtgeplagte Wesen mit dem irren Blick, das er zeigte, eigentlich sei. Wenn es endlich hell wurde, fühlte ich mich alt wie der Tod. Meine Technik ließ nach. Das Geschäft ging den Bach runter. Eines Tages mußte ich die Arbeit ganz aufgeben. Für das nervöse, das sogenannte Künstlertemperament ist in der Trompe-l' œil-Malerei kein Platz.
Zum Glück dauerte dieses Tief nicht ewig. Es brauchte seine Zeit, aber irgendwann berappelte ich mich wieder. Und ich stellte keine zu hohen Erwartungen mehr an das Leben. Statt dessen fing ich an, meine Zeit hier auf Erden als Etappe einer langen Reise zu betrachten und mich selbst als eine Art Transitpassagier. Fortan nahm ich die Kapriolen und Enttäuschungen des Lebens hin, wie ein geübter Globetrotter die Unannehmlichkeiten und Überraschungen wegsteckt, die ihm unterwegs zugemutet werden.
Ich begann wieder zu malen. Zu meiner Überraschung hatte meine Technik nicht ernsthaft gelitten; im Gegenteil, meine Arbeit hatte eine neue Tiefendimension gewonnen. Das fiel auch anderen auf, und bald konnte ich mich vor Aufträgen kaum noch retten. Heute geht mein kleines Trompe-l' œil-Geschäft sehr gut, wobei ich natürlich auch von dem gängigen Trend des »Mehr scheinen als sein« profitiere.
Meine Kunden kommen in der Regel nicht zu mir ins Atelier. Meistens bespreche ich die Aufträge telefonisch mit einem Innenarchitekten. Ich war daher ziemlich überrascht, als an einem ungewöhnlich warmen Aprilnachmittag die Türklingel ging und auf meine Frage, wer denn unten sei, eine Stimme über die Sprechanlage antwortete: »Frances Griffin wünscht Miss Crowell zu sprechen.«
Jeder, der auch nur im geringsten in der Kunstszene bewandert war, kannte den Namen Frances Griffin. Sie und ihr verstorbener Gatte, Holt Griffin, hatten damals, als der Markt noch reich war an wertvollen Bildern und Antiquitäten, eine bedeutende Sammlung aufgebaut. Die Griffin Collection, die zu den ersten des Landes gehörte, war in den beiden Jahrzehnten unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden, als der internationale Kunstmarkt noch nicht durch verschärfte Ausfuhrbestimmungen geknebelt wurde. Nach Holt Griffins Tod stiftete seine Witwe viele ihrer Bilder bedeutenden Museen, darunter den schönsten noch in Privatbesitz befindlichen Tizian. Die Griffins und ihre Sammlung waren jedem, der sich nur im mindesten für Kunst interessierte, ein Begriff.
Holt Griffin, Sproß einer alteingesessenen und vermögenden New Yorker Familie, hatte sich, anders als die meisten seines Standes, durch langjährige Tätigkeit im diplomatischen Dienst selbst einen Namen gemacht. Zufällig wußte ich auch, daß sein Vermögen ursprünglich aus der Fabrikation von Kanaldeckeln stammte und später in Immobiliengeschäfte investiert worden war. Ende des neunzehnten Jahrhunderts hatte Holt Griffins Urgroßvater Elias Holt eine Eisenhütte gegründet, die in erster Linie jene schweren grauen Metallplatten produzierte, mit denen die Abwasserkanäle von New York gesichert wurden. Ich habe mir das gemerkt, weil ich eine Schwäche für solche Details habe – pikante, belanglose Klatschgeschichten, die zu rein gar nichts nütze sind, außer als bunte Tapete für den grauen Alltag.
Das Vermögen stammte zwar von Holt Griffin, aber den Kunstverstand, den besaß Frances Griffin, die Frau, die eben jetzt meine drei Treppen hinaufstieg. Der Aufbau der Griffin Collection galt allgemein als ihr Verdienst. Sie war eine jener legendären Gestalten, die mit ihrem untrüglichen Sinn für Stil und Geschmack selbst in besten Kreisen Ehrfurcht wecken. Sonst wußte ich nicht viel über sie, außer, daß Mrs. Griffin, die vormals, als gefeierte Sammlerin, ein großes Haus geführt hatte, jetzt sehr zurückgezogen lebte und einen sprichwörtlichen Horror vor Partys, Publicity und Publikum bekundete.
Ich ging hinaus auf den schäbigen Flur und sah sie die Treppe heraufkommen – eine schlanke, auffallend gut angezogene Frau mit mädchenhafter Ausstrahlung und beschwingtem Gang. Ihre Augen blickten klar und wißbegierig aus einem großporigen, aber gleichwohl hübschen Gesicht. Sie mußte Anfang bis Mitte Siebzig sein, was man ihr aber nicht ansah. Nein, sie sah fabelhaft aus für ihr Alter, nur wirkte sie, wie viele reiche Leute, ein kleines bißchen unecht. Ihre makellose Kleidung, die damenhafte Zurückhaltung und die Selbstverständlichkeit, mit der sie die gesprungenen Treppenstufen, die abblätternde Farbe und den penetranten Geruch im Flur überging, erinnerten an den guteinstudierten Auftritt einer Filmdiva.
»Guten Tag, meine Liebe«, sagte Mrs. Griffin und streckte mir, kaum, daß sie den Treppenabsatz erreichte, eine spitz zulaufende, diskret manikürte Hand entgegen. »Ich bin Frances Griffin.«
»Sehr erfreut, Mrs. Griffin. Ich bin Faith Crowell.« Ich merkte selbst, daß meine Stimme respektvoll um eine Oktave gesunken war.
Sie trug ein elegantes zartgrünes Wollkostüm mit passendem Hut; in der Hand hielt sie weiße Glacéhandschuhe und eine schwarze Lackledertasche. Ihre auffallend kleinen Füße steckten in schlichten Lackpumps mit niedrigem Absatz. Eine Goldbrosche, besetzt mit grünen und rosa Peridoten, die einen Fisch darstellte, prangte an ihrem rechten Jackenaufschlag.
Ich bat sie in mein Atelier, und als ich ihr eine Tasse Tee anbot, nickte sie freundlich. Wir saßen, ziemlich ungemütlich, auf zwei der zwölf vergoldeten Ballsaalstühle, die ich diese Woche auf Bambus trimmen wollte.
»Ich habe mir sagen lassen, Miss Crowell«, begann sie, »daß Sie sehr gut sein sollen in Ihrem Metier.« Ihre Stimme hatte den leicht aristokratischen Akzent der New Yorker Anrainerstaaten.
Ich bedankte mich, und da ich nichts von falscher Bescheidenheit halte, setzte ich hinzu, daß ich tatsächlich stolz sei auf meine Arbeit. Sie kniff ein Auge zusammen, öffnete ihre Handtasche und zog eine Brille heraus. Als sie die aufgesetzt hatte, sah sie sich im Atelier um.
»Ja«, sagte sie, während ihr Blick über ein paar Stücke wanderte, die ganz oder annähernd fertiggestellt waren – eine Kommode, ein Spiegel, ein kleiner Kaminsims – »ich sehe, Sie sind wirklich gut.« Sie fixierte mich über den Rand ihrer Brille hinweg. »Der Trick besteht darin, das Vorhandene ins rechte Licht zu rücken, stimmt's?« bemerkte sie.
»Im Leben wie in der Kunst«, sagte ich und lächelte.
Sie lachte stillvergnügt in sich hinein.
»Sie haben offenbar sehr viel künstlerisches Gespür. Die Marmorimitation gefällt mir besonders. Da drüben«, sagte sie und deutete auf den kleinen Kaminsims. »Entzückend, wie Sie das gemacht haben. Ich mag überhaupt falschen Marmor gern. Sie nicht auch? Ist doch längst nicht so pompös wie der echte. Echter Marmor bringt leicht etwas Kaltes in einen Raum.«
»Ja, der Meinung bin ich auch. Aber die Nachfrage ist immer noch sehr groß.«
»Echtes Schildpatt dagegen hat eine herrlich warme Ausstrahlung«, sagte sie. »Nur kriegt man's leider nicht mehr.«
»Schildpatt läßt sich sehr schlecht imitieren. Wenn ich nicht achtgebe, kommt am Ende eine Art verunglücktes Leopardenfell dabei raus.«
»Aber da ist es Ihnen sehr gut gelungen.« Sie wies mit dem Kopf auf den mit rot-schwarzem Blendschildpatt gerahmten Spiegel, der zum Trocknen an der Wand lehnte.
»Danke für das Kompliment. Der ist gestern erst fertig geworden. Im dritten Anlauf. Ich finde auch, jetzt macht er sich nicht übel.«
»Gute Imitationen waren immer schon gefragt – ob das jeweilige Original nun verfügbar war oder nicht.«
»Vermutlich geht darum mein Geschäft ganz gut.«
»So vieles Echte ist heute nirgends mehr zu kriegen. Eine Menge Dinge, die uns früher ganz selbstverständlich waren, sind einfach verschwunden.« Sie seufzte. »Was haben Sie nur für eine bewundernswert leichte Hand ... Wirklich sehr schön ...« Wieder ließ sie den Blick durch den Raum schweifen. »Ich möchte, daß Sie nach The Haven kommen und für mich arbeiten.«
Sie sagte das so hoheitsvoll wie eine Königin, die ohne Umschweife ihre Befehle erteilt. Anscheinend wußte sie genau, wie attraktiv ihr Angebot war, ja daß es als Auszeichnung galt, für sie zu arbeiten. Manch einer hätte eingewilligt, bloß um einmal einen Blick in das vielgepriesene Haus auf Long Island zu tun, das bisher noch nie für einen Bildband fotografiert oder in einem der einschlägigen Hochglanzmagazine vorgestellt worden war.
»Ich fühle mich geehrt«, sagte ich. »Und ich würde natürlich wahnsinnig gern für Sie arbeiten.«
Sie lächelte mich an, als habe sie keine andere Antwort erwartet. Dann nahm sie die Brille ab, klappte sie sorgfältig zusammen und schob sie in ihre Handtasche zurück.
»Es ist ein ziemlich großer Auftrag. Sie werden sich ein paar Monate ganz dafür freihalten müssen.«
»Oje, ich weiß nicht, ob ich das einrichten kann.«
Sie fuhr fort, als habe sie mich nicht gehört.
»Es handelt sich um einen Saal, den ich vor Jahren für den ersten Ball meiner Tochter bauen ließ. Nun hätte ich ihn gern renoviert, um ihn wieder in neuem Licht zu sehen. Es ist nie zu spät, die Dinge in neuem Licht zu sehen.«
Auch wenn sie es eher beiläufig sagte, spürte ich doch das Pathos, das sich hinter ihrem ungezwungenen Plauderton verbarg. Sie spielte mit dem Riemen ihrer Handtasche, wickelte ihn sich um den Finger und blickte mich dabei immer wieder so durchdringend an, als versuche sie, sich an etwas zu erinnern, sich mein Gesicht einzuprägen oder meine Gedanken auszuforschen. Mir wurde ganz eigenartig dabei zumute.
»Ich müßte all meine anderen Kunden im Stich lassen. Das geht nicht so ohne weiteres.«
»Besuchen Sie mich doch morgen einfach mal. Dann zeige ich Ihnen, was mir vorschwebt, und hernach können Sie in aller Ruhe entscheiden.«
»Mrs. Griffin«, sagte ich gedehnt, »Ihr Angebot ist wirklich sehr schmeichelhaft für mich. Aber darf ich fragen – wie sind Sie gerade auf mich gekommen?«
Sie zögerte einen Moment.
»Nun, Freunde haben mich auf Sie aufmerksam gemacht.«
Sie nannte zwei meiner reichsten und distinguiertesten Kunden. Ich bin immer wieder erstaunt darüber, daß die Welt der Superreichen so klein ist, wie ein Privatterritorium, in dem alle Nationalitäten vertreten sind. Der Geldadel scheint, genau wie die geborenen Aristokraten, auf der ganzen Welt miteinander versippt oder doch wenigstens bekannt zu sein. Und da viele von ihnen fast ihr ganzes Leben auf der Jagd nach Luxus, Vergnügen und materiellen Gütern verbringen, reichen sie die besten Handwerker, Kunsthändler und Innenarchitekten, Floristen und Küchenchefs untereinander weiter wie die Indianer ihre kostbaren Geschenke beim Potlach, den Initiationsfeierlichkeiten der jungen Häuptlingsanwärter. Über meinen Platz in ihrer Welt machte ich mir keine Illusionen. In ihren Kreisen war ein Handwerker eine Ware, weiter nichts.
»Und außerdem«, fuhr Mrs. Griffin fort, »haben wir anscheinend beide eine Schwäche für Paolo Veronese. Ich habe nämlich Ihren glänzenden Artikel über die Villa Barbaro gelesen. Wirklich sehr gut formuliert, und Sie würdigen darin einen Künstler, den ich hoch verehre.«
Den Essay, auf den sie anspielte, hatte ich vor einigen Jahren in einer wenig bekannten Kunstzeitschrift, dem Chiaroscuro, veröffentlicht. Er befaßte sich mit den berühmten Fresken in der Villa Barbaro von Maser, im Veneto. Paolo Veroneses drollige Trompe-l' œil-Szenen dort haben es mir besonders angetan. Natürlich schmeichelte es meiner Eitelkeit, daß Mrs. Griffin etwas von mir gelesen hatte.
»Freut mich sehr, daß Ihnen der Artikel gefallen hat. Ich habe eine Schwäche für die Villa Barbaro! Ich erinnere mich noch gut, wie ich zum erstenmal in der Halle stand und hinaufsah zu dem imaginären Balkon, von dem ein buntes Völkchen lebensgroßer Figuren samt Papagei und Schoßhund zu mir herunterblickten. Ich hätte damals schwören können, es wäre echtes Publikum.«
»Meine Tochter«, sagte sie unvermittelt. »Meine Tochter war sehr begeisterungsfähig – genau wie Sie.«
Ich entgegnete nichts darauf.
»Sie kommen mich also morgen besuchen?« fragte Mrs. Griffin, die schon hart an der Stuhlkante saß.
»Aber sicher. Trotzdem brauche ich Bedenkzeit. Denn so verlockend Ihr Angebot auch ist, ich muß mir erst darüber klarwerden, wie sich so ein großer Auftrag auf mein Leben auswirken würde.«
Ihr Blick schweifte noch einmal durch mein vollgestopftes, stickiges Atelier. »Nun«, meinte sie ziemlich von oben herab, »hier würde sich auf jeden Fall einiges verändern.«
Damit erhob sie sich. Ich brachte sie zur Tür.
»Bitte verzeihen Sie meine Bedenken«, sagte ich, als ich ihr die Tür aufhielt. »Aber seit ich mich mit der Verkleidung von Flächen befasse, habe ich mir angewöhnt, sie zuvor sehr genau zu prüfen – zu genau vielleicht.«
»Schon gut, überlegen Sie sich's.«
»Ich begleite Sie hinunter.«
»O nein! Danke, ich finde schon selbst hinaus. Ich erwarte Sie also morgen, sagen wir um vier? Dann können wir zusammen Tee trinken. Hier, damit Sie sich auch zurechtfinden.« Damit reichte sie mir eine bedruckte Karte mit einer Zeichnung des Hauses auf der Vorder- und einem Meßtischblatt auf der Rückseite. Ich verriet nicht, daß ich bereits wußte, wo The Haven lag.
Dann ging sie.
Als ich mich am Abend auf den Heimweg machte, hatte ich, ganz gegen meine Art, mächtiges Herzflattern. Ja, mir war so beklommen zumute, als hätte mit Frances Griffin das Schicksal bei mir angeklopft. Einerseits hatte ich wirklich keine Lust, wegen eines solchen Auftrags meine ganzen Pläne umzukrempeln; andererseits war es eine einmalige Chance, für diese ungewöhnliche Frau zu arbeiten. Und ich kann nicht leugnen, daß ihr glamouröser Auftritt mich beeindruckt hatte.
Mit meinem wohlgeordneten, aber eintönigen Leben – Grisaille statt Regenbogenbunt – hatte ich mich längst abgefunden. Ich hatte gelernt, daß Einsamkeit und Alleinsein nicht dasselbe Klima haben: Ersteres war drückend und klamm, letzteres dagegen kühl und belebend. Ich pfeife auf die Binsenweisheit, daß Menschen, die allein leben und arbeiten, vom Abenteuer des Lebens ausgeschlossen bleiben. Für mich ist die Phantasie der Schlüssel zum wahren Sein. Ohne Phantasie kann selbst die tollste Karriere langweilig werden. Mit ihr dagegen schmeckt Selters wie Champagner.
Glücklicherweise war meine Kunst eher ein Handwerk und dementsprechend verläßlicher, ungefähr wie ein Freund im Vergleich zu einem Liebhaber. Gelegentliche Einsamkeitskoller trafen mich wahrscheinlich weniger schlimm als meine sogenannten schöpferischen Kollegen, obwohl ich natürlich auch mein Quantum weghatte. Eben jetzt meldete sich wieder so ein Anfall von rotem Grausen. Ich mußte dringend mit jemandem reden.
Da half nur eins. Ich kaufte zwei Artischocken, ein Kalbsschnitzel extra und in unserer französischen Bäckerei eine Tarte Tatin. Dann rief ich auf gut Glück meinen lieben Freund Harry Pitt an und fragte, ob er heute abend noch frei sei. Er war.
Harry Pitt lebte, wie ich, sehr zurückgezogen und verbrachte seine Zeit lieber mit Büchern, Bildern und mit Mr. Spencer, seinem Zwergschnauzer, als in der Gesellschaft anderer Menschen. Harry war über siebzig und Junggeselle. In seiner Glanzzeit war er ein bekannter Kunsthändler gewesen, ein Ästhet, von dem sich Frauen in gewissem Alter gern ausführen ließen, wenn sie, wie ein Witzbold es taktvoll formulierte, gerade auf dem Trockenen saßen und deshalb »auf Männerfang« gingen.
Harry war inzwischen fast kahlköpfig und rund wie ein Faß, die Strafe dafür, daß er sein Leben lang keine glanzvolle Lunch- und Dinnerparty ausgelassen hatte. Er war eine Fundgrube an unnützen Informationen über unnütze Leute und damit natürlich der ideale Gesellschafter für mich. Er wußte von Pikanterien wie Mrs. Augustus Blodgetts Haute-Couture-Leichenhemd oder dem Spleen des Marquis de Greve, jungen Burschen in den Slums von Rio Geld dafür zu bieten, daß sie sich die Zähne ziehen ließen, um ihn bei der Fellatio besser bedienen zu können.
Harry war über alles im Bilde, was Rang und Namen hatte, und er unterhielt mich gern mit schlüpfrigen Geschichten vom »Gaudimax der High-Society«, wie er es nannte. Auf die Weise hatte ich schon manch vergnüglichen Abend mit Harry verbracht. Er thronte dann immer wie ein Pascha zwischen den quastengeschmückten Seidenkissen auf seiner Couch, zupfte an seinem langen weißen Seidenschal, rauchte Zigaretten in schwarzer Lackspitze und urteilte mit päpstlicher Strenge über die Gesellschaft von einst und jetzt. Fast ein Leben lang hatte er sich im Abglanz der Reichen und Schönen getummelt wie die Motte im Licht und dabei irgendwie die Erkenntnis gewonnen, daß die meisten Menschen bei sich bietender Gelegenheit früher oder später aus der Rolle fallen.
»Auf bewegliche Habe und Schoßtiere ist weitaus mehr Verlaß«, pflegte er zu sagen. »Da weiß man immer, wo man dran ist, und außerdem kommt die Wartung billiger.«
Beim Essen erzählte ich ihm von meiner Begegnung mit Frances Griffin.
»Frances Griffin ... Frances Griffin ...« Er wiederholte den Namen mehrmals, wobei er jedes »R« rollte und auf der Zunge zergehen ließ wie einen Schluck ausgezeichneten Claret.
»Wirklich eine interessante Frau«, sagte er. »Vielschichtig und mit Tiefgang. Na, und einen Blick hat sie – einfach genial. Du kennst natürlich die Geschichte über sie und diesen Kamin?«
»Nein«, sagte ich aufhorchend.
»Also es ist eine unglaubliche Geschichte, und trotzdem stimmt jedes Wort. Ich kenne den Architekten – das heißt, ich kannte ihn, er lebt nicht mehr.«
»Harry, du enttäuschst mich doch nie!«
In Erwartung einer von Harrys unvergleichlicher Anekdoten lehnte ich mich zurück. Er war mein Marco Polo, der mit Geschichten von Fürstenglanz und Reichtümern im Gepäck aus fernen Landen heimkehrt. Während des Erzählens schnitt er sein Kalbsschnitzel erst unter Zuhilfenahme von Messer und Gabel klein, legte dann aber das Messer weg und aß nach amerikanischer Sitte, mit der Gabel in der rechten Hand. Er nannte das eine seiner zeitaufwendigeren Allüren.
»Also, nachdem sie dieses herrliche Haus gebaut hatte, The Haven – wohin du Glückspilz morgen eingeladen bist – , machte sie am Tag der Fertigstellung einen Rundgang mit dem Architekten, um sich zu versichern, daß auch alles tipptopp war. Als sie in den Salon kamen, blieb sie wie angewurzelt stehen, blickte sich um und sagte: ›Hier stimmt etwas nicht.‹ Der bedauernswerte Architekt erstarrte zur Salzsäule und stotterte irgendwas daher. Seine unsterblichen Worte sind uns zwar nicht überliefert, aber wir dürfen getrost annehmen, daß er außer sich war. Sie drehte sich unterdessen ein-, zweimal langsam im Kreis und sagte schließlich: ›Der Kamin. Der steht nicht ganz in der Mitte, oder?‹ Mein Freund, der auch ein ziemlich gutes Augenmaß hatte, warf nun seinerseits einen prüfenden Blick auf das Ding und meinte dann, also er fände nichts auszusetzen. Das Ende vom Lied war, daß sie einen Zollstock holten, den verflixten Kamin ausmaßen – und, bei Gott, es fehlten tatsächlich fünfundzwanzig, dreißig Zentimeter bis zum absoluten Raummittelpunkt.
Tja, und nachdem Mrs. Griffin den Beweis geliefert hatte, sagte sie seelenruhig: ›Bitte bringen Sie das in Ordnung.‹ Worauf mein Freund, der Architekt, erwiderte: ›Mrs. Griffin, ich verspreche Ihnen, wenn der Salon erst eingerichtet ist, sieht man's bestimmt nicht mehr.‹ – ›Ich schon‹, widersprach sie. Und er wandte ein: ›Aber Mrs. Griffin, sie verstehen offenbar nicht – ich kann den Kamin nicht versetzen, ohne alle fünf Stockwerke einzureißen.‹ Worauf Frances Griffin (und das ist keine bloße Anekdote, sondern verbürgt durch meinen Freund, den Architekten und Betroffenen) zur Antwort gab: ›Ich hab Sie nicht gefragt, wie Sie das anstellen werden.‹
Damit ließ sie ihn stehen, und er machte sich daran, das Haus einzureißen und komplett wiederaufzubauen – auf ihre Kosten – mit einem Kamin haargenau im Zentrum. Zwei Jahre später machte sie wieder einen Rundgang durch das Haus, fand nichts mehr daran auszusetzen und zog ein. Na, wenn das keine moderne Variante der Prinzessin auf der Erbse ist, dann weiß ich's nicht!«
»Ich bin sprachlos!«
»Die Frau ist eine krankhafte Perfektionistin«, fuhr Harry fort. »Mit einem unfehlbaren Instinkt für Proportionen. Es heißt, sie bringt es fertig und spaziert in fremder Leute Haus oder Garten und erklärt ihnen, wie sie ihre Rosensträucher versetzen oder die Möbel umstellen sollen. Und erstaunlicherweise hat sie jedesmal recht. Einmal hat sie sogar einem Museumsdirektor erklärt, der Greuze in seiner Galerie sei eine Fälschung. Du kannst dir nicht vorstellen, was da los war! Aber das Bild war bei Gott eine Fälschung.«
»Wo hat sie sich denn all dieses Wissen angeeignet?«
»Ach, was sie weiß, kann man nicht lernen. Ihr Gespür für Proportion und Geschmack ist so etwas wie das absolute Gehör – das hat man oder man hat es nicht. Allerdings ist sie auch sehr gebildet. Sie hat sich große Mühe gegeben und sehr viel gelernt. Von den alten Meistern in der Malerei oder von Barockmöbeln versteht sie genausoviel wie jeder Kunsthistoriker.«
»Wo stammt sie eigentlich her?«
»Keine Ahnung. Ihre Familie gehört nicht zu denen, die man kennt.« Harry rümpfte die Nase. »Ich glaube, vor ihrer Heirat war sie gesellschaftlich eine ziemlich graue Maus. Aber als Holt Griffins Braut stand sie natürlich mit einem Schlag im Rampenlicht. Irgendwer erzählte mir mal, sie habe behauptet, ihr Vater sei Diplomat gewesen. Nun, vermutlich war seine diplomatischste Leistung die, sich in Luft aufzulösen, bevor jemand seine Tochter als Lügnerin bloßstellen konnte.«
Wir kicherten beide. Harry begann eine kleine Pyramide aus ausgelutschten Artischockenblättern zu errichten.
»Ich hab damals Fotos von ihr in Illustrierten gesehen«, fuhr er fort. »Sie war gewiß keine Schönheit, aber sie hatte Stil! Und offenbar war sie eine großartige Gesellschafterin, wahnsinnig amüsant. Tja, und irgendwie schaffte sie den Sprung in den Karpfenteich und angelte sich den heißbegehrten Mr. Griffin – was sämtliche faden, angejahrten Debütantinnen im weiten Umkreis maßlos empörte. War ein richtiger Skandal, damals. Ich find's köstlich, wie heute alle, die seinerzeit Gift und Galle spuckten, vor ihr Kotau machen.«
»Kein Zweifel, sie hat das gewisse Etwas«, sagte ich. »Und auch irgendwas Geheimnisvolles, das habe ich gleich bei der ersten Begegnung gespürt. Ich wette, sie ist zu ihrer Zeit sehr sexy gewesen.«
»Waren wir das nicht alle?« Harry brachte die Artischockenpyramide mit seiner Gabel zum Einsturz.
»Damals pfiffen es natürlich die Spatzen von den Dächern«, fuhr er fort, »daß Holt Griffin ein verkappter Schwuler sei – angeblich stand er haarscharf auf der Kippe, bis sie daherkam und ihn mit gewissen exotischen Sexpraktiken bekehrte. Sie allein, hieß es, habe ihn vor dem endgültigen Schritt bewahrt. In der Beziehung wurde sie ständig mit der Herzogin von Windsor verglichen. Du weißt schon – Kokain auf die Genitalien, Kleopatras Griff, lauter solcher Hokuspokus.«
»Kleopatras Griff?« wiederholte ich arglos, während ich einen Bissen Fleisch auf die Gabel spießte.
»Kontraktion der Vaginamuskeln, wirkt auf den Penis wie eine Art Massage«, erklärte er ohne sonderliches Interesse. »Ein recht wirkungsvolles Mittel, beliebt in Kurtisanenkreisen und vermutlich auch anderweitig von rührigen Damen erprobt. Aber ehrlich gesagt, glaube ich kein Wort von diesem Klatsch. Wenn du mich fragst, hat Griffin sich einfach in sie verliebt, weil sie amüsant war und ihn faszinierte. Im Vergleich zu all diesen gräßlichen höheren Töchtern, unter denen er aufgewachsen war, muß sie auf ihn gewirkt haben wie eine frische Brise. Und sie umgarnte ihn mit der Fürsorge eines mittelalterlichen Burgfräuleins. Einem Ondit zufolge bereitete sie sich direkt generalstabsmäßig auf die erste Begegnung mit ihm vor – erkundete seine Gewohnheiten, seine Lieblingsweine und – spirituosen ebenso wie Leibspeisen, Hobbys, Interessen, Bücher, sexuelle Neigungen et cetera. Als sie sich dann tatsächlich kennenlernten, konnte sie ihm auf diese Weise eine Art Rückkehr in den Mutterschoß suggerieren, bildlich gesprochen, versteht sich.«
»Woher weißt du das bloß alles?« fragte ich staunend.
»Ach, die Romanze war doch damals in aller Munde. Keiner wollte glauben, daß sie ihn wirklich rumgekriegt hatte, also zerbrach man sich den Kopf darüber, wie sie's wohl angestellt haben könnte. Du weißt ja, wie die Leute sind – müssen immer alles in Grund und Boden sezieren. Dabei ist die Wahrheit so einfach! Männer wie Holt Griffin wollen etwas geboten bekommen, Mittelpunkt sein. Sie haben kein Interesse an neurotischen höheren Töchtern, die sich dauernd über irgendwas beklagen, vom Leben enttäuscht sind, im Bett Migräne vorschützen und sich zu guter Letzt vor lauter Selbstmitleid dem Suff ergeben. Nein, Männer wie Holt Griffin wollen eine Frau, die weiß, wie man den Mann bei Laune hält, so eine Art Geisha – und genau das ist, oder war Frances Griffin.«
»Also, so hätte ich sie mir weiß Gott nicht vorgestellt. Ich dachte, sie sei eine ganz große Dame.«
»Ist sie auch, meine Liebe«, rief Harry. »Sie ist die vornehmste von allen. Du darfst nicht glauben, Vornehmheit und zwielichtige Abstammung gingen partout nicht zusammen. Im Gegenteil, Menschen wie sie wachsen an ihrer Vergangenheit. Denk nur, wie sie sich haben durchboxen müssen. Dagegen diese albernen Dummköpfe, die sich vornehm dünken, bloß weil sie aus einer dieser verrotteten Elitefamilien stammen – daß ich nicht lache. Frances Griffin ist vornehm im traditionellen Sinne – zäh, unabhängig, aus eigener Kraft nach oben gekommen. Sie hat die Vornehmheit einer Amazone.«
»Sag, Harry, hast du sie eigentlich persönlich gekannt?«
»Ach, weißt du, eine Frau wie sie kennt unsereins nicht persönlich«, sagte er gedankenvoll. »Aber eine flüchtige Bekanntschaft bestand tatsächlich mal. Das liegt inzwischen Jahre zurück. Eines Tages kam sie in meinen Laden und kaufte vom Fleck weg eine ausgefallene Riesener-Kommode. Allerdings haben wir um den Preis tüchtig gefeilscht. Sie war sehr gewieft, aber dabei nicht – wie soll ich sagen? – schikanös. Diese Kommode war eins der besten Stücke, die ich je in Kommission hatte. Gar keine Frage. Vermutlich sogar eins der besten, die überhaupt je auf den Markt kamen. Ich wußte gleich, daß sie daran nicht vorbeigehen konnte. Sie lobte meinen Geschmack und bat mich, bei Auktionen nach der einen oder anderen Rarität für sie Ausschau zu halten. Das tat ich, und wir fanden ein oder zwei Stücke, alles erstklassige Qualität.
Das ist der Vorteil derer, die aus dem Nichts kommen und sich gewissermaßen selbst erfinden müssen«, bemerkte Harry. »Sie kennen den Unterschied zwischen Original und Fälschung, schon weil sie bei sich selbst so hart daran arbeiten mußten, das eine vom anderen zu trennen. Nun ja, einigen gelingt es. Andere lernen's nie. Sie jedenfalls kannte den Unterschied. Ach, ich hätte meinen rechten Arm dafür gegeben, einmal eins ihrer Häuser von innen zu sehen, aber das Glück war mir nicht vergönnt. Als die Kommode abgeliefert wurde, wollte ich mich tatsächlich fast schon mit den Möbelpackern einschmuggeln. Aber das schien mir denn doch zu geschmacklos.«
»Morgen nehme ich meine Polaroidkamera mit und fotografiere für dich«, neckte ich ihn.
»Gott bewahre!« rief Harry entsetzt. »Außerdem würde ich auf Fotos sowieso nichts erkennen. Ich werde langsam blind, ehrlich.«
Ich tätschelte ihm begütigend die Wange. Plötzlich erinnerte er mich an einen abgeschlafften Jagdhund.
»Ich wünschte, ich würde statt dessen taub«, sagte er. »Gehört hab ich in meinem Leben wahrhaftig mehr als genug. Aber die Rolle des Betrachters macht mir immer noch Spaß. Gott, wie ich mich an schönen Dingen freue! Und wie gern gehe ich noch immer in Museen und Galerien. Verdammt!« Er nahm die Brille ab und wischte sich mit Daumen und Zeigefinger über den Nasenrücken. Er wirkte erschöpft und aufgewühlt zugleich.
Ich stand auf und räumte den Tisch ab. Dann holte ich die Tarte Tatin herein und schnitt Harry ein großes Stück ab, über das er sich sofort genüßlich hermachte.
»Mein Lieblingsgebäck! Bist ein braves Mädchen!«
Ich zündete mir eine Zigarette an und lehnte mich zurück.
»Sie hat also gekriegt, was sie wollte«, sagte ich. »Schön, wenn einem das gelingt.«
»Ach, eigentlich hatte sie doch ein tragisches Schicksal.«
»Wie bitte? Also für mich klingt das nach einem ganz tollen Leben!«
»Aber diese schreckliche Geschichte mit ihrer Tochter.«
»Was ist mit ihrer Tochter?«
»Heißt das, du weißt auch davon nichts? Also ich dachte, davon hätte nun wirklich jeder gehört. Die Tochter hieß übrigens Cassandra – was sagst du dazu? Nur die Reichen bilden sich ein, sie könnten ihren Kindern Namen geben wie Cordelia, Elektra und Cassandra, ohne daß das Folgen hätte. Sie halten sich eben rundum für Ausnahmemenschen.«
»Aber was ist denn nun mit dieser Tochter?« drängte ich.
»Erstens einmal ist sie tot.«
»Wirklich? Mein Gott, wie ist denn das passiert?«
»Ich begreife nicht, daß du nie davon gehört hast«, sagte Harry. Es klang hoch erfreut, und er sah auch gleich wieder munterer aus. Klatsch hatte anscheinend eine unfehlbar belebende Wirkung auf ihn.
»Cassandra Griffin wurde vor über fünfzehn Jahren von einem unbekannten Eindringling in ihrem Zimmer erstochen.«
»Nein!« Fast hätte es mir den Atem verschlagen.
»Man weiß bis heute nicht, wer es getan hat«, fuhr Harry fort. »Der Fall ist nie aufgeklärt worden.«
»Mein Gott, wie schrecklich!«
»Schrecklich ist gar kein Ausdruck. Der Mord geschah in The Haven. Ein Wunder, daß Frances Griffin weiter dort leben kann. Ich glaube nicht, daß ich in einem Haus wohnen bleiben könnte, in dem mein Kind erstochen wurde. Wie steht's mit dir?« fragte Harry. Es sollte scherzhaft klingen, was aber nicht ganz gelang.
»Gott, jeder lebt sein Leben ...«
»Eine Zeitlang war es ein Riesenskandal, aber dann geriet der Fall aus irgendeinem Grund ziemlich rasch in Vergessenheit, und man hörte nie wieder davon. Ich nehme an, aus Rücksicht auf die Familie hat man ihn niedergeschlagen.«
»Und wie lange, sagst du, ist das her?«
»Fünfzehn, sechzehn Jahre. Holt Griffin war damals noch bei den Vereinten Nationen. UN-Botschafter oder irgend so was. Ich wundere mich wirklich, daß du nie davon gehört hast. Der Fall hat ganz schön Staub aufgewirbelt. Wahrscheinlich warst du einfach noch zu jung, damals.«
»Ich lief zu der Zeit mit ziemlichen Scheuklappen durch die Welt«, sagte ich, in Gedanken die Vergangenheit Revue passieren lassend. »Wie alt war sie – die Tochter, meine ich?«
»So Mitte Zwanzig«, antwortete Harry.
»Demnach wäre sie jetzt in meinem Alter. Etwas älter vielleicht.«
»Hmmm.«
»Mein Gott, was für ein Alptraum! Und du sagst, der Fall wurde nie aufgeklärt? Das kommt mir aber sonderbar vor.«
»Ja, nicht wahr? Bestimmt gab's haufenweise Indizien, die nie an die Öffentlichkeit gelangt sind.«
Ich sah, wie Harry nach der Tarte Tatin schielte.
»Noch ein Stück für dich?«
»Aber nur ein hauchdünnes, danke.«
Ich schnitt ihm ein zweites großes Stück ab. Diesmal ging er langsam und bedächtig zu Werk, trug erst die Apfeldecke ab und sparte sich die Karamelschicht auf, um sie zum Schluß – mit den Fingern – zu essen.
»Köstlich! Schon dieser Teig: schmeckt wie Plätzchen«, schwärmte er. »Ich komme immer erst bei der zweiten Probe richtig auf den Geschmack.«
»Wie kann man so was je verwinden? Es ist schon furchtbar, ein Kind durch Krankheit zu verlieren oder durch einen Unfall, aber Mord ... Sie war die einzige Tochter?«
»Das einzige Kind.«
»Mrs. Griffin möchte, daß ich den Saal ausmale, den sie für den ersten Ball ihrer Tochter bauen ließ. Ach, und stell dir vor, sie hat gesagt, ich würde sie an ihre Tochter erinnern.«
»Wirklich, ja?« Das schien Harry zu interessieren. »Ich glaube, die Tochter war ein ziemlicher Wildfang. So jedenfalls hieß es damals. Nach einer recht turbulenten Teenagerzeit heiratete sie schließlich irgend so einen Gigolo.«
»Trotzdem hat sie gesagt, daß ich sie an ihre Tochter erinnere.«
»Vielleicht siehst du ihr ja ähnlich.«
»Armes Ding.« Ich zuckte mit den Schultern.
»Nun krieg mir heute abend bitte keinen Moralischen, Faith.« Harry tätschelte mir die Hand. »Tja, Geld macht wohl doch nicht immer glücklich, wie?«
Ich stellte mir die Frances Griffin vor, die heute nachmittag in meinem Atelier gesessen hatte.
»Weißt du, es ist wirklich komisch«, sagte ich, »aber nicht in einer Million Jahren hätte ich die Frau, die heute bei mir war, mit der in Einklang gebracht, die du beschreibst. Deine Geschichte wirft ein ganz neues Licht auf die Sache. Du hast mich richtig neugierig gemacht. Was, glaubst du, will sie wirklich von mir?«
»Um das herauszufinden, brauchst du bloß nach The Haven zu fahren.«
Harry sah mich durchdringend an.
»Sei nicht töricht, Faith. Wenn sie dich haben will, dann mußt du einfach für sie arbeiten. Das ist geradeso wie der Auftrag von einem Königshaus. Nein, noch besser, weil sie mehr von der Materie versteht. Das ist die ganz große Chance, kapierst du das denn nicht? Ihr Name zählt! Wenn du erst einmal für sie gearbeitet hast, kannst du deine Honorare selbst bestimmen.«
»Das tue ich jetzt schon«, entgegnete ich stolz.
»Ja, aber in Zukunft wirst du von der Touristenklasse auf die Concorde umsteigen können!«
Brush sprang auf den Eßtisch und schlug die Krallen in Harrys Ärmel. Harry streichelte seinen Katzenbuckel. Ich versuchte, den Kater wegzuscheuchen.
»Laß ihn ruhig«, sagte Harry. »Er ist ja bloß ein bißchen liebebedürftig, nicht wahr, Brushie?«
»Wie alt ist eigentlich dein Mr. Spencer inzwischen?«
»So ungefähr hundertzwölf. Er ist zahnlos, herzlos und nutzlos, aber ich liebe den kleinen Racker über alles. Nächstes Mal mußt du zu uns zum Essen kommen. Er würde sich schrecklich freuen.«
Ein Essen in Harrys Wohnung war immer unvorstellbar chaotisch. Zu jedem Gang gab es mindestens drei verschiedene Soßen, die Harry vor lauter Begeisterung oft durcheinanderbrachte. So erinnere ich mich, daß wir einmal eine ansonsten köstliche Lammkeule mit Sauce caramel aßen, die er mit der Bratensoße verwechselt hatte.
»Über deine anderen Arbeiten würde ich mir an deiner Stelle keine Sorgen machen«, sagte Harry. »Du wirst haufenweise Aufträge kriegen, wenn du erst mal für die Griffin gearbeitet hast.«
»Aber will ich mich wirklich monatelang in ein und demselben Haus einsperren lassen?«
»Es dreht sich ja nicht gerade um eine Bruchbude, Liebes. The Haven gehört zu den schönsten Landsitzen der Welt. Und du wirst es noch glanzvoller machen. Im übrigen glaube ich, ehrlich gesagt, daß du einen Tapetenwechsel vertragen könntest, Faith. Du hast dich viel zu sehr abgekapselt. Als ob du's aufgesteckt hättest. Ich hab's erst aufgesteckt, als ich schon viel, viel älter war als du.«
»Hast du's denn wirklich aufgesteckt, Harry?«
»Ach, du weißt ja ...«
Als er sich schwerfällig zurücklehnte und eine Zigarette in die schwarze Lackspitze schob, hatte ich fast Angst, daß der zierliche Regency-Stuhl unter seinem Gewicht zusammenbrechen würde. Er griff nach dem silbernen Feuerzeug in Gestalt eines Affen, das er mir vor ein paar Jahren zum Geburtstag geschenkt hatte. Harry schnippte am Schwanz. Eine züngelnde Flamme schoß heraus. Er zündete sich die Zigarette an.
»Darf ein asthmatischer alter Herr dir seinen weisen Rat antragen?« Er legte den Kopf zurück und blies ein zartes Rauchwölkchen in die Luft. Ich nickte.
»Mir hat es im Leben nur leid getan um die Bilder, die ich nicht gekauft, die Reisen, die ich nicht gemacht, und die Menschen, die ich nicht geliebt habe. Mit anderen Worten, ich habe stets nur dem nachgetrauert, was ich unterlassen – nie dem, was ich getan habe«, sagte er mit Nachdruck. »Das einzige, was man im Leben wirklich bereut, sind die eigenen Versäumnisse.«
Ich dachte ernsthaft über diese These nach. Ob sie auch auf mich zutraf? Je länger ich mein Leben betrachtete, desto grauer, ja farbloser wurde die Leinwand. Vor langer Zeit hatte es einmal einen plötzlichen Farbenrausch gegeben – dominiert von leuchtendem Rot, Symbol meiner einzigen großen Liebesaffäre – , aber selbst das war im Lauf der Zeit zu einem wäßrigen Rosa verblaßt. Hat es, so fragte ich mich jetzt, Augenblicke gegeben, da ich Dinge hätte tun sollen, die ungetan blieben, da ich Menschen hätte lieben sollen und es nicht getan hatte?
Ich hatte immer ganz genau gewußt, wo es langging. Die Frage, ob ich den falschen Weg gewählt hätte oder wenigstens noch einen anderen in Betracht ziehen solle, hatte sich nur sehr selten gestellt. Bis auf die Zeit meiner großen Liebe hatte ich immer mit beiden Beinen fest auf der Erde gestanden. Unbelastet von Zweifeln war ich stets geradeaus marschiert. Geradewegs auf mein Grab zu, dachte ich jetzt.
»Es ist alles so schnell vorbei, Faith«, sagte Harry. »Viel schneller, als man sich das in deinem Alter vorstellen kann. Plötzlich spürt man, wie die ganze Chose knirschend zum Stehen kommt; und dann schaut man zurück und denkt: War das nun mein Leben oder das eines anderen? Man kann es einfach nicht fassen. Es kommt einem alles vor wie ein Traum. Vermutlich reden alte Menschen deshalb soviel von früher, weil sie rauskriegen wollen, was eigentlich an ihnen vorbeigegangen ist. Und was war es? Das LEBEN.«
Harrys hämische Lache mündete unversehens in einen trockenen, stoßweisen Husten. Ich überredete ihn, einen Schluck Wasser zu trinken, was auch half. Dann versanken wir beide in nachdenkliches Schweigen, wobei jeder blicklos vor sich hinstarrte. Harry räusperte sich ein-, zweimal.
»Faith, Liebes, ich muß jetzt gehen«, sagte er endlich müde, während er sich aus dem Stuhl hochwuchtete. »Danke fürs Essen. War köstlich.«
»Nimm den Rest von der Tarte Tatin mit heim. Ich krieg sie ja doch nicht auf.«
»Nein, Liebes, ich bin auf Diät.« Er sah nach der Uhr. »Ach, du meine Güte, so spät ist es schon! Mr. Spencer wird höchst ungehalten sein über mich. Und bestimmt hat er inzwischen die ganze Wohnung vollgepinkelt.«
Ich brachte Harry zur Tür. Bei der geringsten körperlichen Bewegung geriet er in letzter Zeit außer Puste.
»Es wird dir doch gleich wieder bessergehen, Harry, oder?«
»Will's nicht hoffen. Ich werde zu alt. Zeit fürs letzte Gebot.«
Ich küßte ihn auf die Wange.
»Du weißt doch, Faith, Liebes, seit wir uns kennen, habe ich dir immer wieder versichert, daß du zu Großem berufen bist. Das ist jetzt der Anfang.«
»Gute Nacht, lieber Freund.«
»Nimm den Auftrag an!« Harry ergriff meine beiden Hände. »Versprichst du's mir?«
»Also gut. Ich versprech's.«
Kapitel 2
Am nächsten Tag fuhr ich hinaus nach The Haven. Es lag an der Nordküste von Long Island, dort wo von der Jahrhundertwende bis zum Zweiten Weltkrieg die großen Villen entstanden waren. Die meisten dieser imposanten, weitläufigen Anwesen waren inzwischen längst aufgeteilt oder von Highways zerschnitten, waren den Zeitläufen, Unterhaltsschwierigkeiten oder dem Fortschritt zum Opfer gefallen. Doch einige wenige hatten standgehalten und überblickten nun mißbilligend wie strenge Matronen die trostlose Szenerie des ausgehenden zwanzigsten Jahrhunderts mit ihren Tankstellen, Imbißketten und Ladenstraßen.
Das Haus selbst konnte man von der Straße nicht sehen. Auf der Suche nach der Einfahrt kurvte ich um das ganze Anwesen herum. Den riesigen Besitz säumte eine halbzerfallene Steinmauer, an der Weinlaub rankte und die von stattlichen alten Bäumen überschattet war. Es war ein schönes, europäisch anmutendes Gemäuer, wie man es beispielsweise in Frankreich, in der Gegend der Loire-Schlösser, findet. Unkraut schlängelte sich über den Sockel, und aus den Ritzen quoll das Moos. Allein, diese verwitterte Mauer wirkte seltsam künstlich, so als habe nicht der Zahn der Zeit, sondern planmäßiger Vorsatz den Verfall herbeigeführt; zumal Schäden und Mängel in ästhetisch gefälligen Abständen auftraten. Ich kam zu dem Schluß, daß dies keine gewöhnliche Mauer sei, sondern ein Stück Ruinenarchitektur, deren romantischem Touch man durch absichtliche Schlamperei gekonnt nachgeholfen hatte.
Endlich hatte ich den Zugang gefunden. Er war bescheiden, lediglich eine Öffnung in der Mauer, flankiert von zwei steinernen Säulen, in deren eine mit dezenten Blockbuchstaben THE HAVEN eingemeißelt stand. Ich bog in die weißbekieste Auffahrt ein, die sich erst durch dichtbewaldetes Gelände schlängelte und endlich auf eine riesige Lichtung mündete. Als unvermittelt die Sonne durch die Wolken brach, blitzten die Rasenflächen, die sich zu beiden Seiten der Auffahrt erstreckten, smaragdgrün. Bald ging die englische Rasenlandschaft in architektonische Gartenkultur über, geprägt von leuchtend bunten Blumenrabatten und phantasievoll gestutztem Baumwerk.
Eine letzte Biegung, und vor mir, im Widerschein der Nachmittagssonne, erhob sich das Haupthaus. Ich parkte auf einem kleinen kopfsteingepflasterten Hof und stieg aus. Es war merklich kühler geworden, einer dieser frischen, windigen Frühlingstage, bei denen ich immer an den Herbst denken muß. Die Baumkronen duckten sich unter kurzen, heftigen Böen. Es duftete schwach nach Flieder.
Im Näherkommen enthüllte sich mir die architektonische Schönheit des Hauses. Im Stil eines südfranzösischen Schlosses aus hellen Tuffsteinquadern errichtet, gehörte The Haven zu den wohlproportioniertesten Bauten, die ich je gesehen hatte. Bei aller Weitläufigkeit bestach es eher durch Details als durch seine Größe. Kurz, es war ein Juwel von einem Haus, der würdige Rahmen für die berühmte alte Dame, die sich hierher zurückgezogen hatte.
Eben wollte ich den Türklopfer in Gestalt eines bronzenen Löwenkopfes betätigen, da wurde die Tür schon von innen geöffnet und ein weißhaariger Mann im schwarzen Butlerfrack trat aus dem Halbdunkel.
»Miss Crowell?« fragte er.
»Ja.«
»Mrs. Griffin erwartet Sie. Wenn Sie mir bitte folgen wollen?«
Als ich aus dem hellen Sonnenlicht in die kühle, dunkle Halle trat, mußte ich erst ein paarmal blinzeln, um meine Augen an den plötzlichen Lichtwechsel zu gewöhnen.
Von der Decke funkelte ein ganzer Kranz von Lichtern an einem emaillierten Kronleuchter in Form einer Montgolfiere. Zu meinen Füßen erblickte ich ein Schachbrett aus schwarzweißem Marmor. Da der Marmor alt und glatt, die Fliesen klein und ungleichmäßig waren, nahm ich an, der Estrich sei aus einem alten französischen Schloß importiert worden. Die Wände waren in sanftem Taubenblau lasiert. Ein Canaletto, eine seiner entzückenden Venedig-Impressionen, hing über einer kostbaren Rokokokommode. Ob das die Riesener-Kommode war, die Harry Mrs. Griffin verkauft hatte?
Der Butler führte mich an einer kleinen, erlesenen Galerie heiterer ländlicher Genreszenen entlang, die dezent angestrahlt waren. Unsere Schritte hallten in dem hohen Raum wider. Er brachte mich in eine von Rottönen dominierte Bibliothek, die nach dem Park zu lag, und erkundigte sich, ob ich eine Erfrischung wünschte. Ich lehnte dankend ab. Er sagte noch, Mrs. Griffin würde gleich herunterkommen, und zog sich dann zurück.
Ich setzte mich auf ein Sofa und blickte mich um. Über dem Kamin hing ein Delacroix; ein Maurenjüngling, der einen schwarzen Hengst am Zügel führte. Auf einem Beistelltisch aus Mahagoni war eine herrliche Sammlung von Bronzepferden aufgebaut. An der einzigen nicht von Bücherschränken gesäumten Wand stand ein Glasschaukasten mit ausgebleichten Siegesschleifen; rings um die Vitrine hing eine kunstvoll drapierte Kollektion von Reitgerten und Jagdpeitschen. Im Kamin waren Scheite und Papier zum Anzünden hergerichtet. Es roch schwach nach Holzfeuer. Bunte Gartenblumensträuße waren zwanglos in silbernen Siegespokalen arrangiert. Auf einem Butlertisch in einer Ecke war eine kleine, aber gut bestückte Bar aufgebaut. Reit- und andere Sportzeitschriften waren übersichtlich auf einem Couchtisch ausgelegt. Es war ein Raum, in dem die Zwillingsthemen Geld und Luxus eine unaufdringlich leise Hintergrundmusik anstimmten, ein Raum, in dem man verweilen mußte, um seine Annehmlichkeiten gebührend würdigen zu können.
Voll Bewunderung für das Understatement, mit dem wirklich großer Reichtum einhergeht, wollte ich mich eben der friedlichen Stille hingeben, als mein Blick auf das einzige Foto im Zimmer fiel, das Schwarzweißporträt einer jungen Frau in weißem Satinkleid. Sie war weder schön noch häßlich, schwankte vielmehr auf Messers Schneide dazwischen. Ihre Züge hatten etwas Verkrampftes, als ob der Fotograf sie mehr als einmal aufgefordert hätte zu lächeln. Einiges an ihr erinnerte mich an mich selbst: das auffallend schmale Gesicht, die mandelförmigen Augen, die Unbeholfenheit – oder vielleicht war es auch Scheu – , die sich in ihrer Haltung widerspiegelte. Manches an ihr war überaus anziehend, besonders der anmutige Schwanenhals und die Schulterpartie, die das tiefe, runde Dekolleté, wunderschön zur Geltung brachte. Ihr Haar war im Nacken zu einem eleganten Knoten geschlungen, und sie trug ein Halsband aus Perlen und Brillanten. Ich hatte das Gefühl, ihr Gesicht würde, genau wie meins, in der Bewegung, wenn Charakter und Intelligenz ins Spiel kamen, hübscher sein. Aber auch so war das Foto, alles in allem, ganz reizend, schon wegen der sanft-romantischen Aura vergangener Tage.
Es war ein beklemmender Gedanke, daß diese junge Frau, so naiv und unverdorben in ihrem weißen Kleid, so privilegiert und scheinbar immun gegen die Brutalität der Welt, längst tot und begraben war, Opfer eines grauenhaften Mordes. Plötzlich hatte ich eine Vision, als ob Blut über das Bild spritzte. Rasch wandte ich mich ab.
Ich stand auf, um mir die sorgfältig in messingbeschlagenen Bücherschränken verwahrte Bibliothek anzusehen. Bei näherer Betrachtung erinnerten die alten, ledergebundenen Werke, meist mehrbändige Ausgaben, die aber jeden thematischen Zusammenhang vermissen ließen, allerdings arg an die Art Bücher, die man meterweise und mehr des Einbands als des Inhalts wegen kauft. Ich wollte eben eins aus dem Regal nehmen, als ein kleiner Hund mit hervorquellenden Augen und zottigem weißen Fell hereingesaust kam, mir um die Beine tanzte und mit seinen winzigen Pfoten an den Knöcheln kratzte.
»Platz, Pom-Pom! Platz, sag ich!« befahl eine Stimme von der Tür her.
Ich blickte auf. Mrs. Griffin stand in der Tür; sie trug ein schlichtes, cremefarbenes Seidenkleid. Das Hündchen sprang weiter um mich herum, ohne sich von ihrem Kommandoton auch nur im geringsten beeindrucken zu lassen.
»Pom-Pom! Platz, aber augenblicklich!«
»Schon gut. Ich mag Tiere«, sagte ich und bückte mich, um dem kleinen Kerl den Kopf zu kraulen, der freilich unter dem langhaarigen weißen Fell kaum zu erkennen war.
»Ich entschuldige mich für Pom-Pom«, sagte Mrs. Griffin. »Er ist noch ganz jung und einfach unbelehrbar – vermutlich meine Schuld. Ich hab nun mal keine Hand dafür, Viecher abzurichten.«
»Wahrscheinlich riecht er meine Katze«, erwiderte ich. »Na, riechst du meine Katze, du kleiner Bursche, hm?«
Als Mrs. Griffin näher kam, richtete ich mich auf. Wir gaben uns die Hand.
»Aber meine Liebe, Ihre Hände sind ja ganz kalt!« rief sie aus.
»Kalte Hände, warmes Herz, wie das Sprichwort sagt«, versetzte ich leichthin.
»Manchmal ist man andersherum besser dran«, antwortete sie mit einem leisen Lächeln.
Wenigstens hat sie Humor, dachte ich.
»Sie haben also eine Katze«, fuhr sie fort. »Eigentlich sind mir Katzen auch lieber. Sind entschieden ruhiger als Hunde. Und viel schöner anzusehen, finden Sie nicht auch? Schon wie sie sich bewegen! So geschmeidig und dabei so unnahbar. Aber dummerweise bin ich allergisch gegen Katzen.«
Mrs. Griffin setzte sich und forderte auch mich mit einer Handbewegung dazu auf.
»Komm her, du Plagegeist.« Damit hob sie das weiche weiße Knäuel vom Boden auf und plazierte es neben sich auf dem Sofa.
»Was ist er denn für eine Rasse?«
»Pom-Pom ist ein Pommerscher Spitz. Das hat mich auf den Namen gebracht. Nicht gerade originell, ich weiß. Na ja, es heißt, Hunde seien gute Gesellschafter, und so probiere ich's ebenmal aus. Und Ihre Katze heißt wie?«
»Brush.«
»Brush«, wiederholte sie. »Was für ein hübscher, passender Name. Und hat sie auch einen richtig schön buschigen Schwanz?«
»Er, Brush ist ein Kater, und mit nomen est omen ist es leider nicht weit her bei ihm. Er ist bloß ein alter Streuner. Ich fand ihn eines schönen Tages draußen auf der Straße vor meinem Atelier, und da habe ich ihn mit heim genommen.«
»Ist es nicht schrecklich, so ein streunendes Tier durch die Straßen irren zu sehen? Ich finde das noch trauriger als den Anblick von Obdachlosen.« Sie seufzte.
»Also da bin ich mir nicht so sicher, aber Tiere wirken eben so klein und hilflos. Brush war noch ein ganz junges Kätzchen, als ich ihn damals fand. Vor lauter Hunger hat er geschrien wie ein Baby.«
»Oh, bitte!« Sie hob abwehrend die Hände. »Ich kann's gar nicht ertragen, Ihnen zuzuhören. Je älter ich werde, desto weniger ertrage ich traurige Geschichten. Die Ironie dabei ist natürlich, daß man mit zunehmendem Alter immer mehr traurige Geschichten zu hören bekommt.«
Sie blickte verstohlen nach der Fotografie auf dem Tisch.
»Meine Tochter war ganz vernarrt in Katzen.«
»Ist das Ihre Tochter?« fragte ich, obwohl ich die Antwort bereits kannte.
»Ja. Cassandra. Cassa, wie wir sie nannten. Ich sagte Ihnen ja schon, daß Sie mich an sie erinnern. Jetzt sehen Sie selbst, daß eine ziemliche Ähnlichkeit besteht.«
Sie nahm das Foto in die Hand und sah es, während sie weitersprach, unverwandt an.
»Die Aufnahme wurde extra für ihren ersten Ball gemacht. In Wirklichkeit war sie viel hübscher, auch wenn sie sich nicht die geringste Mühe mit ihrem Aussehen gab. Und sie haßte es, fotografiert zu werden. Das sieht man dem Bild an, nicht wahr? Sie wurde nicht müde, mir zu erzählen, daß die Aborigines glauben, man beraube sie ihrer Seele, wenn man sie fotografiert. Wenn man bedenkt, wo die moderne Welt hingeraten ist, haben sie vielleicht gar nicht mal so unrecht.«
Sie stellte die Fotografie auf den Tisch zurück.
Ich wußte nicht, ob ich ihr verraten sollte, daß Cassandras tragisches Schicksal mir inzwischen bekannt war. Ob Mrs. Griffin womöglich davon ausging, daß ich, wie jeder andere, über den furchtbaren Tod ihrer Tochter Bescheid wußte? Da ich aber erst gestern durch Harry davon erfahren hatte, war es mir irgendwie peinlich, darüber zu sprechen. Es brauchte sehr viel Fingerspitzengefühl, um mit Menschen wie Mrs. Griffin, die einerseits im Rampenlicht standen, andererseits aber sehr zurückgezogen lebten, richtig umzugehen. Ich wollte nicht, daß sie mich für eine Schnüfflerin hielt, und ich hatte Angst, alte Wunden aufzureißen oder sie womöglich zu kränken. Schließlich hielt ich es für das beste, das Thema zu wechseln.
»Das ist ein wunderschöner Raum«, sagte ich.
Das Ambiente war in der Regel ein dankbarer Gesprächsstoff bei reichen Leuten, aber sie schien von meiner Bemerkung überrascht.
»Ach ja?« fragte sie mit leicht verstörter Miene. »Ich bin schon eine Ewigkeit nicht mehr hier drin gewesen, und wenn Sie mich fragen, wirkt alles ein bißchen vernachlässigt. Ich sollt's renovieren lassen.«
»Wer hat denn all die Siegesschleifen gewonnen?«
»Oh, Cassa. Sie war eine passionierte Reiterin. Aber dann hat sie's plötzlich aufgegeben. Gott, riecht das hier moderig. Was haben wir denn für Wetter heute? Ich bin noch gar nicht draußen gewesen.«
»Es ist ein schöner Tag. Nur ein bißchen kühl. Man könnte meinen, es wäre Herbst.«
»Ich sollte mehr an die Luft.« Sie sagte das, als ob der Gedanke sie bedrücken würde. »Aber ich gehe nun mal nicht mehr gern ins Freie. Ich muß mich regelrecht dazu zwingen. Das ist so, wenn man älter wird: Bestimmte Dinge tut man nur noch gezwungenermaßen. Wollen wir einen kleinen Rundgang machen?«
Sie erhob sich, und Pom-Pom sprang vom Sofa herunter.
»Ich denke jedesmal, er bricht sich den Hals, wenn er das tut. Wenn du hier drinnen irgendwo Pipi machst, geb ich dich weg«, sagte Mrs. Griffin und drohte dem Hündchen mit dem Finger.
Ich folgte ihr aus der Bibliothek. Pom-Pom, der hinter uns drein tollte, rutschte wie ein Schlittschuh über die Marmorfliesen. Wir gingen durch die Halle auf eine hohe, gläserne Flügeltür zu. Mrs. Griffin drückte die längliche Bronzeklinke nieder, die Flügel öffneten sich majestätisch, und sie trat ein. Ich folgte ihr.
»Der Salon«, erklärte sie und knipste mehrere Schalter an, die sich hinter einer Wandtäfelung gleich neben dem Eingang verbargen.
Es war, als ob plötzlich die Scheinwerfer auf einer Bühne aufgeflammt wären. Ich stand in einem lichtdurchfluteten, farbenprächtigen Raum, der, trotz einer Fülle von Kostbarkeiten und Antiquitäten, intim und anheimelnd wirkte. Drei Paar Glastüren führten hinaus auf ein von einer Glyzinienhecke geschütztes Gärtchen. Zartgelbe Seidenvorhänge bauschten sich in der leichten Brise. Und wieder der Fliederduft, diesmal stärker als vorhin. Ein hinreißendes Ambiente.
Angesichts so vieler herrlicher Kunstgegenstände, Gemälde und Möbelstücke wußte ich kaum, was ich mir zuerst anschauen sollte. Mrs. Griffin ließ mich ein Weilchen herumstöbern, bis ich mich in ein kleines Schreibpult vergaffte, verziert mit Einlegearbeiten aus geblümtem Porzellan, das ganz versteckt in einer Ecke stand.
»Gefällt es Ihnen?« fragte sie. »Das hat einmal Marie Antoinette gehört.«





























