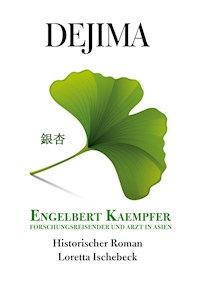
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wir schreiben das Jahr 1690. In Japan sind Fremde unerwünscht. Kontakt mit der westlichen Welt existiert nahezu nicht. Das Land ist für Ausländer abgeriegelt. Die einzige Ausnahme ist die niederländische Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), die erste Aktiengesellschaft der Welt. Obwohl kein großer Freund seines Arbeitgebers, wird der erfahrene und sprachbegabte Arzt Engelbert Kaempfer von der VOC beauftragt, nach Japan zu reisen. Anstatt nur wirtschaftlichen Interessen seines Arbeitgebers nachzugehen, beweist sich Kaempfer als kulturell und wissenschaftlich umsichtiger Pionier. Seine sensible, einfühlsame Diplomatie wird in Japan bis heute geschätzt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 407
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Wir schreiben das Jahr 1690. In Japan sind Fremde unerwünscht. Kontakt mit der westlichen Welt existiert nahezu nicht. Das Land ist für Ausländer abgeriegelt. Die einzige Ausnahme ist die niederländische Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), die erste Aktiengesellschaft der Welt. Obwohl kein großer Freund seines Arbeitgebers, wird der erfahrene und sprachbegabte Arzt Engelbert Kaempfer von der VOC beauftragt, nach Japan zu reisen. Anstatt nur wirtschaftlichen Interessen seines Arbeitgebers nachzugehen, beweist sich Kaempfer als kulturell und wissenschaftlich umsichtiger Pionier. Seine sensible, einfühlsame Diplomatie wird in Japan bis heute geschätzt.
Loretta Ischebeck
Langjährige Tätigkeit im Kunstbereich der klassischen Moderne in London und New York. Zurück in Deutschland Beschäftigung mit ostasiatischer Kunst und Botanik. Es folgte die Begegnung mit den Werken Engelbert Kaempfers.
PROLOG
Batavia – Sonntag 7. Mai 1690.
Letzte Matrosen klettern an Bord der Waelstrohm, einem Segelschoner der Niederländischen Ostindien Kompanie.
Anker gelichtet, Segel gehisst, treibt die frische Morgenbrise das Schiff in zügiger Fahrt aus dem Hafen hinaus Richtung Nagasaki. Wenige Stunden später entschwindet die Waelstrohm im Horizont. Mit diesem Tag beginnt für Engelbert Kaempfer ein neues Kapitel seines Lebens. Ganz seiner Art entsprechend, hält er sein Notizbuch in Händen lange bevor sich die Blicke der Mannschaft von dem Festland gelöst haben, um ihre ungeteilte Aufmerksamkeit der diesjährigen Reise zuzuwenden. Japan liegt in weiter Ferne. »Ich werde versuchen, nichts was nach Schreibstube schmeckt oder nach Studierlampe riecht, nichts aus meiner Phantasie Geschöpftes hier hineinzubringen,« notiert er. Diesem Versprechen bleibt Engelbert Kaempfer treu, solange er lebt.
10. Mai 1690: Himmel verdunkelt unter ost-südöstlichen Winden.
11. Mai 1690: Stille See, wenig Fortkommen.
12. Mai 1690: Erste Hügelausläufer von Sumatra in weiter Ferne zu erahnen.
25. Mai 1690: Kaum sechs Meilen am Tag, mühsames Segeln entlang der Küste von Malacca.
31. Mai 1690: Heiße Trockenstürme. Mast über Bord, ein Mann mit ihm. Leicht verletzt geborgen. Schweres Fortkommen.
6. Juni 1690: Ankunft in Siam in der Mündung des Mae Nam. Warten auf Geleit. Einheimische Barken sollen die Waelstrohm zwei Meilen flussaufwärts ziehen, da zu beiden Ufern hin tiefe Sümpfe.
Undurchdringliche Wälder, bedrohliche Tierwelt, Erforschung nicht möglich, bittere Enttäuschung.
11. Juni 1690: Nach zähen Verhandlungen für VOC und quälendem Zeitverlust geht es bei mildem Südwestwind zurück gen offene See.
25. August 1690: Das Meer steht. Lastende Stille über uns. Zermürbende Hitze. Gefährliche Boten. Kapitän ordnet alle verfügbaren Sicherheitsvorkehrungen an. Nervöse Verunsicherung an Bord.
26. August 1690: Tosende See. Waelstrohm schleudert krächzend durch die Wellen, Besatzung hilflos.
27. August 1690: Fortbewegung nur noch auf allen Vieren, Tiere in Lebensgefahr. Zerstörung und Wasser auf und unter Deck.
28. August 1690: Zustand der Mannschaft dramatisch.
29. August 1690: Waelstrohm treibt weiter hilflos herum.
30. August 1690: Beruhigte See. Morgenappell belegt: alle Männer an Bord. Reparaturen beginnen sofort – soweit möglich. Wasser schöpfen Tag wie Nacht.
31. August 1690: Günstiges Wetter. Der Zustand der Mannschaft dramatisch. Hunger und Durst tägliche Begleiter. Baldige Ankunft dringend!
Dejima
Am 22. September des Jahres 1690 steht Engelbert Kaempfer in der frischen Morgenbrise an Deck der Waelstrohm und hält in seinem Notizbuch fest, was er während ihrer verzweifelten Suche nach der Einfahrt in die Nagasaki-Bucht sieht und hört. Wie jeden Tag sind Stift und Papier seine zuverlässigsten Begleiter.
An Bord herrscht derweil angespannte Konzentration. Die knappen Anweisungen des Kapitäns, die Kraftlosigkeit der Männer, die allgemeine Stille sind untrügliche Zeichen ihrer mal wieder flehenden Hoffnung darauf, dass ihr Martyrium ein Ende finden möge.
Die früh nachmittägliche Sonne glüht auch im September noch heiß vom Himmel und strapaziert die Geduld der Mannschaft zusätzlich. Immer wieder suchen ihre Augen Jong Pit hoch oben am Top Mast. Seit Tagen das gleiche, die Blicke wandern hinauf und phantasieren mit ihm: »Da … da … das muss es sein!«, brüllt der junge Matrose wild gestikulierend. Leider nicht zum ersten Mal. »Das,« schreit er wieder wild gestikulierend, »das muss es sein …!« Und ohne auf das Kommando ›abentern‹ zu warten, rutscht und klettert er johlend den Mast hinunter, an dessen Fuß ihn sofort kräftige Arme packen und mit ihm zum Kapitän hinüberlaufen. Schwungvoll stellen sie dort Jong Pit auf die eigenen Füße.
Hat er wieder geträumt? Oder ist es diesmal tatsächlich der Moment der Erlösung? Sollten sie wirklich angekommen sein? Rasend schnell verbreitet sich die Nachricht, ob richtig oder falsch, über das ganze Schiff und treibt die versammelte Mannschaft an Deck. Die einen brechen in Jubeltänze aus, bei anderen rollen Tränen der Schwäche und Erleichterung. Etliche fallen auf die Knie und danken dem Himmel für ihre Rettung. Sogar die an Skorbut Erkrankten schleppen die Männer hoch, an die frische Luft, um auch ihnen Hoffnung zu schenken.
Von einem strahlenden Jong Pit lässt sich der Kapitän wieder und wieder ausführlich berichten. Nach einer kurzen Pause gibt er sehr klare Anweisungen.
Zurück hoch oben im Korb versucht Jong Pit ab jetzt, seine Aufregung zugunsten der angemahnten Sachlichkeit in Schach zu halten, so wie es die gesamte Mannschaft nun tut, auch wenn es ihnen ausnahmslos schwer fällt.
Innerhalb der nächsten Stunde fühlt sich der Kapitän seiner Sache sicher genug, um die eben noch unwirklich klingende Nachricht in der gebotenen Form als glückliche Tatsache zu verkünden.
Obwohl die Dreimaster der VOC besonders wendig und schnell manövrieren können, da sie mit weniger Tiefgang ausgestattet sind als Frachtschiffe anderer Nationen, bleibt es trotz aller Freude und Zuversicht eine Herausforderung für die Mannschaft der Waelstrohm, ihr schwer beschädigtes Schiff durch die rechts und links von felsigen Hügelketten umsäumte Zufahrt Richtung Festland zu steuern. Erst in den frühen Abendstunden gelingt es ihnen, in die eigentliche Nagasaki-Bucht einzulaufen, wo sie in Sichtweite der Stadt für die Nacht zu ankern.
Fünf Böller in Richtung Festland verkünden die offizielle Ankunft der Waelstrohm.
Engelbert Kaempfer schließt sein Notizbuch. Seit den Nachmittagsstunden galt seine besondere Aufmerksamkeit unscheinbaren Wachttürmen auf den Hügelspitzen zu beiden Seiten. Dank der diskreten Signale war also jedermann in der Stadt schon längst über ihre bevorstehende Ankunft informiert.
So nah am Ziel wie die japanischen Behörden es der VOC gestatten, verzehren die unterernährten Männer ihre kärgliche Mahlzeit, wie sie es seit Ende August gewohnt sind. Ihre letzten Schlucke Wasser trinken sie auf die Segelmacher und Schiffszimmerleute, ohne deren einfallsreiches Geschick sie wohl nie hier angekommen wären. Heute klettern Mannschaft und Offiziere noch früher als gewöhnlich in ihre Hängematten und Kojen, einerseits vor Erleichterung und andererseits, wie so lange schon, um ihren quälenden Hunger und brennenden Durst mit Schlaf zu überlisten.
In Engelbert Kaempfers Quartier liegen unzählige Dokumente herum, auf seiner Koje, der schmalen Tischplatte und dem immer noch feuchten Boden. Der Schaden, den die vergangenen Wochen angerichtet haben, ist für ihn immens. Nie wird er die Spuren des salzigen Wassers gänzlich eliminieren können. Zeichnungen und Notizen liegen in Fetzen, sind verschmiert oder gar vollständig zerstört.
Diese Aufzeichnungen sind sein einziger Besitz von Wert, seine Zukunft. So wird ihm sein Gedächtnis in unverbrüchlicher Treue beistehen müssen, all das erneut zusammenzutragen, was hier verloren ging.
Wieder und wieder nimmt er das eine oder andere Blatt prüfend zur Hand. Die verbleibenden Stunden der Nacht wird er gut nutzen müssen, denn es dauert bis all das, was hier vor ihm liegt, sortiert und in erkennbar gekennzeichnete Stapel verpackt ist. Nichts davon wird er fortwerfen in Erwartung ruhiger Zeiten, wenn er seine Erfahrungen und Erkenntnisse endlich mit der Gelehrtenwelt teilen wird. Getragen von diesem Gedanken macht er sich an die Arbeit. Am folgenden Morgen nähert sich ein imposanter Konvoi von Ruderbooten und Dschunken, eng besetzt mit japanischen Offizieren und Soldaten. Bald gleiten sie in enger Formation um die Waelstrohm herum.
Als der Kapitän die ersten Boote beobachtete, wie sie Nagasaki Hafen verließen, rief er zu Kaempfer hinüber: »In Kürze werden wir hier oben Gäste empfangen, die ganz bestimmt nicht sehen wollen, was Sie da vor sich hin kritzeln. An Ihrer Stelle würde ich Stift und Papier tief in meiner Tasche vergraben. Zur Erinnerung: Wir dürfen nichts sehen und uns schon gar nichts merken!«
Nur zwei Tage zuvor hatte er die Mannschaft antreten lassen: »Zeit, Eure Münzen und jedwede christlichen Insignien in Eurem Besitz, Kreuze, Bibeln, Rosenkränze, schlicht alles, was darunterfallen könnte, zu verstauen. Versucht nicht, mich zu betrügen und irgendetwas zurückzuhalten! Ihr wisst ja, alle sichtbaren Zeichen unseres Glaubens sind in Japan streng verboten. Zur Sicherheit von Euch allen und zur Sicherheit der VOC Handelslizenz versiegeln wir Eure persönlichen Schätze in einem der großen Fässer ganz unten in der Dunkelheit des Schiffsbauches, wo niemand aus freien Stücken hingeht.« Auf das Murren einiger antwortete der Kapitän mit einem kurzen: »Willst wohl Deinen Kopf verlieren, Mann?«, bis schließlich einer nach dem anderen seinen Besitz in dem Fass verstaute und schleunigst wieder nach oben kletterte.
»In Japan sind Fremde unerwünscht. Die einzige Ausnahme wird für die VOC gemacht. Deren Repräsentanten aber dürfen sich nur auf der künstlichen Insel Dejima frei bewegen«, hatte der niederländische Generalgouverneur der Vereenigde Oostindische Compagnie in Batavia Engelbert Kaempfer noch einmal eindringlich erklärt, als sie seinen Aufenthalt in Japan planten. »Die Insel ist mit dem Festland von Nagasaki durch eine einzige schmale abgeschlossene und streng bewachte Brücke verbunden, die wir ohne Erlaubnis und ohne japanische Begleitung nicht betreten dürfen. Seien Sie also auf der Hut, Doktor. Vor allem vergessen Sie niemals: Wer diese Mission antritt und im Auftrag der Niederländischen Ostindien Kompanie nach Dejima geschickt wird, verpflichtet sich, von sämtlichen Auseinandersetzungen mit Japanern abzusehen und alles zu unterlassen, was die Handelsbeziehungen der VOC gefährden könnte.«
Sobald die japanischen Offiziere über Hängeleitern hinauf an Bord der Waelstrohm geklettert sind, werden zurückhaltend höfliche Begrüßungen ausgetauscht. Immer noch legen Boote an, immer mehr Männer erscheinen an Deck. Soldaten verteilen sich überall. Die Schiffsmannschaft der Waelstrohm ist in voller Besatzung angetreten und schaut staunend, aber schweigend zu. Nun tritt ihr Kapitän mit einer schweren Ledertasche vor und übergibt sie mit einer knappen Verbeugung an den Offizier, der neben dem japanischen Befehlshaber steht. Diese Tasche enthält Instruktionen und private Briefe an die niederländische Besatzung von Dejima, sowie verschlüsselte Anweisungen an den niederländischen Kommandanten auf der Insel. Obwohl die Postsendungen in mehrere Lagen Wachspapier eingeschlagen und fest versiegelt sind, um sie vor der Unbill einer langen und wetterwendischen Seereise zu schützen, fühlen sich manche Päckchen verdächtig feucht an. Das wird eine herbe Enttäuschung für deren Empfänger sein, die fast ein ganzes Jahr lang auf Nachrichten von Freunden und Familien gewartet haben. Nun folgt die akribische Überprüfung der Frachtpapiere, während japanische Soldaten jeden Winkel des Schiffes durchstöbern und überprüfen, sämtliche Waffen beschlagnahmen wie auch die Fässer mit Schwarzpulver versiegeln.
Anschließend verhören sie jedes Mitglied der Besatzung einzeln, mit Ausnahme des Kapitäns und des Arztes. Die unsicheren, aber manchmal auch widerspenstigen Antworten auf die teils provokanten Fragen werden mit Hilfe japanischer Übersetzer schriftlich festgehalten und müssen am Ende von den Betroffenen unterzeichnet werden. Engelbert Kaempfer ist traurig berührt davon, wie viele der Männer hierbei nur mit einem schlichten Haken dienen können. Auf außergewöhnliche Vorgehensweisen war er vorbereitet. Aber hier vor Ort entsetzt ihn nun das Ausmaß der erniedrigenden Einzelheiten. Von heute an ist die Vereenigde Oostindische Compagnie weder Herr ihres eigenen Schiffes noch seiner Fracht, während ab sofort sogar die Mitarbeiter des Handelshauses der Autorität Japans unterstellt sind.
Nach einer knappen Verbeugung des ersten Offiziers verlässt die japanische Delegation das Schiff. Nun werden Boote zu beiden Seiten der Waelstrohm vertäut und lotsen sie zur Erleichterung der Mannschaft durch die Enge der zerklüfteten Bucht in den gut geschützten Hafen von Nagasaki.
Am späten Nachmittag liegt Dejima vor ihnen. Als Engelbert Kaempfer die Insel in Augenschein nimmt, ergreift ihn Panik. Was er sieht, übertrifft seine schlimmsten Befürchtungen. Erfüllt von Sehnsucht denkt er an die Weite Russlands, die Karawanen, mit denen er Wüsten durchquerte, an die belebten Straßen von Isfahan, die Schönheit und die Kultur dieser Stadt, die Freizügigkeit, mit der er sich dort bewegen durfte, den regen Austausch mit einheimischen Gelehrten, die kostbaren Bibliotheken, die er genossen hatte. Im Angesicht des kärglichen Zustands dieser winzigen Insel erscheint es ihm einer Strafe gleich, auf Dejima leben zu müssen, ganz so, als sei er ein Dieb.
Als Arzt im Dienst der Niederländischen Ostindien Kompanie wird er sich hier um diejenigen zu kümmern haben, die das ganze Jahr über auf Dejima leben. Aber natürlich steht jetzt erst einmal der dramatische Zustand der Besatzung der Waelstrohm im Vordergrund. Ungläubig schüttelt er noch einmal den Kopf. Man hatte ihm zwar mitgeteilt, dass die Umstände schwierig sein würden, aber das, was er in diesem Moment sieht und empfindet, liegt jenseits seiner schlimmsten Erwartungen. Jedoch, hatte das Angebot, ein Jahr in diesem für ihn gänzlich fremden Land zu arbeiten, nicht verheißungsvoll geklungen? Hatte die Aussicht darauf nicht seinen Ehrgeiz als Arzt und Forscher angespornt?
Denn in dieser Zeit ist Japan noch ein Land voll wohl gehüteter Geheimnisse, ein Land, was für jeden Forscher und Gelehrten eine besonders reizvolle Herausforderung darstellt.
Obwohl er wahrlich kein großer Freund der Niederländischen Ostindien Kompanie ist, hatten sie ihn ausgewählt, getragen von der Hoffnung, dass ein vielseitig erfahrener und sprachbegabter Mann wie Engelbert Kaempfer ideale Voraussetzungen mitbringt, Erkenntnisse wie Informationen zu liefern, die auf lange Sicht dazu beitragen könnten, den geschrumpften Handel der VOC mit Japan wieder auszudehnen.
Nach Ansicht der Leitenden Köpfe in der Batavia Niederlassung hatte man ausreichend Zeit investiert, um ihn für diese Aufgabe umfänglich vorzubereiten.
Jetzt aber, hier vor Ort angekommen, fühlt sich Engelbert Kaempfer keineswegs gerüstet. Wie könnte er auch. Die Entscheidung, nach Dejima zu reisen, fiel in Batavia auf Java, weit weg von europäischen Bibliotheken. Dort hätte er wenigstens die gewissenhaften Aufzeichnungen jener portugiesischen Jesuiten studieren können, die Jahrzehnte lang in Japan gearbeitet hatten, bis hin zu ihrer Verbannung aus dem Land.
Ihre Berichte sind, dem Vernehmen nach, wahre Schatzkisten, die auf eine Zeit zurückgehen, in der die später so genannten südländischen Barbaren als willkommene Gäste und Partner hier lebten, da ihre Handelswaren sich bei den Einheimischen großer Beliebtheit erfreuten. Die Archive der VOC dagegen sind rein geschäftlich ausgerichtet. Dort findet sich wenig über das Leben in Japan, die Mentalität der Bewohner, über ihre Sitten und Gebräuche. Zu verfeindet ist man inzwischen miteinander. Was derzeit verbindet, ist allein eine wirtschaftliche Zweckgemeinschaft – in der jede Seite auf ihren Vorteil bedacht ist.
Das tiefe Misstrauen, welches den Anreisenden spürbar entgegenschlägt, schockiert Engelbert Kaempfer, und er fragt sich, ob er nicht einen großen Fehler gemacht hat. »Vergeude ich kostbare Zeit, von der ich nicht mehr allzu viel habe?«, murmelt er besorgt und blickt zurück über die lange Bucht, als seine Überlegungen von der Schiffsglocke unterbrochen werden.
Die Waelstrohm hinauf und hinunter erklingen Schreie der Erlösung und Begeisterung. Die Männer rufen und winken, lehnen sich weit hinaus über die Reling und beobachten ein Boot, das sich ihnen von der Insel Dejima aus nähert. Kaum dass es angelegt hat, ziehen sie unter Jubelrufen einen Korb nach dem anderen hoch, gefüllt mit duftenden Köstlichkeiten. Sie entdecken Eier und Hühnerfleisch, Gemüse, frisch gebackenes Brot, Pudding, Sake, Wein, Bier und sogar ein wenig Tabak. Gierig und ohne Zeit zu verlieren, lassen sich die hungrigen Männer zu einem prächtigen Mahl gleich hier an Deck nieder – im Hafen von Nagasaki. Still wendet sich ihr Kapitän ab und dankt Gott für diese Gabe.
Es sind die ersten nahrhaften Speisen seit einem Monat. Überwältigt von Hunger und Freude, sinken sie auf die Planken und teilen ihre Schätze auf. An diesem besonderen Tag wird ihnen ihre Spontaneität verziehen.
Während der ganzen Nacht umfahren mehr als zwei Dutzend Schiffe mit brennenden Fackeln das niederländische Schiff, um sicher zu stellen, wie der Kapitän seiner Mannschaft erklärt hat, dass niemand auf die Idee kommt, die Waelstrohm zu verlassen.
Zwei Tage nach ihrer Ankunft im Hafen von Nagasaki, am Morgen des 26. September, darf Engelbert Kaempfer, ausgerüstet mit einem japanischen Pass, ohne den kein Fremder von Bord eines Schiffes gelassen wird, endlich die künstliche Insel Dejima betreten. Er klettert in eines der niederländischen Beiboote und wird hinüber gerudert.
»Seien Sie gegrüßt auf der Insel«, ruft eine heitere Stimme, und schon streckt der Kommandant von Dejima ihm seine Hand mit einem herzlichen Willkommen entgegen: »Ich bin froh, dass Sie hier sind, Doktor! Kommen Sie, Ihr Quartier liegt da drüben.« Heinrich van Butenheim zeigt auf ein kleines, schmuckloses Gebäude zur linken, das auf recht unsolide wirkenden Stelzen ruht, etwa eineinhalb Ellen über dem Boden. Engelbert Kaempfers Blick jedoch ist immer noch auf die uniformierten Japaner gerichtet, die die beiden Männer begleiten. »Machen Sie sich nichts draus, Sie werden sich schnell daran gewöhnen. Die Kerle sind ganz in Ordnung, erledigen nur ihre Arbeit, erzähle Ihnen später davon,« erläutert der Kommandant knapp, »kommen Sie.«
Das neue Zuhause des Arztes ist alles andere als luxuriös. Kleine Zimmer, kleine Fenster, Staub und Spinnweben sind sein Willkommen. »Das ist mal etwas ganz anderes«, sagt er mit leiser Ironie in Richtung des Kommandanten, der beschwingt erwidert: »Gemach, Sie werden sich schon daran gewöhnen, tun wir alle hier. Und nicht vergessen, Doktor, ein Jahr ist nicht das ganze Leben. Übrigens, über eines werden Sie sich auf Dejima nicht beschweren können, einen Mangel an Dienstboten.« Wieder lacht er freundlich: »Sie sind überall, Tag und Nacht, Dienstboten und Spione zugleich. Aber Sie haben Glück, Ihnen als Arzt werden sie einen halbwegs fähigen Helfer zur Seite stellen, der Ihnen, wie gesagt, zur Hand gehen wird, aber natürlich auch von Ihren Kenntnissen profitieren und Sie gleichzeitig ausspionieren soll.«
Ein zartes Klopfen an der Tür unterbricht ihre Unterhaltung. Mit gesenkten Köpfen eilen muskulöse, japanische Träger in einer langen Reihe, bepackt mit Engelbert Kaempfers zahlreichen Taschen, Truhen und Kisten ins Haus.
So schnell sie kamen, so schnell sind sie auch wieder verschwunden mit Ausnahme eines freundlich aussehenden jungen Mannes, der vorsichtig und unsicher auf Engelbert Kaempfer zugeht, sich verbeugt und etwas sagt, was dieser nicht verstehen kann.
»Der scheint es zu sein, Doktor,« erklärt Kommandant van Butenheim. »Nun, ich werde Sie jetzt alleine lassen und erwarte Sie zum Abendessen bei mir. Kommen Sie rüber, wenn Sie hier so weit sind.« Nachdem der Kommandant gegangen ist, betrachtet Engelbert Kaempfer in Ruhe den jungen Mann. Er geht ein paar Schritte auf ihn zu, lächelt ihn auf seine liebenswürdige Art an und nickt mit dem Kopf zur Begrüßung. Das wiederum führt bei seinem Gast zu einer noch tieferen Verbeugung und einem ebenso freundlichen Lächeln. Der Doktor zeigt auf sich und sagt: »Kaempfer.« Der junge Mann bemüht sich nachzusprechen. Die Versuche wiederholen sich, bis beide lachen müssen.
Engelbert Kaempfer zeigt auf den jungen Mann mit einem fragenden Blick, bis er etwas hört, was so ähnlich wie »Imamoa« klingt und versucht, nun seinerseits diesen Namen auszusprechen, wird korrigiert, hört zu und wiederholt, bis er glaubt, verstanden zu haben. Nun geht er in den Raum nebenan und ruft »Imamura«. Der junge Mann folgt sofort. Also hat er verstanden. Engelbert Kaempfer öffnet eines der Fenster. Imamura tut es ihm gleich. Als nächstes öffnet der Doktor eine seiner Ledertaschen, zeigt auf einen Tisch und beginnt mit einem ermutigenden Lächeln auszupacken, wobei er sich fragt, ob Imamura begriffen hat, wozu er ihn auffordern möchte. Der junge Mann beugt sich über den kostbaren Inhalt und beginnt, zunächst zaghaft, es ihm gleich zu tun. Nach zwar kurzer, jedoch konzentrierter Beobachtung beschließt der Doktor, seinem Assistenten zu vertrauen und beschäftigt sich mit seiner neuen Umgebung, wandert herum und überlegt, wo er arbeiten, schlafen und sein Labor einrichten wird.
Gegen Abend muss nur noch ein letzter Koffer ausgepackt werden. Die ganze Zeit hat Engelbert Kaempfer sehr wohl wahrgenommen, mit welcher fast zärtlichen Sorgfalt Imamura sein Hab und Gut behandelt. Auch ist Imamuras durchaus sympathisches Interesse an allem, was er erblickt und in Händen hält, der Aufmerksamkeit des Doktors nicht entgangen.
Nachdem die wichtigsten Arbeiten für diesen Tag erledigt sind, wird Engelbert Kaempfer plötzlich bewusst, wie sehr er die Entspannung in heißem Dampf und Wasser auf seiner Haut während der vergangenen Wochen vermisst hat und ist hoch erfreut, als es ihm gelingt, sich verständlich zu machen.
Nach wunderbar erfrischender Reinigung und in erholsam sauberer Kleidung klopft er am Abend an des Kommandanten Tür. Der Empfang ist herzlich.
»Eine liebenswürdige Idee, Kommandant! Vielen Dank für Ihre Einladung. Unsere Mahlzeiten waren sehr kärglich letzthin.«
»Gern geschehen, Kaempfer, ich hoffe, wir werden uns einer guten Zusammenarbeit erfreuen.«
»Ganz meinerseits, Kommandant! In Batavia erzählte man mir, Sie seien schon zum zweiten Mal auf Dejima?«
»In der Tat.«
Auch wenn dies eher ungewöhnlich ist, wird keine weitere Erklärung angeboten.
»Um auf den Sturm zu kommen, der Sie überrascht hat, Ihr Schiff sieht jämmerlich aus! Mir scheint, Sie können von Glück reden, dass die Waelstrohm es überhaupt hierher geschafft hat.«
»Da haben Sie absolut recht, insbesondere da wir zum Ende der Reise hin noch den Versuch einer Meuterei verhindern mussten.« Der Kommandant blickt überrascht: »Ach ja?«, und füllt bedächtig ihre Gläser.
»Nun, Sie haben die Männer gesehen. Das einzige Schwein, das den Sturm überlebte, haben wir bald danach schlachten müssen. Zusätzlich hatten die Wellen beinahe das gesamte verbliebene Bier verdorben, sodass die Zuteilung durch den Kapitän das Leid eher vergrößerte als es zu mildern. Sie wissen besser als ich, was es bedeutet, eine Mannschaft ohne ordentliche Mahlzeiten und ohne anständige Getränke an Bord zu halten. Beim nächsten Sturm, auch wenn es sich nur um einen milden handelte, verließ sie jedwede Zuversicht. Geschlossen stimmten sie für eine Umkehr.« Engelbert Kaempfer nimmt einen kräftigen Schluck. »Ich bin sicher, wir hätten nicht überlebt, wenn der Kapitän nachgegeben hätte.«
»Vielleicht nicht. Auf jeden Fall werden wir Ihre Leute gut füttern und notwendige Reparaturen vornehmen lassen, bevor sie umkehren, genug Zeit dafür haben wir, denn bis die Waelstrohm beladen und abfahrbereit ist, wird es wie immer später Herbst sein.«
»Danke, Kommandant.«
»Aber jetzt interessiert mich vor allem, wie Sie ihre Mannschaft doch noch zur Weiterfahrt bewegen konnten?«
»Durch Zufall und eine gehörige Portion Glück. Als die Besatzung sich ernsthaft weigerte, war der Kapitän ziemlich sicher, dass wir nicht allzu weit von den japanischen Gewässern entfernt sein konnten. Gleichzeitig sagte mir meine berufliche Erfahrung, dass keiner der Männer eine direkte Rückreise überleben würde. Aber dieses Argument ignorierten sie. Ihr Verstand war vernebelt von Hunger und Verzweiflung. Als aber einer der für die Fracht zuständigen Matrosen in dem hitzigen Wortwechsel anmerkte, dass die Ladung ohnehin zu durchnässt und beschädigt sei, um noch verkauft oder verschenkt zu werden, hatten wir gewonnen. Denn, Sie wissen es nur allzu gut, hätten wir beigedreht, wären wir nicht nur der Meuterei für schuldig befunden, sondern auch für den finanziellen Verlust der VOC verantwortlich gemacht worden, der durch die Weigerung entstanden wäre, unsere Ladung an ihrem Bestimmungsort abzuliefern, ganz gleich in welchem Zustand.«
»Wohl wahr,« bestätigt der Kommandant anerkennend.
»Vielleicht war das Wetter, unter dem wir segelten, tatsächlich außergewöhnlich schlecht! Aber wie ich gehört habe, gab es schon andere vor uns, die es kaum nach Nagasaki schafften?«
»Ganz recht«, lacht Heinrich van Butenheim auf, »dann lassen Sie mich zusammenfassen, dem Himmel sei Dank, dass Sie hier sind, Doktor, ich verspreche mir viel davon.« Plötzlich reckt er sich in seinem gemütlichen Lehnsessel auf und ruft: »Du meine Güte, auch Sie müssen ja entsetzlich hungrig sein!«
Engelbert Kaempfer fühlt sich nicht mehr so niedergeschlagen wie in jenem Moment, als ihr Schiff in den Hafen von Nagasaki einlief. Einerseits ist die freundliche Atmosphäre in Gegenwart des Kommandanten eine unerwartet angenehme Überraschung. Andererseits kann er nicht die Stunden vergessen, die er heute mit Imamura verbrachte. Er hegt keinen Zweifel daran, dass dieser so offenkundig intelligente und zuvorkommende junge Mann in sein Haus gekommen ist, um zu lernen und nicht, um ihn in erster Linie auszuspionieren.
»Sie wollten mir mehr erzählen über diese so genannten Spione auf der Insel«, erinnert Engelbert Kaempfer seinen Gastgeber, als ihr Dessert auf dem Tisch steht.
»Wir sind umgeben von ihnen, täglich, allzu oft rund um die Uhr. Mit ihrem Blut müssen sie alljährlich den Schwur erneuern, keine Einzelheiten über ihre Religion, Staatsangelegenheiten, Lebensweise oder sonstige Informationen über ihr Heimatland Japan preiszugeben. Damit nicht genug, als zusätzliche Vorsichtsmaßnahme werden sie gezwungen, sich ebenfalls untereinander zu bespitzeln. Die Strafe für auch nur einen Verstoß gegen diese Regeln lautet Tod. Das ist das traurige Ergebnis einer Beziehung, die einst mit Gastfreundschaft begann, und später in Hass und Krieg mündete.«
»Es fällt mir schwer, zu glauben, dass sich immer noch, nach sechzig Jahren Isolation, nichts an diesem tragischen Misstrauen geändert hat, es ergibt keinen Sinn.« Heinrich van Butenheim zieht seine Brauen zusammen: »Verehrter Freund, derzeit bin allein ich verantwortlich für unsere Leute hier vor Ort, genauso wie für unsere Geschäfte mit Japan. Ich weiß sehr wohl, wie zerbrechlich die Atmosphäre zwischen unseren Ländern ist, auch nach sechs Jahrzehnten noch. Jedoch, dieses Problem hier und jetzt auf dieser Insel zwischen uns beiden zu erörtern, ist müßig. Denn ändern können wir nichts an unserer prekären Lage. Und damit wir uns verstehen, Doktor, es ist es meine Pflicht, unbedingten Gehorsam von allen, auch von mir selbst, zu verlangen. Vergessen Sie das nicht! Niemand, weder Japaner noch Niederländer, wird auf dieser Insel getötet werden«, setzt er hinzu und starrt dabei aus dem inzwischen dunklen Fenster. »Jedenfalls nicht, so lange ich hier für uns die Verantwortung trage.«
Auch wenn Engelbert Kaempfer die plötzliche Strenge des Kommandanten nicht nachvollziehen kann, schweigt er. Aber sein Gastgeber lässt sich so schnell nicht täuschen.
Heinrich van Butenheim lehnt sich zurück und blickt seinem Gast grad heraus in dessen leuchtend blaue Augen: »Man sagte mir, Sie seien ein erfahrener und weit gereister Mann, Doktor. Ich bitte Sie, mir gut zuzuhören: Einen Aufenthalt in diesem Land zu überleben, bedeutet für uns sicher nicht, Regeln und Gesetze zu missachten. Im Gegenteil, wir sind dazu aufgerufen, uns eben diesen zu unterwerfen. So einfach ist das. Vergessen Sie nicht, wir sind nur einige wenige in einem Meer von japanischen Sicherheitskräften. Bis in die hintersten Winkel, von Nord nach Süd und Ost nach West würden sie uns genauso wie ihre eigenen Staatsbürger bei jeder Zuwiderhandlung verfolgen. Und wir hätten, ganz wie die Einheimischen, nicht die geringste Chance, Ihnen zu entkommen, nicht die geringste.«
Den nächsten Satz flüstert er beinahe drohend und hält den Arzt dabei fest im Blick: »Immerhin wollen doch weder Sie noch ich das Schicksal herausfordern und die lukrativen Handelsbeziehungen für unser Land in Gefahr bringen, oder?«
Natürlich kann Engelbert Kaempfer den Druck nachvollziehen, dem Heinrich van Butenheim in einer derartig angespannten Situation ausgesetzt ist. Er selbst trägt ja seit Jahren schwer an der Last des mitunter skrupellosen Ehrgeizes der Niederländischen Ostindien Kompanie. Dennoch, ihm kommen die letzten Bemerkungen des Kommandanten überzogen vor, und so ist er nicht sonderlich beeindruckt: »Imamura ist anders, da bin ich mir sicher. Wie oft schon habe ich junge Menschen wie ihn kennengelernt. Sie sind eifrig, hellwach, und sobald sich ihnen die Möglichkeit bietet, streifen sie begierig die engen Fesseln ihres bisherigen Lebens ab, bereit ihr Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen.«
Heinrich van Butenheim wirft seine Serviette auf den Tisch.
Wie konnte ich mich derart täuschen, denkt er. Bis jetzt lief doch alles ganz gut. Laut sagt er: »Verzeihen Sie, Doktor, Sie irren sich. Der Vater des jungen Mannes arbeitet als Übersetzer hier auf der Insel. So hat er die Stelle bekommen! Selbst wenn Sie in seinem Fall Recht haben sollten, gibt es immer noch diejenigen, die Sie und ihn im Auge behalten, denn dafür werden sie bezahlt. Also seien Sie auf der Hut, wenn Sie Ärger vermeiden wollen, um unser aller Willen!« Der Kommandant erhebt sich und geht voran in das bescheidene, aber dennoch gemütliche Wohnzimmer.
Auch wenn Engelbert Kaempfer diesen plötzlichen Stimmungsumschwung zutiefst bedauert, so ist er nicht bereit, sich durch die Vorhaltungen des Kommandanten einschüchtern zu lassen. Unzählige Male in seinem Leben wurde er gewarnt und zu Vorsicht angehalten, aber bislang hat er noch jede Situation gemeistert und sich seinen Weg gebahnt, selbst wenn er alles andere als geschmeidig daherkam. Und nun, im reifen Alter von 39 Jahren sieht er keine Veranlassung, daran etwas zu ändern. Nach allem, was er in den vergangenen Wochen auf der Waelstrohm durchgemacht hat, wird er sich den ersten Abend an Land und die willkommene Gastfreundschaft des Kommandanten, den er eigentlich doch recht sympathisch findet, nicht verderben lassen. Also lehnt er sich entspannt in dem etwas geschundenen Sessel zurück, der ihm angeboten wird, schlägt die Beine übereinander und greift nach seiner Pfeife, während Heinrich van Butenheim ihnen beiden einen Digestif einschenkt.
»Verzeihen Sie, Kommandant, ich wollte den Glanz Ihrer so wohltuenden und großzügigen Einladung nicht trüben, aber mir ist noch nichts Vergleichbares widerfahren. Ich bin daran gewöhnt, mich frei zu bewegen, vorausgesetzt natürlich, ich halte mich an die diplomatischen Gepflogenheiten und allgemeinen Vorschriften des Landes, in dem ich bin. Aber hier fürchte ich, wird es etwas dauern, bis ich mich an die doch überraschende Art und Weise gewöhnt habe, mit der dieses Land seine Gäste, beziehungsweise Handelspartner begrüßt und behandelt.«
Dem Kommandanten entgeht nicht die natürliche Eleganz und Leichtigkeit, mit der Engelbert Kaempfer das Beste aus der etwas empfindlichen Situation zwischen ihnen macht und trotz der Zweifel, die er hegt, kommt er nicht umhin, seinen Gast recht charmant zu finden. Vielleicht werden die kommenden Monate doch nicht so trübe, wie das vergangene Jahr. So beschließt er, die erfahrene Selbstsicherheit des Neuankömmlings neugierig zu genießen und reicht ihm ein Glas Brandy. »Sie sollten immer daran denken, Doktor, dass wir weder Gäste noch Partner dieses Landes sind. Japan kennt dergleichen heutzutage nicht. Wir werden nicht empfangen, nur aus Notwendigkeit heraus toleriert. Hat man Ihnen das in Batavia nicht sehr deutlich gesagt?«, fragt er etwas ironisch überspitzt.
»Ich glaube nicht, dass es möglich ist, sich das tatsächliche Ausmaß der hiesigen Haltung im Vorhinein vorzustellen, ganz gleich, was gesagt oder nicht gesagt wurde.«
»Aber etwas gibt es, das Sie erfreuen wird. Sie haben natürlich gehört, dass wir einmal im Jahr nach Edo reisen, um dem Herrscher von Japan unsere Reverenz und unseren Respekt zu erweisen. Unser Auftritt bei Hof und vor allem die Qualität unserer Geschenke entscheiden darüber, welche Handelsbestimmungen der Shogun für die kommende Saison festlegt. Dieser Besuch in der Residenz stellt also den zentralen Kern unserer Handelsbeziehungen dar!« »So habe ich vernommen. Und glauben Sie mir, ich würde mich Ihnen nur zu gerne anschließen dürfen.«
»Nun, das dürfen Sie, Doktor. Ich habe bereits die Erlaubnis erwirkt, in Begleitung des diesjährigen Arztes zu reisen. Wahrscheinlich werden wir Dejima wieder Mitte Februar nächsten Jahres verlassen.«
»Ausgezeichnet!« Engelbert Kaempfer erhebt sein Glas, »also werde ich das Land doch kennenlernen ...«
»Gemach. Erwarten Sie nicht zu viel. Wir reisen nicht allein!« Heinrich van Butenheim versucht sofort, die Freude des Arztes zu bremsen: »Nach dem derzeitigen Stand der Dinge wird eine Delegation von mindestens 50 oder 60 Beamten, Wachleuten, Dolmetschern und Spionen, sowie etlicher regierungstreuer Bürger mit uns auf die Reise gehen. Streng bewacht und eingepfercht, einer Herde Schafe gleich, werden wir eng geführt. Niemals dürfen wir allein vom Pfad abweichen, selbst für die persönlichsten Bedürfnisse nicht. Ja, wir werden sehen, wie die Dorfbevölkerung die Straßen für uns kehrt, die Bäuerinnen vor Angst in ihre Hütten flüchten und ihre Männer sich am Straßenrand vor uns verneigen. Aber schon unsere Blicke auf sie werden beobachtet und kritisch registriert.«
Noch einmal betont der Kommandant ermahnend die allgegenwärtigen Risiken und fügt hinzu: »Ihre Augen können sehen, was sie sehen, Ihre Ohren mögen hören, was sie hören, Ihre Fragen aber dürfen keinem Einheimischen gestellt werden. Alles andere würde unsere Mission und jedermanns Leben auf beiden Seiten gefährden.«
»Immer noch besser als gar nichts, würde ich sagen«, und mit einem spitzbübischen Lächeln fügt Engelbert Kaempfer hinzu: »Sie wissen so gut wie ich, welch reichhaltige Geschichten Augen und Ohren erzählen können.«
»Vielleicht, Kaempfer, vielleicht«, erwidert Kommandant van Butenheim, »aber auch gefährlich, wenn wir uns nicht fügen.« Seine Stimme hat wieder den ernsten, leicht bedrohlichen Tonfall des frühen Abends angenommen.
Dieser Doktor hat etwas an sich, das Heinrich van Butenheim nicht zuordnen kann. Immer noch unsicher, ob er Engelbert Kaempfer nun trauen kann oder nicht, fühlt der Kommandant sich bemüßigt, ein weiteres Mal zu betonen: »Der Auftrag, den ich in Batavia erhielt, war deutlich, und Sie werden bestimmt nicht die Autorität der Niederländischen Ostindien Kompanie anzweifeln wollen.«
Engelbert Kaempfer genießt den Abend und ist nicht gewillt, zum Wohle der Kompanie, für die er nicht das geringste empfindet, das Vergnügen seines ersten Abends auf Dejima zu opfern. So wechselt er ungezwungen das Thema, was umso leichter ist, als die beiden Männer nicht auf demselben Schiff gesegelt sind.
»Ich darf annehmen, unser Schiff ist nicht das letzte in diesem Jahr, das den Hafen von Nagasaki ansteuert?«
»Ganz recht, und ich bedaure sehr, was Sie durchlitten haben. Aber vielleicht wäre zu dieser Jahreszeit ein verkürzter Aufenthalt in Siam sinnvoller gewesen?«
»Gewiss«, antwortet sein Gast. »Leider jedoch lagen die wichtigsten Ballen der kostbarsten Qualität noch nicht vor, als wir ankamen. Und wie mir gesagt wurde, ist ausgerechnet ihre Qualität ein besonders angesehener Teil der Geschenke bei Hof?«
»Richtig, und jetzt sind sie wahrscheinlich ebenso schadhaft wie viele andere Geschenke? Die Sorgen des Kapitäns werden schon berechtigt sein. Was schätzen Sie, Kaempfer, welchen Prozentsatz von dem, was hier angekommen ist, werden wir in Edo mit gutem Gewissen überreichen können?«
Kaempfers Augen wandern durch den Raum. Zutiefst beunruhigt durch das Ausmaß der Schäden seiner über Jahre verfassten Aufzeichnungen, und auch seines medizinischen Grundbestandes, klingt die Frage des Kommandanten in seinen Ohren beinahe banal. »Das kann ich nicht übersehen, aber was allein ich verloren habe, schätze ich auf ein gutes Drittel meiner medizinischen Vorräte. Und der Gedanke daran, wie es möglich sein soll, unter diesen Umständen uns, die wir auf der Insel zurückbleiben, möglichst gesund durch den Winter zu bringen, beunruhigt mich zutiefst.« Dann wagt er zu fragen: »Ob es mir wohl gestattet wird, Pflanzen auf dem Festland zu sammeln, um meinen Bestand aufzubessern? Das wäre ungemein hilfreich.«
»In gewisser Weise, ja. Hat man Sie darüber informiert, wie es Ihren Vorgängern ergangen ist? Sie mussten sich mit dem begnügen, was die Einheimischen für sie pflückten. Jedenfalls habe ich es so im letzten Jahr erlebt. Aber unter den gegebenen Umständen ist Ihre Unruhe natürlich absolut berechtigt, schauen wir in ein paar Tagen, was sich machen lässt. Ohnehin, die Kompanie verspricht sich einiges von Ihrem Aufenthalt hier, Kaempfer. Aber erwarten Sie bitte nicht zu viel, und vor allem, drängen Sie nicht. Das dient Ihrem Ziel überhaupt nicht.«
»Seit ich Schweden vor sieben Jahren verlassen habe, ist mir nirgendwo auch nur annähernd so viel Misstrauen entgegengebracht worden wie hier.«
Keiner von beiden hatte es gewollt, doch schon wieder gerieten sie in die Nähe konfliktträchtiger Bereiche. Diesmal jedoch geht Heinrich van Butenheim einfach zu seinem Schrank hinüber, ergreift die Brandy Flasche und füllt erneut ihre Gläser: »Tut mir leid, Doktor«, seufzt er, »Sie wurden arg gebeutelt. Die Nachricht, dass Sie nicht nur ein erfindungsreicher und äußerst versierter Arzt und Chirurg sind, sondern eine Vielseitigkeit an Fähigkeiten besitzen, hat mich sehr wohl erreicht und mein Befehl ist eindeutig: Sie unterstützen, wo und wie ich kann. Aber die Japaner werde ich nicht für Sie und Ihren Auftrag ändern können. Der beste Rat, den ich Ihnen geben kann, lautet: versuchen Sie, sich nützlich zu machen. Gleichzeitig aber denken Sie immer daran, Sie können so süß sein wie Honig, niemand wird Sie je wirklich mögen oder gar Gefühle für Sie hegen.«
Es war ein langer, ein ereignisreicher Tag. Engelbert Kaempfer liegt hell wach in seinem Bett.
»Dieses Land ist eine große Herausforderung«, denkt er und wälzt sich herum. Er mag Heinrich van Butenheim und seine gepflegte Art. Anders als bei vielen Europäern, denen er im Ausland begegnet ist, hat der Kommandant nichts Rohes oder Überhebliches an sich. Aus welchem Grund auch immer scheint er seine Aufgabe im besten Sinne für die Niederländische Ostindien Kompanie erfüllen zu wollen, während ihm tatsächlich das Wohlergehen und die Sicherheit seiner Untergebenen in ungewöhnlichem Maß am Herzen liegt.
»Aber was immer andere, sogar auch der Kommandant sagen mögen, Imamura ist kein Spion«, murmelt der Arzt in den frühen Morgenstunden, als ein Anflug von Schlaf durch sein Fenster weht und seine Träume beflügelt.
Die folgenden Wochen lassen keinen Raum für weitere Wunschträume. Der Alltag fordert des Doktors volle Energie, so dass ihm nicht einmal die Zeit bleibt, Entladung und erneute Beladung des niederländischen Schoners genauer zu verfolgen, geschweige denn an dem spannenden Hin und Her, welches vorübergehend die Insel belebt, teilzunehmen. Stattdessen hat Engelbert Kaempfer nach wie vor von früh bis spät damit zu tun, zerraufte und erschöpfte Mannschaften für die Abreise auf Vordermann zu bringen. Den erbärmlichen Rest seiner medizinischen Vorräte zu sortieren und sein Labor so gut er kann, in Stand zu setzen, Tinkturen und Tropfen zu mischen sowie Salben aufzubereiten, braucht ebenfalls seine Zeit.
Hinzu kommt, dass er sich notgedrungen viel zu häufig draußen aufhalten muss, wenn es laut wird. So diskret wie möglich mischt er sich dann unter die Gruppe der besonders ungeduldigen und streitsüchtigen Matrosen, um sie, soweit ihm das möglich ist, vor gravierenden Folgen zu bewahren.
Denn Dejima ist ein ereignisloser, trostloser Ort für so viele frustrierte Seeleute. In kleinen Gruppen dürfen sie abwechselnd stundenweise auf die Insel, ansonsten müssen die Matrosen auf ihren engen Schiffen darauf warten, dass die Japaner endlich alle Laderäume mit Kupfer, Silber, Perlen, Tee, Reis und heimlichen Kleinigkeiten bestückt haben. Hinzukommt eine Auswahl gut verkäuflicher Waren, die auserwählten Japanern ein besonders lukratives Geschäftsfeld bieten, weshalb sie sehr darauf bedacht sind, die Unterbringung ihrer Waren persönlich an Bord zu überwachen.
Untätigkeit zählt wohl mit zu den größten Übeln, die Matrosen auferlegt werden können. Es sind raue Männer, gewöhnt an einsame Wochen auf hoher See voller Entbehrung. Da draußen arbeiten sie Tag und Nacht, segeln immer wieder gegen furchterregende Stürme an, während die See schon so manchen Freund in ihre Tiefen gezogen hat. Die mit Schwielen übersäte Haut ihrer Hände ist Zeugnis der unzähligen Segel, die in den vergangenen Jahren gehisst und eingeholt wurden. Alles, was sie vermissen, wenn sie ihre Bahn durch die Wellen der Ozeane brechen, suchen sie später an Land. Unglücklicherweise ist nichts davon auf Dejima zu ihrer Entlastung erreichbar. Kein Umherstreifen durch die Stadt, kein Tanz auf den Straßen und keine Chance, in einer dunklen, verrauchten Spelunke die Nacht zu verplaudern. Der Entzug dieser vertrauten, überall in der sonstigen Welt erreichbaren Freiheiten, erhitzt an diesem spröden Ort natürlich ihre Gemüter. Kein Wunder also, dass so manche in einer Rauferei erlittene Wunde versorgt werden muss.
Und, wie überall auf der Welt, gibt es die Nimmersatten, jene, die in jeden Streit verwickelt sind, weil sie ihn suchen. Jene, die ein ernsthaftes Problem darstellen, besonders für den Kommandanten dieser unwirtlichen Insel.
Henrik ist so einer. Groß und breitschultrig bummelt er an einer kleinen Gruppe japanischer Dienstboten vorbei, verbeugt sich spöttisch und wünscht nicht minder ironisch: »Schönen Tag, meine Herren.«
Ohne darauf einzugehen, eilen die Japaner rasch an ihm vorbei.
»Hei, ihr Puppen, was ist los mit Euch, zu dumm zu reden?« Henrik kickt einen kleinen Stein zwischen ihre Füße. Die Diener hasten weiter, ohne diesen Bär von einem Mann auch nur eines Blickes zu würdigen. Aber er kommt näher: »Na, na … Angst habt Ihr? Ich werd’ Euch schon beibringen, wer auf dieser verdammten Insel das Sagen hat«, ruft er und schlägt einem von ihnen hart auf den Rücken. Der Mann stolpert, findet keinen Halt und stürzt zu Boden. Im selben Moment schreit Henrik auf vor Schmerzen. Sein rechter Arm ist gefangen im eisernen Griff eines japanischen Wächters.
Für Henrik und seinesgleichen ist das »Haus der Unermüdlichen«, wie Kommandant van Butenheim den Verschlag zur Sicherungsverwahrung auf Dejima nennt, die letzte Zuflucht. Sicher weggesperrt, aber gut ernährt und versorgt, denn schließlich wird ihre volle Kraft in Kürze an Bord gebraucht, erwarten die Unermüdlichen ihre Abreise hinter vergitterten Fenstern.
In den letzten Tagen des Monats Oktober segeln drei schwer beladene niederländische Handelsschiffe aus dem Hafen von Nagasaki und lassen nur wenige Niederländer zurück. Unter ihnen ist ein Kaufmann namens Abbott, ein Mann in seinen späten 30ern, der sich schnell als unangenehm neugierig erwiesen hat, Grund genug für Engelbert Kaempfer, ihn soweit möglich zu meiden. Unter diesen Umständen ist es eine glückliche Fügung, dass der junge Martens, ein freundlicher 19 Jahre alter und wenig ehrgeiziger Lehrling der VOC, ebenfalls für ein Jahr herübergeschickt wurde. Denn es dauert nicht lange, bis der junge Mann im Netz von Herrn Abbotts lästigem und leider unüberhörbaren Geschwätz gefangen ist.
Bald verbringen die beiden ihre Tage und Abende hauptsächlich beim Kartenspiel in der Abgeschiedenheit des Kaufmanns Quartier, welches die VOC alljährlich bereithält für einen von ihr ausgewählten Gast, von dem sie sich einiges verspricht.
Engelbert Kaempfer ist ein Mann, für den kein Tag je lang genug sein kann. Stets setzt er alles daran, die Stunden, die ihm zur Verfügung stehen, konzentriert auszuschöpfen.
So kommt Imamura pünktlich jeden Morgen um acht Uhr, und oftmals sind sie zur Abendessenszeit, wenn die meisten Diener die stille Insel bereits verlassen haben, noch beschäftigt.
Das kleine und verschlissene Wörterbuch, welches ein wohlmeinender Freund in Batavia Engelbert Kaempfer als Abschiedsgeschenk mit auf den Weg gab, ist ihnen ein höchst willkommener Band. Unglücklicherweise jedoch erkennen sie sehr bald, dass das rührende Büchlein keineswegs ausreicht, sondern viele ihrer Wünsche nicht befriedigen kann. Außerdem hat ihm das Salzwasser arg zugesetzt. Die Wochen vergehen. Der Doktor fühlt sich immer sicherer.
Imamura, dieser eifrige junge Mann mit seinem unstillbaren Wissensdurst und exzellenten Gedächtnis, wird eine Schlüsselrolle bei seinen Erkundungen einnehmen. Engelbert Kaempfer ist inzwischen sicher, dass er ihm zugeteilt wurde, um sich als medizinische Hilfskraft zu schulen und nicht nur, um die niederländische Sprache zu erlernen oder auf ihn aufzupassen. Doch auch er selbst möchte lernen, und zwar das Japanische. Und genau das tut er, jeden Tag. Wie sonst sollten sie in der Lage sein, sich in einer Weise auszutauschen, die den Ansprüchen des Arztes genügte.
Die fremden und kehligen Laute lassen Imamuras Zunge wirbeln. Schweißperlen schimmern auf seiner Stirn, wenn er versucht, der Aussprache des Arztes zu folgen. Der schwierigste Buchstabe ist das »L«. Er bringt es nicht über die Zunge, wie sehr er sich auch bemüht. Leder wird zu »Reder«, Pflanze zu »Pranze«, Leben zu »Reben«.
Zum Glück ist Engelbert Kaempfer ein begabter Zeichner, der geschwind und mit wenigen, leichten Strichen eine expressive Darstellung von dem behandelten Gegenstand anfertigen kann. Schritt für Schritt wächst so ihr eigenes, ihr geheimes Bild-Wörterbuch. Unter die Zeichnung eines Berges etwa setzt er das niederländische Wort, Imamura für Engelbert Kaempfer das japanische. Dann setzt der Doktor die japanische Bezeichnung, wie er die Laute vernimmt, in lateinischen Buchstaben wiederum dahinter. So kann auch er lernen und allmählich verstehen.
Natürlich verschwinden nach jeder Lektion diese geheimen Blätter in ihrem wohlüberlegten Versteck, um am nächsten Morgen wieder hervor geholt zu werden. Das Vertrauen zwischen ihm und Imamura wächst von Tag zu Tag.
Zusätzlich zu diesen häufig sehr lustigen und erhellenden Sitzungen, erweist sich Imamura als großartige Hilfe. Den ganzen Tag lang begleitet er auf Schritt und Tritt seinen heimlichen Lehrmeister und steht ihm aufmerksam zur Seite. Wenn sie in den frühen Stunden im Labor arbeiten, schaut und hört Imamura mit nicht versiegendem Interesse zu. Engelbert Kaempfer ermutigt ihn zu riechen, wo angebracht zu schmecken und ist höchst erfreut, wenn hin und wieder ein Erkennen aufflackert. Es gibt also doch bestimmte Heilpflanzen, mit denen er seinen Bestand aufbessern könnte.
Die Warnungen des Kommandanten aber hat er durchaus ernst genommen und wagt es deshalb nicht, Imamura darum zu bitten, ihm jene Pflanzen zu besorgen, noch nicht.
Eines Tages klopft ein Bote an seine Tür.
Der für die Verwaltung von Dejima zuständige Ottona liegt krank im Bett und verlangt nach dem neuen Doktor. Das an sich ist nicht allzu ungewöhnlich, da europäische Ärzte hohes Ansehen genießen. Engelbert Kaempfer ist natürlich gerne bereit, allemal ihm sofort klar wird, welche Chance diese Bitte eventuell eröffnen könnte. Zusammen mit Imamura packt er bewusst zwei stattliche Taschen, um die Neugier des Ottonas zu wecken.
Eine Stunde später warten ein hochrangiger Offizier, vier Wachleute und ein Übersetzer vor seinem Haus, um ihn zur Residenz des Ottona zu geleiten. Engelbert Kaempfer besteht darauf, Imamura mitzunehmen unter dem Vorwand, er benötige die Unterstützung seines medizinischen Gehilfen. In Wahrheit fühlt er sich jedoch sicherer in Begleitung des jungen Mannes bei seinem ersten Ausflug auf das japanische Festland. Nach einer kurzen Unterredung wird dies gestattet, und zusammen machen sie sich schweigend auf den Weg über die Brücke, die Dejima von der Stadt Nagasaki trennt, geradewegs hinauf zum Haus des Ottona.
Auch wenn dies die erste Möglichkeit für Engelbert Kaempfer ist, einen Blick auf das alltägliche Leben in Nagasaki zu erhaschen, traut er sich nicht, seine neugierigen Augen wandern zu lassen. Ein Wachmann zur linken und einer zur rechten begleiten sie ihn durch die engen Straßen, gefolgt von Imamura in gleicher Anordnung. Der stramme Schritt des ersten Offiziers ist beeindruckend. Mit der linken Hand umgreift er das Heft seines Schwertes und schleudert seine Beine mit einem so energischen Klack-Klack-Klack voraus, dass seine Stiefel durch die Straßen hallen, sobald sein Fuß den Boden berührt. Wo immer sie vorbei gehen, verklingen die Stimmen während Körper sich in Ehrfurcht vor dem beängstigenden Auftritt beugen. Mit erhobenem Haupt, die Augen geradeaus gerichtet, biegt er zackig links ab und einhundert Schritte weiter, wie Engelbert Kaempfer mitzählt, nach rechts, weg vom Hafen landeinwärts, seiner Vermutung nach Richtung Stadtmitte. Die Straße windet sich sacht bergan und gibt bald einen eindrucksvollen Blick auf die strahlenden Herbstfarben der dahinter liegenden Landschaft frei. Noch immer wagt Engelbert Kaempfer nicht, seinen Kopf in die eine oder andere Richtung zu wenden. Seine Konzentration ist darauf gerichtet, sich den Weg, den sie nehmen, genau einzuprägen. Ein paar Minuten später bleibt der Offizier stehen und wartet, damit die Gruppe aufschließen kann.
Zur Linken gleiten hauchdünn gefiederte, flammend rote Blätter eines kleinen buschig wachsenden Baumes zu Boden und verwandeln den Grund in einen brennend roten Teppich. Engelbert Kaempfer hätte hier gerne verweilt, nur einen Augenblick lang, um das liebliche Geschehen auszukosten. Doch schon dreht sich der Offizier nach links und stapft in Richtung des nahen Gebäudes.
Nach europäischen Maßstäben ist das Haus des Ottona zwar nicht groß, aber von strahlender Helligkeit. Trotz der drängenden Eile des Offiziers bleibt Engelbert Kaempfer in Verwunderung stehen und schaut.
Die Wand vor ihm leuchtet weiß wie Schnee in der Mittagssonne und schimmert wohlbehütet unter dem tänzelnden Dach. Dieser Eindruck wird unterstrichen durch den für sein Empfinden ungewöhnlich scharfen Giebel, der sich bald in weichen Bögen behutsam auf den Wänden niederlässt, sodann über sie hinaus schwingt, einem Greifvogel gleich, der seine Schwingen ausbreitet, um eine ebenso elegante Aufwärtsbewegung zu vollführen. Hier allerdings ist der Tanz der Lüfte zu inniger Ruhe gekommen. Nichts stört die friedliche Eintracht zwischen der Unschuld der makellosen Wand und ihren beschützenden Flügeln darüber.
Erst jetzt wird Engelbert Kaempfer der Eingangstür gewahr, die weit geöffnet steht. Innen gestikuliert der Offizier ungeduldig.
Auch hier ist nichts dunkel. Genauso wie draußen durchflutet der lichte Tag die papierdünnen Wände, umfängt die wenigen erlesen gefertigten Möbelstücke und spielt mit ihren Schattenwürfen, als seien sie Teil eines Bühnenspektakels. Ein Regal, eine Vase, ein Zweig, eine schmale Nische in der Wand, darin eine einzelne Schale, Tatami-Matten auf dem Boden und lichtdurchlässige Schiebetüren, die sich nicht nur farblich, wie ihm scheint, sondern auch in ihren Maßen ergänzen.
Engelbert Kaempfer und sein Gehilfe werden zu ihrem Patienten geführt.
Schweißperlen strömen über das Gesicht des erschöpften Ottona. Er trägt einen bunt gemusterten Kimono. Seine Arme ruhen zu jeder Seite seines Körpers. Die Augen, halb geschlossen, sind auf die weit geöffnete Schiebetür mit Blick in den Garten gerichtet. Ein kräftiger Luftzug strömt in das Zimmer hinein. Ein schneller Blick nach draußen lässt das Herz des Doktors höher schlagen. So klein, ja geradezu zierlich er ist, so spontan erinnert ihn dies Fleckchen an die frühherbstliche Landschaft um Nagasaki.
Engelbert Kaempfer kniet nieder und fühlt den Puls des Ottona. Sein Handgelenk ist so heiß wie seine Stirn, und seine Brust hebt sich schwer mit jedem Atemzug. Inzwischen ist Imamura mit vielen der Handgriffe des Arztes vertraut und erklärt dem Patienten, dass er seinen Kimono um den Oberkörper herum nun öffnen wird, damit der Arzt seinen Atem und Husten genauer hören kann.
Der Offizier jedoch wittert Ärger. Die Hand am Schwert tritt er hitzig einen Schritt vor. Doch Imamura ist schon zur Stelle und erläutert für ihn noch einmal, was der Doktor tun wird, denn es besteht kein Zweifel, der Ottona leidet unter einer entzündeten Brust, offensichtlich begleitet von hohem Fieber.
Imamura öffnet die Taschen und assistiert Engelbert Kaempfer, während der Offizier doch wieder ein Stückchen näher rückt, denn sein Ottona ist ein mächtiger Mann. Stellvertretend für den Gouverneur von Nagasaki hat er die Entscheidungsbefugnis über alle Vorgänge auf Dejima und damit auch jeden einzelnen der niederländischen Abgesandten. Er bestimmt ihr Schicksal auf der Insel, und er ist derjenige, der die Verantwortung für die Japaner, die dort arbeiten, trägt. Deshalb besitzt auch er ein Haus auf Dejima, natürlich das Größte, was die Niederländer besonders ärgert, da die Insel ohnehin schon viel zu klein für ihre Bedürfnisse ist.
Engelbert Kaempfer erhebt sich von der Tatami-Matte, verschreibt eine Schale Hühnersuppe alle drei Stunden und zehn Tropfen seiner feinsten Brustmedizin alle zwei Stunden, zusätzlich feuchte, kalte Handtücher, die eng um die Waden des Ottona gewickelt werden. Sie müssen erneuert werden, sobald sie warm geworden sind. Dann tut Engelbert Kaempfer kund, dass er am nächsten Morgen seinen Patienten erneut aufsuchen muss. Er schließt die Schiebetür zum Garten hin zur Hälfte und erklärt, frische Luft sei wichtig, um den Raum von den Ausdünstungen des Kranken zu befreien, aber zu viel kühle Luft, vor allem Zugluft, könne sehr wohl die brennende





























