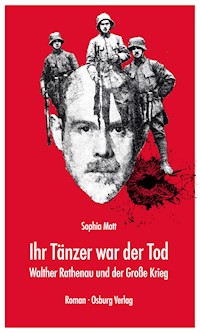19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ebersbach & simon
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Verfilmt für die ARD unter dem Titel »Martha Liebermann – Ein gestohlenes Leben« mit Thekla Carola Wied in der Hauptrolle – mehrfach ausgezeichnet! Das bewegende Leben der Martha Liebermann als Roman. Mit eindringlicher Erzählkraft entfaltet Sophia Mott Martha Liebermanns bewegende Lebensgeschichte und zeichnet in Rückblenden zugleich die Familiengeschichte der Liebermanns nach. Berlin 1941: Martha Liebermann, die Witwe des Malers Max Liebermann, kämpft, von zahlreichen einflussreichen Freunden unterstützt, um ihre Ausreise aus Nazi-Deutschland. Von ihrem Paradies am Wannsee hat sie schon lange Abschied nehmen müssen, ebenso wie von ihrer Tochter Käthe und von Enkelin Maria, die in die USA emigriert sind. Nun droht ihr die Deportation. Ein verzweifelter Wettlauf gegen die Zeit beginnt … »So lange die Werke nicht zerstört werden, bleibt die Hoffnung auf künftige andere Zeiten bestehen.« Martha Liebermann
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 372
Ähnliche
Sophia Mott
Dem Paradies so fern
Martha Liebermann
Roman
Mit einem Nachwortvon Hans Gerhard Hannesen
Für meine Söhne Moritz und Felixund für Annette
Inhalt
Herbst 1941
18. Oktober 1941
Was vom Leben bleibt, sind Bilder und Geschichten
18. Oktober 1941
Ich bin doch nur ein Maler
20. Oktober 1941
Hundert Siege berichtet, keiner erdichtet
31. Oktober 1941
Das Schifflein fährt auf den Wellen so sacht, still ist die Nacht, die Liebe nur wacht
4. November 1941
Da muss ich eben auch noch lernen, wie man solche Bilder versteht
11. November 1941
Was, heiraten wollen Sie? Das ist nichts als Zeitverschwendung
14. November 1941
Dezember 1941
Wenn man nach Berlin reinkommt gleich links
11. Dezember 1941
Allet mit diesen zehn Fingern in zwee Jahren ermalt
15. Dezember 1941–Januar 1942
4. Januar 1942
März 1942
Jedenfalls sollte jeder seinen Kohl pflanzen
Hoffentlich sehen die Arbeiter bald ein, dat se nich zwanzig Mark am Tag verdienen können, ohne zu arbeiten
Da ham doch vor allem die Weiber nach ihrem Jefühl jewählt
Seien Sie versichert, der Sturm bricht bald los
Gesamtrahmen d. Pol. Unerfüllbar
13. März 1942
2. Mai 1942
Dat ick all det dann nich mehr sehen werde
15. Mai 1942
Jetzt wird allet anders
Mai 1942
Juli 1942
Das wird lange, lange dauern
August 1942
September 1942
Schəma jisroëil adaunoi elauhëinu adaunoi echod
Berliner Luft, Luft, Luft
4. Oktober 1942
Abschied vom Paradies
November 1942
Berlin, November 1942
Kopenhagen, November 1942
Entscheidungen
Stockholm, November 1942
Berlin, November 1942
Stockholm, November 1942
Berlin, Dezember 1942
Februar 1943
5. März 1943
Epilog Vom Füllen der Leerstellen
Nachwort
Literatur
Herbst 1941
Der Schlaf, wenn er kommt, ist voller Träume, die so wirklich erscheinen, als müssten sie das Leben sein. Das aber ist ein Albtraum. Martha lauscht auf das Pochen der Standuhr im Flur, tock-tock, tock-tock, der Schlag hinkt ein bisschen, und dennoch geht die Uhr ganz richtig, viel länger schon als Marthas Herz schlägt, das jetzt auch manchmal zu hinken scheint, wenn sie sich aufrichtet, zur Seite dreht oder aufstehen will. Manchmal schmerzt es, als würde es sich verkrampfen, bis es klein und hart wird. Eine Faust in ihrem Brustkorb. Nie hat sie ihr Herz zuvor so gespürt, es hat vielleicht einmal schneller geschlagen, es hat geklopft, niemals hat es geschmerzt. Es hat seinen Dienst versehen, ohne in Erscheinung zu treten, zuverlässig, still, beinahe heimlich, wie ein kleines Tier in ihrem Inneren verborgen; jetzt lauscht sie manchmal darauf, auf dieses fremde Wesen. Sie hat sich nie Gedanken darum gemacht. Nun muss sie sich über vieles Gedanken machen.
Tock-tock, tock-tock, die Musik all ihrer Nächte, seit sie ihr das Radio weggenommen haben, eintöniger, trockener Rhythmus der Zeit, die zäh dahinfließt in der Nacht und dennoch zu schnell vergeht, weil nichts besser wird mit ihrem Fortschreiten, sondern nur schlimmer, jeden Tag ein bisschen unerträglicher. Und jeden Tag denkt sie, es ginge nun gerade noch, so werde sie es schon aushalten können. Erst jetzt weiß sie, dass sie es schon lange nicht mehr aushalten kann.
Das Licht erlischt. Vollkommene Finsternis. Ihr Zimmer ein Sarg. Wenigstens kein Fliegeralarm heute Nacht. Tock-tock, tock-tock, noch schlägt ihr Herz im hinkenden Zweivierteltakt mit der Uhr. Ihre Hände liegen auf der Decke, fremd wie ihr Herz, fadenscheinige, fleckige Haut, abgetragen.
Das Licht geht an. Es kriecht aus dem Lämpchen auf ihrem Nachttisch gerade bis zum Fußende ihres Bettes. Sie lässt es immer eingeschaltet, meist ist es sowieso ohne Strom. Wenn es aufflackert, suchen ihre Augen das Vertraute, umrunden Konturen, die langsam sichtbarer werden, wie bei dem Kinderspiel, als sie Münzen unter ein Papier legten und mit einem Bleistift darüberfuhren, bis Ziffern, Buchstaben oder die Silhouette des König sich darauf abzeichneten. Vieles wird nur noch im Kopf sichtbar, die Erinnerung ist so gegenwärtig wie die Gegenwart.
Max, da ist Max, blanker Schädel, Raubvogelnase, hochgezogene Augenbraue. Immer zwischen 60 und 70 Jahren, nie als junger Mann, eilt er durchs Zimmer, tritt über Schwellen, immer kommt er gerade herein, nie geht er hinaus. Nur wenn er malt, bleibt er auf der Stelle. Das Unruhige lebt in ihren Träumen fort – und das Banale. Er fragt nach dem Essen und ob sich Besuch angesagt habe, er bemängelt, dass ein Strauß Pfingstrosen zu alt sei, das Wasser faulig rieche, und erregt sich darüber, dass der Strauß fortgenommen wurde, der doch gerade erst seinen eigentlich Reiz entfaltet habe.
Käthe lacht. Sie ist die Einzige, die über so etwas lachen darf. Sie sitzt mit übergeschlagenen Beinen und wippt mit der Fußspitze. »Aber, Papa!« Ihr Kopf schief gelegt. Der Gesichtsausdruck mokant. Bei ihr ist alles ein Vorzug. Die kurze Bubikopffrisur endet knapp über dem Ohrläppchen. Max: »Die schönen, langen Haare!« und dann doch: »Mach nur, Kind, man muss mit der Zeit jehen.«
Automobile holpern, Fuhrwerke quietschen, Hufe rutschen über die Kopfsteine, ein Zeitungsjunge ruft Schlagzeilen aus. Er konkurriert mit dem Leierkastenmann: »Du, du sollst der Kaiser meiner Seele sein.« Die Stadt drängt durch die Fenster.
Martha öffnet die Balkontür und tritt auf die Terrasse hinaus. Im Wind klingeln Ringe und Haken an den Takelagen der Segelboote. Die Leierkastenmelodie verweht über dem Wannsee. Das Wasser liegt schwarz mit weißen Tupfen. Max kommt wieder einmal über die Schwelle, diesmal über die ihres Sommerhauses: »Lass uns een Rundjang durch den Jarten machen.« Einer ihrer Dackel wackelt hinter ihnen her. Es duftet nach Flieder. Parksand knirscht unter ihren Sohlen. Käthe hakt sich ein.
Das ist das Tableau. Max und sie, Käthe in der Mitte, Marie, die Enkelin, und der Dackel. Selten, eigentlich nie, der Schwiegersohn Riezler.
Das Licht geht aus. Die Angst kommt. Was sich in ihrem Gedächtnis die schönsten Plätze gesucht hat, ist ihr jetzt Beschwernis, liegt auf der Seele als Verlust.
Jetzt würde Martha gerne aufstehen und davonlaufen. Wenn es hell wird, mag sie nicht mehr fliehen. Da ist das Bett die Trutzburg gegen das Draußen. Ihr Leben findet fast nur noch in diesem Bett statt und drüben im Turmzimmer im Sessel, ihr Radius ist klein geworden, dreht sich allein ums Überleben, bei jeder Drehung wird er enger, formt eine Spirale, die sie tiefer zieht, am Ende wird sie sich nur noch um sich selber drehen, schneller und schneller, Schwindel ergreift sie, das zerrt an ihrem Dasein, wie ein Abfluss aus dem Leben, blubb und weg.
18. Oktober 1941
Als er vors Haus tritt, steht diese schwarze Limousine auf der gegenüberliegenden Straßenseite wie eine Drohung. Zu Beginn des dritten Kriegsjahres gibt es selbst im Tiergartenviertel kaum noch Privatfahrzeuge, und wem es gelungen ist, seinen Wagen vor der Beschlagnahme zu retten, der hat keinen Treibstoff. Vielleicht will die Gestapo ihn einschüchtern.
Edgar Baron von Uexküll läuft die Admiral-von-Schröder-Straße hinunter. Nur einmal sieht er kurz über die Schulter und stellt fest, dass die dunkle Limousine ihm im Schritttempo folgt, so wie er es erwartet hat. Er bummelt betont langsam am Landwehrkanal entlang. Gegenüber vom Shell-Haus bleibt er stehen und stützt die Ellenbogen auf das Geländer. Im Wasser verzittert die wellenförmige Fassade zum Zerrbild. Der Traum einer anderen Zeit! Heute residiert in dem Gebäude das Oberkommando der Marine. Kriegerische Nutzungen haben sich der Moderne bemächtigt.
Der Motor in seinem Rücken tuckert gleichmäßig. Uexküll biegt in die Matthäi-Straße ein. Auf dem Platz vor der Kirche wartet seine Droschke. Der Fahrer stochert mit dem Schürhaken im Holzvergaser. Er hat gerade ein paar neue Holzwürfel aufgelegt, und aus dem Fülldeckel qualmt es rußig.
»Det is eenfach zu frisch«, flucht er und wirft den Deckel zu. Dann wischt er sich die Ascheflocken von den Schultern und nimmt auf dem Fahrersitz Platz. Uexküll setzt sich in den Fond. »Det Problem mit die Badeöfen is, man kann jut heizen mit die Dinger, aber nich fahrn.«
Begleitet von Gasverpuffungen, setzt sich der Wagen ruckhaft in Bewegung. Als sie den Landwehrkanal überquert haben und in die Potsdamer Straße einbiegen, dreht sich Uexküll noch einmal um und sieht die Limousine, die ihnen in kurzem Abstand folgt. Er bittet den Fahrer, in die Kurfürstenstraße abzubiegen, dann in die Nettelbeckstraße. Sie fahren den Tauentzien hinunter bis zum Auguste-Viktoria-Platz und umrunden die Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche. Die Limousine klebt an ihnen wie Pech.
Der Taxifahrer wirft einen Blick in den Rückspiegel und sagt: »Wenn Se ne Stadtrundfahrt machen wollen, Meester, denn mach ick Sie ‘n Pauschalpreis.«
»Fahren wir zum Potsdamer Platz zurück.«
Es ist ein prachtvoller Tag, morgens hat er kühl und herbstlich feucht begonnen, dann aber hat die Sonne die Luft sommerlich erwärmt. Am Potsdamer Platz herrscht beinahe so viel Betrieb wie zu Friedenszeiten. Die Gehsteige sind gefüllt mit jungen Frauen in hübschen, leichten Kleidern, ihre Beine sind gebräunt vom Sommer am Wannsee. Im Gleichschritt, eingehakt bei der Kollegin oder der Freundin, bummeln sie an den Schaufenstern vorbei, während die wenigen jungen Männer in Uniform und vom Krieg beschwert wie Holz im Gedränge treiben. Aus den Seitenstraßen fließen stetig neue Rinnsale von Menschen zu. An Hindernissen wie Litfaßsäulen und den Masten der Bogenlampen teilt sich die Flut, beschleunigt sich in Strudeln vor den Abgängen zur U-Bahn und spült zugleich neue Pulks von Büromädchen nach oben. Militärisches dominiert auf der Fahrbahn, dazwischen überfüllte Straßenbahnen, wenige Busse. Die meisten Berliner radeln, solange es das Wetter zulässt.
»Halten Sie hier!«
Der Droschkenkutscher sagt: »Lassen Se uns noch hundert Meter weiterfahrn, Meester, inne Leipzijer. Da is die Haltestelle vonne Tram. Wenn wa die überholen, bevor die Türen uffjehn, denn muss die Limousine hinter uns stehn bleiben. Denn können Se sich verkrümeln.«
Die Droschke passiert die Torhäuser am Leipziger Platz und schiebt sich am Wertheim vorbei. An der Haltestelle stoppt die Bahn. Der Taxifahrer gibt Gas. Uexküll hört das mahnende Bimmeln des Straßenbahnfahrers. Als er sich umdreht, sieht er, dass die Tram ihren menschlichen Inhalt ausschüttet, der sich kreuz und quer über die Fahrbahnen ergießt. Die dunkle Limousine ist zurückgeblieben.
Der Droschkenfahrer biegt in die Wilhelmstraße ab, hält. Baron Uexküll schiebt ihm einen größeren Geldschein zu, springt aus dem Wagen und drückt sich in einen Hauseingang. Die Taxe rollt in dem Moment zurück auf die Fahrbahn, als die schwarze Limousine um die Ecke biegt. Sie haben nicht bemerkt, dass er ausgestiegen ist, denkt Uexküll erleichtert, während der Wagen an ihm vorüberzieht.
Er beschließt, mit der U-Bahn zur Friedrichstraße zu fahren und dort in die S-Bahn umzusteigen. Die Droschkenfahrt ist ein Vorkriegsreflex gewesen. Am besten wäre er den Weg durch den Tiergarten zu Fuß gegangen. Zwischen Kaiserhof und der Reichskanzlei viel SS und Leute vom SD. Sie schwirren wie Wespen um ihr Nest. Dahinter reihen sich in schnurgerader Flucht die neuen Zentren der Macht, immer größere und glattere Steinberge, einschüchternd, die Vorbeihuschenden auf das Maß von Mäuschen reduzierend.
Uexküll beschleunigt seine Schritte. Wenige Meter, dann ist die Treppe zur Station Kaiserhof erreicht. Er springt die Stufen hinunter. Auf dem Perron steht eine dunkle Masse von Menschen, die Einfahrt einer Bahn muss kurz bevorstehen. Um Treibstoff für das Militär zu sparen, sind viele Buslinien eingestellt, die Fahrzeuge an die Front geschafft worden. Man hat dafür den Takt der U-Bahnen erhöht und sie sind jetzt voller als jemals zu Friedenszeiten.
Ein warmer Luftzug mit dem typischen Geruch von Gummi und Metall quillt aus dem Tunnelloch. Das Quietschen der Bremsen begleitet die Einfahrt der Bahn, die Menge schiebt in Richtung der Gleise. »Von der Bahnsteigkante zurückbleiben!«, krächzt der Lautsprecher. Die Türen öffnen sich, Aussteigende drängen durch das Spalier derer, die zusteigen wollen. Uexküll schiebt mit, macht ein, zwei Reihen gut, Schulter an Schulter gepresst, fühlt er fremde Wärme, riecht Gerüche fremder Wohnungen. »He, nich drängeln, det jilt ooch für de besseren Herrschaften«, wer will schon des anderen Nächster sein, dann flutet die Menge in den Waggon und nimmt ihn mit.
Edgar Baron von Uexküll ist Spross einer weit verzweigten, in Deutschland, Schweden und Estland angesiedelten Adelsfamilie. Die estländischen Uexkülls gehörten der dortigen deutschen Minderheit an und waren, vor der Revolution und der Unabhängigkeit Estlands, russische Staatsbürger. So trat der in Reval geborene, vielsprachige junge Mann in den russischen diplomatischen Dienst ein. Mit der Revolution verlor er seinen Arbeitgeber und seine Heimat und suchte sich in Berlin eine neue. Uexküll hat erst bei einer Bank und dann bei der Allianz in der Presseabteilung Karriere gemacht. Sehr spät hat er geheiratet und noch später, als er schon glaubte, es werde nichts mehr damit, einen Sohn bekommen. Der ist jetzt drei Jahre alt. Uex, wie seine Freunde den Baron nennen, führt ein großbürgerliches Leben, er bewohnt eine Wohnung im Tiergartenviertel und gehört dem deutschen Herrenclub an. Die Beziehungen aus seiner Zeit als Diplomat pflegt er, soweit sie ihm nicht ins feindliche Lager entglitten sind. Die Zugänge zur eigentlichen Macht, die Verbindungen in die Ämter der Wilhelmstraße sind weitgehend verloren gegangen. Ein nie zuvor erlebter Wechsel der Vorzeichen hat stattgefunden. Statt Sommernachtstraum Götterdämmerung.
Zu End’ ewiges Wissen! Der Welt melden
Weise nichts mehr.
Andere haben sich anpassungsfähiger gezeigt. Uexküll erlebt gerade zum zweiten Mal, dass ihm eine Heimat fremd wird. Er ist entschlossen, diesmal um seinen Platz zu kämpfen.
Am Lehrter Bahnhof steigt er aus der S-Bahn. Von hier sind es nur wenige Schritte über die Spree, dann ist er im Alsenviertel, bis vor Kurzem gediegene Adresse vieler Botschaften in der direkten Nachbarschaft zum Reichstag. Die Planungen des Generalbauinspektors Speer für eine Nord-Süd-Achse quer durch den Tiergarten, an deren einem Ende eine monströse Halle stehen soll, die das ganze Alsenviertel unter sich begraben wird, hat dem Quartier inzwischen die Anmutung einer halb ausgeräumten Wohnung gegeben. Die gepackten Kisten stehen bereits in der Ecke, Vertrautes, lieb Gewordenes betrachtet man mit wachsender Wehmut und dem sicheren Wissen, dass man es bald hinter sich lassen muss. Die Siegessäule ist schon weg, zum großen Stern geschleppt. Zwischen Reichstag und Alsenstraße klafft eine Brache.
In der Alsenstraße wohnt aber noch immer Hanna Solf, Witwe des ehemaligen Botschafters in Samoa und Japan. Eine Frau von natürlicher Autorität. Ihr Mann hat sie gern mit den Worten vorgestellt: »Die schießt Löwen.« Das war auch wörtlich zu verstehen. Aus ihrem schöngeistigen Nachmittagstee hat sich ein Kreis entwickelt, der längst um Handfesteres kämpft. Sie kennt viele, die vom Regime bedroht sind.
Hanna Solf empfängt Uexküll mit Erleichterung. Sie habe sich Sorgen gemacht, sein Ausbleiben befürchtet. Er schildert sein Abenteuer mit der vermeintlichen Gestapo-Limousine und versucht, die Sache herunterzuspielen. »Ich weiß ja nicht einmal, ob das tatsächlich Gestapo war.«
Hanna Solf findet, man erkenne Spitzelfahrzeuge und Spitzel doch auf den ersten Blick, vor ihrer Haustür stünden sie auch immer.
»Man muss leider jedem misstrauen«, meint Gräfin Maltzan, »weil die deutsche Neigung zur Unterordnung alle menschlichen Regungen negiert«. Dann lacht sie bitter. »Ich habe solche Vorsicht aus eigener Erfahrung erlernen müssen.« Mit einem kräftigen Schnauben stößt sie den Rauch ihrer Zigarette aus. »In einer kleinen Runde, der ich glaubte, vollkommen vertrauen zu können, habe ich einmal erzählt, wie ich gleich im ersten Kriegsjahr bei der Brief-Zensurstelle zwangsverpflichtet war.« Sie habe da, zuständig für die Buchstaben K–L, auch die Post des Grafen Keyserling kontrollieren müssen. »Wie wir alle wissen, äußert sich der ja gern ohne Rücksicht auf irgendwelche Gefahren abfällig über das Regime. Um ihn zu schützen, ist mir tatsächlich nichts anderes übriggeblieben, als seine Briefe mit auf die Toilette zu nehmen und sie dort aufzuessen. Sie zu zerreißen und sie hinunterzuspülen, habe ich als zu riskant verworfen. Es hätte ja wieder etwas nach oben kommen können. Man stelle sich vor: Eine beinharte Nazianhängerin nach mir auf der Toilette oder eine von diesen furchtsamen Denunziantinnen, die glauben, die Nazis blickten wie Götter allwissend aus der Toilettenschüssel und nähmen sie hops, wenn sie es nicht anzeigte.« Die Gräfin drückt ihre Zigarette im Ascher aus und dreht sie so lange mit dem Daumen platt, bis der Rest zu einem flachen, bräunlichen Knopf reduziert ist. Erst dann lässt sie seufzend die Pointe folgen: »Schließlich habe ich Keyserling angerufen und ihn gebeten, wenigstens kein Büttenpapier mehr zu verwenden, weil das so schwer zu schlucken sei.« Sie wartet, bis die Lacher verklungen sind. »Bald nachdem ich diese Anekdote erzählt hatte, bin ich verhaftet und stundenlang verhört worden.«
So könne es einem ergehen, wenn man nicht auf eine gute Pointe verzichten wolle, seufzt Graf Bernstorff.
Die Gräfin erwidert, manches sei nur in Form einer guten Pointe noch zu ertragen.
Maria von Maltzan hat so gar nichts Damenhaftes an sich, findet Uexküll. Sie ist dicklich, nicht besonders hübsch, hat den rauen Charme eines Berliner Bierkutschers, ist dabei hochintelligent und ziemlich dominant. Nach einer gescheiterten Ehe studiert sie jetzt Tiermedizin. Die Gräfin kann sehr unterhaltsam von Tierseuchen, Sektionen und den Zuständen in Schlachthäusern erzählen. Gelegentlich versorgt sie die Mitglieder der Teegesellschaft mit Fleisch, das sonst in der ganzen Stadt nicht mehr zu haben ist. Nur wer ihre haarsträubenden Geschichten erträgt, isst es mit Vergnügen.
Ob Uexküll schon gehört habe, dass heute eine erste Umsiedlung von Juden in den Osten stattgefunden habe, fragt Bernstorff.
Natürlich hat Uexküll davon gehört. »Es sind Bekannte von mir unter den Evakuierten gewesen.«
»Von der Levetzowstraße in Moabit, wo sich das Sammellager in der Synagoge befindet, mussten die Menschen laufen bis nach Halensee und dann über die Ringbahnbrücke.« Dort hat Bernstorff den Zug selbst gesehen. »Ein Gewährsmann hat mich verständigt, dass es zum Bahnhof Grunewald geht. Aber schon in Halensee waren viele am Ende ihrer Kräfte. Die Leute hatten ja auch Gepäck dabei. Es ist wie ein Gefangenentransport gewesen. Wenn jemand ausruhen wollte, sich auf seinen Koffer setzte, kam sofort ein Polizist und hat ihn weitergetrieben. Es müssen an die 1000 Leute gewesen sein.«
Graf Bernstorff ist sichtlich mitgenommen. Seine Hand mit der Zigarette zwischen den Fingern zittert stark. Glut fällt auf seine Hose. Er bemerkt es nicht. Uexküll möchte ihn aufmerksam machen, aber er ist zu müde. Er sieht zu, wie der kleine, brennende Fetzen noch einmal kurz aufleuchtet, dann in den Stoff sinkt und plötzlich verschwindet, als würde er immer weiter fallen, sich durch die Haut fressen, den Knochen annagen, einen Schwelbrand entzünden und Bernstorff schließlich von innen zu Asche verwandeln, bis er sich vor seinen Augen mit einem Atemhauch plötzlich in staubige Flocken auflöst. Uex schüttelt sich. Die Glut hat nur einen kleinen dunklen Fleck hinterlassen.
Drei Monate ist Bernstorff im Konzentrationslager Dachau inhaftiert gewesen. Er spricht weder über die vermutlichen Gründe noch über das, was er dort erlebt hat. Aber er ist deutlich verändert zurückgekehrt, schmaler geworden, das Gesicht ist grau, voller Flecken und Furchen, als hätte man aus einem prallen Ballon die Luft herausgelassen. Man munkelt, dass seine Schwägerin, die mit Karl Wolff, dem Leiter der Adjutantur des Reichsführers der SS, ein Verhältnis unterhält, seine Verhaftung erwirkt habe. Es ging um eine Erbschaftsangelegenheit. Nach Bernstorffs Freilassung wurde sie tatsächlich zugunsten der Schwägerin geregelt.
Aber natürlich hat Bernstorff der Gestapo auch sonst reichlich Material geliefert. Er macht gerne Witze über die NS-Größen und scheut sich nicht, sie überall und ohne Rücksicht darauf, wer ihm zuhört, zu erzählen. Zehn Jahre ist er an der Botschaft in London tätig gewesen, bis die Nazis ihn 33 rausgeschmissen haben. Das Reden ist seine diplomatische Berufskrankheit. Damit gräbt er sich gerade sein eigenes Grab.
»Ich habe Dr. Lilienthal unter den zu Evakuierenden gesehen. Er ging Hand in Hand mit seiner Frau. Als er mich am Straßenrand entdeckte, ließ er ihre Hand los und zog den Hut, als würden wir uns Unter den Linden beim Sonntagsspaziergang begegnen.«
Auch Gräfin Maltzan weiß zu berichten, dass Bekannte sorgfältig die sogenannten Listen ausgefüllt hätten, die man vor der Deportation zugestellt bekomme und in denen das gesamte persönliche Eigentum dokumentiert werden müsse. »Und dann sind sie am nächsten Morgen ganz brav in die Levetzowstraße gegangen. Viele glauben immer noch, dass sie Gehorsam und Gesetzestreue vor Schlimmerem bewahrt.« Eine Vorstellung, die der Gräfin vollkommen fremd ist.
Frau von Thadden sieht das anders. »Es ist das Letzte, was sie haben, sie sind ihrer deutschen Seele treu.«
»Die wird auf diese Weise auch bald perdu sein«, braust die Gräfin auf.
Elisabeth von Thadden stammt aus einem pommerschen Adelsgeschlecht, ist Anfang 50, ein ältliches Fräulein, Lehrerin, Mitglied der bekennenden Kirche und zu jeglichem Opfer bereit, wie Jesus in Gethsemane am Vorabend der Kreuzigung, während Gräfin Maltzan sich im Ernstfall mit einer Browning, die sie in der Tasche trägt, verteidigen würde bis zur letzten Kugel.
»Frau Liebermann«, sagt Hanna Solf, »wir müssen uns um Frau Professor Liebermann kümmern!«
Bis jetzt habe sich die 84-jährige Witwe des Malers Max Liebermann beharrlich geweigert, Deutschland zu verlassen. Nun müsse sie angesichts der neuesten Entwicklung unbedingt noch einmal gedrängt werden, ihre Entscheidung zu revidieren. »Ich glaube, sie ist sich noch immer nicht bewusst, dass es hier nicht nur um Besitz, Geld oder die Bilder ihres Mannes geht, sondern vielleicht um ihr Leben.« Die alte Dame würde keinesfalls so einen Transport in irgendein Lager im Osten, das Leben unter primitiven Umständen, überstehen. Man müsse sie noch einmal mit allen denkbaren Schrecken konfrontieren, auch wenn das hart sei.
Bernstorff berichtet, dass Kurt Riezler, Martha Liebermanns Schwiegersohn, Kontakt zu ihm hielte und ihn immer wieder darum bäte, der Schwiegermutter gut zuzureden. Es sei in New York, wo Riezlers jetzt lebten, doch für alles gesorgt, ein Affidavit für die Einreise zu besorgen jederzeit möglich.
Sie müsse nur erst hier herauskommen, sagt Uexküll. Das sei wohl das größere Problem.
»Dafür ist es zu spät«, konstatiert Gräfin Maltzan gewohnt direkt. Vielleicht sei es besser, Frau Liebermann zu verstecken.
Diese Idee löst bei den anderen Kopfschütteln aus.
Das sei mit solch einer alten Frau nicht mehr zu machen, man könne sie nicht bei Gefahr im Verzug in einen Schrank stecken, vollkommen undenkbar.
Zweifellos, sagt Bernstorff, sei eine Emigration nach Amerika die beste Lösung. Doch zunächst müsse man näher Liegendes ins Auge fassen. Die Schweiz oder Schweden, beide Möglichkeiten müsse man sondieren, von da aus könne man weitersehen.
Frau Solf glaubt zu wissen, dass Bilder aus der Liebermann’schen Privatsammlung in die Schweiz gebracht worden seien. Da müsse man ansetzen. Da könne man auf einen finanziellen Grundstock hoffen, den man ohne Zweifel brauchen werde. »Und Schweden?«
Baron Uexküll ist mit dem an der schwedischen Botschaft als Attaché tätigen Rutger von Essen befreundet, hat Bekannte in Stockholm.
»Zuerst einmal muss Frau Liebermann zustimmen«, fasst Hanna Solf zusammen, »sonst hat ja alles keinen Sinn. Mögen Sie noch einmal mit ihr reden, Uex? Sie wohnen doch beinahe um die Ecke.«
Bernstorff bietet sich an mitzukommen. Als die beiden Herren die Treppe hinuntergehen, sagt er: »Kennen Sie übrigens den? Eine Bombe kracht zwischen Hitler, Mussolini und Stalin. Wer überlebt? – Europa!«
Was vom Leben bleibt,sind Bilder und Geschichten
»Was vom Leben bleibt, sind Bilder und Geschichten«, hatte Kultusminister Becker bei der Eröffnung von Max großer Ausstellung in der Akademie Goethe zitiert und Max hatte es natürlich nicht lassen können, ihn zu korrigieren: »Det kenn ick nich. Det is nich von Joethe.« Über seinen Lieblingsdichter brauchte ihm keiner was zu erzählen. Martha aber fügte für sich hinzu: ›Es bleiben auch die Kinder.‹ Wie leicht vergessen die, die große Worte machen, was eigentlich fortdauert. Aber natürlich verlassen einen die Kinder eines Tages und manchmal auch die Geschichten und vielleicht sogar die Bilder. Mit jedem Verlust verliert man gelebtes Leben. Nur was erinnert werden kann, ist gewesen. Und manches wird erinnert, was niemals gewesen ist.
Da sind die Orte des Spiels und der scheinbar endlosen kindlichen Freiheit gewesen. Sie beschränkten sich in Wahrheit auf eine Wiese, ein bisschen Gebüsch, hinter dem man sich versteckte, und einem Teich mit Enten, der Martha groß wie das Meer oder wenigstens wie der Wannsee vorkam.
Schätze verwahrte sie in der Schürzentasche, ihrem heiligen Gral, der entweiht wurde, jedes Mal, wenn er in die Wäsche kam. Wenigstens legte das Kindermädchen Murmeln, Steinchen, Blättchen, verschrumpelte Kastanien und leere Schneckenhäuschen auf Marthas Nachttisch, bevor sie das Kleidungsstück zur Wäsche gab. Dort lagen die Zeugen eines Lebens, von dem die Erwachsenen nichts verstanden, entblößt, im Licht des Tages oder der Lampe ihrer Magie beraubt, bis sie am nächsten Morgen in eine neue Schürzentasche wanderten und diese zu einem heimeligen, heimlichen Ort belebten. Um den herum rankten sich Abenteuer, so aufregend, dass sie sie noch in den Schlaf verfolgten.
Eine erste Freundin. Nie erfuhr Martha einen Nachnamen, Adresse oder aus welcher Familie das Mädchen stammte. Ihre Verbindung bestand einzig darin, dass auch Bertha regelmäßig mit ihrem Kindermädchen in den Monbijoupark kam und dass Marthas Mädchen die gleiche Vorliebe für eine bestimmte Bank hatte.
Eines Tages hockte sie neben ihr am Boden, schnippte eine fensterglasklare Murmel in Marthas Richtung und sagte: »Willst du meine Freundin sein?!« Es war beinahe keine Frage, die sie stellte, sondern eine Forderung, und Martha antwortete unsicher: »Wenn du meinst.« »Wollen wir Ball spielen?« »Wenn du meinst.« »Lass uns an den Teich gehen.« »Wenn du meinst.« »Gib mir mal den Stock.« »Wenn du meinst.« Bertha platzte der Kragen, sie streckte Martha die Zunge heraus und äffte sie nach: »Wenn du meinst, wenn du meinst, wenn du meinst!«
Das Kindermädchen setzte dem aufkeimenden Streit ein Ende, indem es Martha an der Hand fasste und wegzog. Es wurde Zeit, nach Hause zu gehen. Noch als sie bereits auf dem Monbijouplatz angelangt waren, drehte sich Martha an der Hand des Mädchens um und blickte zurück, dorthin, wo schon lange nichts anderes mehr zu sehen war als die Torhäuser, die Parkmauern und darüber das grüne Gewölk der Gartenanlage.
Am nächsten Tag war Bertha wieder da. Wieder hockte sie am Boden, zog mit einem Stock Linien in den Sand, die die Begrenzungen einer imaginären Wohnung darstellten. »Da ist der Salon. Da das Esszimmer, da ist die Küche. Ich bin die Mutter, du bist das Kind.« Martha wollte nicht das Kind sein. Kind sein bedeutete in diesem Spiel wie im wahren Leben, gehorchen zu müssen, und die strenge Erzieherin Bertha ließ zahllose Anweisungen auf Martha niederprasseln. »Jetzt will ich die Mutter sein!«, sagte sie.
»Nein, ich habe keine Lust mehr.« Bertha wischte mit einem Ast die Linien fort, der Salon verschwand im märkischen Staub. Sie zog ihre durchsichtige Murmel aus der Tasche und schnippte sie weit fort, bis vor die Füße eines Spaziergängers. »Hast du keine Murmeln?« Doch, auch Martha hatte welche. Ihr größter Schatz war eine dunkelblaue, in der hellere Einschlüsse eine Spirale bildeten. Sie zog sie hervor. Berthas Begehren war deutlich in ihren Augen zu lesen. »Gib sie mir.« »Nein.« »Nur für kurz.« »Nein.« »Ich gebe dir dafür die durchsichtige.« Ein zögernder Austausch. Bertha ließ sofort die blaue Murmel in ihrer Schürzentasche verschwinden. »Ich will aber meine Murmel wiederhaben. »Getauscht ist getauscht.« »Nur für kurz hast du gesagt.« Martha zerrte an Berthas Schürze. Bertha kreischte. Die Kindermädchen erhoben sich seufzend. Die Streitenden wurden getrennt. Martha weinte.
Aber auch zu Hause kehrte das Leid wieder, kurz vor dem Schlafengehen. »Warum weint das Kind?« Die Mutter entlockte ihr den Kummer. Das Mädchen wurde angewiesen, die Murmel zurückzufordern. Als ob damit alles erledigt gewesen wäre! Es war ihre eigene Hilflosigkeit, die Martha verstörte, einem fremden Willen ausgeliefert zu sein, und natürlich die Murmel, die war es auch. Die durchsichtige lag auf ihrem Nachtschränkchen. Ein Pfand.
Am nächsten Tag gab es eine frische Schürze und Martha packte die Murmel hinein. An der Hand des Mädchens hüpfte sie zum Monbijoupark. Bertha kam lange nicht. Martha langweilte sich. Und dann stand Bertha plötzlich doch hinter ihr und drückte ihr einen Kuss auf die Wange. »Hast du meine durchsichtige Murmel noch?« Martha wischte das Feuchte auf ihrer Backe weg und zog die Murmel heraus. Sie hatte gut auf sie achtgegeben. Bertha hielt die blaue hoch. Sie hatten beide achtgegeben. Sie konnten einander vertrauen.
Das Kindermädchen forderte den Austausch der Murmeln. Jede solle ihre eigene wieder nehmen. Das war gar nicht mehr wichtig. Aber der Anweisung musste Folge geleistet werden. Es war klar, dass die Welt der Erwachsenen sich jetzt in ihre Freundschaft mischte, das Gleichgewicht zerstörte. Martha hatte gepetzt.
Später saßen sie am Rand des Ententeiches. Bertha hob plötzlich den Arm und schleuderte ihre Murmel so weit sie konnte in den kleinen See. Martha zögerte. Dann holte auch sie aus. Ihre blaue Murmel versank mit einem weichen, schmatzenden Laut.
Die Freundschaft mit Bertha endete so beiläufig wie sie begonnen hatte. Martha erinnerte sich später nicht daran, irgendein Leid empfunden zu haben. Ihre Familie zog in die Französische Straße, wer auf sich hielt, rückte in Richtung Tiergarten vor, der Zug nach dem Westen hatte sie erfasst, immer weiter weg von den Wurzeln, die nicht allein im Osten Berlins, sondern noch weiter in Hinterpommern in einem kleinen Kaff namens Märkisch Friedland lagen.
Das Mädchen ging jetzt mit ihr und den Geschwistern sehr viel lieber zum Tiergarten. Über die Hauptwege rollten Equipagen, es konnte sein, man sah den Regentenkönig mit seinem Gefolge bei einer Ausfahrt, Reiter trabten auf ihren Pferden vorbei, führten die schönen Gäule vor, warfen sich in die Brust und blickten von oben herab auf das Volk. Es war viel Militär unterwegs, auch in kleinen Gruppen zu Fuß, mit umgeschnallten Säbeln, die an die glänzenden Stiefel schlugen, und alle blickten sich um, ob sie gesehen wurden oder ob sie jemanden sahen, die jungen Offiziere ein hübsches Mädchen, ein Kindermädchen wie Marthas, dem man heute ein paar Blicke und morgen ein paar Worte zuwarf, übermorgen ging man zum Tanz ins »Alte Türmchen« am Kreuzberg und am folgenden Wochenende fuhr man mit ihr vielleicht irgendwo ins Umland in eine Pension.
Martha und ihre Geschwister wurden sich selbst überlassen. Die Kinder spielten auf den Nebenwegen, die schnurgerade und unheimlich verschattet durch den lichten Wald führten. Dass man so weit blicken konnte und doch nicht sah, was dort am Ende, wo ein wenig Licht einen winzigen Punkt setzte, war, machte das Geheimnis. Es war eine Mutprobe, hineinzulaufen, so weit, wie man sich traute, dorthin, wo es angeblich wilde Tiere gab, die unversehens aus dem Gebüsch hervorspringen konnten, Wildschweine, Hirsche, Füchse.
»Da dieser Schatten, ist da nicht was? Wer traut sich mit mir zu kommen? Es bewegt sich. Ich habe ein tiefes Brummen gehört.« – Jetzt raschelte es im Gebüsch und alle liefen sie schreiend zurück zur Promenade, nur um bald wieder aufzubrechen zu einer nächsten Expedition.
An den Wegen entlang verliefen schmale, verschlammte Rinnsale. Ihr Gefälle war gering, nie wurden sie ausgegraben und gereinigt, Abwässer vom Schifffahrtskanal wurden hineingedrückt, so fing die Brühe an zu stinken. Im Dämmerlicht der Baumschatten sah man aus den Gräben Faulgase in bunten Blasen aufsteigen, die zerplatzten wie ein kleines Feuerwerk.
»Das sind Elfenrülpser«, sagte Marthas Bruder Benno und schickte gleich selbst einen hinterher. Die Kinder sprangen über die übel riechenden Rinnen, Benno sprang zu kurz, rutschte auf der anderen Seite des Grabens ab und fiel in den Dreck. Er stank so fürchterlich, dass er auf dem hastig angetretenen Heimweg ein paar Schritte hinter ihnen laufen musste. Als sie in die Französische Straße einbogen, hefteten sich ein paar Nachbarskinder an ihre Fersen und schrien: »Kieckt ma da, der dreckije Judenbengel!«
Das Kindermädchen wurde vom »Fräulein« abgelöst. Ihm wurde nicht mehr die ganz unkritische und heiße Liebe zuteil, die noch dem Mädchen gegolten hatte. Fräuleins waren Lehrerinnen, Respektspersonen, man sollte ihnen gehorchen, aber sie waren in der Erwachsenenwelt selbst wenig geachtet. Das Empfinden, das man solch einer Existenz entgegenbrachte, hatte einen Beigeschmack von Herablassung, auch wenn das Fräulein an allen familiären Ereignissen teilnahm, als gehörte es tatsächlich dazu. Erinnerungen an diese Frauen waren ins Anekdotenhafte verzerrt, wie jene an das Fräulein Brasig, ein große, grobknochige Person mit tiefer Stimme und einem dunklen Flaum auf der Oberlippe. Marthas Mutter nannte sie heimlich »Herr Brasig«, und der Vater sagte manchmal scherzhaft, wenn sie vom Essen aufstanden: »Brasig, kommen Sie, lassen Sie uns im Herrenzimmer eine gute Zigarre rauchen.« Die Brasig ließ sich alles mit einem sauren Lächeln gefallen. Einmal sprang sie in die Bresche, als Marthas Schwester Else nicht imstande gewesen war, den Belsazar am Mittagstisch lückenlos und fließend aufzusagen, wie es der Vater gewünscht hatte. Beim Vortrag der Ballade fand die Brasig zu plötzlicher Größe und offenbarte schauspielerisches Talent, welches man ihr nie und nimmer zugetraut hätte, indem sie mit unvergesslicher Geste, einem entschlossenen Schnitt der Handkante unter ihrer blassen, bereits leicht faltigen Kehle, das letzte Verspaar vortrug: »Belsazar ward aber in selbiger Nacht von seinen Knechten umgebracht.« Noch Jahre später zitierten die Familienmitglieder unter großem Gelächter jene Worte, begleitet von wildem Augenrollen und der Bewegung der flachen Hand an der Kehle.
Vollkommen überrascht war Martha, dass gerade dieses Fräulein sie eines Tages verließ, um zu heiraten. Sie bekam zum Abschied von Marthas Vater eine Art Aussteuer und eine kleine Mitgift. Dass einer die Brasig liebte, unbegreiflich.
18. Oktober 1941
Uexküll und Bernstorff treten hinaus auf die Alsenstraße. In einem Hauseingang gegenüber weicht eine schemenhafte Gestalt zurück. Bernstorff packt Uexküll am Arm. »Uexküll, ich muss mit Ihnen reden. Ich liebe Ihre Frau!«, sagt er sehr laut.
Uexküll weiß nicht recht, was er antworten soll. »Was denken Sie denn, was ich jetzt tun werde«, fragt er schließlich. »Soll ich Sie zum Duell fordern?«
»Wir müssen reden. Gehen wir ein paar Schritte.«
Bernstorff schiebt Uex in Richtung Tiergarten. An der Straßenecke sieht er sich noch einmal um und kichert.
»Sehen Sie, es hat funktioniert. Unser Aufpasser fand den Streit zweier Herren um eine Dame nicht wert, die Verfolgung aufzunehmen.«
Es ist schon beinahe dunkel, als Uexküll und Bernstorff durch die Siegesallee gehen. Am Tag gleißend in weißem Marmor, stehen die Hohenzollern und ihre Vorfahren jetzt finster in ihren Heckennischen. Der Erste in der Reihe preußischer Herrscher, die die Prachtstraße säumen, ist Albrecht der Bär, er streckt ihnen das Kreuz entgegen, seine linke Hand am Schwert, die Augen zusammengekniffen.
Bernstorff hält inne und sagt: »Was meinen Sie, Uex, ist das Kreuz Schuld an der menschlichen Katastrophe? Kriecht aus der alten Feindschaft zwischen denen, die den Messias gemordet haben, und denen, die die Nachfahren seiner Anhänger sind, tatsächlich die neue Schuld?«
Es sei Albrecht dem Bären in diesem besonderen Falle kein Vorwurf zu machen, antwortet Uex trocken. Im Übrigen seien die Kriege Albrechts in erster Linie expansionistisch gewesen und weniger idealistisch. Was die aktuelle Lage betreffe, sehe er wieder einmal nicht den Gegensatz zwischen Christen und Juden, sondern den zwischen den Zeitgenossen mit einem Glauben und denen, die einem Kult anhängen, der kein Gewissen kenne.
Sie nehmen ihren Weg schweigend wieder auf. In den Gebüschen hinter den Denkmälern raschelt es, vielleicht Vögel, die sie aufgeschreckt haben, oder Ratten.
»In der Nacht«, sagt Uexküll, »ist hinter den Altvorderen das ideale Versteck für Strauchdiebe.«
Bernstorff lacht und klopft mit seinem Stock in einem raschen Staccato vor sich auf den Kies.
»Bis jetzt ist Frau Liebermann in ihrer Wohnung wohl ziemlich unbehelligt geblieben?«, fragt er.
»Beinahe ein Wunder«, bestätigt Uexküll. Natürlich habe sie, wie alle wohlhabenden Juden, unglaubliche Sühneleistungen zahlen müssen, Konten seien gesperrt, das Haus in Wannsee schon lange zwangsverkauft worden, aber von tätlichen Angriffen, Anpöbeleien, ebenso wie einem Umzug in eine Judenwohnung sei sie bisher verschont geblieben. Zwei Haushälterinnen kümmerten sich nach wie vor rührend um sie. Sie leide keine Not.
Bernstorff sagt, man müsse Frau Liebermann klarmachen, dass sie, auch wenn sie sich ganz in ihrer Wohnung vergrabe, nicht sicher sei vor den Nachstellungen der Nazis. Schonung sei jetzt nicht mehr opportun. »Sie muss wissen, was ihr droht. Dabei sollten wir nicht übertreiben, aber auch nichts auslassen.«
Er glaube nicht, sagt Uex, dass Frau Liebermann so unwissend sei. »Sie ist eine intelligente Frau, geistig noch vollkommen auf der Höhe, unsentimental und stark.« Wenn sie sich bisher geweigert habe, zu emigrieren, hänge das eher mit ihrem Verständnis von Pflichtgefühl und einer Form von Bescheidenheit zusammen. Um sich selbst habe sie nie große Geschichten gemacht. »Alles drehte sich immer nur um ihren Mann.«
Bestimmt aber, meint Bernstorff, überschätze sie ihre Stärke. Alle überschätzten ihre Stärke. Angesichts der nackten Gewalt werde man klein und jämmerlich. Er drückt die Faust, die er um den Knauf des Spazierstocks geschlossen hat, an die Brust, zieht tief Luft ein und fügt nach ein paar Schritten hinzu: »Jeder wird klein und jämmerlich.«
Sie überqueren die Charlottenburger Chaussee. Die grünen Tarnnetze, die über die Chaussee ebenso wie über die Linden gespannt sind, um den feindlichen Bombern die Orientierung zu erschweren, knattern leise im Abendwind. Durch die Löcher des Netzes blitzt ein letztes magentafarbenes Abendrot.
»Tochter und Enkelin sind der Schlüssel. Wir müssen Frau Liebermann klarmachen, wie sehr beide die Sorge um ihre Mutter und Großmutter belastet, und dass ein Wiedersehen nur durch die Ausreise möglich ist. Hoffnungen auf ein baldiges Kriegsende könnten sie in Versuchung führen, abzuwarten. Doch danach sieht es im Moment nicht aus. Wenn Hitler den Russlandfeldzug gewinnt, ist das Regime auf Jahre, vielleicht Jahrzehnte stabilisiert.«
»Die Siegesmeldungen sind meiner Meinung nach alle nur Propaganda«, sagt Uexküll. »Die Schlacht ums russische Reich ist noch lange nicht gewonnen.« Er kenne das Land zu gut. Sein Reservoir an Menschen sei unerschöpflich, an Leidensfähigkeit auch. »Wenn der Winter kommt, wird sich das Blatt wenden, glauben Sie mir«.
»Wir sind nicht mehr in Napoleons Zeiten.«
»Nein, aber Russland ist nicht kleiner geworden, die Winter nicht weniger streng, die Straßen nicht viel besser. Der Nachschub wird das Problem werden.«
Er wolle auf eine Wende hoffen, auch wenn natürlich niemand Lust auf den russischen Bolschewismus habe, meint Bernstorff. Vielleicht sei die Angst davor noch der einzige Antrieb für den Rest an Kriegslust im Volk.
»Die einen hoffen auf Sieg und Schluss, die anderen auf Niederlage und Schluss«, seufzt Uexküll. »Kriegsbegeisterung hat nicht die gleiche Konjunktur wie 14–18. So weit reicht das Erinnerungsvermögen der Deutschen noch.« Gerüchte hätten sich dagegen zur geltenden Währung entwickelt. Jeder kenne ein neues: Separatfrieden mit England, Militärputsch von rechts. Überhaupt das Militär! Die Unzufriedenen hofften, die Offiziere würden es schon machen. Hitler sei überhaupt ahnungslos. Alle Schuld seinen Schergen. Wenn der Führer nur wüsste, was los sei! Der gute Mensch vom Obersalzberg.
Das Abendrot, plötzlich ausgeknipst, lässt ein fahles Rauchgrau zurück und ein wenig Helligkeit hinter dem Horizont. Gleich wird es stockfinster sein. Wegen der Verdunkelungsvorschrift ist die Straßenbeleuchtung ausgeschaltet. Bernstorff klemmt sich den Stock unter die Achsel und zieht eine Taschenlampe hervor.
»Geben Sie acht, nicht dass einer denkt, sie seien bewaffnet«, warnt Uexküll.
»Die Pistole habe ich in der anderen Tasche. Ich möchte mir in diesem Staat nicht noch ein Bein brechen, wenn schon der Hals in ständiger Gefahr ist.«
Der Taschenlampenstrahl zittert ihren Füßen voraus.
»Jedenfalls werden Devisen für Martha Liebermanns Flucht unerlässlich sein«, nimmt Uexküll den Faden wieder auf. »Alles, was sich in ihrer Wohnung befindet, ist längst registriert und kann nicht zu Geld gemacht werden.«
»Wir müssen jede Verbindung nutzen, vor allem Bürgen in der Schweiz oder Schweden finden. Und wie ist das nun mit der Kunstsammlung in der Schweiz?« fragt Bernstorff.
So viel er wisse, meint Uexküll, habe das Dr. Walter Feilchenfeldt organisiert. Er sei einer der Geschäftsführer der Galerie Cassirer gewesen, über die in erster Linie die Bilder Liebermanns verkauft worden seien. Seine Geschäftspartnerin Grethe Ring sei eine Nichte Martha Liebermanns. »Formidable Frau! Sie erinnern sich an den Fall Wacker, die Van-Gogh-Ausstellung 1928?! Angeblich alles Bilder aus russischem Privatbesitz und alle falsch. Es gab Expertisen von de la Faille und Meier-Graefe.« Aber Feilchenfeldt und Ring hätten sich nicht täuschen lassen. Vor allem Rings Auftreten vor Gericht sei ganz große Bühne gewesen. »33 mussten Ring und Feilchenfeldt liquidieren, jedenfalls sahen sie keine andere Möglichkeit, um einer Arisierung zuvorzukommen.«
»Und Ihre Verbindungen nach Schweden, Uex?«
»Max Liebermann war mit Anders Zorn, dem schwedischen Maler, befreundet. Seine Witwe lebt in Mittelschweden in Mora und kümmert sich um den Nachlass. Der müsste man schreiben und sie auf Martha Liebermanns Schicksal aufmerksam machen.«
Bernstorff hebt die Taschenlampe und strahlt das Standbild Otto des Faulen an. Der letzte Wittelsbacher auf preußischem Thron steht mit schlaff eingeknickter Hüfte, seine Mundwinkel hängen missmutig herab. »Otto der Faule ist mir immer der Liebste gewesen«, sagt Bernstorff, »weil Mensch. Die anderen sind doch alle nur Stein gewordene Ansprüche an ein Preußentum, das mir angesichts der heutigen Lage allerdings als kultiviert erscheint. Der Nationalsozialismus ist dagegen der Triumph des mittelmäßigen Mannes. Die Gefahr ist, dass er jede Form von Qualität hasst und alles auf sein hoffnungsloses Maß reduzieren möchte. – Und übrigens«, fährt er nach einer kurzen Pause fort, »ich liebe ihre Frau wirklich.«
Uex lächelt: »Ich weiß. Alle lieben meine Frau.«
Martha hat ihren Daumen als Lesezeichen zwischen die Seiten ihres Buches geklemmt und mit einem Seufzer innegehalten. Es ist ein Wunder, dass sie mit dieser Brille, die ein Optiker lange vor dem Krieg angefertigt hat, überhaupt noch etwas erkennen kann. Sie blinzelt in die Sonne, die tief stehend über den First des Nachbarhauses scheint. Heute ist es schwer, eine neue Brille zu bekommen. Alles ist heute schwer zu bekommen, nicht nur für Juden, aber für die besonders.
Das Reichswirtschaftsministerium bestimmt, dassJuden keine Kleiderkarten und keine Bezugsscheinefür Textilien, Schuhe und Sohlenmaterial erhalten.Ihre Versorgung soll ausschließlich durch dieReichsvereinigung garantiert werden.
An manchen Tagen und wenn das Licht nicht gut ist, bemerkt sie nach einer Weile, dass sie nur noch aufs Papier starrt und aus den schwarzen Strichen, Bögen, Häkchen und Kreisen Sätze entziffert, die sie mehr träumt, als sie wirklich zu lesen. Es ist, als sei sie in ihre Kindheit zurückgekehrt, als sie voller Stolz aus den wenigen ihr bekannten Buchstaben Worte und Sätze erfand, die zu den Bildern auf den gegenüberliegenden Seiten passten. Ihr Vergnügen ist unverändert geblieben, die Seiten umzuwenden, das Papier zwischen den Fingerspitzen auf und ab gleiten zu lassen, Dünndruckpapier etwa, das beim Wenden flattert und ein wisperndes Geräusch erzeugt, während das dickere Bütten pelzig und steif sich sträubt und nur zu einem stumpfen Fauchen fähig ist.
Die Nachwelt werde sie dereinst für eine reizlose und hinfällige Person halten, hat Martha manchmal scherzhaft geklagt, weil Max sie auf seinen Bildern meist ruhend und lesen darstellte. Lesend hat sie versucht, das Leben zu begreifen, ohne die Abenteuer der Realität zu vermissen, bequem im Sessel, auf der Chaiselongue, im Liegestuhl oder auf einer Gartenbank sitzend, den Gedanken anderer folgend, wie durch ein Labyrinth mit exotischen und unbekannten Pflanzen, wilden Tieren und Abenteuern, die zu bestehen in ihrem Anspruch nicht geringer gewesen sind als das wahre Leben. Auch in der Graf-Spee-Straße haben sich ihre Gewohnheiten nicht verändert. Ihr Lesesessel hat hier seinen Platz im Türmchen gefunden, das, aus der Front des Hauses leicht vorspringend, die nördliche Ecke des Bauwerks markiert.
Im Herbst nach Max Tod ist sie in die Graf-Spee-Straße 23, Hochparterre, gezogen, eine großbürgerliche Flucht von vielen Zimmern mit allem Komfort. Es gab eine zentrale Gasheizung, einen Gaskühlschrank und einen Gasherd, natürlich Telefonanschluss. Heute wärmt die Gasheizung kaum noch. Der Hauswart hat Öfen aufgestellt. Und der Kühlschrank hat nichts mehr zu kühlen, auf dem Herd kochen Kartoffeln und Rüben. Von den Hausangestellten sind nur noch Marie Hagen und Alwine Walter übrig geblieben. Die anderen haben sich weniger aus Überzeugung, denn aus Furcht verabschiedet.
Aber am Anfang unterschied sich ihr Leben in der Graf-Spee-Straße noch wenig vom bisher gelebten. Besucher kamen, eine Ausstellung im Jüdischen Museum wurde anlässlich des ersten Todestags von Max zusammengestellt. Sie war ein großer Erfolg. 6.000 Liebermann-Freunde fanden sich ein, unter ihnen auch die treue Käthe Kollwitz. So hatte Martha sich das Witwendasein vorgestellt. Ausstellungen eröffnen, das eine oder andere verkaufen, das eine oder andere verleihen, Ruhm erhalten, mehren, es hätte ihre große Zeit werden sollen, Witwenherrschaft.
Martha setzt die Lesebrille ab. Draußen knattert ein dreirädriger Tempowagen vorbei, beladen mit Baumaterial für die japanische Botschaft am oberen Ende der Straße, die noch immer nicht ganz fertiggestellt ist. Schippen und Spitzhacken klappern auf der Pritsche.
Tempo, Tempo, sagt die Welt, Tempo, Tempo,Zeit ist Geld. Hast du keinen Tempowagen, wirddie Konkurrenz dich schlagen.
Hinter dem lärmenden Gefährt fallen Blätter vom Baum und schweben beiläufig zu Boden, machen noch ein paar Zuckungen im aufgewirbelten Staub. Das Rumpeln und Knattern entfernt sich, wird leiser, bricht ab. Martha sieht auf die leere Straße hinaus. Die Sonne ist hinter dem gegenüberliegenden Haus verschwunden. Wie lange wird es dauern, bis draußen die nächste Bewegung stattfindet, bis ein Auto kommt, ein Mensch vorübergeht, das nächste Blatt fällt? Ihre Wahrnehmung der Außenwelt beschränkt sich seit Wochen auf diesen Ausschnitt, das Stück Straße, das Nachbarhaus, den Baum vor dem Fenster, das Pflaster und ein kleines Stück Himmel, wenn sie nahe an die Scheibe heranrückt und den Kopf nach oben dreht.
Die Verordnung über den Stern, den sie am Mantel tragen soll, ist vor etwa vier Wochen herausgekommen. »›Für L–Z‹«, las Marie Hagen aus dem Jüdischen Nachrichtenblatt vor, »›erfolgt die Ausjabe am Donnerstag, dem 18. September durchjehend von 8 bis 20 Uhr in den nachstehend anjejebenen Verteilungsstellen: für die Bewohner der Verwaltungsbezirke Charlottenburg und Tierjarten in der Synajoge Levetzowstraße oder in der Schule Joachimstaler Straße. Die Ausjabe erfolgt nur jejen Vorlegung des lila Bezugsausweises der Reichshauptstadt Berlin. Wer für andere mitbesorgt, muss deren lila Ausweis mitbringen und ihre jenaue Kennkartennummer mit Kennort. Die Ausjabe des Kennzeichens erfolgt jejen Zahlung von 0,10 RM. Jeder kann zunächst nur einen Stern erhalten.‹«
»Levetzowstraße, det ist zu weit, ick jeh inne Joachimstaler«, hat Marie gesagt.
»Ich brauche den Stern nicht.«
»Ick hol den. Wenn Se mal zum Arzt müssen.«
»Dr. Wolff kommt doch hierher.«
»Oder wenn Se mal een Besuch machen wollen.«