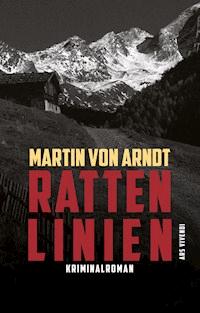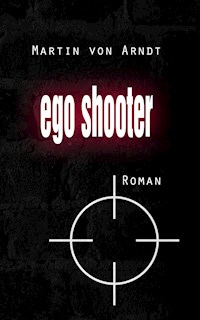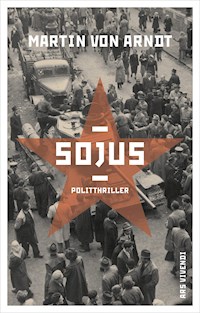2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: edition enso
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Achtundzwanzig frühe Erzählungen, Kurzgeschichten und Kurzprosa-Miniaturen von Martin von Arndt aus den Jahren 1990 bis 2000. Alptraumhafte Erzählungen in lyrischer Sprache mit feinem Sprachgefühl, die nicht selten an den französischen oder russischen Symbolismus des frühen 20. Jahrhunderts erinnern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Martin von Arndt
Der 40. Tag vor Sophienlund
Erzählungen
Erweiterte eBook-Ausgabe der 1997 / 2008 erschienenen Print-Originalausgabe
edition enso . Siemensstr. 1 . D-71706 Markgroeningen . [email protected] . https://enso.poetik.de
©2023 Alle Rechte vorbehalten
ISBN 9783757922597
Coverbild: Brigitta Sui-Dschen Mattke unter Verwendung einer kunsthandwerklichen Arbeit von Anne Pawletta für die Originalausgabe von »Der 40. Tag vor Sophienlund«
Fonts: Delicious: A font by Jos Buivenga (exljbris, www.exljbris.com); TheMix: A font by Luc de Groot
Wenn du einen Schlafenden bestiehlst,
gib acht, daß du ihn nicht weckst. Der
Mensch gibt nichts aufs Bestohlensein,
allein: er wacht nicht gerne auf.
(Dem Ahriman abgelauscht)
Kleine, sentimentale Geschichte
Variationen über ein Thema von Sergej Prokofieff, opus 16, andantino – Die Erste
Da steht einer. Steht auf der Straße.
Steht.
Uneinsichtig. Es ist ein Uneinsichtiger. Wie wir alle, die wir die nötige Einsicht besitzen, ja, und eine wesentliche Änderung in unserer Gemütslage uns doch nicht glückt.
Er steht nun auf der Straße und blickt in dies Fenster, strahlend vor üppigem Licht und eitler Wärme. Denn draußen knackt das Eis auf den Plätzen und die Nacht lädt nicht zum Stillstehn.
Blickt in dies entfernte Fenster und macht Schluß mit der Einbildung, es sei keine Heimat. Wer hier wacht, hat Leben.
Da steht er nun recht lange. So lange, bis ihm die Zehen zuschweigen: Wir sind Fleisch nicht mehr von deinem Fleische und er beinahe grimassieren muß bei dem Gedanken. Aber endlich – da beschließt er, hinzugehen, auf das Licht zuzutreten und selbst zu sehen, zu befühlen, zu erwittern, was das sei: Wärme, ein Ofen, ein Zuhause.
Geht dorthin und beginnt die Suche, sucht, nicht langsam, sucht und findet, er pocht an eine Türe.
Pochen. Jemand hat an die Türe gepocht.
Drinnen horcht einer unsicher auf. Er hat gelesen. Nun hat es an der Türe gepocht. Er zieht groteske Schnörkel mit seinen Brauen, ist unschlüssig, soll er das Buch beiseite legen oder wird er unvermittelt zurückkehren, er hört wieder das Pochen und hastet der Türe entgegen. Öffnet.
Nun, einer mit Brille, steht und bringt Kälte herein.
Rein?
Es ist spät, ja, außerdem habe er gelesen. Und. Schließlich. Schließlich.
Schließlich ist es, vielleicht ist es ein Tag für eine Begegnung, und so läßt er ihn ein.
Der sieht um sich. Sucht wieder, aber nicht allzu rasch, und blickt nicht habgierig. Auch ist er nicht furchtsam; der andere schon. Furchtsam, ein wenig gereizt, ihn verlangt nach dem offenen Buche.
Aber der da, der sieht nur um sich.
Und lächelt unvermittelt: ja, so ist’s recht, das ist es: Wärme, ein Ofen, ein Zuhause.
Und beeilt sich mit der Erklärung: nicht, daß er stören wolle. Er habe auch kein Anliegen, das sei es nicht. Nur eintreten habe er gewollt, fühlen, sehen, wittern, ein Zuhause. Nicht als ob es das seine wäre, bitte, er möge nicht glauben, er ergötze sich in unschicklicher Weise an der Vorstellung, die Bücher (und besonders nicht das auf Seite 518 weltoffen leuchtende, auf das der andere nunmehr seinen wehmütigen, halb aller Hoffnung entseelten Blick richtet), der Branntwein, die ungeordneten Papiere, die Messer und Gabeln, die nicht glänzen, oder die wenigen Kleider im Schrank, dessen Türen sich seit Jahren nicht mehr bewegen lassen, seien die seinen; vielmehr wolle er das fremde Heim kosten, einen Moment im Fremden selbst heimisch sein, kurz: er suche – den »alten Hort«.
Der andere klappt das Buch unwirsch zu. Nun aber. Nun ist es genug. Doch man wehrt ihn ab: nein, nein, er wolle, er könne ja nicht bleiben. Nur für diese Minuten. Und dann sei es auch schon genug.
Mit vier Fingern trommelt der Heimgesuchte auf das Buch. Beider Blicke kreuzen sich, erst auf den Fingerkuppen, dann auf dem Einband. Der Fremde nickt. Er kenne sie wohl, die Erzählung, einen Pjotr Werchowenskij stoße man schließlich nicht aus seinem Hirn.
Ja, das, das mag wohl richtig sein, obschon er ja noch nicht. Aber er möge sich doch wenigstens setzen. Und: Kaffee sei keiner im Hause, aber vielleicht Tee – ein Gläschen vielleicht – ein Glas, ja.
Dann setzt er den Tee auf und fühlt sich nicht mehr gar so heimgesucht, denn Besuch, damit könne ja niemand mehr rechnen zu so später Stunde und bei dieser – nachgerade sibirischen Kälte.
Jaja, spricht der Eindringling, dessen Zehen nunmehr schmerzen, wenn er sich vorsichtig in einen Stuhl niederläßt, so als hätte er bereits eingewilligt in die seichten Anspielungen des laut in einer Nische Hantierenden.
Einen Tee vielleicht, vielleicht ein Glas Branntwein dazu, dazu die Nacht, die Kälte, die Heimat, die Wärme, der Ofen und das Licht. Da ist man dann eingekehrt, so muß man es wohl nennen, und man hat den Mantel nicht abgelegt und beabsichtigt es auch nicht zu tun, und man sitzt da und streift all den liebevoll aufgetürmten Plunder, den man selbst nicht zusammengeklaubt hat auf den Basaren dieser Erde, und ahnt und weiß es nicht, woher diese Photographie stammt und welcher Liebe man sie nun verdankt, und doch ist all dies – gut.
Und wo getrunken wird, wird auch geschwatzt, gewitzelt, vielleicht rasch geweint. Und wenn die Einbildung: es sei keine Heimat, dann ferne, ganz ganz ferne ist, steht er unversehens auf, der Uneinsichtige, und schließt die Tür mit einem Ruck.
Der andere aber bleibt zurück mit Branntwein, Tee und leerem Blicke. Und er mag das Buch nicht mehr anrühren, mag auch nicht mehr sitzen, er bleibt zurück mit einem ungewissen Verlangen, allein. Und plötzlich – sind die Bücher und der Branntwein, die ungeordneten Papiere, die Messer und Gabeln, die nicht glänzen, oder die wenigen Kleider im Schrank – sind ihm kein Zuhause mehr.
Dann steht da einer. Steht am Fenster.
Steht. Und blickt hinaus auf die entfernte Straße, in die Kälte, in die Nacht.
Stabat Mater
Alles begann mit dem Erscheinen jenes Fremden, der sich Ghil nannte. Frühmorgens und an einem Tag in der Julimitte stand er vor meiner Tür, Nachricht mir zu mitteln von meiner Schwester. »Sie ist krank, hoch oben im Norden. Jeder Tag kann der letzte sein. Wir müssen uns beeilen.«
Ich konnte mich nicht daran erinnern, eine Schwester zu haben. Nein, ich hatte keine. Aber das änderte nichts. Gar nichts. Schließlich vermochte ich mich auch nicht mehr zu entsinnen, daß und seit wann ich in Helsinki lebte.
Und endlich: ich hatte nichts zu verlieren, und der Fremde war klein und hager. Er lächelte mit grünlichen Zähnen. Ein auffallend arabischer Typus.
Noch gegen Mittag war ich reisebereit. Wir nahmen den Zug.
Fuhren in die Nacht. Schlaf überfiel mich rasch. Für Studien hatte ich im ›Vathek‹ gelesen, doch benahm mir ein beginnendes Fieber die Aufmerksamkeit und geleitete mich in einen schmerzensreichen, nebligen Zustand. Meine nackten Füße hob ich da aus einem Sumpf und strich über deren Spann: sie waren mit einer tiefen, klaffenden Fleischwunde versehen, die von ungefähr mit einer Hautschicht überwachsen schien. ›Merkwürdig‹, dachte ich bei mir, ›daß es noch nicht verheilt ist‹, und: ›So lange schon‹.
Ich erwachte vom Kreischen der Zugbremsen in tiefster Nacht. Mich fröstelte. Keine Landschaft zu erkennen draußen. Drinnen gloste eine erstickende Kälte, anders weiß ich es nicht zu beschreiben. Ghil musterte mich lange schon. Die ganze Zeit über mußte er so dagesessen und mich angesehen haben unter halbgeschlossenen Lidern.
Da gewahrte ich, daß er – größer geworden war, größer und merklich breitschultriger. Auch hatte das Haar längst nicht mehr die schwarzblaue Tönung und die Gesichtsfarbe hatte sich aufgehellt.
Doch nicht im mindesten vermochte diese Entdeckung mich zu schrecken, denn ich wußte ja: Ghil schlief. Schlief offenen Auges. Atmete dabei oberflächlich und röchelnd wie ein Lungenkranker.
Dann durchzitterte das Abteil die erste Regung der Weiterfahrt. Ich griff nach meinem Buch, das mir entglitten war und vermochte es nicht mehr zu finden. Stattdessen lag neben Ghil eine Auswahl Lieder des ›Kalevala‹.
Ich konnte mich nicht besinnen und fiel wieder in diesen jämmerlichen, halbdunklen Zustand.
Yön vallat aamun valkeus jo voittaa, sun päiväs koittaa, oi synnyinmaa.
Männerstimmen hörte ich diesen Hymnus singen, der mir auf ewig fremd bleiben würde.
Und dann stand mir jäh die Erinnerung zur Seite: daß man sich erzählt, hoch oben im Norden erscheine einmal alle hundert Jahre die Muttergottes in einem Dorfe, um all jenen Gehör zu schenken, die in diesem, ihr feindlichen Lande den Lutheranern abgeschworen und sich der rechtgläubigen Kirche angeschlossen hatten.
Sollte ich eine Pilgerfahrt begonnen haben? Was hatte all dies dann zu tun mit mir? Wo war ich in jenem Momente? Auf dem Weg wohin war ich?
Und, wichtiger noch: wer – wer war nun ›ich‹?
Oi nouse, Suomi nosta, korkealle...
Der Zug hatte einen spürbaren Ruck getan. Ich fuhr auf. Zu meinem Erstaunen stellte ich fest:
daß ich vier Stunden in diesem Dämmer verbracht;
daß es noch immer tiefe Nacht war;
daß Ghil in derselben Stellung wie zuvor mir gegenübersaß und schlief;
schließlich, daß die Kälte zugenommen hatte und in Form winziger Schwaden von Atemstoß zu Atemstoß vor meinen Augen tänzelte.
Meine eigene Körpertemperatur hatte gleichermaßen zugenommen, von innen war ich dem Verbrennen nahe, so schien mir.
Ich rüttelte mich aus meinem Wahn und suchte mir neue Gedanken einzuflößen. Ich griff nach dem Buch und öffnete es auf beliebiger Seite. Die Lieder von Kullervo hatten sich mir aufgetan und ich las.
Sind Dinge auch zu hören,
Ist Unheil auch geschehen,
Schlief bei der Schwester ich,
Buhlt’ ich mit der Mutter Kind!
Sie hat ihr Ende schon gefunden,
Den Tod hat sie gesucht,
Im harten Schaum der Schnellen,
In feuertollen Wirbeln.
Das Buch fiel mir zu Boden.
Da, dort, dort im Freien, dachte ich, da beten sie jetzt vielleicht im Schlafe um ein seliges Ende.
Oder opferten sie Ukko, dem fremden alten Götzen, der diesem Lande und den Menschen aus dem Fleisch gewachsen war und nur mit Mühe hatte von dort entfernt werden können? Man pfählte den Alten, indem man das Fleisch mit einem Stahlstift durchstieß.