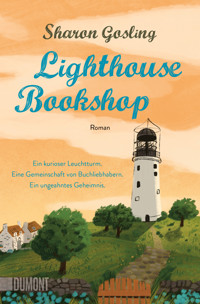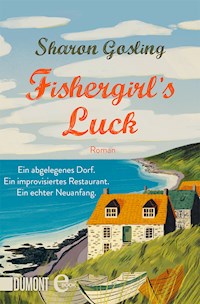9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Crowdie Farm liegt an der schroffen Steilküste Schottlands; dort sind Bette und Nina Crowdie aufgewachsen, zwischen Kühen, Hühnern und der rauen See. Nahegestanden haben sie sich nie. Zu verschieden sind die beiden Schwestern, zu groß der Altersunterschied von zehn Jahren. Nun lebt Bette ihr ganz eigenes Leben in London, fernab der Familie, während für Nina die Farm ihr Ein und Alles ist. Als plötzlich der Vater stirbt und die Schwestern unerwartet den Hof gemeinsam erben, treffen sie wieder aufeinander. Bald erfahren sie von den enormen Schulden, die ihr Vater vor ihnen verheimlicht hat. Widerstrebend willigt Bette ein, ihrer Schwester bei der Rettung von Crowdie Farm zu helfen. Doch das bedeutet, dass sie einen Weg finden müssen, zusammenzuarbeiten, und Bette nicht länger verdrängen kann, warum – oder wegen wem – sie vor all den Jahren weggegangen ist. Die Entdeckung eines seit Jahrzehnten vergessenen Apfelgartens mit uralten, seltenen Cidersorten auf ihrem Land ist der einzige Hoffnungsschimmer. Er bleibt die letzte Möglichkeit, die Farm zu retten – und die Beziehung der Schwestern wieder zu kitten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 562
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Die Crowdie-Schwestern könnten unterschiedlicher nicht sein. Bette hat die Familienfarm direkt nach ihrem Schulabschluss verlassen und sich ein Leben als erfolgreiche Scheidungsanwältin in London aufgebaut. Für ihre zehn Jahre jüngere Schwester Nina ist der Hof ihr Ein und Alles. An der Seite ihres Vaters schuftet sie tagein, tagaus, kümmert sich um die Kühe und Hühner, das Heu, die Erdbeeren, die sie verkauft, um sich und ihren Sohn über die Runden zu bringen. Als plötzlich ihr Vater stirbt und nicht nur Nina, sondern auch Bette den Hof erbt, treffen die Schwestern nach Jahren wieder aufeinander. Bald erfahren sie von den Schulden, die ihr Vater vor ihnen verheimlicht hat. Widerstrebend willigt Bette ein, ihrer Schwester bei der Rettung von Crowdie-Farm zu helfen. Doch das bedeutet, dass sie einen Weg finden müssen, zusammenzuarbeiten, und Bette nicht länger verdrängen kann, wegen wem sie vor all den Jahren Reißaus genommen hat.
Die Entdeckung eines seit Jahrzehnten vergessenen Gartens mit einer uralten, seltenen Apfelsorte, aus der man den perfekten Cider herstellen kann, ist der einzige Hoffnungsschimmer. Wohl die letzte Möglichkeit, die Farm zu retten – und die Beziehung der Schwestern zu kitten.
© Phil Rigby
Sharon Gosling ist eine britische Journalistin und Autorin. ›Der alte Apfelgarten‹ ist nach ›Fishergirl’s Luck‹ (2022), ›Lighthouse Bookshop‹ (2023) und ›Forgotten Garden‹ (2024) ihr vierter Roman bei DuMont. Sie lebt mit ihrer Familie im Norden von England, ihr Mann besitzt einen Buchladen.
Sibylle Schmidt hat in Berlin Theaterwissenschaften und Amerikanistik studiert und lebt seit einigen Jahren in Ostfriesland. Sie übersetzt aus dem Englischen, u.a. JP Delaney, Ciara Geraghty und David James Poissant.
Sharon Gosling
DER ALTE APFELGARTEN
Roman
Aus dem Englischen von Sibylle Schmidt
Von Sharon Gosling sind bei DuMont außerdem erschienen:
Fishergirl’s Luck
Lighthouse Bookshop
Forgotten Garden
Deutsche Erstausgabe
E-Book 2025
DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten.
Die Nutzung dieses Werks für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
© Sharon Gosling, 2023
Die englische Originalausgabe erschien 2024 unter dem Titel ›The Secret Orchard‹ bei Simon & Schuster UK Ltd, London.
© 2025 für die deutsche Ausgabe: DuMont Buchverlag GmbH & Co. KG, Amsterdamer Straße 192, 50735 Köln, [email protected]
Übersetzung: Sibylle Schmidt
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagabbildung: © Mona Eing & Michael Meissner
Satz: Angelika Kudella, Köln
E-Book Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN E-Book 978-3-7558-1092-6
www.dumont-buchverlag.de
Für Madge und Barry Shaw, die mir einen Bramley-Apfelbaum geschenkt haben, der uns alle überdauern wird, und für George und Angela Ritchie für ihre unermüdliche Unterstützung.
Herbst
1839
Sie tobte innerlich vor Wut, als sie den Weg an den Klippen entlangstürmte. Vom aufgewühlten Meer fegte ein heftiger Wind herüber, aber er war nicht Ursache der Tränen, die noch eine Stunde nach dem jüngsten Streit in Ophelias Augen brannten.
»Das ist Irrsinn«, hatte Milton schroff gesagt. »Was verliere ich auch nur ein Wort darüber? Diese Idee ist so irrsinnig wie du selbst. Das höre ich mir nicht länger an. Selbstverständlich kommt das nicht infrage. Du bist meine Frau, um Himmels willen. Du solltest zumindest so tun, als bedeute dir das etwas.«
Für gewöhnlich gelang es Ophelia Greville, das barsche Benehmen ihres Gatten auszublenden. Das hatte sie bereits im ersten unerquicklichen Jahr ihrer Ehe gelernt. Doch das war eine Grausamkeit zu viel. Milton wusste genau, wie sehr ihr dieser Plan am Herzen lag, dennoch weigerte er sich rundweg, die Idee auch nur in Erwägung zu ziehen. Es ging ihm lediglich darum, Macht auszuüben. Liebe hatte in ihrer Ehe noch nie eine Rolle gespielt, einzig Geld und die Notwendigkeit eines Erben.
Ophelia wischte sich heiße Tränen aus dem Gesicht. Was war sie doch für eine unbedarfte Närrin gewesen! Sie hätte sich damals widersetzen und für sich kämpfen sollen. Stattdessen hatte sie sich mit einem Versprechen abspeisen lassen, das nicht mehr wert war als die Zusage ihres Vaters. Ein Prozent seiner Ländereien! Was für ein erbärmliches Almosen das war, erkannte sie erst jetzt. Sogar darüber hatte Milton noch mit ihr gestritten. Sie hatte ihren Anteil verkaufen wollen – an Milton selbst, weil sie das Geld für die Reise brauchte, von der sie seit ihrer Kindheit träumte. Eine Reise nach Afrika, um die Savanne zu sehen, die wundersamen wilden Tiere, die dort umherstreiften. Aber Lord Greville hatte ihr ins Gesicht gelacht. Warum sollte er für etwas bezahlen, was ihm bereits gehörte? Und selbst wenn sie eigenes Geld besäße – wie könnte sie glauben, dass er ihr diese Reise erlauben würde? Darauf hatte Ophelia eingewandt, sie wolle ja nicht allein reisen, er solle sie begleiten. Aber auch dieser Vorschlag wurde mit verächtlichem Gelächter abgetan.
Alles war im Grunde reinste Betrügerei – die Ehe eine Falle, das Eigentum ein Trugbild. So gesehen besaß Ophelia weder Land noch Geld und hatte von ihrem Vater rein gar nichts geerbt.
Sie schluchzte auf und blieb keuchend am Rande der Steilküste stehen, die Hände in die Hüften gestützt. Erst jetzt fiel ihr auf, dass sie nicht mehr wusste, wo sie war. Nach Miltons abfälligen Worten war Ophelia blindlings drauflosgelaufen, aus den erstickenden Räumen geflohen, in denen ihr beengtes Leben stattfand. Aber verirren konnte sie sich hier eigentlich nicht. Sie musste nur die gleiche Strecke am Meer entlang ins Dorf und zu dem Anwesen zurückgehen, das sich über den Häusern erhob.
Ophelia sah sich neugierig um. Sie stand mitten in hohem Gras und entdeckte, halb verborgen hinter wuchernden Ginsterbüschen, einen Pfad, der sich den Hang hinabschlängelte. Etwas verlockte sie dazu, diesen mysteriösen Weg zu erkunden, und sie schlug sich durch das Gebüsch, um zu ihm vorzudringen. Zweige verfingen sich in ihren Röcken, sie befreite sich von ihnen, doch nach wenigen Schritten merkte Ophelia, dass sie sich gefährlich nah am Klippenrand befand. Ein falscher Schritt, und sie würde hinunterstürzen auf die spitzen Felsen, die aus den tosenden Wellen aufragten. Dieser Gedanke lenkte sie ab, und prompt geriet sie im nächsten Moment ins Stolpern. Ophelia stieß einen schrillen Schrei aus, weil sie sich nirgendwo festhalten konnte, und kniff fest die Augen zu, während sie sich von ihrem kurzen Leben verabschiedete.
Plötzlich wurde sie von kraftvollen Händen gepackt und vom Abgrund weggezogen. Als sie die Augen öffnete, sah sie einen jungen Mann vor sich, der wetterfeste Kleidung und eine Tweedkappe trug und Ophelia mit freundlichen braunen Augen betrachtete.
»Alles in Ordnung, Ma’am?«, fragte er. »Sie wären um ein Haar da heruntergepurzelt.«
Ophelia wollte antworten, lachte jedoch stattdessen und presste zitternd eine Hand auf den Mund. Ihr Herz schlug einen Trommelwirbel.
»Kommen Sie«, sagte ihr Lebensretter und schob sie sachte am Ellbogen vorwärts, »Sie müssen sich nach dem Schrecken erst einmal ausruhen.«
Ophelia achtete sorgsam darauf, nicht nach unten aufs Meer zu schauen, während der Mann sie auf eine ebene Fläche geleitete. Dort ließ er sie los. Ophelia sah sich benommen um. Sie war umgeben von niedrigen knorrigen Bäumen.
»Was ist das hier?«, fragte sie.
»Ein alter Apfelgarten«, antwortete der Mann.
»Ein Apfelgarten? An der Steilküste?«
Der Mann lachte über ihre Verwunderung, aber nicht verächtlich, wie Milton es stets tat. Warmherzigkeit lag in den haselnussbraunen Augen. Ophelias Herz pochte nicht mehr so heftig, zog sich aber jetzt mit einem Schmerz zusammen, den sie nicht verstand.
»Aye, ist merkwürdig, das gebe ich zu.« Er sah sie einen Moment lang sinnend an. »Sie sind Lady Greville vom Anwesen, nicht wahr? Verzeihen Sie, dass ich Sie nicht gleich erkannt habe, Ma’am.«
»Sie müssen mich nicht Ma’am nennen. Ich heiße Ophelia«, sagte sie, während sich das merkwürdige Gefühl weiter in ihr ausbreitete.
Er lächelte. »Angenehm. Ich bin George Crowdie. Warten Sie hier einen Augenblick. Ich habe etwas für Sie, das Ihnen guttun wird.«
Bevor Ophelia etwas erwidern konnte, verschwand der junge Mann im Zwielicht. Sie blieb an Ort und Stelle stehen, lauschte dem Rauschen der Wellen und dem Säuseln des Winds in den Ästen der eigenartigen kleinen Bäume. Es kam ihr vor, als sei sie in einer anderen Welt gelandet. Kurz darauf kehrte George Crowdie zurück, in den Händen eine braune Glasflasche, die er ihr hinhielt.
»Ich habe kein Gefäß für Sie«, sagte er entschuldigend, »aber Sie können aus der Flasche trinken.«
Ophelia hatte Whisky erwartet, doch der Geschmack des Getränks war viel süßer. »Oh!«, rief sie entzückt aus. »Ist das Apfelsaft?«
Ein munteres Funkeln lag in George Crowdies Augen. »Aye, aber nicht nur das. Wir geben Erdbeersaft und ein wenig Honig von den Bienenstöcken hinzu.«
Ophelia war diesem Getränk auf Anhieb verfallen. Noch nie hatte sie etwas Köstlicheres geschmeckt, und bevor sie sichs versah, hatte sie die halbe Flasche geleert. Als Ophelia sich die Lippen mit dem Handrücken wischte, fühlte sie sich gestärkt. Sie wollte ihm die Flasche zurückgeben, doch George Crowdie lächelte versonnen.
»Behalten Sie sie«, sagte er. »Dieses Getränk ist gut für die Seele, wissen Sie.«
Ophelia blickte auf die Flasche. Damit konnte sie nicht nach Hause zurückkehren. Sie war so lange weg gewesen, und das auch noch allein. Gewiss würde sie von Milton zur Rede gestellt werden, und wenn sie diese Flasche bei sich trug … Ophelia ließ den Blick über die eigentümlichen Bäume schweifen, die in dieser verborgenen Senke wuchsen und gediehen.
»Das kann ich nicht«, erwiderte sie. »Aber ich danke Ihnen für Ihre Freundlichkeit, George Crowdie.«
Sie gab ihm die Flasche zurück und wandte sich zum Gehen, widerstrebend, obwohl es jetzt rasch dunkel wurde. Nun musste sie besonders auf den Weg unter ihren Füßen achten. Doch nach zwei Schritten drehte Ophelia sich abrupt um.
»Halten Sie diesen Ort geheim, George«, sagte sie leidenschaftlich. »Wüsste mein Ehemann davon, würde er den Apfelgarten sofort besitzen wollen. Bewahren Sie Stillschweigen darüber.«
Ein Schatten fiel über George Crowdies Gesicht, und er zuckte leicht mit den Schultern. »Das ist sein Land, Ma’am. Die Bäume gehören ihm. Der Cider, den wir herstellen, landet in seinen Kellern.«
»Nicht für immer«, erwiderte Ophelia. »Dafür werde ich sorgen.« Der Blick der nussbraunen Augen ruhte auf ihr, und eine Spur Neugier war darin zu erkennen. Ophelia gab keine Erklärung ab. Ein Prozent. Ein Almosen, gewiss, aber es gehörte ihr, und es würde ausreichen. Vielleicht würde sie das Anwesen niemals für eine große Reise verlassen können, sondern für immer hierbleiben. Wie der Apfelgarten. Wie die Familie Crowdie. Und wie dieser junge Mann mit den freundlichen braunen Augen.
»Noch etwas«, fügte Ophelia hinzu. »Ich denke, Sie sollten an diesen tückischen Klippen einen Zaun bauen. Das Anwesen wird die Kosten übernehmen. Dann bin ich nicht mehr in Gefahr, wenn ich zu Besuch komme.« Sie warf ihm einen Blick zu. »Darf ich? Ab und zu?«
»Aye, Ophelia«, antwortete George. »Jederzeit. Wann immer es Ihnen beliebt.«
»Morgen?«
»Ja.« Er lächelte wieder, und sie wünschte sich, dieses Lächeln immer sehen zu können. »Sehr gern morgen.«
1
Jetzt
In der goldenen Abendsonne trat Nina aus der Küchentür des Farmhauses in den Hof hinaus und blickte zu der altehrwürdigen Crowdie-Eiche auf. Ihre Äste bewegten sich im warmen Sommerwind, und Nina erinnerte sich daran, wie sie schon als Kind fasziniert die flirrenden Blätter beobachtet hatte. Einmal hatte sie zu ihrem Vater gesagt, der Baum spreche mit ihr. Wenn sie aufmerksam genug sei, könne sie verstehen, was er ihr mit jeder noch so winzigen Bewegung in seiner Blättersprache sagen wolle. Seit jenem Tag war es für sie beide zu einer lieben Gewohnheit geworden, gemeinsam die hohe alte Eiche zu betrachten und Geschichten über die seltsamen Gestalten zu erzählen, die sie in ihrem Geäst zu sehen glaubten. Die kuriosen Märchen, die Bern Crowdie sich für seine Tochter einfallen ließ, hatten sie beide immer zum Lachen gebracht. Und so hatten sie oft hier gestanden, zwei Spinner, die sich über einen Baum kringelig lachten, bis Bern sich um die Kühe kümmern oder mit den Hunden auf die Weide gehen musste, um die Schafe zusammenzutreiben. Doch obwohl es auf der Farm alle Hände voll zu tun gab, hatte Bern immer Zeit für sie gehabt, daran erinnerte Nina sich genau. Das war die wichtigste Botschaft, die ihr Vater ihr mitgegeben hatte: dass er sich Zeit nahm, seine Tochter zum Lachen zu bringen, auch wenn die Arbeit noch so sehr drängte.
Als Nina Schritte hinter sich hörte, drehte sie sich um. Ihre Mutter steuerte auf sie zu. Auch mit zweiundsechzig besaß Sophia Crowdie noch die umwerfende Schönheit, die Bern auf den ersten Blick in Bann gezogen hatte (so die Familienlegende) und die beide Töchter geerbt hatten. Sophia war in Edinburgh geboren und aufgewachsen, als Tochter einer irischen Mutter und eines italienischen Vaters, und verfügte über eine natürliche Eleganz. Nina liebte beide Elternteile von Herzen, hatte sich aber bereits in ihrer Jugend gefragt, wieso die beiden sich eingeredet hatten, ihre Ehe könne von Dauer sein. Zwei Lebensentwürfe prallten aufeinander. Sophia sehnte sich nach der Stadt und ihren Annehmlichkeiten, die sich Bern nur äußerst selten genehmigen konnte. Dennoch waren die beiden zwanzig Jahre zusammengeblieben, viel länger, als manche Leute vermutet hätten, und jedenfalls lange genug, um zwei Kinder und eine liebevolle Freundschaft zu erschaffen, die auch noch erhalten blieb, als die Töchter erwachsen waren. Bern Crowdie war nie ein Mann gewesen, der Groll hegte. Er hatte seit jeher verstanden, dass Sophia das lebhafte Treiben einer Großstadt vermisste und lange davon träumte, dem unbeständigen schottischen Wetter zu entkommen und die Sonne zu suchen. Für Sophia wiederum hatte es keinerlei Zweifel gegeben, dass diese Farm an der schottischen Küste der Ort war, an dem Bern sich zu Hause fühlte. Und so hatten sie sich letztlich als Freunde zu sehr geliebt, um sich als Ehepartner unglücklich zu machen. Vom besonnenen Verhalten ihrer Eltern hatte Nina sich hinreißen lassen zu glauben, dass alle Erwachsenen sich in Herzensangelegenheiten derartig verhielten. Erst viel später war sie mit einer vollkommen anderen Realität konfrontiert worden.
»Alles okay?«, fragte Sophia, als sie zu ihrer Tochter trat und ihr den Arm um die Schultern legte.
»Ja«, sagte Nina, obwohl sie einen Kloß im Hals hatte und Tränen in ihren Augen brannten. Sie umarmte ihre Mutter. »Ich habe nur gerade an Dad gedacht.«
Sophia strich ihr über den Arm, dann blickten die zwei Frauen Seite an Seite auf den Innenhof der Farm, die Bern Crowdies Leben gewesen war. »Weißt du noch«, sagte Sophia mit rauer Stimme, »wie wir einmal an Weihnachten morgens aufgewacht sind und er hier im Hof eine ganze Schneefamilie gebaut hatte?«
Nina lachte. »Na klar! Wir alle hatten eine Figur bekommen.«
Sophia schüttelte den Kopf bei dieser Erinnerung. »Er hatte sogar einen Hund gemacht. Wie hieß der noch gleich, den wir damals hatten?«
»Turtle«, antwortete Nina schmunzelnd. »Wir hatten ihn Turtle genannt.«
»Bern war wirklich ein Original«, sagte Sophia mit so liebevoller Stimme, dass Nina unter Tränen lächelte. »Er muss stundenlang draußen gewesen sein. Seine Hände waren blau vor Kälte, weil er nie Handschuhe tragen wollte. Ich habe ihn damals gefragt, weshalb er nicht gewartet hat, bis ihr beide auf seid, dann hättet ihr das zusammen machen können. Bern antwortete, er hätte mit einem angefangen und dann niemanden auslassen wollen, deshalb hätte er weitergemacht. Später mussten wir alle beim Melken helfen, weil er zu spät dran war! Die armen Kühe.«
Nina kicherte bei der Erinnerung, wie ihre Mutter sich an diesem schneereichen Weihnachtsmorgen damit abgeplagt hatte, die Ayrshire-Kühe zusammenzutreiben. Sie hatte nie Begabung für Farmarbeit an den Tag gelegt, genau wie Ninas Schwester Bette. Obwohl Sophia, sinnierte Nina, sich im Gegensatz zu Bette zumindest bemüht hatte.
»Er hat euch Mädchen so sehr geliebt«, murmelte Sophia. »Hat immer gesagt, dass er gar nicht begreifen könne, womit er so viel Glück verdient habe. Danke, dass du in den letzten Jahren für ihn da warst. Ohne dich hätte er die Farm nicht halten können.«
»Weißt du, ich war diejenige, die großes Glück hatte«, sagte Nina leise. »Dass ich nach Hause kommen konnte, hat mich und Barnaby gerettet. Und das ist nicht übertrieben ausgedrückt.«
»Unseren Superhelden Seepocke«, ergänzte Sophia schmunzelnd, und Nina lachte, seufzte aber gleich darauf beim Gedanken an ihren Sohn.
»Genau, Superheld Seepocke«, sagte sie. »Ist er ohne großes Theater ins Bett gegangen? Ich schaue gleich nach ihm.«
Ihre Mutter drückte sie liebevoll und ging in die Küche zurück, gefolgt von Nina. »Ja, er ist oben, mit Spider-Man oder so was. Ich habe ihm gesagt, er darf lesen, bis du zum Gutenachtsagen kommst. Vielleicht gelingt es dir ja, ihn zu überreden, diese Maske abzunehmen. Ich habe es nicht geschafft.«
Nina stöhnte, während beide Frauen begannen, das Geschirr vom Abendessen abzuräumen. »Ich bekomme ihn nicht mehr aus diesem Kostüm raus, Mum. Er hat es seit Dads Tod an, und ich mache mir Sorgen, dass er es womöglich auch zur Beerdigung tragen will. Am Samstagmorgen bin ich sicherlich nicht imstande, darüber zu streiten.«
»Ach, soll er doch anziehen, worauf er Lust hat.« Ihre Mutter ließ heißes Wasser in das betagte Spülbecken laufen und begann mit dem Abwasch. »Dein Vater hätte bestimmt nichts dagegen. Im Gegenteil – wahrscheinlich hätte er den Jungen noch darin bestärkt. Er ist doch erst sechs! Niemand wird sich daran stören. Und falls doch, ist es deren Problem, nicht deines. Solange es Barnaby guttut …«
Nina begann, den ersten Teller abzutrocknen, und legte den Kopf an die Schulter ihrer Mutter. »Ich kann immer noch nicht begreifen, dass Dad nicht mehr da ist. Ein Teil von mir hat wohl geglaubt, er würde für immer bei uns bleiben.«
Sophia drückte ihrer Tochter einen Kuss auf den Kopf und setzte den Abwasch fort. Beide Frauen verfielen für ein paar Minuten in Schweigen. Im Farmhaus war eine Leere entstanden, die es nie zuvor gegeben hatte und die nicht mehr gefüllt werden konnte. Offenbar hatten beide ähnliche Gedanken, denn Sophia sagte unvermittelt: »Wann kommt wohl deine Schwester?«
Nina verzog das Gesicht, während sie sich abwandte, um das trockene Geschirr in den Schrank zu stellen. »Meinst du, sie bemüht sich überhaupt hierher?«
Ihre Mutter schnalzte mit der Zunge. »Selbstverständlich wird Bette dabei sein. Sie kommt wahrscheinlich morgen. Hat sicher bei der Arbeit viel zu tun.«
»Das ist doch ständig so«, wandte Nina ein, obwohl sie selbst merkte, wie trotzig ihre Stimme klang. Das passierte unweigerlich, sobald sie über ihre ältere Schwester sprach. Manchmal kam es Nina vor, als gerate sie beim Gedanken an Bette in einen Zeittunnel, der auf direktem Wege zu den Streitereien von früher führte.
»Ehrlich gesagt, Mum«, sagte Nina mit einem Seufzer, »hätte ich nicht mal was dagegen, wenn sie nicht dabei wäre. Sie will doch sowieso nicht hier sein, oder? Zu Dads Lebzeiten hat sie sich auch nicht um ihn geschert.«
Sophia trocknete sich die Hände ab und wandte sich ihrer Tochter zu, einen besorgten Ausdruck in den Augen. »Sag so was bitte nicht. Deine Schwester hat euren Vater genauso geliebt wie du.«
Nina blies die Wangen auf. »Wie kannst du das behaupten? Bette hat Dad doch nur noch gesehen, wenn sie beruflich in Aberdeen war und ihn dort zum Essen getroffen hat. Aber seit Barnaby und ich hier leben, war sie erst ein einziges Mal hier! Einmal in fünf Jahren! Heißt also, meine Schwester hat ihren Neffen bisher genau zwei Mal erlebt. Das eine Mal hier und das zweite Mal, als wir drei in London waren. Wo sie von uns verlangt hat, dass wir zu ihr fahren. Mit einem Einjährigen!«
»Nina, bitte«, erwiderte Sophia. »Ihr seid eben sehr unterschiedlich und gestaltet euer Leben ganz anders. Du lebst hier, Bette in einer Großstadt.«
»Also, ich finde, es gibt nur eine Art, seiner Familie zu zeigen, dass sie einem wichtig ist«, sagte Nina. »Und zwar, indem man für sie da ist. Was Bette nie war. So ein Verhalten ist doch total selbstsüchtig, oder?«
Einen Moment lang sah es aus, als wollte ihre Mutter etwas erwidern, doch sie blieb stumm. Nina schämte sich sofort. Sie hatte Bette und Sophia nicht in einen Topf werfen wollen, so ähnlich die beiden sich auch waren. Doch bevor Nina etwas hinzufügen konnte, trat ihre Mutter zum Herd. »Sollen wir diese Reste aufheben?«
»Cam kommt sicher gleich vorbei«, antwortete Nina mit einem Blick auf die Wanduhr. »Er freut sich bestimmt darüber, wenn er zu Hause noch nicht gegessen hat.«
»Wer ist Cam?«
»Ich hatte dir von ihm erzählt, weißt du nicht mehr? Unser Nachbar? Er hat vor ein paar Jahren die Bronagh-Farm gekauft. Cam hilft uns aus, seit ich hier bin. Und nach Dads Tod hat er zusätzlich das Abendmelken übernommen, damit ich Barnaby nach dem Abendessen nicht allein lassen muss.«
»Ach ja? Wie nett von ihm«, sagte Sophia. »Aber hat Cam nicht mit seiner eigenen Farm schon genug zu tun?«
»Doch, und genau das habe ich auch gesagt, als er mir das angeboten hat«, antwortete Nina. »Aber er hat darauf bestanden. Ehrlich gesagt, wüsste ich gar nicht, wie ich ohne ihn zurechtkommen sollte. Ich muss demnächst jemanden einstellen, habe es aber noch nicht geschafft, mich damit zu beschäftigen. Cam ist ein Geschenk des Himmels.«
Als Nina fünf Jahre zuvor auf die Crowdie-Farm zurückgekehrt war, hatte sie es nicht leicht gehabt. Sie war eine alleinerziehende Mutter mit einer schmerzhaften Vorgeschichte, hatte sich erst wieder an die Arbeiten in der Landwirtschaft gewöhnen und gleichzeitig um ihren Vater kümmern müssen, der weitaus stärker gealtert war, als sie das aus der Entfernung eingeschätzt hatte. Mit großer Geduld hatte Cam sich Nina und auch Barnaby gewidmet, ihr alles erklärt, wenn Bern keine Kraft mehr dafür hatte.
Nina spürte den Blick ihrer Mutter und schaute auf. »Was?«
»Dieser Cam«, sagte Sophia. »Wie alt ist der? Und ist er single?«
»Ah!« Nina hob die Hand. »Stopp! Nein. Auf gar keinen Fall. Das kannst du gleich vergessen.«
»Was denn?«, fragte Sophia mit einer Unschuldsmiene, die Nina ihr keine Sekunde abnahm.
»Cam und ich sind Freunde, mehr nicht«, erklärte Nina. »Gute Freunde. Komm bloß nicht auf irgendwelche Ideen. Ich habe schon genug an der Backe, ohne dass du dich einmischst.«
»Keine Ahnung, was du meinst«, erwiderte Sophia augenzwinkernd.
»Mum! Auf Verkupplungsversuche kann ich bestens verzichten, schönen Dank auch. Du bist in ein paar Tagen wieder weg, aber Cam und ich leben hier.«
Sophia nahm sich eine Traube von der Obstschale auf dem Tisch und kaute nachdenklich. »Ganz genau. Und mir ist nicht entgangen, dass du allen Fragen nach ihm ausgewichen bist. Was Bände spricht.«
»Wirklich, lass das, Mum«, wiederholte Nina warnend. »Ich gehe jetzt nach oben und sage Barnaby Gute Nacht. Und dieses Thema ist ein für alle Mal beendet, ist das klar?«
»Das ist das Problem mit euch jungen Leuten heutzutage«, bemerkte Sophia mit theatralischem Seufzen, während Nina hinausging. »Ihr seid alle so ernsthaft. Warum amüsiert ihr euch nicht ein bisschen?«
»Weil wir uns das nicht leisten können!«, rief Nina aus dem Flur.
2
Als Nina das Schlafzimmer ihres sechsjährigen Sohnes betrat, fand sie ihn aufrecht sitzend im Bett vor, auf den Knien ein Comic, den er im Licht der Nachttischlampe las. Limpet lag wie üblich neben dem Jungen. Der schwarz-weiße Collie war als Welpe auf die Farm gekommen, Bern hatte das getreue Tier vor einem harten Leben als Hofhund bewahrt. Obwohl Limpet gehorsam war, wäre aus ihm nie ein Arbeitstier geworden, denn er hatte furchtbare Angst vor Schafen. Als Haustier jedoch erwies er sich als unverzichtbarer Begleiter des Jungen. Die beiden waren zusammen aufgewachsen und unzertrennlich. Nina hatte es längst aufgegeben, beiden mitzuteilen, dass der Hund auf dem Boden schlafen sollte. Barnaby hatte sie nämlich jedes Mal angeschaut, als hätte sie gesagt, Limpet müsse draußen übernachten, wo er von Bären, Wölfen … oder vielleicht auch Schafen gefressen werden konnte. Außerdem war sie froh, dass Limpet ihrem Sohn auf Schritt und Tritt folgte und sein Leben riskiert hätte, um ihn zu retten. Deshalb war Nina großzügig bereit, dem Hund sämtliche kleineren Vergehen zu verzeihen.
Obwohl Barnaby schon im Bett war, trug er eine schwarze Wollmaske, die seinen Kopf und bis auf die Augen sein gesamtes Gesicht bedeckte. Erleichtert stellte Nina fest, dass es ihrer Mutter gelungen war, ihn zu überreden, den Rest seines Kostüms auszuziehen. Sonst hätte er jetzt statt eines frischen Schlafanzugs sein übliches schwarzes Outfit getragen, das aus Pulli, Hose und Umhang bestand. Auf dem Pyjama waren zwar auch Superhelden aus den Marvel-Comics abgebildet, aber er war immerhin besser zum Schlafen geeignet als das Kostüm, das der Junge die gesamte letzte Woche getragen hatte.
»Hey, du«, sagte Nina leise. Sie setzte sich auf den Bettrand und küsste ihren Sohn auf den Kopf, wobei sie spürte, dass die Maske schon leicht feucht vor Schweiß war. »Das Ding ist zu warm, Schatz. Damit kannst du nicht gut schlafen.«
Sie machte Anstalten, ihm die Maske auszuziehen, aber Barnaby hielt sie unterm Kinn so energisch fest, dass Nina vorerst aufgab. Er liebte das Kostüm innig, seit Nina es ihm in einem Secondhandshop gekauft hatte, aber nach Berns Tod hatte es noch mehr an Bedeutung gewonnen. Barnaby (der neuerdings hartnäckig darauf bestand, Superheld Seepocke genannt zu werden, aus Gründen, die er anscheinend entweder zu simpel oder zu kompliziert fand, um sie einer gewöhnlichen Sterblichen wie seiner Mutter zu offenbaren) weigerte sich schlichtweg, irgendetwas anderes anzuziehen. Sophia hatte vorgeschlagen, nach einem identischen Kostüm Ausschau zu halten, damit eines gewaschen werden konnte. Nina gab sich aber der Hoffnung hin, dass diese Phase bald vorüber sein würde. Man musste keine Kinderpsychologin sein, um sich zu erklären, wie es zu dieser Gewohnheit gekommen war und welchem Zweck sie diente. Auf die Diskussion am Montag, wenn die Ferien zu Ende waren und Barnaby seine Schuluniform anziehen musste, freute Nina sich allerdings gar nicht.
»Was liest du?«, fragte sie mit Blick auf das bunt bebilderte Heft.
»Spider-Man. Bin grade fertig geworden. Er hat gegen Hobgoblin gekämpft.«
»Und hat Spider-Man gewonnen?«
»Klar. Er gewinnt immer. Am Ende auf jeden Fall. Auch wenn er vorher erst was verlieren muss.«
Nina umarmte ihren Sohn und nahm ihm den Comic aus der Hand. »Wie alle Superhelden.«
»Mum!«
»Es ist Schlafenszeit, Liebling.«
»Ich will aber das nächste Heft lesen.«
»Morgen. Spider-Man wartet auf dich, wenn du aufwachst, okay?«
Barnaby stieß einen dramatischen Seufzer aus. »Na gut.«
»Und ziehst du vielleicht die Maske aus?«, wagte Nina einen erneuten Vorstoß. »Das wäre wirklich besser. Sogar Spidey zieht seine aus, wenn er nach Hause geht, oder nicht?«
»Aber nur, weil Tante May nicht weiß, dass er Spider-Man ist«, erklärte ihr Sohn in dem betont geduldigen Tonfall, den Kinder bei begriffsstutzigen Erwachsenen anwenden. »Hier weiß doch jeder, dass ich Superheld Seepocke bin.«
Es bedurfte weiterer fünf Minuten Überredungskünste, aber nachdem die Haube ausgezogen war, schlief Barnaby auf der Stelle ein. Nina strich ihm das dunkle Haar aus der Stirn. Seine Lider zuckten leicht, und sie hoffte, dass er von angenehmen Abenteuern träumte.
Als Nina nach unten kam, hörte sie Stimmen und fand ihren Nachbarn Cameron Hayes und ihre Mutter am Küchentisch vor. Cam verspeiste gerade den Rest Lasagne, den Sophia aufgewärmt hatte, mit einem Appetit, der darauf hinwies, dass er keine Zeit zum Mittagessen gehabt hatte. Er blickte lächelnd auf, und seine blauen Augen leuchteten freudig, als Nina hereinkam.
»Hi«, sagte er. »Ist unser kleiner Superheld im Reich der Träume?«
»Jawoll.« Nina steckte die Haube in die bereits vollgestopfte Waschmaschine und schaltete das Gerät ein. Dann ließ sie sich am Tisch nieder und stellte erfreut fest, dass Sophia ihr schon ein Glas Wein eingegossen hatte.
»Na, vielleicht kannst du dich jetzt ein bisschen entspannen«, sagte Cam. »Das Melken ist erledigt, und ich habe frische Salzlecken auf dem oberen Feld aufgestellt, das kannst du also von deiner Liste streichen.«
»Ach, verflixt, das wollte ich gestern schon gemacht haben.« Nina strich sich über die Stirn. »Ich bin abgelenkt worden, weil der Catering-Service wegen der Lieferung für die Trauerfeier angerufen hat. Danke, Cam. Du bist ein wahrer Lebensretter.«
»Was für einen tollen Nachbarn du hast«, bemerkte Sophia und beugte sich vor, um Cams Hand zu tätscheln. »Danke, dass Sie sich so um meine Tochter kümmern. Sie hat großes Glück, dass ihr jemand zur Hand geht, und noch dazu ein so attraktiver Mann.«
»Mum«, sagte Nina strafend, während Cam ihre Mutter charmant angrinste.
»Was denn?« Sophia sah ihre Tochter mit großen Augen an. »Du willst doch wohl nicht behaupten, das sei dir nicht aufgefallen?«
Nina schüttelte den Kopf, als Cam ihr nun das gleiche Grinsen zuteilwerden ließ und dabei die Augenbrauen hochzog.
»Du bist der reinste Albtraum«, sagte Nina in den Raum hinein.
»Was, ich?«, erwiderte Cam mit gespielter Betroffenheit. »Gerade war ich doch noch ein Lebensretter!«
»Ich bin gemeint«, bemerkte Sophia trocken.
»Nein, ihr beide«, widersprach Nina. »Ihr seid beide gleich schlimm. Cam weiß genau, wie gut er aussieht. Und nicht nur er, sondern auch seine unzähligen Verehrerinnen.«
»Autsch«, sagte Cam und grinste noch breiter. »Das war hart, aber nicht unverdient.«
»Ich gehe jetzt schlafen«, verkündete Sophia, erhob sich und verteilte den Rest des Weins auf die Gläser der beiden. »Ich habe morgen jede Menge zu tun. Aber ihr beide könnt ruhig noch weiterquasseln, ihr stört mich nicht.«
»Unfassbar«, sagte Nina, nachdem Sophia die Küchentür hinter sich geschlossen hatte. »Entschuldige. Achte einfach nicht auf sie. Ich glaube, es gibt keinen Mann in meiner Nähe, den sie nicht schon mal mit mir verkuppeln wollte.«
Cam lachte. »Ich finde sie hinreißend. Und etwa so subtil wie ein Stoppschild.«
»Stimmt«, pflichtete Nina ihm schmunzelnd bei. »Was zumindest den Vorteil hat, dass ich es immer schon kommen sehe.«
Ein kurzes Schweigen trat ein, während Cam seine Mahlzeit beendete. Nina betrachtete ihn verstohlen über den Rand ihres Glases hinweg. Trotz der fröhlichen Stimmung, die er verbreitet hatte, sah er müde aus, und sie empfand sofort Schuldgefühle. Eigentlich hatte er keinerlei Verpflichtungen ihr gegenüber, und doch unterstützte er sie weit mehr, als sie es von einem Nachbarn erwarten konnte.
Nina musste sich eingestehen, dass ihre Mutter recht hatte: Cam war ein sehr attraktiver Mann. Mitte dreißig, groß und breitschultrig, mit blondem Haar und blauen Augen. Sein Gesicht war sonnengebräunt von der Arbeit auf der Farm, die er jetzt sein Eigen nannte. Und Ninas gutmütige Stichelei war berechtigt gewesen – Cam mangelte es nie an Gespielinnen, und keine von ihnen schien besonders lange zu bleiben. Abgesehen von leichtem, charmantem Flirten, wie er es auch gerade in Anwesenheit von Sophia getan hatte, machte er Nina gegenüber jedoch nie Vorstöße, wofür sie dankbar war. Sie vermutete, dass Bern Cam wahrscheinlich von der gescheiterten Beziehung mit Barnabys Vater erzählt hatte. Oder aber ihr Nachbar vermutete etwas Derartiges, weil Nina vorsätzlich Abstand hielt. Vielleicht hatte er aber auch die Narbe an ihrer linken Wange bemerkt, die meist unter ihrem Haar verborgen war, und seine Rückschlüsse gezogen.
In diesem Moment schaute Cam auf und bemerkte ihren Blick. »Was ist?«
Nina schüttelte den Kopf. »Nichts. Entschuldige, ich war in Gedanken versunken.«
Er sah mitfühlend aus, und prompt fühlte sie sich wieder schuldig. Cam hatte immerhin heute zu seiner eigenen Arbeit noch die Hälfte ihrer Aufgaben übernommen. Wenn jemand ein Recht darauf hatte, geistesabwesend zu sein, dann wohl er.
»Wie gehts dir?«, fragte er leise.
»Ach, gut so weit.« Nina stellte das Weinglas auf den alten Holztisch und drehte es zwischen den Fingern. »Die Trauerfeier ist organisiert, die Liedblätter können morgen beim Drucker abgeholt werden, und ich bin mir recht sicher, dass ich alle informiert habe, die dabei sein möchten.«
Cam ergriff ihre Hand. »Das meinte ich nicht«, sagte er sanft. »Wie geht es dir, Nina?«
Ihre Kehle wurde eng, und Nina musste mehrmals schlucken und tief Luft holen, bevor sie antworten konnte. »Ich … Er fehlt mir. Ich kann einfach nicht glauben, dass er nicht mehr da ist.«
Cam nickte, und sie saßen eine Zeit lang schweigend da, bis Nina ihre Hand wegzog und einen Blick auf die Wanduhr warf. »Mum hat vorhin nach meiner Schwester gefragt. Ich habe noch nichts von ihr gehört, seit ich ihr den Bestattungstermin mitgeteilt habe.«
»Sie wird rechtzeitig da sein«, sagte Cam und trank einen Schluck Wein. »Ganz bestimmt.«
Nina schnaubte. »Das ist echt ein Problem von dir, Cam. Dass du immer in jedem Menschen das Beste sehen willst.«
»Nicht in jedem«, widersprach er ernst, und es kam Nina vor, als hätte er den Blick dabei auf ihre Wange gerichtet.
3
Bette runzelte die Stirn, als ein weiterer Vesper Martini vor ihr auftauchte. Zumindest hielt sie den Cocktail für einen Vesper Martini, auch wenn sie es nicht genau erkennen konnte. Die Beleuchtung war gedimmt worden, die Musik wurde lauter. Ein Kaleidoskop von farbigen Lichtern funkelte auf den zahllosen Flaschen hinter der Bar. Wie viel Uhr war es?
»Ich habe den Drink nicht bestellt!«, rief Bette dem jungen Barkeeper zu, der aber nur mit den Schultern zuckte und auf etwas hinter ihr zeigte.
Bette drehte sich um und entdeckte Mae, die sich gerade ihren zweiten Drink vom Tresen nahm.
»Mae!«, schrie Bette und beugte sich vor, damit ihre Freundin sie hören konnte. »Ich habe dir doch gesagt, dass ich losmuss!«
»Ausgeschlossen!«, schrie Mae zurück. »Jetzt noch nicht. Ich habe dir gerade einen Cocktail bestellt.«
»Und ich hatte gesagt, dass ich nur auf einen mitkomme!«
Mae pustete Luft aus und wedelte wegwerfend mit der Hand, um den Protest im Keim zu ersticken. Bette wurde klar, dass es ein Fehler gewesen war, überhaupt zuzusagen. Was hatte sie sich dabei gedacht? Sie war noch nicht einmal gern ausgegangen, als sie jünger gewesen war. Und heute Abend hätte sie wirklich lieber zu Hause ihre Notizen ein weiteres Mal durchschauen sollen. Außerdem musste sie packen.
»Nur noch dieser eine«, rief Mae über den Lärm hinweg. »Du warst doch eine Ewigkeit nicht mehr feiern. Komm schon, bleib! Da ist jemand, der dich kennenlernen möchte. Und ein bisschen Zerstreuung könntest du gerade gut gebrauchen, meinst du nicht?«
»Du weißt aber, was ich morgen vor mir habe?«, widersprach Bette. »Ich muss nach Hause, mich vorbereiten und zur Ruhe kommen.«
Mae legte ihr die Hand auf den Arm. »Du hast monatelang geschuftet, um den Locatelli-Fall zum Abschluss zu bringen.« Ihre Stimme konnte sich bei dem Geräuschpegel hier ebenso gut durchsetzen wie im Gerichtssaal. »Das solltest du feiern. Wir wissen beide, dass du das morgen, am Wochenende oder nächste Woche nicht tun kannst. Und danach bist du zu erhaben, um noch mit uns auszugehen.« Sie zog bedeutsam die Augenbrauen hoch, eine Geste, die auf Bettes Beförderung anspielte, von der man offiziell noch ebenso wenig wissen durfte wie von der Kanzleifusion. »Gönn dir was. Jeder Mensch braucht Pausen, Bette. Entspann dich und tanz wenigstens einmal heute Abend!«
Bette warf einen Blick auf die überfüllte Tanzfläche. Wer sind diese Leute, die abends feiern und am nächsten Morgen früh bei der Arbeit antreten können?, fragte sie sich. Haben die keine Familien, keine Kinder, die sie ins Bett bringen müssen? Vermutlich übernahmen das die jeweiligen Partner. Bei Mae passte jedenfalls der fürsorgliche Ehemann auf das zweijährige Kind auf. Und die anderen … Die Männer waren sicher eher von der Sorte wie dieser eine, Greg, mit dem Mae sie zusammenbringen wollte. Bette sah ihn von ihrem Platz an der Bar aus. Ging für Ende dreißig durch, war aber sicher erste Hälfte vierzig. Dunkles Haar, das ihm in die Augen fiel, gestreiftes hellblaues Hemd. Strahlte die Überzeugung aus, dass die Welt ihm zu Füßen lag, und arbeitete mit Sicherheit im Finanzwesen, wo er vermutlich mit der Zukunft anderer Menschen spekulierte. Er wirkte, als habe er Vier Hochzeiten und ein Todesfall so beeindruckend gefunden, dass er seither als eine Art jungenhafter Doppelgänger von Hugh Grant unterwegs war. Aber vielleicht sahen die Typen in dieser Branche alle so aus wie am Fließband produziert.
Bette dachte an die Notizblätter auf ihrem Bett, mit denen sie sich für morgen noch beschäftigen musste. Wieso, um Himmels willen, saß sie also in diesem Club? Weil du nicht allein sein wolltest, raunte eine Stimme tief in ihrem Inneren. Was schauderhaft bedürftig klang, und Greg war das beste Beispiel dafür, dass Bette dieser Stimme kein Gehör schenken durfte. Was sie normalerweise auch nicht tat, meist ließ sich das blöde Raunen mit Arbeit ausblenden. Aber jetzt gerade …
»Nein«, sagte sie zu Mae. »Kommt überhaupt nicht infrage.«
»Ach, komm schon«, erwiderte ihre Freundin. »Der ist doch süß, oder etwa nicht?«
»Ja, klar«, pflichtete Bette ihr bei, »und ich verwette mein baldiges erhöhtes Gehalt, dass der Mann verheiratet ist und mindestens ein Kind hat.«
Mae starrte auf die Tanzfläche. »Glaubst du das wirklich?«
»Und ob.« Bette wandte sich ab, bevor Greg ihren Blick als Einladung deuten konnte. »Und so was mache ich nicht, Mae. Nie. Das weißt du auch genau. Nicht mal, wenn sie angeblich in einer offenen Beziehung leben.«
Als Bette nach dem Cocktailglas griff, bermerkte sie aus den Augenwinkeln, dass ihr Handydisplay aufleuchtete. Sie wollte nicht draufschauen, weil Nina vielleicht geschrieben hatte. Der Termin am Vormittag würde schon anstrengend genug sein, aber Bette wollte gar nicht daran denken, was ihr danach bevorstand. Sie spürte einen Stich im Herzen, als sie an ihren Vater dachte, an ihre Familie, an den Ort, der eigentlich ihre Heimat war, den sie aber vor etlichen Jahren verlassen und seither nur selten aufgesucht hatte. Bette trank zu hastig einen großen Schluck und bekam die Zitronenzeste zwischen die Zähne. Morgen früh würde sie garantiert mit Kopfschmerzen aufwachen. Wieso, um alles in der Welt, war sie nicht nach der Arbeit schnurstracks nach Hause gegangen?
»Hallo.«
Bette sah Mae an und verdrehte die Augen, bevor sie sich umwandte. Dabei warf sie einen raschen Blick auf die linke Hand von Greg und fragte sich, weshalb notorische Fremdgänger sich nie darum bemühten, keinen verdächtigen weißen Streifen am Ringfinger zu haben. Aber vielleicht war es ihnen auch gleichgültig, und sie gingen davon aus, dass es den Frauen in Bars ebenso egal sein würde. Womöglich bin ich einfach naiv, dachte Bette. Letztlich verdiene ich mein Geld mit genau solchen Typen.
Sie zog eine Visitenkarte aus ihrer Tasche und reichte sie Greg. Seine Augen leuchteten auf, und ein begehrliches Grinsen erschien auf seinem Gesicht.
»Gib die deiner Frau«, rief Bette und stand auf, bevor er etwas erwidern konnte. »Sag ihr, sie soll mich anrufen, wenn sie sich scheiden lassen will. Mae – wir sehen uns morgen. Komm gut nach Hause. Ich muss jetzt los.«
Bette leerte ihr Glas, warf ihrer Freundin Luftküsschen zu und wandte sich ab, ohne den Mann zu beachten, der die Visitenkarte immer noch vor sich hielt, als sei er zur Salzsäule erstarrt.
Draußen schaute Bette auf ihr Handy. Die Nachricht leuchtete grell im Dunkeln.
Enttäusch Mum nicht, stand da nur.
Am frühen Nachmittag des nächsten Tages erlaubte sich Bette einen kurzen Blick aus dem Fenster und atmete erleichtert auf, als sich die Anwesenden im Sitzungsraum erhoben. Draußen strahlte die Sonne am Himmel über London. Vom fünfundzwanzigsten Stockwerk des modernen Bürohochhauses aus Glas und Stahl konnte man die Themse sehen, auf der jede Menge Touristenboote unterwegs waren. Bette genoss diese Aussicht – und würde sie noch mehr genießen, wenn sie bald ihr neues Büro fünf Etagen höher beziehen würde. Beim Gedanken daran lächelte sie kurz, wurde dann jedoch sofort von Trauer erfasst. Ihr Vater war tot. Bern Crowdie war tot, und nach dem Ende dieses Termins hier gab es nichts mehr, womit sie diese Wahrheit verdrängen konnte.
Bette blinzelte mehrmals, und als sie aufschaute, sah sie, dass ihr Mandant, ein erfolgreicher Geschäftsmann namens Arnold Locatelli, sie prüfend betrachtete. Seine künftige Ex-Frau verließ gerade mit ihrem eigenen Anwalt den Raum und beendete damit die fünfzehnjährige Ehe.
»Angenehmes Arbeiten mit Ihnen, Ms Crowdie«, sagte Locatelli, als hätte sie lediglich eine seiner zahlreichen feindlichen Übernahmen abgewickelt und nicht eine lange Ehe aufgelöst. »Sie haben meine Kontaktdaten. Falls Sie irgendwann keine Lust mehr auf Ihre Kanzlei haben, melden Sie sich. Ich hätte da vielleicht was für Sie. Leute wie Sie kann ich immer gebrauchen.«
Bette versuchte, sich ihre Überraschung nicht anmerken zu lassen. »Danke. Gut zu wissen.«
Er nickte und ging hinaus auf den Gang. Sie folgte Locatelli und verabschiedete ihn am Fahrstuhl. Als ihr Mandant verschwunden war, entdeckte Bette Mae am anderen Ende des Flurs und winkte ihr. Sie erwiderte das Winken, offenbar trotz des vorherigen Abends putzmunter.
»Oliver!«, rief Bette energisch, als sie das Büro neben dem ihren betrat, worauf der junge Mann am Schreibtisch erschrocken hochfuhr. »Haben Sie sich um meinen Flug gekümmert?«
»Ja, Ms Crowdie. Der letzte Flug von Heathrow nach Aberdeen geht um einundzwanzig Uhr.«
»Dann buchen Sie den bitte für mich«, verlangte Bette. »Der Locatelli-Fall ist abgeschlossen. Am Montag bin ich nicht im Büro, aber ab Dienstagvormittag wieder. Wenn Sie den Flug gebucht haben, können Sie nach Hause gehen.«
Oliver sah ziemlich verblüfft aus. Seit er ihr Assistent war, hatten sie so gut wie nie früher Schluss gemacht. Bette war nicht für frühe Feierabende bekannt. »Wirklich? Danke schön, Ms Crowdie«, sagte Oliver.
»Genießen Sie’s«, erwiderte Bette. »Wenn ich zurückkomme, wird es hier hektisch. Die Ankündigung geht demnächst raus.«
Die Fusion der beiden renommierten Kanzleien war ein noch längerer Prozess gewesen als die Locatelli-Scheidung, stand jetzt aber kurz vor dem Abschluss. In ein bis zwei Wochen würde Bette erreicht haben, worauf sie ihr Leben lang hingearbeitet hatte – Vollpartnerin in einer erfolgreichen Anwaltskanzlei zu sein –, und das bereits vier Jahre vor ihrem vierzigsten Geburtstag. So etwas gelang nur mit Zielstrebigkeit und harter Arbeit.
Bette ging zu ihrem eigenen Schreibtisch und studierte die Liste von Anrufen, die Oliver während des Termins mit den Locatellis entgegengenommen hatte. Nichts Dringendes war dabei, bis auf …
14.51, Anruf von Sophia Crowdie. Ihre Mutter würde gerne wissen, wann Sie in Barton Mill ankommen, und richtet Ihnen aus, dass Sie zu Hause ist.
Da war dieser Ausdruck wieder. Zu Hause. Bette wusste, dass ihre Mutter bereits in Schottland auf der Farm war, und fragte sich, wie es sich wohl für sie anfühlte, an den Ort zurückzukehren, an dem sie ihre Kinder großgezogen hatte. Im Gegensatz zu Bette war Sophia allerdings seit der Trennung von Bern häufiger dort zu Besuch gewesen. Die Beerdigung war zwar schon morgen, aber Bette hätte vor dem Abschluss des Locatelli-Falls keinesfalls verreisen können. Das hätte einen miserablen Eindruck gemacht, vor allem angesichts der nahenden Fusion und ihrer Beförderung. Außerdem war es Bette durchaus recht, so wenig Zeit wie möglich auf der Farm zu verbringen. Auf dem Weg zum Flughafen würde sie ihre Mutter zurückrufen, beschloss Bette.
»Die Buchungsbestätigung für den Flug sollte jede Minute bei Ihnen eintreffen«, rief Oliver von seinem Schreibtisch.
»Danke!«
Bette warf einen Blick auf ihr Spiegelbild im Fenster hinter ihrem Schreibtisch. Ihr kurzer Bob begann sich an den Enden leicht zu kräuseln, die aufsässigen chaotischen Locken, die sie mit so viel Mühe zu bändigen versuchte, leisteten wieder einmal Widerstand. Aber ihr Make-up saß tadellos, der dezente Lidschatten unter ihren gepflegten Brauen brachte die dunklen Augen perfekt zur Geltung. Bette sah genau so aus, wie sie aussehen wollte – beherrscht und effizient.
Ihr Handy vibrierte in ihrer Hand, als die Bestätigung für ihren Flug auf dem Display erschien. Beim Anblick des Flugziels beschleunigte sich Bettes Puls. Es gab wahrhaftig keinen Ort, an dem sie jetzt weniger gern sein wollte als auf der Crowdie-Farm über der Lunan Bay bei Arbroath, Schottland.
4
Frühmorgens wachte Bette von einem Albtraum auf, den sie jahrelang nicht mehr gehabt hatte. Von düsteren Ängsten verfolgt, hatte sie sich hin- und hergewälzt, bis sie endlich erwachte, schweißgebadet und in zerwühltem Bettzeug. Es dauerte einige Momente, bis sie merkte, dass sie sich in einem Hotelzimmer am Flughafen von Aberdeen befand, wo sie am Abend zuvor gelandet war. Keuchend starrte Bette an die Decke, wütend über die verstörende Leere, die jedes Mal nach diesem Traum einsetzte. Sie hasste dieses schreckliche Gefühl von Hilflosigkeit.
Als sie ihr Handy checkte, fiel ihr Blick als Erstes auf die Trauerrede für ihren Vater, über der sie abends eingeschlafen war. Nina hatte sie schon vor Tagen geschickt, mitsamt der Frage, ob Bette noch etwas hinzufügen wolle. Doch es war ihr zu schmerzhaft gewesen, sie zu lesen, zumal sie an dem Tag für Locatelli in Bestform hatte sein müssen. Beides zugleich schaffte sie einfach nicht. Bette hatte geantwortet, sie habe keine Zeit, aber Nina habe bestimmt alles toll gemacht. Auf die Nachricht wurde nicht reagiert. Das war ihr letzter Austausch gewesen, abgesehen von der knappen Aufforderung, Sophia nicht zu enttäuschen. Garantiert war Nina stinksauer, aber auch damit konnte Bette sich gerade nicht abgeben. Schon gar nicht heute.
Sie stand auf, duschte und zog ihr bestes schwarzes Kostüm an, dazu eine weiße Seidenbluse. Dabei dachte Bette wieder an den Albtraum. Es war nicht weiter verwunderlich, dass er sie gerade jetzt heimsuchte. Er tauchte immer bei akutem Stress auf, und an den Ort zurückkehren zu müssen, an dem sie aufgewachsen war, stand für Bette ganz oben auf der Stressliste. Tatsächlich hatte sie den Traum zuletzt gehabt, als sie vor einigen Jahren der Crowdie-Farm einen Besuch abgestattet hatte. Damals war Nina noch nicht dorthin zurückgekehrt, um als pflichtbewusste Tochter die Art von Leben zu führen, der Bette unter allen Umständen entgehen wollte.
Um kurz nach acht befand sie sich in ihrem kleinen Mietwagen schon auf der A90Richtung Süden, in der Hand einen starken Kaffee, auf der Nase die Sonnenbrille, ihren müden Augen zuliebe. Bette hatte kurz mit dem Gedanken gespielt, gar nicht zuerst zur Farm zu fahren, sondern direkt zur Beerdigung. Doch dann hatte sie beschlossen, dass es wohl keine gute Idee war, wenn das Wiedersehen mit ihrer Schwester – das so oder so verlaufen konnte – vor Menschen stattfand, die Bette kaum kannte oder an die sie sich nicht mehr erinnern konnte. Bern Crowdie war zeit seines langen Lebens ein beliebter Mann gewesen, und gewiss würden zu seiner Bestattung viele Freunde erscheinen.
Außerdem wollte Bette vorher ihre Mutter sehen. Sie hatten sich zuletzt an Ostern getroffen, als Bette über ein Wochenende in Neapel gewesen war, wo Sophia mit ihrem neuen Partner lebte. Der Mann wirkte ziemlich jung, bestimmt würde die Beziehung nicht lange halten. Aber für was galt das schon, und solange ihre Mutter glücklich war …
Die Crowdie-Farm lag vor Blicken verborgen oberhalb einer kleinen Ortschaft namens Barton Mill an der Strecke nach Dundee. In Stonehaven musste man auf die Küstenstraße A92 abbiegen und war dann noch etwa eine Stunde unterwegs.
Die Sonne machte dem schottischen Spätsommer alle Ehre und strahlte hell über den kleinen Ortschaften und grünen Feldern entlang der Strecke. Immer wieder sah Bette Stände, an denen man Erdbeeren kaufen konnte, für deren Anbau diese Region bekannt war. Hinter Stonehaven kam die pittoreske Silhouette von Dunnottar Castle auf der felsigen Landzunge über der Nordsee in Sicht, wo diese Burganlage seit dem Mittelalter thronte.
Bette strich sich eine Haarsträhne hinters Ohr. Sie näherte sich jetzt der Kleinstadt Montrose, wo sie zur Schule gegangen war, und überquerte die Flussmündung des South Esk. Als sie zu der Abzweigung kam, wo sie auf die Straße zur Crowdie-Farm abbiegen musste, wappnete sich Bette innerlich für die Begegnung mit der Vergangenheit. Diese Gegend kannte sie wie ihre Westentasche. Die schmale Straße, an der die Crowdie-Farm und die Bronagh-Farm lagen, war früher bei jedem Wetter ihr Heimweg von der Schule gewesen, nachdem der Bus sie abgesetzt hatte. Häufig hatte sie Nina im Schlepptau gehabt, obwohl Bette es gehasst hatte, ständig auf die kleine Schwester aufpassen zu müssen. Aber das war Bette als der Älteren nun einmal aufgetragen worden. In ihren späteren Jugendjahren war sie hier unterwegs gewesen, wenn sie von Freunden nach dem Ausgehen abgesetzt worden war. Und als sie ihren Führerschein gemacht hatte, war sie selbst diese Strecke gefahren.
Doch nein, sie würde jetzt auf keinen Fall an diese Zeit zurückdenken. Und schon gar nicht an die Person, die damals neben ihr gesessen hatte, obwohl ihr sein junges Gesicht deutlich vor Augen stand, vor allem nach dem nächtlichen Albtraum.
Bette fuhr weiter, vorbei an dem Feld zu ihrer Rechten, das vor dem Farmhaus endete. Es war ein großes Gebäude mit zwei Stockwerken und einem Dachboden, der sich über die gesamte Fläche erstreckte. Als Kind hatte Bette sich mit Vorliebe dort oben aufgehalten und durch die Fenster gespäht, wenn Stürme über dem Meer tobten. Hinter dem Haus befand sich ein betonierter Platz, den sie allmorgendlich überquert hatte, wenn sie die Hühner und Ziegen füttern ging. Das war damals ihre Aufgabe gewesen. Um diesen Platz waren die anderen Gebäude der Farm angeordnet: eine offene Scheune für den Traktor und andere Geräte sowie Melkschuppen und Milchkammer. Dahinter befanden sich die Erdbeerfelder und weitere Wiesen bis zur Steilküste. Bette fragte sich, wie weit die Erosion der Felsen wohl in zwei Jahrzehnten fortgeschritten war. Früher war ihr und Nina immer eingeschärft worden, niemals in die Nähe der Klippen zu gehen.
Die Farm kam in Sicht, und Bette fuhr langsamer. Auf der hellbraunen Schotterfläche vor dem Haus pflegten Besucher zu parken, und auch die vor dem schottischen Wind durch eine Holzveranda geschützte Haustür wurde nur von Gästen benutzt. Familienmitglieder und Freunde dagegen fuhren auf dem Asphaltweg weiter bis in den Hof und betraten das Farmhaus durch die Hintertür, die direkt in die Küche führte. Unwillkürlich fragte sich Bette, wozu sie nun zählte. Offiziell natürlich zur Familie, aber sie konnte nicht einschätzen, wie man sie empfangen würde. Nach kurzem Zögern entschloss sie sich aber, auf dem Hof neben dem alten Land Rover ihres Vaters und einem ebenso betagten zweitürigen roten Fiat zu parken, der vermutlich Nina gehörte.
Als Bette ausstieg, ging sie davon aus, dass man ihre Ankunft bemerkt hatte. Aber niemand erschien in der Hintertür, die durch einen unordentlichen Haufen Schuhe einen Spalt offen stand. Nichts schien sich zu rühren, obwohl die geräumige Wohnküche früher immer der Ort gewesen war, an dem sich alle aufhielten. Während Bette sich dem Haus näherte, nahm sie jedoch Geräusche wahr – quäkende Stimmen, Musik und Soundeffekte. Wahrscheinlich schaute sich ihr Neffe Barnaby, dem sie bislang nur zweimal begegnet war, einen Cartoon im Fernsehen an. Bette überlegte, wie alt der Junge inzwischen sein mochte. Bis sie endlich Oliver aufgetragen hatte, Barnabys Geburtstag zu vermerken, hatte sie ihn ständig vergessen, sicher sehr zum Ärger ihrer Schwester.
Bette trat über die Schuhe hinweg und schob die Tür weiter auf. Tatsächlich hielt sich niemand in der großen Küche auf, bei deren Anblick sich etwas in Bettes Magen zusammenzog. Der Raum sah fast genauso aus, wie zu der Zeit, als sie hier vor zwanzig Jahren gelebt hatte. Lediglich das alte Fernsehgerät, das auf einem Rolltisch gestanden hatte, war durch einen an der Wand fixierten Flachbildschirm ersetzt worden. Der jetzt auch die Quelle des Lärms darstellte, während grellbunte Bilder über den Monitor flackerten.
Der Fernseher schien auf den ersten Blick das einzig Neue im Raum zu sein. Die durchgesessene braune Ledergarnitur mit Sofa und zwei Sesseln hatte es damals schon gegeben, ebenso die von ihrer Großmutter Jean gehäkelte Wolldecke auf einer Armlehne. Die hellen Kiefernholzdielen waren ebenfalls unverändert, lediglich der niedrige Couchtisch mochte eine Neuanschaffung sein. Auf selbigem lagen ein angeknabberter Toast mit Marmelade (ohne Teller) und einige Legosteine. Die ganze Szenerie wirkte, als habe ein Kind überstürzt die Flucht ergriffen.
»Rrraaaaaarrrrrrggggghhhhh!«
Der wüste Kampfschrei, begleitet von erbostem Gebell, ließ Bette trotz des dröhnenden Fernsehers herumfahren. Eine kleine Gestalt, gekleidet in einen schwarzen Jogginganzug mitsamt Cape und Maske, kam durch den Korridor gerast, ein Lichtschwert drohend erhoben und gefolgt von einem kleinen Collie.
»Einbrecher!«, schrie die Gestalt, sprang mit einem Satz auf das Sofa und fuchtelte so wild mit dem Lichtschwert, dass es beinahe Bettes Nase traf. Der Hund stand seinem Besitzer zur Seite und hopste wild bellend neben ihm auf und ab. »Hinaus mit dir!«
»Barnaby?« Bette wich zurück und hob die Hände.
»So heiße ich nicht!«, kreischte der Junge und schwang weiter drohend das Spielzeug. »Du hast hier nichts zu suchen! Einbrecher!«
»Hör auf damit!« Um sich zu schützen, packte Bette das Plastikschwert und riss es ihrem Neffen aus der Hand – denn um ihn musste es sich zweifellos handeln. »Barnaby, ich heiße Bette. Ich bin deine Tante. Die Schwester deiner Mum. Beruhige dich, um Himmels willen!«
Beim Verlust seiner Waffe fing der Junge durchdringend an zu schreien. »Hilfe! Hilfe! Mum! Mummy!«
»Barnaby …«
Bette streckte die Hand aus, aber der Hund knurrte und sprang wild bellend auf sie zu.
Als die Hintertür so heftig aufgestoßen wurde, dass sie an die Wand knallte, fuhr Bette herum und sah eine junge Frau mit olivfarbener Haut, wilder schwarzer Lockenmähne und feurigen dunklen Augen auf sie zustürmen. Einen verwirrten Moment lang glaubte Bette, es wäre ihre Mutter, plötzlich wieder jung geworden. Aber Sophia erschien jetzt auch in der Tür.
»Nina!«, rief Bette aus, noch immer das Lichtschwert umklammernd. »Mum!«
Der kleine Superheld wurde in die Arme seiner Mutter gerissen, die Bette jetzt über seinen Kopf hinweg mit dem gleichen wütenden, trotzigen Blick bedachte, den sie schon als Fünfjährige gehabt hatte.
»Im Ernst jetzt?«, fauchte Nina. »Du schaffst es gerade mal, kurz vor der Beerdigung unseres Vaters aufzutauchen, und das Erste, was du machst, ist ein Kind zu verängstigen?«
»Was, ich?«, erwiderte Bette empört. »Als ich ankam, wurde ich sofort von diesem kleinen Raufbold angefallen!«
»Na klar«, konterte Nina abfällig und warf einen Blick auf das Plastikspielzeug. »Du warst auch echt in Lebensgefahr. Gut gemacht.«
»Mädels«, sagte Sophia Crowdie, die jetzt den Fernseher ausschaltete. In der plötzlichen Stille hörte Bette Barnaby am Hals seiner Mutter wimmern. Der Collie saß vor Ninas Füßen und blickte besorgt zu dem weinenden Kind hoch. »Jetzt atmen wir mal alle tief durch, okay?«
»Das kann sie machen«, entgegnete Nina und wies mit dem Kinn auf Bette, bevor sie mit Barnaby in den Armen hinausmarschierte, dicht gefolgt von dem Collie. »Ich habe zu tun.«
5
»Alles gut«, sagte Nina beruhigend, während sie Barnaby über den Hof trug. Es war erst kurz nach neun, aber in der Sonne wurde es schon heiß. »Das ist deine Tante Bette, Mummys Schwester. Als du sie zum letzten Mal gesehen hast, warst du noch klein.«
»Sie hat mein Lichtschwert geklaut«, murmelte der Junge an Ninas Schulter. Cams silberner Pick-up fuhr gerade auf den Hof.
»Du bekommst es zurück«, versicherte Nina ihrem Sohn und strich ihm über den Kopf. »Bestimmt hast du Tante Bette genauso erschreckt wie sie dich.«
»Alles okay?«, fragte Cam stirnrunzelnd, als er ausstieg.
»Ja, bis auf die Tatsache, dass meine Schwester eingetroffen ist und sie und Barney …«
»Superheld Seepocke!«
»… sie und Superheld Seepocke sich gegenseitig einen gehörigen Schrecken eingejagt haben.«
»Kann ich irgendetwas tun?«, fragte Cam und wuschelte dem Jungen durchs Haar, als Nina ihn absetzte. Cam war schon für die Bestattung gekleidet, trug einen dunkelgrauen Anzug, den Nina noch nie an ihm gesehen hatte. Die obersten Knöpfe des Hemds standen offen, aber in der Tasche steckte eine schwarze Krawatte. Nina blickte an sich herunter. Sie trug Jeans und ein gestreiftes T-Shirt, beides schmutzig, und hatte schwarze Fingernägel.
»Mum und ich haben gerade die Erdbeeren für Merson’s gepflückt«, antwortete Nina. »Jen wird jede Minute eintreffen, um sie für den Laden abzuholen. Sie stehen im Folientunnel, schon in Körbchen, aber die müssen noch in Kisten gepackt werden.«
»Mache ich«, sagte Cam und sah Barnaby an. »Hey, Superheld. Sieht aus, als hätten wir einen Notfall. Kann ich mich darauf verlassen, dass Superheld Seepocke am Start ist?«
Der Junge nickte eifrig. »Ich weiß genau, was zu tun ist«, verkündete er. »Folge mir!«
Erleichtert, dass das Bette-Drama vergessen schien, sah Nina ihrem Sohn nach, während er mit Limpet zum Folientunnel hinter der Scheune steuerte. Der Tag würde schon emotional genug werden, ohne weitere Zwischenfälle. Nina fühlte sich jetzt bereits so erschöpft wie normalerweise erst am Abend. Sie hatte nicht gut geschlafen.
»Erledige du deine Sachen«, sagte Cam, bevor er Barnaby folgte, der hinter der Scheune verschwunden war. »Ich beschäftige ihn.«
»Danke, Cam.«
Ihr Nachbar winkte ihr fröhlich zu, als er losmarschierte, und Nina fragte sich wie so oft, was sie ohne ihn nur tun würde.
Als sie in die Küche zurückkehrte, hatte Sophia den Wasserkocher eingeschaltet und war dabei, Tee zuzubereiten. Bette stand dicht neben ihr, was Nina überraschte. Sie hielt ihre Schwester für eine Person, die überall und immer auf Abstand blieb, einer Insel in einem Fluss gleich. Bette Crowdie schien niemanden an sich heranzulassen, körperlich wie emotional. Vielleicht hatte sie Freunde in London, aber ihre Familie erfuhr davon nichts.
Bette schaute auf. »Tut mir leid«, sagte sie, was Nina noch mehr wunderte. Mit einer Entschuldigung – die überdies aufrichtig wirkte – hatte sie nicht gerechnet. »Ich wollte Barnaby nicht erschrecken. Er wusste ja nicht, wer ich bin.«
»Was nicht weiter erstaunlich ist, nicht wahr?«
»Nina«, sagte ihre Mutter warnend, während sie die Teekanne füllte. »Bitte keinen Streit. Nicht heute.«
Nina zuckte mit den Schultern. »Okay. Du kannst ja später mit Barnaby reden, Bette, am besten ohne zu schreien. Und entschuldige dich dafür, dass du sein Lichtschwert gestohlen hast. Das hilft vielleicht.«
Ärger blitzte in Bettes Augen auf. »Ich habe es nicht gestohlen! Er hat es mir fast ins Auge gerammt. Und dieser Hund …«
»Mädels!«, sagte Sophia mit erhobener Stimme, bevor Nina etwas erwidern konnte. »Nina, möchtest du Tee?«
»Nein, ich habe noch zu viel zu tun. Ich muss duschen und mich umziehen, dann zur Kirche fahren, dort die Gottesdienstblätter abgeben, damit man sie an die Trauergäste verteilen kann, und auf dem Rückweg beim Caterer vorbeischauen, wo ich die restlichen Angelegenheiten für den Leichenschmaus kläre.«
»Kann ich irgendwie behilflich sein?«, fragte Bette.
Nina starrte sie an. »Kannst du irgendwie behilflich sein vor einer Bestattung, an deren Organisation du dich keine Sekunde beteiligt hast? Nein, Bette, kannst du nicht. Leg die Füße hoch und trink eine schöne Tasse Tee, um dich von den Strapazen deiner Reise in die Pampa zu erholen. Ich weiß, dass das bereits Anstrengung genug und der reinste Horror für dich ist.«
Mit diesen Worten marschierte sie hinaus und hinterließ ein betroffenes Schweigen.
Die Bestattung verlief organisatorisch reibungslos. Viele Freunde von Bern waren gekommen, die später bei der Trauerfeier über Erinnerungen an ihn sprachen und Geschichten aus der gemeinsamen Schulzeit vor über sechzig Jahren erzählten. Er wird hier fehlen, hörte man, und Bern Crowdie war ein ganz besonderer Mensch. Nina weinte und lachte und hielt Barnaby im Arm, der das gesamte Geschehen ziemlich verwirrend zu finden schien. Bette wirkte die ganze Zeit über gefasst, und Nina fragte sich, ob sie so beherrscht sein konnte, weil sie als Anwältin geübt darin war, oder ob sie vielleicht gar keine Gefühle hatte. Wahrscheinlich konnte sie es kaum erwarten, wieder abzureisen. Würde sie abends aufbrechen oder womöglich schon nachmittags? Nach der Feier direkt zum Flughafen fahren? Jedenfalls würde sie bestimmt keine Minute länger als notwendig bleiben wollen. Das war zwar einerseits traurig, für Nina aber auch eine Erleichterung. Das Leben hier war einfacher ohne Bette, sie verstanden sich ohnehin nicht gut. Das mochte an dem großen Altersunterschied liegen. Bette war zehn Jahre lang ein Einzelkind gewesen, bis Nina erschien, die von ihrer älteren Schwester offenbar lediglich als lästige Plage empfunden wurde. Das ließ sich im Nachhinein nicht mehr ändern. Nina wünschte sich nur, sie hätte das als Kind schon verstanden, dann wären ihr viel Sehnsucht und Enttäuschung erspart geblieben.
Die Trauergäste brachen nach und nach auf. Als die letzten gegangen waren, stellte sich jedoch heraus, dass Sophia andere Pläne für die Dauer von Bettes Aufenthalt hatte.
»Du bleibst doch bis Montag noch bei uns, oder?«, fragte sie Bette. »Ich bin auch so lange hier, und es gibt viel zu erzählen.«
»Mum!«, sagte Nina etwas schärfer als beabsichtigt.
Ihre Mutter sah sie fest an. »Was? Hast du vergessen, dass am Montag das Testament eröffnet wird? Bette sollte dabei sein.«
Nina sah ihre Schwester an. »Willst du das denn?«
»Um Wollen geht es an diesem Wochenende nicht«, antwortete Bette mit betonter Geduld, die Nina noch mehr auf die Palme brachte. »Mum hat mich letzte Woche angerufen und darum gebeten, dass ich mit zu dem Notartermin komme. Aber letztlich ist das nur eine Formsache, oder? Wir wissen doch, dass Dad die Farm komplett dir vererben wollte und ich einen Anteil von den jährlichen Einnahmen bekomme.«
Nina schnaubte. »Welche Einnahmen?«
Bette runzelte die Stirn und schien etwas sagen zu wollen, blieb aber stumm.
»Es gibt einen Grund, warum ich dich gebeten habe, dabei zu sein«, sagte Sophia jetzt, während sie begann, das Geschirr abzuräumen. »Euer Vater hat mich vor einigen Monaten angerufen, um mir mitzuteilen, dass er sein Testament geändert hat. In welcher Weise hat er nicht erklärt. Er meinte nur, er habe im letzten Jahr viel darüber nachgedacht.«
Das kam für beide Schwestern so unerwartet, dass sogar Bette bestürzt aussah. »Ich hatte ihm doch gesagt, er müsse das nicht machen«, murmelte sie.
»Und wann willst du ihm das gesagt haben?«, fragte Nina. »Da du ihn ja so häufig angerufen hast, um dich nach seinem Befinden zu erkundigen?«
»Nina«, mahnte Sophia.
»Was? Stimmt das etwa nicht?«
»Wir haben gemailt«, sagte Bette.
Nina glaubte, sich verhört zu haben. »Wie bitte?«
»Wir haben uns E-Mails geschrieben«, wiederholte ihre Schwester. »So sind wir in Verbindung geblieben. Manchmal wollte er mir Dinge mitteilen. Über die Farm.«