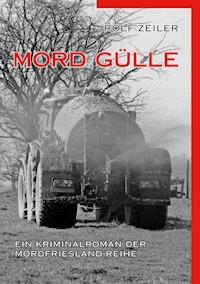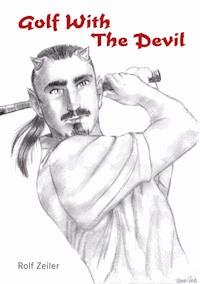Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein alter Chinese, der auf der ostfriesischen Insel Borkum eine Gärtnerei betreibt, findet nach einem heftigen Sturm über der Nordsee ein halb totes Mädchen am Strand. Er pflegt sie gesund und muss sich dabei den Dämonen aus seiner Vergangenheit stellen, die ihn seit den Ereignissen der chinesischen Kulturevolution plagen. Das Mädchen birgt ein zusätzliches, dunkles Geheimnis, das zu einer tödlichen Konfrontation mit einer gefährlichen Verbrecherbande führt. In seinem neuen „Ostfrieslandkrimi“ erzählt der Autor diesmal eine Doppelgeschichte. Er entführt den Leser in eine spannende Kriminalstory, die sich unaufhaltsam in der Gegenwart auf der schönen Nordseeinsel Borkum entwickelt, und unaufhaltsam mit der dramatischen Vergangenheit der Hauptfigur im fernen China verschmilzt. Die dunkle Zeit der kommunistischen Herrschaft ist noch heute ein Tabu-Thema in China. Es herrscht offizielles Schweigen, es gibt weder Gedenkfeiern noch eine Entschuldigung der Regierung für das verübte Unheil, das die kommunistische Partei über das Land gebracht hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 373
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Weitere Bücher vom Autor
Asia with Suit and Tie
Asien mit Anzug und Krawatte
Kopf hoch, Herbert, wenn der Hals auch dreckig ist!
Golf With The Devil
MordFriesland Serie:
Mord Hieve
Mord Gülle
Mord Asyl
Zum Gedenken an Wu Han, Historiker und Politiker, das erste Opfer der chinesischen Kulturrevolution von 1966 von 1976, und an die eineinhalb bis zwei Millionen Toten, 30 Millionen Verfolgten und 100 Millionen Menschen, die indirekt von den Exzessen betroffen waren.
Die Handlung und die Personen in diesem Roman sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen und Organisationen wären rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Der Mensch hat dreierlei Wege, klug zu Handeln, erstens durch Nachdenken, das ist das Edelste, zweitens durch Nachahmen, das ist das Leichteste, und drittens durch Erfahrung, das ist das Bitterste.
(Konfuzius)
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 1
1974, China, Guangzhou, an der Mirs Bay
Der Tag, an dem er seine seit Monaten geplante Flucht in die Tat umsetzen wollte, war endlich gekommen. Li Han Cheng hatte am Vormittag gezielt den Linienbus von Guangzhou nach Xichong, im Longgang-Distrikt von Shenzen in der Guanggong-Provinz, China, genommen. Die Strände Xichongs lagen im Dapeng-Nationalpark im Süden der Dapeng-Halbinsel, am Südchinesischen Meer, und waren ein beliebtes Ausflugsziel der Chinesen. Niemand würde hier den wahren Grund seines Ausflugs vermuten. Li fühlte sich sicher, es war alles Teil seines ausgefeilten Fluchtplans. Er verbrachte mit den vielen anderen Ausflüglern den Nachmittag am Strand und aß eine letzte warme Mahlzeit in einem der Fischrestaurants. Kurz nach Einbruch der Dunkelheit wanderte er zu einer schon Wochen vorher auskundschafteten Bucht, an die Mirs Bay. Die Mirs Bay trennte Chinas Festland von Hongkong. Unbehelligt und ohne Zwischenfall hatte Li Xichong schnell hinter sich gelassen und war über die karge Berglandschaft an die steinige, südliche Steilküste gelangt. Zweimal musste er jedoch einer Patrouille der chinesischen Volksarmee ausweichen, die die Küsten Chinas streng gegen Eindringlinge und Flüchtlinge, wie er einer war, bewachten. Nach anstrengenden Stunden des Wanderns war er, mithilfe eines Kompasses, an seinem Zielort angekommen. Li hatte die kleine Bucht bei seiner ersten und einzigen Exkursion, einige Wochen zuvor, entdeckt und sich ihre Lage genau eingeprägt. Die Bucht hatte er als ideal für sein Vorhaben empfunden und von hier plante Li, hinüber in die Freiheit nach Hongkong zu schwimmen.
Li Hang Cheng plagte nur ein für ihn unumstößlicher Gedanke: diesem so verhassten Regime, das ihm unsagbares Leid zugefügt hatte, endgültig zu entkommen. Er hatte alles, was ihm in seinem Leben lieb und heilig gewesen war, in China verloren. Jahrelang hatte er davon geträumt, ein neues Leben zu beginnen. Alles war bisher genauso verlaufen, wie er es vorher tausendmal ersehnt hatte. Nur eines nicht, er musste seine Flucht allein antreten.
Li hatte alles gut vorbereitet, sich keine Illusionen über die äußeren Bedingungen gemacht. Doch solch eine kühle, stürmische Nacht hatte er trotzdem nicht erwartet. Schwarze, drohende Wolken hingen dicht über dem wie endlos erscheinenden, tosenden Meer. Ein heulender Wind peitschte, mit wilden orkanartigen Böen, über das immer stärker aufschäumende Meer der Mirs Bay. Li konnte nur sehr wenig von der vor ihm liegenden, wie endlos erscheinenden Bucht ausmachen. Die zu schwimmende Distanz war plötzlich zu einer erschreckenden Route der Ungewissheit geworden. Die unheimlich wirkende, fast rabenschwarze Dunkelheit brachte zusätzliche Zweifel über das Gelingen seiner Flucht. Nur vereinzelt wurde der wolkenverhangene Himmel von ein paar wenigen, hoffnungsverheißenden Vollmondstrahlen durchbrochen. Das manchmal plötzlich auftauchende, gleißende Mondlicht schien dann in hellen senkrechten Lichtbalken durch die wenigen Löcher der dichten Wolkendecke. Die wild schäumenden Wellenkämme, die das tobende Meer in einem Poseidonschen Spektakel offenbarte, ließen das Blut in Lis Adern gefrieren. Es erfüllte Li mit dem Gedanken, ob er sich nicht doch zu viel zugemutet hatte und ob das zu erwartende Abenteuer erfolgreich enden würde. Er war ein guter Schwimmer, fast jeden Tag war Li, um sich auf diesen einen Tag vorzubereiten, zur Übung zehn Kilometer im Perlfluss geschwommen. Aber alles, was er jetzt fühlte, war eine langsam aufsteigende, innerliche, ungewollte Furcht, die ihm die Luft abzuschnüren drohte. Er sah, wie die gewaltigen Wellen aus kaltem, alles mitreißendem Wasser wie mächtige Stahlwalzen unermüdlich von der rauen, mit Schaumkronen übersäten See heranrollten. Wie diese mit ihrer gewaltigen Urkraft die Steilküste in ein gischtsprühendes Inferno verwandelte. Die gigantischen Brecher türmten sich immer wieder furchterregend mehrere Meter hoch vor ihm auf, warfen Treibgut und andere im Wasser treibende Dinge mit brachialer Gewalt gegen die Felsen. Er wischte letzte quälende Panikattacken beiseite, machte sich Mut. Es gab für ihn kein Zurück mehr; Sieg oder Tod waren seine einzigen Alternativen.
Li packte seine wenigen Habseligkeiten in eine mitgebrachte, wasserdichte Haut, band diese an seinem Gürtel fest und warf sich todesverachtend in die eisigen Fluten. Zuerst dachte er, die Kraft der Strömung wäre zu groß und er würde es nicht schaffen, doch unbeirrt schwamm er Meter für Meter, entfernte sich stetig von der Küste. Von einem Land, das er liebte, aber das von einem ungerechten Regime regiert wurde, welches er hasste. Ein in seinen Augen bösartiges Regime, das ihm seine Zukunft genommen hatte. Er hatte für sich entschieden, es war ein grausames politisches System, das es ihm unmöglich machte, jemals wieder in das Land seiner Vorfahren zurückkehren. Li hatte sich vorm Sprung in die Fluten der Mirs Bay geschworen, solange die Kommunisten an der Macht waren, nie wieder einen Fuß auf chinesischen Boden zu setzen.
Unermüdlich bewegte Li einen Arm vor dem anderen, schwamm in Richtung einer Freiheit, von der er keinerlei Vorstellung hatte. Er wusste nur so viel von Hongkong, dass dort sein Großvater und die Familie seines Onkels lebten. Sie würden ihm schon helfen, da war er sich sicher, ein neues Leben zu beginnen.
Nachdem er mehr als vier Stunden geschwommen war, setzten die ersten Krämpfe ein. In der Ferne konnte er erstmals schemenhaft kleine Lichter ausmachen. War es schon die Küste Hongkongs oder vielleicht nur ein paar Fischerboote, die in der Nacht ihr Glück nach dem großen Fang suchten? Dann schoss es ihm durch den Kopf, es könnte auch eins der wenigen Küstenschutzboote der chinesischen Marine sein, die nach Flüchtlingen im Wasser suchten. Lieber wollte er ertrinken, als von einem Patrouillenboot aufgenommen zu werden. Li wusste nur zu gut, er durfte ihnen nicht in die Hände fallen, es würde sein Todesurteil oder jahrelange Haft in einem der Arbeitslager bedeuten. Er hatte es am eigenen Leib erfahren, was es hieß, in einem chinesischen Arbeitslager zu leben. Auch wenn die Jahre, die er unfreiwillig auf dem Land verbracht hatte, nicht als Arbeitslager bezeichnet wurden, waren sie dennoch nichts anderes gewesen. Der Gedanke an das Erlebte in seiner Heimat war zu überwältigend; er konnte, durfte es nicht noch einmal erdulden. Es machte ihn traurig und er zweifelte plötzlich, ob es überhaupt einen Sinn für ihn machte, zu überleben. Was gab es wirklich noch für ihn, allein in dieser Welt? Li musste dabei an Yan Yi, die große Liebe seines Lebens, denken, wie wunderschön sie gewesen war. Ihre leicht hohen Wangenknochen waren wohlgeformt gewesen und ihre Haut hatte die Farbe eines hellen Marmors. Er erinnerte sich, dass ihre Augen, schwarz, groß und oval, immer lustig strahlten, wenn etwas Schönes ihre Gedanken streifte. An ihren Mund mit den weichen kleinen roten Lippen, der, wie kein anderer, diesen ewig zum Küssen animierenden Schmollmund formen konnte. Alles war eingerahmt mit tief in den Rücken reichenden langen, schwarzen Haaren. Sie war ein Blickfang gewesen, der jedes Männerherz höher schlagen ließ. Die Vorstellung ihrer schlanken, zierlichen Figur, die trotz der einfachen Kleidung, eines Mao-Anzugs, ihre anmutigen Bewegungen betonte, raubte ihm fast den Verstand. Li hatte Yan Yi über alles geliebt und sie ihn auch. Sie waren glücklich gewesen, bis zu jenem Tag, an dem sie so tragisch sterben musste. Er würde die Bilder ihres geschundenen, leblosen Körpers niemals vergessen können. Geplagt von den schmerzlichen Erinnerungen des Verlustes und der ihn lähmenden Traurigkeit wurden seine Schwimmzüge weniger und weniger, Li ließ sich alsbald einfach nur noch treiben und begann, ohne es wirklich zu realisieren, langsam zu sinken. Er hatte plötzlich keine Angst mehr, blickte noch einmal zur Wasseroberfläche zurück und sank tiefer und tiefer, vereint mit den immer schwächer werdenden letzten Lichtstrahlen, die die Oberfläche durchdrangen.
Li hörte in seinen Gedanken plötzlich Yan Yis Rufe. „Li, wach auf“, rief die Stimme. „Li, du kannst jetzt nicht loslassen, du hast es mir versprochen, mit mir nach Hongkong zu fliehen. Ich bin doch hier bei dir, mein Liebster, öffne deine Augen.“
Die flehenden Worte, die er in seinem Unterbewusstsein hörte, rissen ihn jäh aus seiner Apathie. Es war wie eine gefühlte Ewigkeit gewesen, die sein Gleichmut ihn hatte abwärts gleiten lassen, aber in Wirklichkeit waren nur wenige Sekunden vergangen. Li befand sich schon mehrere Meter unter der Wasseroberfläche, öffnete seine Augen und konnte gerade noch einen letzten Mondstrahl Licht ausmachen. Dann sah er aus dem Augenwinkel im trüben Wasser einen großen grauen Schatten langsam auf sich zukommen. „Hai“ war sein erster Gedanke, denn er wusste, all die Gewässer um Hongkong waren mit diesen Räubern der Meere verseucht. Viele seiner Vorgänger hatten es wie er versucht, Hongkong schwimmend durch die Mirs Bay zu erreichen, und waren den mörderischen Raubfischen schon zum Opfer gefallen. Deshalb fuhren in der Mirs Bay auch nur so wenige Patrouillenboote des chinesischen Küstenschutzes. Die gefräßigen Haie waren ein wesentlich besserer, natürlicher Schutz gegen die Volksrepublikflüchtlinge. Li hatte mit dem Leben abgeschlossen und erwartete den tödlichen Angriff des Hais. Was sich ihm im Wasser näherte, war aber kein Haifisch, sondern ein junger Delfin. Der Meeressäuger beäugte Li, stupste ihn mit seiner Schnauze leicht an, bevor er ihn vorsichtig, ganz behutsam, zur Oberfläche zurück bugsierte. Lis Lungen füllten sich mit Sauerstoff, sein Lebenswille kam mit unbändigem Willen zurück.
Der Sturm hatte sich etwas gelegt und gleißendes Mondlicht schien durch eine einzige Wolkenlücke am Himmel direkt auf das Meer um ihn herum. Das Wasser leuchtete plötzlich in einem kreisrunden Kegel grünen Lichtes. Es begann mit jeder Bewegung, die er mit den Armen oder Beinen machte, stärker zu leuchten. Für Li war es in dem Moment der Beweis, dass es höhere Dinge zwischen Himmel und Erde gab. Viele Jahre später las er dann einmal in einem Tauchmagazin, dass dieses Phänomen des grünen Meeresleuchtens durch Bewegungsreiz von Mikroorganismen im Wasser ausgelöst wird. In dem Augenblick, damals in der Mirs Bay, wusste er es nicht besser. Für ihn war es ein Omen.
Li drehte sich ein paarmal im Wasser, hielt Ausschau nach seinem Retter. Doch von dem kleinen Delfin gab es weit und breit keine Spur mehr. Sein so plötzlich aufgetauchter Helfer war so schnell verschwunden, wie er gekommen war. Eventuell hatte er ihn auch nur geträumt und in Wirklichkeit war es Yan Yis Geist gewesen, dachte er sich. Sie wollte, dass er lebte, überlebte, er durfte ihr Zeichen, ihren Wunsch nicht missachten. Die Erkenntnis gab ihm neue Kraft, vitalisierende Energie durchströmte seinen erschöpften Körper und Li mobilisierte noch einmal alle verbliebenen Reserven. In der jetzt nicht mehr allzu weiten Ferne erhellten die unzähligen Lichter Hongkongs jetzt die Nacht. Yan Yi gab ihm den Willen, wieder einen Arm vor den anderen zu nehmen, in die so lange ersehnte Freiheit zu schwimmen.
Nach etwa weiteren drei Stunden und mehr als insgesamt sieben Stunden beharrlichen Kampfes gegen die unbarmherzigen Elemente hatte er es geschafft. Am Morgen des sonnigen 16. Oktober 1974, ausgelaugt, erschöpft und mit zerschundenen Knochen, erreichte Li die lang ersehnte Küste der Hongkong New Territories.
Er war endlich in Freiheit!
Kapitel 2
2017, September, vor der holländischen Küste auf der Nordsee
Jens Haldermark hielt sein billiges grünes Plastikfeuerzeug unter den vom wiederholten Erhitzen schon leicht angeschwärzten Löffel. Die leicht braune Flüssigkeit im Löffel begann langsam zu zischeln und köcheln. Danach nahm er behutsam eine handelsübliche Einwegspritze vom Tisch und füllte sie mit der heißen Flüssigkeit. Er drückte die wenige verbliebene Luft aus der Nadel, bis nur noch die alles versprechende Drogenmixtur aus der Spitze tröpfelte. Mit der aufgezogenen Spritze ging er langsam hinüber zur Koje im Achterdeck, auf der, in einer freudigen Erwartungshaltung, ein schwarzhaariges Mädchen saß. Sie war noch so jung, viel zu jung, um an diesem elenden Dreckszeug zu sterben, dachte sich Jens. Doch es lag nicht in seinem Ermessen, er führte nur diese Scheißbefehle aus. Er hatte Mitleid mit dem Mädchen, das nur mit einem knappen blauen Bikini und einem passenden Badetuch bekleidet gequält, glücklich, ihren Heilsbringer anstrahlte. Sie konnte es kaum abwarten, ihre geißelnde Sucht zu befriedigen. Voller Ungeduld streckte sie ihm ihren Fuß entgegen und bettelte mit weinerlicher, flehender Stimme.
„Mach doch endlich, Jens, ich brauche es jetzt, du hast es mir versprochen.“
„Nun warte doch ab, Laura, es ist ja alles gut, ich bin doch schon hier. Nur noch einen Moment, meine Kleine, und dann kann deine Reise ins Nirvana losgehen“, sagte der junge Mann mit einer beruhigenden Stimme zu dem Mädchen, als er sich neben sie auf die Kojenkante setzte.
Er lächelte das schwitzende Mädchen voll Mitgefühl an und wedelte mit der aufgezogenen Spritze, worauf sie ihm mit dankbarem Blick ihren rechten Fuß auf den Schoß legte. Jens setzte behutsam die dünne, feine Nadel zwischen die kleinen rot lackierten Zehen und drückte bedächtig das Rauschgift in eine ihrer Venen. Das Mädchen schaute ihm dabei mit einem entseelten Blick aus ihren grünen Augen, die tief in dunkel umrandeten Höhlen lagen, zu. Als das Heroin seine ganze Wirkung entfaltete, verwandelte sich auch zusehends, wie durch Magie, ihr vorher noch gequälter Gesichtsausdruck. Jens blickte auf einmal wieder in das glückliche und zufriedene Antlitz des jungen Mädchens, welches er in Hamburg an Bord genommen hatte. Wohlig seufzend drehte sich das Mädchen mit dem Namen Laura langsam, sich rückwärts legend, auf das Kojenkissen. Entrückt ins Nirgendwo, in ihrem Rausch der Sinne, lächelte sie träumerisch.
Jens warf einen letzten Blick auf das Mädchen in der Koje, das sich jetzt high und traumverloren weltlichen Einflüssen entzogen hatte. Er begab sich zurück in die Kajüte und schniefte selber etwas Kokain. Er war kein Fixer und hatte höllische Angst vor Heroin sowie vor den Folgen einer Sucht. Auch Kokain nahm er nur sehr selten, doch er war in der Lage, gute Qualität von billigem verschnittenem Stoff zu unterscheiden. Jens freute sich über die äußerst hervorragende Qualität des Stoffes, den er an Bord schmuggelte. Er wusste auch, dass davon beim Endverbraucher auf der Straße nicht mehr viel ankommen würde. Die Dealer würden vorher alles Mögliche hineinmischen, um das Zeug zu strecken, den Profit zu erhöhen. Der reine Stoff kam auf allen möglichen Wegen nach Deutschland, zu Luft, über Land oder, wie in seinem Fall, zu Wasser. Nachdem das Kokain erst einmal im Land und mehrfach gestreckt worden war, brachte das Zeug eine Unmenge an Geld ein. Jens’ Auftraggeber in Hamburg regelte dies alles, damit hatte er nichts am Hut, er war nur für den Transport aus Holland nach Deutschland zuständig. Er fragte sich manchmal, wie er nur in diesen ganzen Schlamassel hatte geraten können und ob er je wieder herauskommen würde. Es war ein mitleidloses Geschäft mit den Seelen der User, ein sehr lukratives Geschäft, von dem er auch nicht ganz unfreiwillig profitierte. Jens hatte genug Erfahrung mit Drogen, um zu wissen, dass sie keine Antworten auf Probleme des Lebens gaben. Es interessierte ihn auch wenig, denn seine wirkliche Droge war das Segeln auf den offenen Weltmeeren.
Jens war in Hamburg in einem gutbürgerlichen Hause aufgewachsen. Seine Eltern sowie Großeltern und Vorfahren waren schon immer angesehene Kaufleute in Hamburg gewesen. Jens Haldermark war 32 Jahre alt, athletisch gebaut und etwas über 1,85 Meter groß. Er trug seine blonden Haare kurz geschnitten und sein markantes Gesicht zierte ein ewiger, aber so gewollter Dreitagebart. Seine hellblauen Augen sowie eine ovale Gesichtsform machten ihn zu einem sehr gut aussehenden jungen Mann, dem die Frauen zu Füßen lagen. Er hielt nicht viel von dem Spießertum seiner Eltern und Geschwister, er war das schwarze Schaf der Familie. Es hatte alles angefangen mit seinem abgebrochenen Jurastudium und dem daraus resultierenden Bruch mit seinem patriarchalischen Vater. Mit seiner schon in frühen Jugendjahren entdeckten Liebe zum Segeln, dem Meer, dem Wind und der Sonne kaufte er sich von dem Geld, das sein Großvater ihm vererbt hatte, ein gebrauchtes Segelboot. Es war aber mehr als ein kleines Segelboot, man konnte es mehr als eine Segeljacht bezeichnen. Jens konnte mit Stolz eine Bavaria 36 Avantgarde, die zu seinem neuen Zuhause wurde, sein Eigen nennen. Mit ihr segelte er mehrfach um die halbe Welt, bis ihm eines Tages das Geld knapp wurde. Mit seiner Familie zerstritten und mittellos, lernte er Frank Martens, einen Hamburger Drogendealer und Zuhälter im großen Stil, kennen. Jens hatte vorher niemals etwas mit einer kriminellen Gesellschaft zu tun gehabt und wusste nicht, auf was er sich eingelassen hatte. Frank Martens hatte ihn angestiftet, seine finanzielle Situation ganz einfach aufbessern zu können, indem er mit seinem Segelboot für ihn Drogen von Holland nach Hamburg transportierte. Am Anfang dachte er sich nicht allzu viel dabei und die ersten Fahrten waren einfach, brachten ihm schnell das dringend benötigte Geld für notwendige Bootsreparaturen und lang ersehnte Segeltörns für den Winter im Mittelmeerraum. Die Sorglosigkeit der gelegentlichen Fahrten hielt nicht lange an. Es folgte sehr schnell Frank Martens’ erpresserischer Zwang, immer wieder neue Schmuggeltörns zu übernehmen, ob Jens damit einverstanden war oder auch nicht. Der Gangster ließ ihn nicht mehr aus seinen Klauen. Mit seinem Wissen konnte Jens nicht zur Polizei gehen, ohne sich selber zu belasten. Das wäre für ihn aber das kleinere Übel gewesen, doch Frank hatte ihm einmal gedroht, er würde ihn sowie seine Familie umbringen, wenn er jemals mit dem Gedanken spielte, vor der Polizei auszupacken. Wie ernst es der Verbrecher mit seiner Drohung nahm, bewies er Jens während eines gemeinsamen privaten Segeltörns. Er hatte mit ansehen müssen, wie Frank Martens, vor seinen Augen, einen Mann erschoss. Der Mord geschah auf seinem Boot bei einem Segeltörn vor Sylt, den Martens eigens für ein paar sogenannte gute Freunde arrangiert hatte. Sie waren zu fünft an Bord seines Seglers gewesen, Frank Martens, seine Schergen Leon Bratcke, Klaas Reimann und ein Typ namens Igor Vestojk. Nach ein paar harten Drinks, einigen Linien Koks und einer fröhlichen Stimmung an Bord nahm Frank plötzlich einen Revolver und schoss Igor Vestojk ohne Vorwarnung in den Kopf. Den Leichnam beschwerten seine Kumpanen anschließend mit einem Anker und versenkten ihn zusammen mit dem Revolver im Meer.
„Mitgefangen, mitgehangen“, hatte Martens ihm danach, grausam lächelnd, ins Ohr geflüstert. Damit war alles gesagt gewesen, ohne groß eine Wahl zu haben, schipperte Jens weiter die Drogen von Holland nach Hamburg. Es lief immer nach dem gleichen Schema ab. Frank brachte vor jedem Törn ein oder zwei junge Mädchen aus einem seiner Klubs an Bord. Sie sollten, wie er es nannte, zur sexuellen Imagetarnung auf dem Boot mitsegeln. Es sollte Jens das Image eines Playboys geben. Ein Segler, der, um seinen sexuellen Appetit zu befriedigen, immer wieder neue junge Mädchen auf seinen Segeltörns mitnimmt. Jens war sich aber darüber im Klaren, dass es sich dabei indirekt für ihn auch um kleine unschuldige Aufpasser handelte. Denn die Mädchen mussten tagtäglich mit Martens telefonieren, um ihm Bericht zu erstatten. Zum anderen störte es ihn keineswegs, die Mädchen waren sexy und, noch viel wichtiger, immer sehr willig. Er hatte mehr Sex auf dem Wasser, als er jemals an Land gehabt hatte. Die meisten Zollbootführer kannte ihn schon und grinsten immer nur von einem Ohr zum anderen, wenn sie ihn anliefen. Die anschließende Kontrolle fiel, wenn überhaupt, jedes Mal nur äußerst oberflächlich aus.
Einmal wollte Jens im Sommer mit Freunden einen privaten Segeltörn nach Norwegen machen. Als er sich weigerte, zu demselben Termin eine Schmuggelfahrt zu übernehmen, fand er nach einem Landgang sein Boot total verwüstet. Sämtliche nautische Bordelektronik war zerschlagen und auf dem Tisch in der Kombüse stand ein voller Kanister mit Benzin. Die Message war so klar wie eindeutig, es gab für ihn keine Wahl. Jens machte die Fahrt, wenn auch widerwillig. Vorher ließ Frank die ganze Schiffselektronik als eine großzügige Geste der Wiedergutmachung und Versöhnung auf seine Kosten aufwendig erneuern. An dem Tag war Jens so richtig bewusst geworden, er war Frank Martens’ Sklave, ein Gefangener seiner dunklen Machenschaften.
Es wird ein Sturm aufkommen, dachte er sich, als er an Deck stand und über die wolkenverhangene Nordsee schaute. Der Wind frischte auf, Schaumkronen bildeten sich vermehrt über dem Meer und erste kleinere Gischtfahnen der graugrünen Wellen sprühten die Bordwand hoch. Er verspürte keinerlei Angst vor dem heraufziehenden Sturm, er liebte die See, den Geruch von Salz und Meer, die Herausforderung mit den Elementen der Natur. Jens verstaute die Drogenutensilien aus der Kabine bei den anderen Drogen, in dem eigens von ihm gebauten Hohlraum unter dem Hilfsdiesel. Kein Zollfahnder der Welt würde jemals sein Versteck finden, kein Hund der Welt konnte dort die Drogen erschnüffeln. Der starke, alles überlagernde Geruch von Diesel und Öl im Motorraum war einfach zu überwältigend. Außerdem lag das gute Versteck direkt unter der Motoraufhängung in einem luftversiegelten Zwischenboden, verdeckt durch eine massive, falsche Motorträgerplatte. Auch bei einer genauen Inspektion an Land war es äußerst fraglich, dass irgendjemand seine geniale Vorrichtung würde enttarnen können. In der Kabine des Bootes säuberte er alles, was mit Drogen in Berührung gekommen war, mit einem nach frischen Zitronen riechenden Desinfektionsmittel, warf anschließend den Löffel über Bord und sprühte die Kabine nochmals intensiv mit einem Luftreiniger ein. Erst als alles zu seiner Zufriedenheit erledigt war, kümmerte er sich um die hereinkommenden, vor dem nahenden Sturm warnenden Wettermeldungen. Er überlegte noch kurz, ob er in Holland oder Borkum einen abwartenden Zwischenstopp einlegen oder einfach bis Hamburg durchsegeln sollte. Er entschied sich dann am Ende, nach Hamburg weiterzusegeln. Ein Grund für ihn war dabei auch, dass er nicht noch einmal das Bitten und Betteln des Mädchens nach einem weiteren Schuss Heroin ertragen wollte. Was hatte sich Frank Martens nur dabei gedacht, als er ihm diesmal ein drogenabhängiges Mädchen an Bord brachte, überlegte er vorwurfsvoll. Sie konnte die ganze Aktion gefährden mit ihrer offensichtlichen Sucht.
„Das ist meine kleine süße Laura“, hatte Frank Martens sie ihm in seiner angeberischen Art vorgestellt. „Pass gut auf sie auf, sie ist mein bestes Pferd im Stall. Ich möchte nicht, dass ihr etwas zustößt. Bring sie mir ja heil wieder zurück nach Hamburg.“
Jens konnte es sich nur so erklären, dass Martens keine Ahnung von ihrer Drogensucht hatte. Zu Anfang hatte er auch selber nichts gemerkt, aber nachdem sie mehrmals guten Sex gehabt hatten, erwischte er, rein zufällig, Laura dabei, wie sie sich eine Injektion zwischen die Zehen setzte.Total außer sich, nahm er ihr die Drogen ab und wollte sie schon in Amsterdam von Bord schmeißen. Doch dann erfolgte ein einziger Anruf von Martens. Dieses eine Telefonat des Verbrechers genügte, um Jens’ Meinung zu ändern. Das Mädchen, wurde ihm befohlen, musste mit dem Segelboot nach Hamburg zurückgebracht werden. Welch ein Wahnsinn und was für ein großes Risiko. Ein einziger Blick eines erfahrenen Zollbeamten in ihr drogenvernebeltes Gesicht würde genügen und sie würden das ganze Boot auseinandernehmen. Es blieb ihm auch nichts erspart, dachte er sich, und jetzt musste er auch noch den herannahenden Sturm meistern.
Jens wusste, es würde eine sehr harte Nacht werden, aber was sollte es, er hatte schon schlimmere Stürme auf See gemeistert. Irgendwie freute er sich sogar auf den kommenden Kampf mit der wilden, rauen Nordsee. Es würde ihn von seinen Sorgen ablenken. Außerdem war er sich hundertprozentig sicher, er würde wie immer als der Sieger aus dem Schlamassel herauskommen.
Kapitel 3
2017, September, auf der Insel Borkum, zur gleichen Zeit
Am östlichen Strand von Borkum, geschützt hinter den Sanddünen, lag die Gärtnerei des alten Chinesen, Li Han Cheng. In den ganzen Jahren, die er jetzt schon auf Borkum lebte, sowie auch heute verbrachte der alte Mann die meiste Zeit allein in seinem schönen Gewächshaus mit seinen auserkorenen Lieblingspflanzen. Li beugte sich über eines seiner Bonsaibäumchen, die er liebevoll, zwischen seinen vielen verschiedenen Orchideenarten, in einer kunstvoll gestalteten Schale züchtete. In der rechten Hand hielt er eine Nigri-Schere. Es war eine pinzettenähnliche Schere mit kleinen Messern an der Vorderseite, die für den feinen Blattschnitt diente. Immer wieder knipste er sorgsam winzige Blätter aus dem Miniaturbaum, bis er voller Zufriedenheit sein Werk betrachtete und die Schere gegen eine Jin-Zange tauschte und vorsichtig damit die Rinde des winzigen Baumes abzog. Diese ganz spezielle Technik wendete er an, um den Bonsaibaum künstlich zu altern. Er arbeitete an einem sogenannten „Okan“, einem Zwillingsstamm, die Form, die bei Bonsailiebhabern auch „Vater und Sohn“ genannt wird. Der erste Seitenast entspringt bei dieser Form sehr tief und bildet einen eigenen Baum, den Sohn, dessen Stamm deutlich niedriger und dünner ist als der des Vaters, der höher liegt. Beide Äste bilden optisch eine Einheit, deshalb spielen die Astanordnung und die Formung der gemeinsamen, spitzwinkligen Krone eine große Rolle. Die heute meist bekannten Bonsaibäume werden häufig im japanischen Stil gezüchtet, der sich Anfang des frühen 20. Jahrhunderts herausbildete. Doch Li wusste nur zu gut, die Bonsaikunst war viel älter und entstammte in Wirklichkeit der Gartenkunst des Kaiserreiches China. Schon in der frühen Han-Dynastie, um 206 bis 220 nach Christus, wurden bereits ganze künstliche Landschaften mit Seen, Inseln und bizarren Felsformationen in Palastgärten der Kaiser nachgestaltet. Der Mythologie nach lebte in dieser Zeit der Zauberer Jiang-Feng, der die Fähigkeit besaß, ganze Landschaften mit Felsen, Wasser, Bäumen, Tieren und Menschen verkleinert auf ein Tablett zaubern zu können. In dieser Epoche entstand offenbar die Kunst „Penjing“, das aus den chinesischen Wörtern „Pen“ für Schale und „Jing“ für Landschaft zusammengesetzt war. Li war stolz auf die alte traditionelle chinesische Kunst und auf alles andere auch, was mit der alten Kultur der Chinesen im Zusammenhang stand. Er war ein begeisterter Verehrer von Konfuzius, Laozi, Mozi und der „Fünf-Elemente-Lehre, Yin und Yang“.
Er verabscheute aus tiefer Überzeugung den Marxismus und das radikale Umdenken nach der Gründung der Volksrepublik China, die verachtenden kritischen Auseinandersetzungen mit den chinesischen Traditionen, durch die Kommunisten.
Der alte Chinese, Herr Li, wie ihn die Inselbewohner höflich nannten, oder kurz Li, wie ihn seine Freunde riefen, lebte jetzt schon mehr als dreißig Jahre zurückgezogen in Ostland, auf der größten ostfriesischen Insel, Borkum. Anfang der achtziger Jahre, im May 1981, um genau zu sein, war er plötzlich eines Tages auf dem Inselamt aufgetaucht und hatte sich als der neue Besitzer eines alten, heruntergekommenen Anwesens auf der östlichen Seite der Insel eintragen lassen. Li konnte sich noch sehr gut, als ob es gestern gewesen wäre, an den Tag erinnern. Der wie immer gelangweilte mürrische Inselbeamte Jakob Bartmann staunte damals nicht schlecht, als er den hochgewachsenen Chinesen mittleren Alters, mit dem Ordner amtlicher Dokumente in den Händen, am frühen Morgen vor sich stehen sah. Nicht nur, dass Li ihn mit nahezu perfektem Deutsch ansprach, zu seiner totalen Verblüffung kam hinzu, dass der Chinese obendrein auch noch einen deutschen Pass besaß, ausgestellt auf den Namen Li Han Cheng. Argwöhnisch beäugte er den in einem schwarzen, für ostfriesische Verhältnisse äußerst ungewöhnlichen Aufzug vor ihm stehenden Mann. Um Jakob Bartmanns mentales Chaos komplett zu machen, wollte der Chinese sich außerdem als neuer Einwohner der Insel amtlich registrieren lassen. Als Li dem Beamten sein Anliegen freundlich lächelnd eröffnete, glaubte Jakob Bartmann zuerst an einen lustigen Scherz seiner Kollegen vom Amt. Doch schnell merkte er, es war dem Mann ernst mit seinem persönlichen Antrag. Viele Jahre später und nachdem er und Li schon lange Zeit Freunde geworden waren, hatte er Li einmal bei einem steifen Grog seine damaligen Gedanken gebeichtet. Jakob Bartmann konnte es sich zu jener Zeit einfach nicht vorstellen, warum ausgerechnet ein Chinese sich auf Borkum niederlassen wollte. Für ihn gab es keine Frage, es konnte also etwas nicht stimmen, aber auch nach einer intensiven Überprüfung aller vorgelegten Dokumente gab es absolut nichts zu beanstanden. Sie waren ohne jeglichen Zweifel einwandfrei korrekt, der beglaubigte und notariell gestempelte Kaufvertrag für das Haus und das Grundstück, vollkommen in Ordnung. Li sagte ihm, er hatte Verständnis für seine damalige Skepsis gehabt. Er erklärte ihm daraufhin, dass Jakob mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der gleiche Unglauben widerfahren wäre, wenn er in China auf dem Meldeamt mit einem chinesischen Pass auftauchen würde. Beide mussten bei der grotesken Vorstellung herzlichst lachen.
Beim anschließenden Besuch der Inselbank für eine Kontoeröffnung erging es Li nicht viel anders. Erstaunt, aber pflichtgemäß füllte der Bankbeamte, Jan Münkens, nach mehrfacher Rücksprache mit seinem nervös wirkenden Filialleiter, Albert Meier, und dessen wiederholtem, zustimmendem Kopfnicken die notwendigen Formulare aus. Nachdem das Konto ihm zugeschrieben war und alles nach deutscher Gründlichkeit seine Richtigkeit hatte, fiel beiden die Kinnlade runter, als Li dann auch noch seiner Aktentasche 20 000 US-$ in bar entnahm und auf sein frisch eröffnetes Konto einzahlte. Li lächelte immer nur freundlich. Er kannte die Deutschen, nachdem er fünf Jahre in Hamburg gelebt hatte, mittlerweile recht gut, liebte ihre manchmal etwas steif wirkende Korrektheit, die Pünktlichkeit und die Korruptionslosigkeit. Die Deutschen waren freundlich, es gab kaum Rassisten und alles hatte seine Ordnung im Land. Er fragte den Bankbeamten, Jan Münkens, anschließend noch nach einem guten Notar auf Borkum. Der gab ihm dann die Adresse von Johann Klever, dem damals einzigen Anwalt und Notar der Insel.
Li bekam noch am gleichen Tag, ohne weitere Probleme, einen Termin beim empfohlenen Anwalt. Seinem eigenen Anruf musste wohl ein anonymer Tipp vorausgeeilt sein. Denn es schien Li gerade so, als ob Johann Klevers Sekretärin schon auf sein Telefonat gewartet hätte. Am frühen Nachmittag betrat er dann die Anwaltskanzlei Klever. Sie befand sich zentral gelegen, in einem aus rotem Backstein gebauten Gebäude in der Inselortsmitte. Es folgte dann eine fast dreistündige Besprechung mit dem befürworteten Inselnotar, Johann Klever. Der studierte Rechtswissenschaftler war 40 Jahre alt und ein geborener Borkumer. Bis vor wenigen Jahren unterhielt er noch eine sehr erfolgreich laufende Anwaltspraxis in Hamburg, hatte sich aber aus für die neugierigen Insulaner unbekannten Gründen wieder auf Borkum niedergelassen. Nur sehr wenige Menschen wussten von seiner beruflichen Verbindung zum Rotlichtmilieu, dem berüchtigten Hamburger Kiez. Johann Klever war die kriminelle Szene irgendwann zu heiß geworden, zu gewalttätig. Er war es am Ende leid gewesen, ewig diese undankbaren Zuhälter und Drogenbosse vor Gericht herauszupauken. Eines schönen Tages hatte er sich Knall auf Fall abgesetzt. Hier auf Borkum war er zufrieden, zu Hause, und führte ein ruhiges beschauliches Leben.
Als Li dem Mann gegenübersaß, spürte er sofort die innerliche Härte des Mannes, aber auch die friedliche gute Seele. Er spürte, der Mann war kein gewöhnlicher Advokat, der nur auf das leichte Geld eines reichen Klienten aus war. Nach einem freundlichen, kräftigen, aber nicht quetschenden Händedruck setzten sie sich nicht, wie es allgemein üblich war, an Klevers Schreibtisch, sondern in eine bequeme lederne Sitzgruppe. Johann Klever war Li von Anfang an sympathisch.
Klever musterte Li geradeheraus und begann die Unterhaltung mit den Worten: „Sie sind also der mysteriöse Chinese mit dem Kontrabass“, worauf er breit anfing zu grinsen.
„Kommt die Polizei und fragt, was ist denn das?“, antwortete Li lachend mit der zweiten Strophe des Kinderliedes, das er, nicht unfreundlich gemeint, schon früh in Deutschland zu hören bekommen hatte.
Damit war das Eis zwischen den beiden Männern gebrochen und es begann eine lange, bis heute anhaltende Freundschaft. Li erklärte Johann Klever, was er auf der Insel vorhatte und wofür er seine professionelle Hilfe benötigte. Es war ein langes, gutes Gespräch, Klever willigte nur zu gerne ein, Li in Zukunft bei allen geschäftlichen und persönlichen Dingen zu vertreten. Er war sehr neugierig, wie das ungewöhnliche Projekt seines neuen Klienten bei den Insulanern angenommen würde. Li bat ihn noch um Rat für ein gutes Hotel auf der Insel, wo er während der Zeit wohnen konnte, bis sein neu erworbenes Haus bezugsfähig war. Johann Klever konnte ihm auch dabei helfen und empfahl ihm das schöne ruhige Nordseehotel. Er sagte, er kenne die alte Besitzerfamilie schon lange und werde für Li einen angemessenen, guten Preis aushandeln. Danach verabschiedeten sich die beiden, und zufrieden, wie es mit den offiziellen, amtlichen Dingen bisher gelaufen war, mietete sich Li gleich für mehrere Wochen im Nordseehotel der Familie Schmidt ein.
Sein neuer Anwalt und Notar, Johann Klever, beauftragte in den kommenden Tagen ansässige sowie Fremdfirmen mit der Sanierung des in Strandnähe abseits gelegenen Anwesens im Osten der Insel. Für Johann Klever war sein gut bezahlender, mysteriöser Auftraggeber schon bald kein Mysterium mehr. Li und er unternahmen in den anschließenden Wochen gemeinsam viele Strandspaziergänge, wobei sie sich viel erzählten und schnell näherkamen. Johann Klever schätzte den Mann aus China, sein Wissen und dass er, wie er selber, dunkle Flecken in seiner Vergangenheit hatte. Li hatte ihm die Pläne sowie genaue Instruktionen für das Bauvorhaben zukommen lassen. Johann Klever war beeindruckt von den vielen Details. Es war ein schönes Projekt und, wenn eines Tages fertig, sicherlich eine Bereicherung für die Insel Borkum.
Täglich fuhr Li persönlich mit dem Fahrrad an den Oststrand der Insel, um den Fortschritt seines neuen Zuhauses zu überprüfen. Mit der Fähre aus Emden wurden Baumaterialien aus aller Welt, wie Edelholz aus Indonesien, Marmor aus Italien sowie ein ungewöhnliches, kunstvolles, schmiedeeisernes Gewächshaus im viktorianischen Stil aus England, angeliefert. Ständig tauchten auf seiner Baustelle neue Handwerker und Fachfirmen aus ganz Europa auf, bauten etwas oder installierten irgendeine neue Technik, um dann so plötzlich, wie sie gekommen waren, wieder zu verschwinden. Der ganze Spuk der emsigen Bauphase dauerte knapp fünf Monate, dann war Lis Anwesen endlich fertig. Es war ein prächtiges Haus mit einem noch viel prächtigeren, riesigen Gewächshaus geworden. Zum Abschluss kamen noch eine Ladung Möbel aus Hongkong, Orchideenpflanzen aus Singapur und Bonsaibäume aus Taiwan, Japan und China. Zur Einweihung seines neuen Hauses und Geschäftes, der Yin & Yang-Gärtnerei, hatte Li alles, was Rang und Namen auf der Insel hatte, und seine neuen Freunde eingeladen. Es gab eine grandiose Party, die ebenso ungläubiges Staunen wie Begeisterung für das voll klimatisierte, viktorianische Gewächshaus auslöste. Die Vielfältigkeit der in allen Farben und Formen blühenden Orchideen, die beeindruckenden wie wunderschönen Miniaturbäume, die Bonsais, ließen die Gäste in Faszination und Entzückung schwärmen.
Li, konnte man ohne Übertreibung sagen, war für die ersten Monate seines Aufenthaltes auf Borkum das Gesprächsthema Nummer eins auf der Insel gewesen. Er hatte die ungeteilte Aufmerksamkeit der Inselbewohner auf sich gezogen. Doch so schnell, wie die ganze Aufregung gekommen war, verlosch das große Interesse an Li auch sehr bald wieder. Die einfachen Borkumer gingen binnen kurzer Zeit wieder stoisch wie gewohnt ihren Tagesgeschäften nach. Borkum war eine geschäftige Urlaubsinsel und in der Saison, die fast das ganze Jahr dauerte, hatte man keine große Zeit, sich um viele andere Dinge zu kümmern. Li war zwischenzeitlich einer der Ihren geworden; abgesondert, wortkarg, eigenbrötlerisch passte er zu den Ostfriesen. Nur der ihm ewig anhängende Klatsch über sein Vermögen und wie er es wohl erworben hatte, der blieb haften. Das unwissende Gerede war immer mal wieder gut, die Gerüchteküche mit neuer Nahrung zu versorgen. Manche behaupteten, Li sei in Wirklichkeit ein berüchtigter Hongkonger Gangster, der sich mit seiner Beute ins Ausland abgesetzt hatte. Andere wiederum behaupteten, er sei der Sohn eines einflussreichen Parteifunktionärs in China, der mit Millionen von Parteigeldern geflohen war. Dann hieß es wieder, er wäre ein Erfinder, der von den Einkünften seiner Patente lebte. Romantikern, hauptsächlich den Frauen unter den Insulanern, gefiel mehr die Version, er sei der verstoßene Sohn eines Hongkonger Millionärs, der bei seinem Vater wegen einer nicht standesgemäßen Liebschaft in Ungnade gefallen war. Es gab unzählige Gerüchte um Li, das waren noch die harmlosesten. Es wurde niemals langweilig in den Fantasien der Inselbewohner und ein jeder hatte irgendwie eine andere Vorstellung, was Lis Vergangenheit betraf. In den letzten Jahren waren die Gerüchte jedoch immer weniger geworden. Er hatte das schwindende Interesse wohl zuletzt auch seiner resoluten Haushaltshilfe, Frau Anna Wolders, zu verdanken, die mindestens zweimal die Woche bei ihm putzte und auch sonst eine große Hilfe in Lis kleinem Haushalt war.
Anna Wolders machte, neben dem Putzen, verschiedene Besorgungen für Li, regelte seine Wäsche und hielt ihn mit dem neuesten Inseltratsch immer auf dem Laufenden. Die vielen Gerüchte um seine Person hatte sie schnell aus dem Weg geräumt. Ihr „Herr Li“, wie sie ihn immer offiziell, vor anderen, titulierte, lebte einzig und allein auf Borkum, weil er es so wollte und ihm die hervorragende, gesunde Seeluft guttat. Die Gerüchte verstummten wohl auch, weil Li sich zwischenzeitlich zu einem international bedeutenden Orchideenzüchter gemausert hatte. Viele der großen Blumengeschäfte vom Festland kauften seine wunderschönen Orchideen, die er profitabel übers Internet vermarktete. Nur wenige Inselbewohner wussten gleichwohl, Li war nicht nur ein erfolgreicher Orchideenzüchter, sondern auch ein begnadeter Bonsaizüchter mit einem mittlerweile legendären Ruf. Seine Miniaturbäume erzielten auf dem internationalen Markt bei Sammlern Höchstpreise. Sie kosteten im Schnitt zwischen 10 000 und 30 000 US-$. Im letzten Jahr hatte er sogar einen wunderschönen „Bankan“, zu Deutsch ein zusammengerollter Stamm, für sage und schreibe 50 000 US-$ verkauft. Li liebte die „Bankan“-Bonsais, die einen Miniaturbaum in Tierform darstellen. Li hatte sich an den Nachbildungen eines Bonsais in Drachenform besonders häufig versucht. Der Drache, im chinesischen „Long“ genannt, galt im Buddhismus als Glückssymbol. Der Stamm bildete dabei den Leib, während die Äste die Gliedmaßen darstellten. Sein sehr hochdotierter „Bankan“ war außerordentlich perfekt im Detail gewesen und der kleine Bonsai hatte das Herz eines taiwanesischen Käufers erobert. Der Taiwanese hätte ihm jede Summe dafür geboten, sie einigten sich auf 50 000. Li trennte sich immer wieder nur ungern von einem seiner Bäume, aber von Zeit zu Zeit benötigte auch er das Geld, um die aufwendigen Kosten zu tragen und den Unterhalt des Gewächshauses zu bewerkstelligen. Allein mit dem Verkauf von Orchideen langte es nicht dafür und sein Geld aus dem Nachlass seines Großvaters in Hongkong war schon vor langer Zeit aufgebraucht. Li betrachtete die kleinen Bäumchen als seine Kinder, die ihm in seinem Leben nie vergönnt gewesen waren. Es schmerzte ihn jedes Mal, wenn er, hier und da, eines seiner Kinder verkaufen musste. Li war auch sehr wählerisch, an wen er verkaufte, aber in den Jahren wuchs sein Kundenstamm von Liebhabern und Sammlern, bei denen er seine Bonsais in gute Hände wusste.
Bedächtig legte er sein Werkzeug aus der Hand und nahm die Tasse mit seinem geliebten grünen Jasmintee von dem kleinen Beistelltisch neben seinem Arbeitsplatz. Das wunderbare blumige Aroma erfrischte seinen müden Körper und seine Seele. Er trank ein paar Schlucke und setzte sich lächelnd auf den bequemen Korbliegestuhl, den er inmitten seiner Pflanzenkulturen zum Ausruhen platziert hatte. Li ließ den betörenden sinnlichen Duft der Jasminblüte auf seinen Geist wirken und dabei fiel ihm das chinesische Sprichwort des gelehrten Tien Yiheng ein:
„Man trinkt den Tee, um den Lärm der Welt zu vergessen.“
Li legte seinen Kopf zurück, schloss seine Augen und dachte, er würde alles dafür geben, wenn er selber nur vergessen könnte. Seine Atemzüge wurden gleichmäßiger und er begann zu träumen von einer längst vergangenen Zeit in China.
Kapitel 4
1966, China, Guangzhou, in der Stadt
Li saß an seinem erkorenen Lieblingsplatz im kleinen, liebevoll angelegten Garten des Hinterhofs seines Elternhauses. Umgeben von blühenden und grünen Pflanzen, war es der Ort, an dem er immer am liebsten studierte. Dort saß er oft stundenlang allein für sich und las all die Klassiker des Konfuzius, Laotse und anderer berühmter chinesischer Philosophen, die ihm sein Großvater zurückgelassen hatte. Er fühlte sich wohl, auf irgendeine Weise behütet, in dem winzigen grünen Gefilde, in dem unzählige Tontöpfe mit wunderschönen Orchideen und kleinen Miniaturbäumen, Pinyins, wie die Chinesen die kleinen Landschaften in einer Schale bezeichneten, standen. Li hatte von seinem „Gung Gung“, wie er als kleiner Junge in guter chinesischer Tradition immer liebevoll und respektvoll seinen Großvater nannte, die Liebe zur großen Kunst der Pinyinzüchtungen übernommen. Er erinnerte sich gut, als ob es gestern gewesen wäre, an die chinesische Weisheit, die sein Großvater beim gemeinsamen Pflanzen seines ersten Pinyin zitierte:
„Trage immer einen grünen Zweig im Herzen, es wird sich ein Singvogel darauf niederlassen.“
Sein geliebter Großvater hatte ihm, nebst unzähligen lehrreichen Aphorismen, auch die kunstfertige Gestaltung von Pinyins, die Japaner sagen Bonsai, beigebracht. Er hatte Li mit sehr viel Geduld die verschiedenartigsten Gestaltungsformen der Miniaturbäume erklärt. Ihn die Technik des gewollt herbstvortäuschenden Blattbeschnitts, die kunstvolle Drahtung der einzelnen Äste, die unterschiedlichen Lichtbedürfnisse der einzelnen Arten, die richtige Bewässerung und das Prinzip des Abmoosens gelehrt. Die schwere Kunst des richtigen Abmoosens beim Pinyin ist die am wichtigsten zu lernende, hatte er ihm dargelegt. Es entscheidet, ob ein Pinyin überlebt oder stirbt. Man muss genau erkennen können, wo man den Saftfluss zwischen den Blättern und dem Wurzelsystem unterbricht. Ein anderer wichtiger Aspekt der Technik war, wie man einen Stamm oder Ast zur Bildung neuer Wurzeln an einem bestimmten anderen Punkt zwingen konnte.
Sein Großvater war schnell zu der Erkenntnis gekommen, Li hatte das Talent und die Liebe zum Pinyin. Li war ein richtiger Künstler im Umgang mit den Miniaturbäumen, er selber empfand es als seine Berufung und Passion. So absurd, wie es auch klingen mochte, Li fühlte sich in seiner gärtnerischen Arbeit und seinen Studien damals sogar politisch bestärkt. Schließlich hatte ihr großer Führer Mao Zedong, sieben Jahre nach der Machtergreifung der Kommunisten in China, die Kampagne ausgerufen:
„Lasst hundert Blumen blühen, lasst hundert Schulen miteinander wetteifern.“
Li empfand sich in seinem Tun indirekt ermuntert. Er gärtnerte und studierte im Sinne Mao Zedongs. Sein Leben war aus seiner Sichtweise geradezu musterhaft für einen jungen Studenten, der traditionellen Medizin. Er folgte den Richtlinien Mao Zedongs und ging ziemlich konform mit den Ideologien der Kommunistischen Partei.
Li war im Jahre des Hundes, 1946, in Guangzhou, China, geboren und stand kurz vor seinem zwanzigsten Geburtstag. Er war ein ganz normaler junger Mann, ein Student der traditionellen chinesischen Medizin an der Universität in seiner Heimatstadt Guangzhou. Li war, wie die große Mehrheit der jungen Chinesen, ein glühender Verehrer ihres verehrten Führers Mao Zedong und von dessen oft eigensinnigen politischen Direktiven. Politik war damals allgegenwärtig. Die vom kommunistischen System ständig geforderte politische Diskussion gehörte zum täglichen Leben eines jeden Studenten in China, ob einer nun wollte oder nicht. Sie nahm keinerlei Rücksicht auf das Individuum, es gab immer nur das Kollektiv, das zählte. Das galt auch für den jungen Li Han Cheng, der sich glücklich schätzen durfte, ein hoffnungsvoller Student im vorletzten Semester an einer der berühmtesten Akademien für traditionelle chinesische Medizin, kurz TMC Guangzhou genannt, zu sein. Doch wessen sich Li in seiner kleinen Welt nicht bewusst war, war, dass er in Mao Zedongs China, einem Unrechtsstaat, lebte. Li studierte in Zeiten eines politischen Machtkampfes zwischen dem westlichen Kapitalismus und dem östlichen Kommunismus. Es gab kein Internet und Informationen weltlicher Nachrichtensender, sondern nur eine allgegenwärtige marxistisch-leninistische Staatsdoktrin. Diese hämmerte, angepasst als Maoismus, der Bevölkerung unangefochten die einzig wahre Staatsideologie ein. Li, der wie Millionen anderer Chinesen psychologisch manipuliert wurde, war ihre willige Marionette. Er verspürte, wie alle Studenten an Chinas Schulen und Universitäten, eine verheißungsvolle Euphorie des Umbruchs zu einer überlegenen Staatsform. Doch was der Staat, oder besser gesagt seine Führung in ihrem Machtwahn, zulassen würde, das mussten sie erst noch alle bitter erfahren.
„Li, lege endlich dein Buch beiseite und komm zum Essen ins Haus“, rief seine Mutter mit sanfter Stimme, aber in ihrer gewohnt bestimmenden Art, durch das halb offene Küchenfenster.
Li lebte mit seinen Eltern und seiner jüngeren Schwester in einem eigenen kleinen Haus am Perlfluss im Süden Chinas. Das kleine Haus, in einem zentralen Stadtteil von Guangzhou, das früher auch Kanton genannt wurde, lag in der Datong Road. Es gehörte seit Generationen der Familie und war alles, was ihnen aus den Wirren der großen „Bodenreform“ von 1949 bis 1952, aus dem einstigen Besitz seines Großvaters mütterlicherseits, geblieben war. Kleine und große Landbesitzer waren