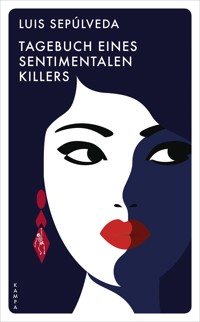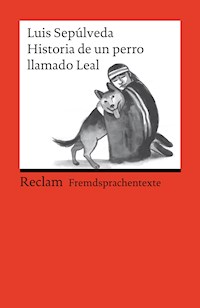Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: OKTOPUS by Kampa
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Seit dem Tod seiner Frau lebt Antonio Bolívar allein in einer Hütte im Regenwald des Amazonas. Zweimal im Jahr steht der Alte am Bootssteg der winzigen Siedlung El Idilío und erwartet die Ankunft seines Freunds Rubicundo Loachamín, der ihn mit neuen Liebesromanen versorgt. Traurig sollen sie sein, mit viel Liebeskummer, aber auch ein Happy End haben. Lesend vertreibt er sich die Zeit im Dschungel, den er dank seiner Freundschaft mit den Shuara wie kein anderer kennt. Als eines Tages die schrecklich zugerichtete Leiche eines Engländers aufgefunden wird, begreift nur Antonio, dass nicht die Ureinwoh ner den Mann getötet haben, sondern ein Ozelotweibchen, dessen Junge er umgebracht hat. Um weitere Opfer zu verhindern, zwingt man den Antonio, die Jagd auf das Tier aufzunehmen. Ein dramatischer Kampf zwischen Mensch und Natur beginnt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 140
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Luis Sepúlveda
Der Alte, der Liebesromane las
Aus dem chilenischen Spanisch von Mayela Gerhardt
Kampa
Anmerkung des Autors
Als die Jurymitglieder in Oviedo diesen Roman lasen, den sie wenige Tage darauf mit dem Literaturpreis Tigre Juan auszeichnen würden, ereignete sich viele Tausend Kilometer entfernt ein schmähliches Verbrechen. Eine Bande bewaffneter Auftragskiller, die von noch größeren Verbrechern bezahlt wurden, solchen mit gut geschnittenen Anzügen und gepflegten Fingernägeln, die behaupten, im Namen des »Fortschritts« zu handeln, ermordeten einen der bewundernswertesten Kämpfer für die Rettung des Regenwaldes und eine der herausragendsten und konsequentesten Persönlichkeiten der weltweiten Umweltbewegung.
Du wirst diesen Roman niemals in den Händen halten, Chico Mendes, geliebter Freund weniger Worte und vieler Taten, aber der Premio Tigre Juan gehört auch dir und all jenen, die deinen Weg fortbeschreiten, unseren gemeinsamen Weg zum Schutz dieser Welt, der einzigen, die wir haben.
Meinem fernen Freund Miguel Tzenke, Vertreter der Shuar-Gemeinde Sumbi am oberen Nangaritza und großer Schützer des Amazonasgebiets.
In einer von magischen Erzählungen erfüllten Nacht gewährte er mir Einblicke in seine unbekannte grüne Welt, die mir später an anderen Orten, weit entfernt von jenem Eden am Äquator, dazu dienen sollten, dieser Geschichte Gestalt zu verleihen.
1
Der Himmel war ein aufgeblähter Eselsbauch, der bedrohlich tief über den Köpfen hing. Der lauwarme, klebrige Wind fegte ein paar lose Blätter umher und rüttelte ungestüm an den schwächlichen Bananenstauden, die die Vorderseite des Bürgermeisteramtes schmückten.
Die wenigen Einwohner von El Idilio und eine Handvoll Abenteurer aus dem Umland hatten sich am Bootssteg versammelt, wo sie darauf warteten, auf dem tragbaren Stuhl von Doktor Rubicundo Loachamín Platz nehmen zu dürfen. Der Zahnarzt linderte die Schmerzen seiner Patienten mithilfe einer eigentümlichen Art mündlicher Anästhesie.
»Tut das weh?«, fragte er.
Die Patienten krallten sich seitlich am Stuhl fest und antworteten, indem sie die Augen weit aufrissen und am ganzen Körper schwitzten.
Einige versuchten, die dreisten Hände des Doktors aus ihrem Mund zu entfernen, um mit einem angemessenen Fluch zu antworten, aber ihr Vorhaben prallte auf die muskulösen Arme und die autoritäre Stimme des Zahnarztes.
»Halt still, verflucht! Finger weg! Mir ist schon klar, dass es wehtut. Und wer ist schuld daran? Wer wohl? Ich etwa? Die Regierung! Hämmer dir das in deinen Dickschädel! Die Regierung ist schuld an deinen verfaulten Zähnen. Die Regierung ist schuld an deinen Schmerzen.«
Die Gepeinigten stimmten daraufhin zu, indem sie die Augen schlossen oder sachte nickten.
Doktor Loachamín hasste die Regierung. Jede Regierung, ausnahmslos. Er war der uneheliche Sohn eines iberischen Auswanderers und hatte von ihm einen tiefen Groll auf alles geerbt, was auch nur im Entferntesten nach Autorität klang. Allerdings war ihm der Grund für seinen Hass während einer Sauftour in seiner Jugend entfallen, wodurch sich seine anarchistischen Schwadronaden in eine Art moralische Warze verwandelt hatten, die ihn sympathisch machte.
Er schimpfte ebenso lautstark über die wechselnden Regierungen wie über die Gringos, die ab und zu von den Ölförderanlagen am Río Coca zu Besuch kamen, unverfrorene Fremde, die ohne Erlaubnis die offenen Münder seiner Patienten fotografierten.
Ganz in der Nähe verlud die überschaubare Besatzung der Sucre Büschel grüner Kochbananen und Säcke mit Kaffeebohnen.
Auf einer Seite des Stegs stapelten sich die Kisten mit Bier, Frontera-Schnaps und Salz sowie die Gasflaschen, die zuvor ausgeladen worden waren.
Sobald der Zahnarzt alle Kiefer ausgebessert hätte, würde die Sucre auslaufen; sie würde dem Río Nangaritza flussaufwärts folgen, der ein Stück weiter in den Río Zamora mündete, und nach vier Tagen gemächlicher Fahrt am Flusshafen von El Dorado einlaufen.
Das Schiff war ein betagter schwimmender Kasten, angetrieben von der Entschlossenheit des Mechanikers und Kapitäns in Personalunion, der Tatkraft zweier muskulöser Männer, aus denen die Besatzung bestand, und dem schwindsüchtigen Willen eines alten Dieselmotors. Es würde erst nach der Regenzeit zurückkehren, die sich mit dem wolkenverhangenen Himmel ankündigte.
Doktor Rubicundo Loachamín kam zweimal im Jahr nach El Idilio, ebenso wie der Briefträger, der aber nur selten Post für einen der Einwohner brachte. Aus seiner verschlissenen Tasche förderte er nur offizielle Schreiben an den Bürgermeister zutage oder die ernsthaften, von der Feuchtigkeit verblichenen Porträts der jeweils amtierenden Machthaber.
Die Leute erwarteten die Ankunft des Schiffs einzig in der Hoffnung, Nachschub an Salz, Gas, Bier und Schnaps zu bekommen, aber den Zahnarzt empfingen sie mit Erleichterung – besonders die Überlebenden der Malaria, die es leid waren, Gebissreste auszuspucken, und sich einen Mund ohne Zahnstummel wünschten, um eine der Prothesen anprobieren zu können, die auf einem Tischtuch angeordnet waren, dessen purpurrote Farbe unweigerlich an einen Kardinal denken ließ.
Während er über die Regierung wetterte, befreite der Doktor das Zahnfleisch seiner Patienten von den letzten Stummeln und wies sie gleich danach an, sich den Mund mit Schnaps auszuspülen.
»Also, dann schauen wir mal. Wie sitzt diese hier?«
»Die drückt. Damit krieg ich den Mund nicht zu.«
»Herrgott noch mal! Was für zimperliche Kerle. Na, dann probier eine andere.«
»Die sitzt zu locker. Die fällt mir beim Niesen raus.«
»Wozu erkältest du dich auch, Trottel. Mach den Mund auf.«
Und die Patienten gehorchten.
Sie probierten verschiedene Gebisse an, entschieden sich für das bequemste und handelten den Preis aus, während der Zahnarzt die übrigen Prothesen in einem Topf mit kochendem Chlorwasser desinfizierte.
Für die Uferbewohner der Flüsse Zamora, Yacuambi und Nangaritza war Doktor Rubicundo Loachamíns tragbarer Stuhl eine echte Institution.
Genau genommen handelte es sich um einen alten Barbierstuhl mit weiß emailliertem Sockel und Gestell. Nur mit vereinten Kräften konnten der Kapitän und die Besatzung der Sucre den Stuhl an Land hieven und ihn auf einem ein Quadratmeter großen Podest aufstellen, das der Zahnarzt »die Praxis« nannte.
»In der Praxis habe ich das Kommando, zum Teufel! Hier wird gemacht, was ich sage. Wenn ich hier runtersteige, schimpft mich ruhig Zahnklempner, Schnauzenschnüffler, Zungengrapscher oder wie auch immer ihr wollt, und vielleicht dürft ihr mir sogar einen Schnaps spendieren.«
Diejenigen, die noch auf die Behandlung warteten, machten ein schrecklich leidendes Gesicht, und wer die Extraktionszangen zu spüren bekam, guckte nicht weniger gequält.
Die Einzigen, die in der Nähe der Praxis lächelten, waren die Jíbaros; sie saßen in der Hocke da und sahen zu.
Die Jíbaros. Sie gehörten zum indigenen Volk der Shuar, waren aber von ihm verstoßen worden, weil sie als entwürdigt galten, verdorben von den Sitten der »apaches«, der Weißen.
Sie trugen weiße Lumpen und duldeten widerspruchslos den verunglimpfenden Namen Jíbaro, den die spanischen Eroberer den Shuar verpasst hatten.
Es bestand ein himmelweiter Unterschied zwischen einem aufrechten und stolzen Shuar, der die verborgenen Amazonasregionen kannte, und jenen Jíbaros, die sich am Anlegesteg von El Idilio zusammenscharten und auf einen Schluck Alkohol hofften.
Beim Lächeln entblößten die Jíbaros ihre spitzen Zähne, die sie mit Flusskieseln zurechtgefeilt hatten.
»Und ihr? Was gafft ihr so? Euch krieg ich irgendwann auch noch in die Hände, ihr Affen«, drohte ihnen der Zahnarzt.
Als sich die Jíbaros angesprochen fühlten, antworteten sie frohgemut: »Jíbaro haben gute Zähne. Jíbaro essen viel Affenfleisch.«
Manchmal verscheuchte ein Patient mit seinem Geschrei die Vögel, schlug mit einer Hand die Zangen beiseite und packte mit der anderen den Griff seiner Machete.
»Benimm dich wie ein Mann, du Schwachkopf. Mir ist klar, dass es wehtut, und ich habe dir gesagt, wer schuld daran ist. Also spar dir deine Drohgebärden! Sitz still und zeig, dass du Eier in der Hose hast.«
»Aber Sie reißen mir die Seele raus, Doktor. Erst brauche ich noch einen Schluck Schnaps.«
Nachdem er den letzten Leidenden behandelt hatte, stieß der Zahnarzt einen Seufzer aus. Er wickelte die Prothesen, die keinen Abnehmer gefunden hatten, in das Kardinalstischtuch ein, und als er gerade dabei war, die Instrumente zu desinfizieren, sah er das Kanu eines Shuar herangleiten.
Der Shuar stand am Heck des schmalen Wassergefährts und paddelte in gleichmäßigen Zügen. Auf Höhe der Sucre angelangt, brachte er das Kanu mit zwei Paddelschlägen direkt neben dem Schiff zum Liegen.
An der Reling erschien mit mürrischer Miene der Kapitän. Der Shuar erklärte ihm etwas mit Händen und Füßen und spuckte dabei ständig aus.
Der Zahnarzt hatte alle Instrumente abgetrocknet und verstaute sie in einem Lederetui. Dann nahm er den Behälter mit den gezogenen Zähnen und warf sie ins Wasser.
Der Kapitän und der Shuar liefen auf dem Weg zum Bürgermeisteramt an ihm vorbei.
»Wir müssen uns etwas gedulden, Doktor. Sie bringen einen toten Gringo.«
Das war keine erfreuliche Neuigkeit. Die Sucre war ein unbequemer Kahn, erst recht auf der Rückfahrt, wenn sie Kochbananen geladen hatte und Säcke mit überreifen, halb verfaulten Kaffeebohnen.
Falls die Regenfälle schon bald einsetzten, was recht wahrscheinlich war, weil das Schiff wegen mehrerer Pannen bereits eine Woche Verspätung hatte, müssten sie zum Schutz der Fracht, der Passagiere und der Besatzung eine Plane aufspannen, unter der kein Platz für die Hängematten blieb, und wenn dann noch ein Toter hinzukäme, würde die Reise doppelt unbequem werden.
Der Zahnarzt half, den Stuhl zurück an Bord zu befördern, dann lief er zum anderen Ende des Stegs. Dort erwartete ihn Antonio José Bolívar Proaño, ein alter Mann mit robustem Körper, dem es nichts auszumachen schien, die Namen so vieler Nationalhelden mit sich herumzutragen.
»Bist du immer noch nicht tot, Antonio José Bolívar?«
Der Alte schnupperte an seinen Achseln, bevor er antwortete.
»Scheint nicht so. Noch stinke ich nicht. Und selbst?«
»Wie geht es deinen Zähnen?«
»Die habe ich hier«, antwortete der Alte und griff mit einer Hand in seine Tasche. Er faltete ein verblichenes Stofftaschentuch auseinander und zeigte ihm die Prothese.
»Und warum trägst du sie nicht, alter Esel?«
»Mache ich gleich. Ich habe mit niemandem geredet und nichts gegessen. Wozu sie umsonst abnutzen?«
Der Alte setzte das Gebiss ein, schnalzte mit der Zunge, spuckte herzhaft aus und hielt dem Zahnarzt die Frontera-Flasche hin.
»Warum nicht. Ich glaube, ich habe mir einen Schluck verdient.«
»Allerdings. Sie haben heute siebenundzwanzig ganze Zähne gezogen und einen Haufen Stummel, aber Ihren Rekord haben Sie noch nicht gebrochen.«
»Behältst du immer noch den Stand im Auge?«
»Dafür hat man doch Freunde. Um seine Verdienste gegenseitig zu feiern. Früher war es besser, meinen Sie nicht auch? Als noch junge Siedler hergekommen sind. Erinnern Sie sich an den Montuvio, dem Sie alle Zähne gezogen haben, weil er eine Wette gewinnen wollte?«
Doktor Rubicundo Loachamín neigte den Kopf zur Seite, um seine Erinnerungen zu sortieren, bis das Bild jenes Mannes auftauchte; er war nicht mehr allzu jung gewesen und auf die typische Art der Montuvios gekleidet: ganz in Weiß, ohne Schuhe, aber mit silbernen Sporen.
Der Montuvio war in Begleitung von rund zwanzig sturzbetrunkenen Kerlen zur Praxis gekommen. Sie waren Goldsucher, die von einer Flussbiegung zur nächsten zogen. Man nannte sie Pilger, und es war ihnen egal, ob sie das Gold in den Flüssen oder in den Taschen ihrer Mitbürger fanden. Der Montuvio ließ sich auf den Stuhl plumpsen und sah den Zahnarzt mit albernem Gesichtsausdruck an.
»Was willst du?«
»Ziehen Sie mir alle Zähne. Einen nach dem anderen. Und dann legen Sie sie hier auf den Tisch.«
»Mach den Mund auf.«
Der Mann gehorchte, und der Zahnarzt sah, dass ihm, abgesehen von einem Trümmerhaufen aus Backenzähnen, noch mehrere Zähne blieben, einige von Karies zerfressen, andere gesund.
»Du hast noch eine ganze Menge. Kannst du es dir überhaupt leisten, dir so viele Zähne ziehen zu lassen?«
Der Montuvio bemühte sich um einen weniger albernen Gesichtsausdruck und setzte zu einer Erklärung an.
»Also, es ist so, Doktor: Meine Freunde hier glauben, ich hätte keinen Mumm in den Knochen, und da habe ich ihnen gesagt, dass ich mir alle Zähne ziehen lasse, einen nach dem anderen, ohne einen Mucks zu machen. Also haben wir eine Wette abgeschlossen, und wenn ich gewinne, kriegen Sie die Hälfte ab, Doktor.«
»Beim zweiten Zahn, den er dir rausreißt, scheißt du dir in die Hose und schreist nach deiner Mama!«, brüllte einer aus der Gruppe, und von den anderen Männern ertönte beifälliges Gelächter.
»Trink besser noch einen und überleg’s dir noch mal. Für solche Dummheiten bin ich mir zu schade«, sagte der Zahnarzt.
»Es ist nur so, Doktor, wenn Sie mir nicht helfen, die Wette zu gewinnen, macht mein Gefährte hier Sie einen Kopf kürzer.«
Die Augen des Montuvios funkelten, während er liebevoll über den Griff seiner Machete strich.
Also galt die Wette.
Der Mann öffnete den Mund, und der Zahnarzt machte eine erneute Bestandsaufnahme: Es waren fünfzehn Zähne, und als er dem Herausforderer die Zahl nannte, reihte dieser fünfzehn Goldnuggets auf dem Kardinalstischtuch mit den Prothesen auf. Eins für jeden Zahn. Die Männer legten ihren Wetteinsatz – für oder gegen ihn – dazu. Ab dem fünften Zahn stieg die Zahl der Goldnuggets beträchtlich an.
Der Montuvio ließ sich ohne jede Regung die ersten sieben Zähne ziehen. Es war mucksmäuschenstill, und als der achte rauskam, trat eine Blutung ein und füllte ihm in Sekundenschnelle den Mund. Der Mann bekam keinen Ton heraus, gab aber durch ein Zeichen zu verstehen, dass er eine Pause brauchte.
Er spuckte mehrmals aus und bedeckte das Podest mit Blutklumpen, nahm einen kräftigen Schluck Schnaps und wand sich daraufhin vor Schmerzen auf dem Stuhl, gab aber keinen Laut von sich. Nachdem er noch einmal ausgespuckt hatte, signalisierte er dem Zahnarzt, weiterzumachen.
Nach dem Gemetzel erschien auf dem zahnlosen und bis zu den Ohren geschwollenen Gesicht des Montuvios ein grausiger Ausdruck des Triumphs, während er sich den Gewinn mit dem Zahnarzt teilte.
»Ja, das waren noch Zeiten«, murmelte Doktor Loachamín und nahm einen ordentlichen Schluck.
Der Zuckerrohrschnaps brannte ihm in der Kehle, und er verzog das Gesicht, als er dem Alten die Flasche zurückgab.
»Jetzt schneiden Sie nicht so eine Grimasse, Doktor. Das treibt einem die Würmer aus dem Gedärm«, sagte Antonio José Bolívar, dann wurde er unterbrochen.
Zwei Kanus glitten heran, und aus einem ragte der reglose Kopf eines blonden Mannes.
2
Der Bürgermeister, einziger Staatsdiener, oberste Autorität und Vertreter einer Macht, die zu weit entfernt war, um Furcht zu gebieten, war ein fettleibiger Kerl, der unablässig schwitzte.
Die Dorfbewohner erzählten, das Schwitzen habe augenblicklich begonnen, nachdem er von der Sucre an Land gegangen war, und seitdem wringe er pausenlos Taschentücher aus, was ihm den Spitznamen Schleimschnecke beschert hatte.
Weiterhin wurde gemunkelt, er sei vor seiner Ankunft in El Idilio mit einem Posten in einer großen Stadt in den Anden betraut gewesen und wegen Unterschlagung in diese gottverlassene Gegend im Osten strafversetzt worden.
Neben dem Schwitzen bestand seine zweite Tätigkeit darin, den Bierbestand zu verwalten. Er saß in seinem Büro und trank in kleinen Schlucken, kostete die Flaschen bis auf den letzten Tropfen aus, denn er wusste, dass die Wirklichkeit noch trostloser erscheinen würde, sobald sein Vorrat zur Neige ging.
Wenn ihm das Schicksal in die Hände spielte, wurde die Durststrecke durch den Besuch eines Gringos wettgemacht, der einen anständigen Proviant an Whisky dabeihatte. Im Gegensatz zu den übrigen Dorfbewohnern trank der Bürgermeister keinen Schnaps. Er behauptete, vom Frontera bekäme er Albträume, und er lebte in der ständigen Angst, dem Wahnsinn zu verfallen.
Seit unbestimmter Zeit lebte er mit einer Einheimischen zusammen, die er brutal schlug und beschuldigte, ihn verhext zu haben, und alle spekulierten darauf, dass sie ihn irgendwann umbringen würde. Es wurden sogar Wetten darauf abgeschlossen.
Seit seiner Ankunft vor sieben Jahren hatte sich der Bürgermeister den Hass aller Einwohner zugezogen.
Er hatte sich in den Kopf gesetzt, absurde Steuern zu erheben. In einem unregierbaren Gebiet wollte er Angel- und Jagdscheine verkaufen. In einem Regenwald, der älter war als alle Staaten, wollte er die Holzsammler, die feuchtes Brennholz zusammentrugen, für das Nutzungsrecht zur Kasse bitten, und von staatsbürgerlichem Übereifer gepackt ließ er eine Hütte aus Schilfrohr bauen, um darin die Betrunkenen einzusperren, die sich weigerten, eine Geldbuße wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses zu zahlen.
Wenn er vorbeilief, erntete er abschätzige Blicke, und sein Schweiß nährte den Hass der Dorfbewohner.
Sein Amtsvorgänger war wiederum sehr beliebt gewesen. Leben und leben lassen, hatte sein Motto gelautet. Ihm war es zu verdanken, dass das Schiff hier anlegte und dass der Briefträger und der Zahnarzt regelmäßig vorbeikamen. Doch der frühere Bürgermeister war nicht lange im Amt geblieben.
Er war eines Nachmittags mit ein paar Goldsuchern aneinandergeraten, und zwei Tage darauf fand man ihn – den Kopf von Machetenhieben gespalten und von den Ameisen halb aufgefressen.
Einige Jahre blieb El Idilio ohne eine Autoritätsperson, die in diesem grenzenlosen Urwald über Ecuadors Staatshoheit gewacht hätte, bis die Zentralregierung den Strafversetzten schickte.
Jeden Montag – er war besessen von den Montagen – beobachteten die Einwohner, wie er an einem Pfahl am Steg eine Flagge hisste, bis ein Sturm den Stofffetzen in den Urwald riss und mit ihm die Gewissheit, dass es Montag war, was ohnehin niemanden kümmerte.
Der Bürgermeister traf am Bootssteg ein. Mit einem Taschentuch fuhr er sich über Gesicht und Hals. Während er es auswrang, befahl er, die Leiche an Land zu verfrachten.
Der Tote war ein junger Mann, nicht älter als vierzig, blond und von kräftiger Statur.
»Wo habt ihr ihn gefunden?«
Die Shuar sahen einander an, unsicher, ob sie antworten sollten.
»Verstehen diese Wilden kein Spanisch?«, maulte der Bürgermeister.
Einer der Shuar beschloss zu antworten.
»Stromaufwärts. Zwei Tage von hier.«