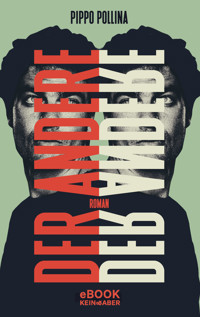
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Leonardo Conigliaro, von Familie und Freunden Nanà genannt, ist Arzt in Camporeale, einem sizilianischen Dorf, in dem die ehrenwerte Gesellschaft und die Mafia seit jeher eine bedeutende Rolle spielen. Frank Fischer, in Wolfsburg von einer alleinerziehenden Mutter großgezogen, ist ein aufsteigender Stern am deutschen Journalistenhimmel und bekannt für seine Investigativrecherchen. Beide Männer sind Ende der 1950er-Jahre geboren, haben aber keinerlei weitere Berührungspunkte, bis Nanà ein lange Zeit gut gehütetes Geheimnis lüftet und eine alte Familienschuld bei ihm eingefordert wird. Im wiedervereinten Deutschland prallen Franks und Nanàs Wege unausweichlich aufeinander und verlangen eine Entscheidung, die ihre beiden Leben für immer verändert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 371
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
INHALT
» Über den Autor
» Über das Buch
» Buch lesen
» Impressum
» Weitere eBooks von Kein & Aber
» www.keinundaber.ch
ÜBER DEN AUTOR
Pippo Pollina, geboren 1963 in Palermo, besuchte das Konservatorium und studierte Rechtswissenschaften. Er engagierte sich früh in der Antimafiabewegung und arbeitete u.a. für die von Giuseppe Fava gegründete Zeitschrift I Siciliani. Nach Favas Ermordung durch die Mafia verließ Pollina 1985 Sizilien, um erstmal als Straßenmusiker durch die Welt zu reisen. Pippo Pollina, der seit Langem in Zürich lebt, wurde für sein musikalisches Schaffen mehrfach ausgezeichnet, hat zahlreiche Alben aufgenommen und ist auf vielen großen Bühnen aufgetreten. Der Andere ist sein Debütroman.
ÜBER DAS BUCH
Leonardo Conigliaro, von Familie und Freunden Nanà genannt, ist Arzt in Camporeale, einem sizilianischen Dorf, in dem die Mafia seit jeher eine bedeutende Rolle spielt. Frank Fischer, in Wolfsburg von einer alleinerziehenden Mutter großgezogen, ist ein aufsteigender Stern am deutschen Journalistenhimmel und bekannt für seine Investigativrecherchen.
Beide Männer sind Ende der 1950er -Jahre geboren, haben aber keinerlei weitere Berührungspunkte, bis Nanà ein gut gehütetes Geheimnis lüftet und eine Familienschuld bei ihm eingefordert wird. Schmerzlich muss er feststellen, dass eine Hand die andere wäscht und Schuld in den Augen der Ehrenwerten Gesellschaft nicht vergeht. Frank Fischer hingegen erfährt durch eine Recherche, wie gefährlich es ist, die Mafia herauszufordern. Als ihre Wege aufeinandertreffen, stehen ihre Leben und die ihrer Familien plötzlich auf dem Spiel, und jeder von ihnen muss sich der Frage stellen, was für ein Mensch er sein möchte.
Camporeale, Januar 1988
fragment eins
Im sanften Abendlicht nahm ich Kurve um Kurve, der Monte Iato rückte unaufhaltsam näher, und als es plötzlich nach Eukalyptus roch, wusste ich, dass es bis nach Hause nicht mehr weit war. Ich zuckelte hinter einem Traktor her, der Rauchwölkchen in den Himmel stieß, und hatte Zeit, die Hügellandschaft zu betrachten, Korn und Melonen sprossen neben nackten Rebstöcken, selbst im Winter tanzten Grün und Braun über die Felder, und sehnsüchtig dachte ich an den Kaffee, den ich mir gleich bei Don Calogero an der Piazza genehmigen würde.
Über den Kaffee in Palermo konnte man nicht meckern, aber an den in Maciddaru – wie Camporeale im Dorf genannt wurde – kam er nicht heran. Don Calogeros Arabica-Mischung duftete einmalig und spielte gekonnt mit der Note des Abgangs. Manchmal träumte ich von einem kleinen, typischen Wiener Kaffeehaus, mit runden, schwarzen Holztischchen, Jugendstilstühlen wie im alten Caffè Caflisch in Palermo, Kellnern mit Fliege und cremeweißem Frack.
In Wahrheit arbeitete ich als angehender Arzt in einer Praxis im Zentrum von Palermo und konnte mich wirklich nicht beschweren. Ab und zu kam ein Rentner vorbei, der auf der Treppe gestürzt war, oder ein Zwölfjähriger mit gebrochenem Arm, der das Moped seines großen Bruders stibitzt hatte. Klar, Unangenehmes gab es auch. Etwa der junge Mann mit der Schussverletzung und durchtrenntem Bizeps, der hereingerannt kam und rief: »Los, dalli, dalli.« Ich sagte kein Wort, aber unser Blick erzählte die Geschichten und Schicksale von Generationen.
Mamma hatte es schon immer gesagt: »Such dir ne Stadtwohnung, jetzt, wo du verdienst.« Vielleicht hatte sie recht. Das dachte ich jedenfalls, als der Traktor weiter stur vor mir hertuckerte, statt auf den Seitenstreifen auszuweichen.
Doch dann kamen links der Wasserturm und das alte Dorf, soweit es das Erdbeben von 1968 überstanden hatte. Obwohl der Staat ein paar Kilometer weiter talabwärts moderne Mehrfamilienhäuser gebaut hatte, wohnten alle noch immer hier. Dort unten jagten die streunenden Hunde der Stille hinterher.
An der Piazza saß Don Calogero vor der Tür, auf einem alten Holzstuhl, und sog begierig an seiner filterlosen Zigarette. Als er mich sah, erhob er sich, mit schmerzverzerrtem Gesicht, wie immer. Zu viele Jahre schon stand er hinter dem Tresen, vor sich wie einen Hochaltar die alte rote Gaggia für drei Portionen.
»Ristretto oder normal?«, fragte er mich. Das war unser Ritual.
Ob ich den Kaffee stark oder weniger stark trank, hing davon ab, wie viel ich zu Hause noch arbeiten musste. In einigen Wochen standen mir die schwierigen Facharztprüfungen bevor, die raubten mir den Schlaf. Heute war ein Ristretto-Tag.
»Wie gehts, Don Calogero, alles gut?«, fragte ich.
»Warum tu ich mir das überhaupt noch an? Mein Sohn ist in Bologna, meine Tochter in Vigevano, und ich bin bald dreiundsiebzig. Und wenn du wegziehst, für wen mach ich dann überhaupt noch Kaffee?« Flüsternd fügte er hinzu: »Es gefällt mir nicht, was hier momentan passiert. Es stinkt zum Himmel.«
»Nun übertreibt mal nicht, Don Calogero«, beschwichtigte ich ihn. »Das sagt Ihr schon seit mindestens fünf Jahren, und Ihr seht, ich bin noch da. Und Ihr genauso, mit ein paar Zipperlein. Ich häng an unserem Dorf. Palermo ist schön, aber zu groß, der viele Verkehr, ich geh nicht weg, keine Sorge.«
Don Calogero schwieg, ich blickte nach draußen. Die Piazza von Maciddaru lag halb leer in der Dämmerung. Nur ein paar Autos krochen den Hügel zum Friedhof hinauf. Dort lag mein Vater schon seit fünf Jahren. Meinen Uniabschluss hatte er nicht mehr erlebt. Ich war sein einziger Sohn, meine Schwester hatte nicht viel mit der Schule am Hut.
»Sagt mal, Don Calogero, habt Ihr meinen Vater eigentlich gut gekannt?«
Don Calogero blickte mich überrascht an.
»Niemand hier hat deinen Vater wirklich gekannt. Als er damals aus Deutschland zurückkam, war er einfach nicht mehr derselbe. Don Vincenzo, kann ich dir irgendwie helfen?, hab ich gefragt. Er antwortete immer nur: Nein, wieso?«
Offenbar wunderten sich im Dorf viele, warum Don Vincenzo Conigliari erst ins Land von Volkswagen emigriert und kaum ein Jahr später wieder zurück war.
»Ich weiß noch genau, wie wütend Zio Rocco über seine Auswanderungspläne war«, sagte Don Calogero. »Jeden Morgen hörte ich: Was will der denn in Deutschland? Hier gibts doch Arbeit für Enzuccio! Aber auf dem Ohr war dein Vater taub, und eines Tages ist er einfach weggegangen, nach Wolfsburg.«
Ich malte mir gerne aus, dass ihn die Sehnsucht in die Arme der Familie zurückgetrieben hatte, meine Schwester war noch klein, meine Mutter mit mir schwanger.
»Man kann keinem in den Kopf schauen«, sagte Don Calogero. »Er war wieder da und basta. Wenn wir gefragt haben, wie es in Deutschland war, hat er nur gesagt: Kalt, das Essen schmeckt nicht. Vom Kaffee ganz zu schweigen.«
»Tja, der Kaffee«, sagte ich und schaute Don Calogero an.
»Wieso fragst du das jetzt, Nanà? Du kanntest deinen Vater doch?«
Die Frage überraschte mich, ich überlegte, die Antwort fiel mir schwer. Nein, ich hatte meinen Vater nicht wirklich gekannt, auch mir gegenüber hatte er sich in düsteres Schweigen gehüllt.
»Ich hab meine Zeit mit Lernen verbracht, Don Calogero, erst hier, dann am Gymnasium und später an der Uni in Palermo. Wie hätte es ihn gefreut, mich als Arzt zu sehen, aber er hat nicht mal mehr meinen Uniabschluss erlebt. Dabei hätte ich früher fertig sein können. Das werde ich mir nie verzeihen.«
Don Calogero blickte mich wortlos an. Schließlich räumte er meine Tasse weg.
»Der geht aufs Haus«, sagte er.
»Salutamu, Don Calogero, und danke.« Den Kaffeegeschmack noch im Mund, schlenderte ich durchs Dorf nach Hause.
Eines Morgens hatte mein Vater, mit blassem Lächeln auf den Lippen, tot im Bett gelegen … Das Herz, hieß es, nicht mal meine Mutter hatte etwas gemerkt. Ich erinnerte mich noch genau, wie er jeden Abend von unserem Getreideacker oder vom Weingarten nach Hause gekommen war. Die Coppola auf dem Kopf, die Hände so faltig wie Baumrinde, die Finger geschwollen, die Handflächen rissig, mit sonnengegerbtem Gesicht, dunkel wie Ebenholz, die Augen klein und unruhig. Nie ein einziges Wort, nie ein Lächeln zu viel. Ab und zu holte ihn sein Bruder, Zio Rocco, nach dem Abendessen ab, und sie spazierten zur Bar. Als Kind durfte ich sonntags manchmal mit, im Sommer sprang sogar ab und zu ein Ascaretto dabei heraus, mein Lieblingseis. Mein Vater und Zio Rocco hatten ein kompliziertes Verhältnis. Zio Rocco war Junggeselle geblieben und betrachtete mich als seinen Sohn. Aber Papa zog eine klare Grenze: Er durfte uns nicht in seine Angelegenheiten hineinziehen. Rocco Conigliaro gehörte zum Tacco-Clan in Camporeale, der zur Corleone-Mafia hielt. Damit wollte Papa nichts zu tun haben. Wenn die Sprache auf die Mafia-Mitglieder im Dorf kam, konnte allerdings selbst er seine Hochachtung nicht verhehlen. Irgendwann hatte er sich wohl entscheiden müssen, ob er seinem Bruder auf dem gesetzeswidrigen, riskanten Weg folgen oder Frau und Kinder vor einer Welt bewahren wollte, aus der es kein Zurück gab. Zur großen Enttäuschung von Zio Rocco und zur großen Erleichterung meiner Mutter entschied sich Papa für Letzteres, was seinem friedfertigen, zurückhaltenden Charakter entsprach. Zu seiner Entscheidung hatte vermutlich auch Donna Maria, meine Mamma, beigetragen. Sie stammte aus Ganci, einem Dorf in der Madonie, auf tausend Metern Höhe. Im Winter lag dort Schnee. Als Kinder hatten Francesca und ich oft die Sommer bei den Großeltern verbracht. Mammas Vater, Opa Giuliano, war in der Jugend Hirte gewesen. Er war zwar Analphabet, erzählte uns aber noch als Neunzigjähriger minutiös vom Zweiten Weltkrieg: Wie er sich nach der Kriegsgefangenschaft in Jugoslawien mit den anderen Soldaten zu Fuß, ohne Wasser, Lebensmittel oder warme Kleidung nach Hause durchschlagen musste. Er erinnerte sich haargenau an die achtunddreißig Tage Fußmarsch von Triest nach Ganci, an die Kameraden aus Molise und Kalabrien.
Als Kinder verbrachten meine Schwester Francesca und ich die Sommer bei unseren Großeltern in Ganci, wo wir abends Wollpullis überziehen mussten, weil es so kühl wurde. Ich liebte meine Großeltern, aber langweilte mich dort unsäglich. In Maciddaru konnte ich mit Gaetano, Michele und Antonio durch die steilen Gassen streifen, in Ganci kannte ich keinen. Mit den Jahren besuchten wir das Heimatdorf meiner Mamma dann seltener. Als meine Großeltern starben, wurde ihr Häuschen erst verrammelt und später verkauft.
An diesem Abend saß Donna Maria wie gewohnt am Fenster und wartete auf mich.
»Nanà, die Polpette al sugo sind noch warm«, empfing sie mich. Ich setzte mich an den Tisch. Francesca fläzte auf der Couch und sah fern. Der Wandel der Generationen hätte nicht sichtbarer sein können. Während Mamma stickte, schielte sie immer wieder ungläubig zu Francesca hinüber, die auf den Röhrenfernseher starrte, gefesselt von zwei jungen, knapp bekleideten Tänzerinnen, die lasziv in die Kamera blinzelten.
Tagein, tagaus saß sie vorm Fernseher, und wenn meine Mutter oder ich Kritik äußerten, verfiel sie in Schimpftiraden.
Ich machte mir Sorgen, und sie tat mir auch leid. Sie hatte sich in Pietro Marino verliebt, einen Handlanger des Tacco-Clans. Er saß im Ucciardone-Gefängnis in Palermo, weil man ihn beim Drogenhandel erwischt hatte. Jeden Samstagmorgen besuchte sie ihn und strahlte danach den Rest des Tages. Donna Maria hatte ihr Leben lang darum gekämpft, dass ihr Mann sich von Verbrechern fernhielt, und jetzt hatte ausgerechnet ihre Tochter einen Narren an einem Kleinkriminellen gefressen. Dennoch hütete sie sich davor, sich einzumischen. Das Verhältnis zu ihrer Tochter war ohnehin schwierig.
An diesem Abend schaltete Francesca den Fernseher früher aus als sonst und verschwand wortlos in ihrem Zimmer.
»Wie weit bist du, Mamma?«, fragte ich und zeigte auf die Decke, die sie seit Wochen bestickte. All ihre Wünsche und Sorgen flossen mit der emsigen Bewegung ihrer Hände in die Arbeit ein.
»Ich werde wohl noch ein paar Wochen brauchen. Schau dir die Vorlage an, alles haarfein, der Adler wird perfekt. Aber ich werd mir noch die Augen verderben. Und mir fehlt die Zeit.«
»Dann nimm sie dir doch einfach! Oder gibt es ein Problem?«
»Ob es ein Problem gibt? Schau dir deine Schwester an. Was sollen wir bloß mit ihr machen?«
»Wenn ich meinen Facharzt hab und die Praxis im Dorf aufmache, kann Francesca die Verwaltung übernehmen. Pietro muss doch drei Jahre sitzen. Glaubst du wirklich, sie fährt so lange zum Ucciardone, nach Palermo?«
»Aber er ist doch in ein paar Monaten schon wieder draußen, Nanà. Zio Rocco hat das in die Hand genommen.«
Verblüfft blickte ich meine Mutter an.
»Hat Francesca ihn darum gebeten?«
»Ja. Er setzt über die Taccos alle Hebel in Bewegung, bis nach ganz nach oben. Polizeibeamte und sogar Richter.«
»Mamma, wir müssen uns da raushalten! Ich will nichts mit diesen Leuten zu tun haben!«
»Dann sag das mal deiner Schwester.« Mamma ließ ihre Stickerei nicht aus den Augen. »Es ist eh zu spät, Nanà!« Nichts konnte sie von dem gespannten Stück Stoff in dem runden Holzrahmen, über das ihre flinken Finger mit der Nadel auf- und abfuhren, ablenken. Die traditionelle Stickkunst hatte sie von ihrer Mutter gelernt.
»Geh schlafen, um halb sieben klingelt dein Wecker«, beendete sie das Gespräch.
Von meinem Schlafzimmerfenster aus überblickte ich fast ganz Maciddaru. Das Dorf klebte an einem steilen Hang, ich schaute von oben darauf. Ich lehnte im Fenster und rauchte meine tägliche Zigarette, im schwachen Licht einer Laterne.
Die feine Linie des Horizonts war in der Dunkelheit nur zu erahnen, und während ich der nächtlichen Stille lauschte, dachte ich, dass die Zeit hier stehen geblieben war. Die Moderne mit ihrem Eroberungsdrang bevorzugte die Städte, auf dem Land war es immer noch wunderbar einsam. Zwischen Camporeale und Palermo lagen nur fünfzig Kilometer, aber dreihundert Jahre.
In den Gassen von Maciddaru roch es noch genauso wie vor Jahren: Ein kräftiger Geruch nach Pferdeäpfeln mischte sich mit dem zarten Duft von frisch gebackenem Brot. Es roch nach den Jahreszeiten, nach dem starken, böigen Winterregen, der manchmal auch in Hagelkörnern fiel. Im Frühling kündete ein würziger Blütenduft von langen Tagen mit strahlendem Sonnenschein, satt an Freud und Leid.
Von meinem Fenster aus schien mir die Welt, die im Dunkeln vor mir lag, wunderschön. In der Einsamkeit der Gassen, der absoluten Stille wirkte sie so unversehrt und vollkommen wie sonst nur in den Vorstellungen von Kindern und Träumern.
Nürnberg, Januar 1988
fragment zwei
Frank hatte ein grünes und ein braunes Auge. Wenn die Leute ihn anschauten, stutzten sie erst und merkten erst kurz darauf, warum. Es passierte oft, dass jemand rief: »Du hast ja zwei verschiedene Augen!«
Er hatte sich daran gewöhnt. In der Schule zogen ihn die anderen damit auf, aber mit der Zeit entpuppte sich die Auffälligkeit als Vorteil. Frauen waren fasziniert und blickten ihm tief in die Augen, während sie versuchten, auf die Gründe seiner Schweigsamkeit zu schließen.
Mareike waren seine Augen jedenfalls sofort aufgefallen, als sie sich damals auf der Demo gegen die neuen Rechtsextremen zum ersten Mal begegnet waren. Der Hauptmarkt in Nürnberg war relativ leer, vorn auf der Bühne trat ein routinierter Mitte-Links-Politiker nach dem nächsten auf und hielt eine Rede, aber der Funke sprang nicht über.
»Wer wohl zuerst einpennt? Die Redner da vorn oder wir?« Mit diesen Worten hatte Mareike ihn angesprochen. Er hatte sich umgedreht, gelächelt, aber nichts gesagt. Eine Stunde später tranken sie ihren ersten Glühwein zusammen.
»Du bist nicht von hier, oder?«, fragte Mareike, als das Schweigen langsam unangenehm wurde.
»Bist du ein echtes Nordlicht?«, rätselte sie. »Du sprichst nicht wirklich fränkisch, bist auch nicht so redselig, und auch nicht so herzlich wie die Rheinländer …«
Frank machte es Spaß, Mareike ein wenig zappeln zu lassen. Ihr Interesse schmeichelte ihm. Er war nicht umsonst Journalist: Normalerweise stellte er die Fragen. Als er merkte, dass Mareike sich unwohl fühlte, sagte er: »So richtig fränkisch hörst du dich aber auch nicht an?«
»Anders verstehst mi fei ned«, antwortete Mareike lachend. »Aber stimmt, meine Familie stammt aus Sylt, meine Großeltern hatten dort ein Hotel. Mein Vater wollte es nicht übernehmen, sein Bruder führt es weiter. Aus allen Zimmern schaut man auf den weißen Strand, das Hotel ist wirklich toll. Kennst du Sylt?«
Frank schüttelte den Kopf. »Ich war noch nie da. Aber was machst du dann in Nürnberg?« Mareike lachte erneut.
»Ich bin hier geboren und aufgewachsen, jetzt arbeite ich hier. Mein Vater ist nach Nürnberg gezogen und hat hier meine Mutter kennengelernt. Ab und zu fahren wir noch nach Sylt, vor allem in der Nebensaison, ohne Touristen. Und du?«
»Ich komme ursprünglich aus Wolfsburg: plattes Land, so weit das Auge reicht, Industrie. Kultur und das Schöne spielen nur eine untergeordnete Rolle. Als mir die Zeitung Franken Aktuell eine Redakteursstelle anbot, habe ich nicht einen Moment überlegt. Ich wohne jetzt seit einem Jahr hier, kenne aber noch kaum jemanden.«
»Wundert mich nicht«, sagte Mareike. »Wenn du immer so dreinschaust, wenn dich einer anspricht!«
Da musste sogar Frank lachen und vergaß den Artikel, den er eigentlich schreiben sollte. Als Mareike vorschlug, noch ein wenig durch die Altstadt zu schlendern, sagte er Ja.
Es war ein kalter Winter, nachts fielen die Temperaturen unter minus zehn Grad, es schneite nicht mal mehr. Ein eisiger Wind fegte durch die Straßen.
Die gotischen Kirchen und anderen historischen Gebäude der Altstadt waren nach dem Krieg neu aufgebaut worden. Wenn man Fotos vom zerbombten Nürnberg sah, fragte man sich, wie aus den Schuttbergen und Steinhaufen wieder so eine zauberhafte mittelalterliche Stadt werden konnte.
»Du bist also Journalist?«
»Kann man so sagen. Ich habe in Berlin Italienisch und Französisch studiert und bei der Zeitung Die Fakten ein Praktikum gemacht, als Italienkorrespondent in Rom. Leider nur kurz, ich habe mich dort wohlgefühlt. Das Essen ist super, man kann das Leben echt genießen. Dann kam das Angebot von Franken Aktuell aus Nürnberg, und jetzt kümmere ich mich um bayrische Innenpolitik. Aber eigentlich interessiere ich mich mehr für die internationalen Themen.«
Ab und zu erhielt er von den Fakten noch immer Aufträge zu den Themen, wegen derer er ursprünglich Journalist geworden war, erzählte er weiter. Das war Teil seiner Vereinbarung gewesen.
»Letztes Jahr war ich in Moskau. Der Kreml von innen ist echt beeindruckend. Und Gorbatschow hält bestimmt noch einige Überraschungen für uns bereit. Wie schnell er Ronald Reagan ein Abrüstungsabkommen abgeluchst hat, mit der Vernichtung von Atomwaffen! Die DDR-Kader haben garantiert einen Riesenbammel, dass sich andere Ostblockländer von der Tauwetterpolitik anstecken lassen …«
Mareike hörte Frank überrascht von seiner Redseligkeit zu, dann antwortete sie: »Ich habe mit anderen eine Theater- und Konzertagentur. Wir betreuen eine irische Band und einen Kabarettisten hier aus der Gegend.«
Ihr kleines Team habe mehrere Künstler unter Vertrag, an die sie wirklich glaubten. Bei der Arbeit hätten sie jede Menge Spaß, erzählte sie, wenn es ihnen gelänge, einen Auftritt zu organisieren, legten sie eine Kaffeepause ein und freuten sich gemeinsam. »Unsere Nachbarin Gertrud, eine sympathische ältere Frau, macht sich schon Sorgen, wenn sie kein Plaudern und Feiern von drüben hört. Dann kommt sie mit einer Apfeltorte und einer Kanne Kaffee ins Büro spaziert. Maadla, sagt sie, auch wenn ihr heute keinen Erfolg habt, essen müsst ihr trotzdem!« Mareike lächelte, doch plötzlich wurde sie ernster. »Kennst du das Burgtheater?«
»Den Namen schon, ich war aber noch nie drin«, gab Frank zu.
»Es ist ein kleines Theater, ganz hier in der Nähe, meine Wohnung ist genau gegenüber. Hast du Lust, noch auf ein Glas Wein zu mir zu kommen?«
Vom Vorplatz der Kirche St. Sebald aus folgten sie der leicht ansteigenden Straße und bogen dann links in die Gasse ein, in der Mareikes Wohnung lag.
Ihr kleines Wohnzimmer war sehr gemütlich, mit dunklem Holzboden und Reispapierlampen in den Ecken. Überall verstreut standen oder lagen Bücher. Momo von Michael Ende, Ganz unten von Günter Wallraff, Der Name der Rose von Umberto Eco, Der kleine Prinz von Saint-Exupéry, ein wildes Durcheinander.
»Ich hab einen italienischen Wein, den mir Freunde empfohlen haben, echte Weinkenner. Aus Sizilien, ein Regaleali. Kennst du den?«
»Nein«, gab Frank zu, der sich noch immer umschaute. »Ich kenne eher norditalienische Weine, aber ehrlich gesagt, verstehe ich nicht viel davon. Man muss nicht alles verstehen, um es zu genießen.«
Nun musterte er Mareike nochmals heimlich. Sie hatte einen wachen, eindringlichen Blick, war kräftig gebaut, mit fülligem Busen, in ihrem ungeschminkten Gesicht saß eine Stupsnase, und wenn sie lächelte, strahlte sie übers ganze Gesicht.
»Hast du einen Freund?«, fragte er. Bei seiner Arbeit als Journalist hatte er sich eine gewisse Direktheit angewöhnt. Mareike lachte. »Dann hätte ich dich doch nicht angesprochen. Bis vor zwei Monaten hatte ich allerdings noch einen.«
»Und?«
»Ich habe ihn verlassen. Er ist zum Spießer mutiert. Kinder, nach der Arbeit in die Pantoffeln, die Frau am Herd, am besten in fränkischer Tracht. So stellt er sich das vor. Dabei war er so fröhlich und unbekümmert, ein Träumer irgendwie. Wir waren schon auf demselben Gymnasium, meine erste große Liebe. Und du?«
»Meine Beziehungen gehen immer nach ein paar Wochen auseinander, ich weiß nicht mal, warum. Ich versteh die Frauen einfach nicht.«
Er hielt kurz inne.
»Wahrscheinlich war ich einfach noch nie richtig verliebt – oder hing noch zu sehr an meiner Mutter. Elke. Sie ist vor drei Jahren gestorben, mit gerade mal fünfzig, das hab ich wohl noch nicht überwunden.«
Mareike blickte Frank an und griff nach seiner Hand.
»Ich habe keine Geschwister und auch kaum Verwandte«, fuhr er fort. »Meinen Vater kenne ich nicht mal. Die Begeisterung für den Journalismus habe ich von meiner Mutter. Sie war in der bleiernen Zeit, als der Terrorismus das große Thema war, leitende Journalistin bei der Berliner Alternativen Zeitung, immer an vorderster Front. Sie hat über das Unbehagen der Jugend und den Idealismus berichtet, von dem selbst die gewalttätigen Aktivisten beseelt waren. Sie war unbequem und wurde überwacht. Man hielt sie für einen Stasi-Spitzel.«
Sie habe sich dem revolutionären Geist verbunden gefühlt, erzählte Frank weiter, aber keiner Fliege etwas zuleide tun können. Ob der Befreiungskampf der Frauen, die Studentenunruhen oder südamerikanische Politiker, die vor dem amerikanischen Imperialismus fliehen mussten, immer war sie zur Stelle und er, Frank, mit dabei.
»Wie oft hat sie mich als Kind mitgenommen, um Demoluft zu schnuppern. Einmal hat die Polizei eine Einzimmerwohnung gestürmt, in der eine politische Gruppe, zu der sie gehörte, gerade eine Versammlung abhielt. Ich erinnere mich noch, wie man uns in Polizeibullis gezerrt und dann auf enge Gefängniszellen verteilt hat. Ich war das einzige Kind und hab verzweifelt geweint. Eigentlich hat die Polizei aber Ulrike Meinhof gesucht, viele aus der Gruppe sympathisierten mit ihr, auch meine Mutter.«
»Woran ist sie denn gestorben?«
»Sie hat wohl zu viel geraucht. Lungenkrebs, nichts mehr zu machen.«
»Und was war sie für ein Mensch?«, beeilte sich Mareike, das Gespräch in eine angenehmere Richtung zu lenken.
»Sie war lebhaft, begeisterungsfähig und stürzte sich unbekümmert in jede Gefahr. Beim Schreiben lebte sie in einer Welt aus Utopien. Heute gibt es diese Mischung aus Recherche und literarischem Schreiben im Journalismus gar nicht mehr. Heute soll alles schnell erzählt werden …«
»Trotzdem bist du Journalist.«
»Tja. Der Journalismus verändert sich, wie alles, aber ich geb mir Mühe, dagegenzuhalten. Die Leserinnen und Leser sollen in die Zeit und den Ort der Geschichte eintauchen. Darum muss ich immer mittendrin sein. So wie heute bei der Demo …«
Franks Begeisterung beeindruckte Mareike. Er war so anders als ihre anderen männlichen Bekannten.
Auf die vielen Worte folgte dann das lange Schweigen der Nacht. Als sich Haut und Haut berührten, verschmolzen die Körper im Kerzenschein zu einem. Frank wollte etwas sagen, aber Mareike legte ihm lächelnd den Zeigefinger auf die Lippen.
Mit dem ersten Morgenrot schlief Mareike ein. Frank lauschte auf ihren Atem, blickte an die fremde Zimmerdecke und fragte sich, ob auch diese Bekanntschaft nur ein Abenteuer sein würde. Dann erhob er sich vorsichtig vom Futon, schob Mareike sanft zur Seite, um sie nicht zu wecken, und zog sich leise an.
Er hinterließ ihr einen Zettel mit seiner Büronummer und daneben: »Ruf mich an, falls du Lust hast. Frank.«
Palermo, April 1988
fragment drei
Die Oper muss von innen gigantisch sein, dachte ich, als ich an dem verrosteten, schmiedeeisernen Zaun stand und zu dem halbrunden Gebäude, das wohl die Größe eines Fußballfelds hatte, aufschaute. Das Teatro Massimo an der Piazza Verdi erwartete mich Morgen für Morgen. Reglos und ungerührt. Seit Jahren schon war es wegen Sanierungsarbeiten geschlossen, und niemand konnte erklären, warum sie nicht vorankamen.
Wie lange würde ich noch die Löwen passieren müssen, ohne jemals hineinzugehen? Durch die Gänge bis zu meinem Platz Parkett Mitte im überwältigenden Opernraum? Vor den immensen Säulen warteten heruntergekommene Kutschen. Die Pferde ließen resigniert die Köpfe hängen, schienen Tag für Tag älter und müder. Pinuzzu, einer der Kutscher, Sohn und Enkel von Kutschern, kannte alles und jeden im Viertel. Zur Begrüßung lüftete er die schwarze Coppola, die seinen kahlen Kopf bedeckte. Um uns herum toste der Verkehr, und das Hupkonzert der Autos versetzte dem eigentlich barocken Flair in der Via Maqueda den Todesstoß.
»Wie wärs mit nem Kaffee?«, fragte ich Pinuzzu im Dialekt.
»Sehr gern, Dottore!«
Wenn ich keinen Parkplatz fand, stellte ich mein Auto in zweiter Reihe auf der Piazza ab und gab Pinuzzu die Schlüssel, der es gegen einen kleinen Obolus bei Bedarf umparkte.
»Heute hatte ich Glück, ich hab direkt vor der Banca d’Italia geparkt. Bei den vielen Carabinieri kann mein Auto kaum geklaut werden.«
»Bei denen weiß man nie, Dottore!«
»Aber Pinuzzu!«
»So isses doch, Dottore. Aber keine Sorge, ich pass schon auf!«
Die Bar degli Artisti war hauptsächlich für ihren Mittagsimbiss bekannt, aber auch jetzt drängelten sich die Büroangestellten für ihren morgendlichen Espresso an der Theke.
»Guten Morgen, der Herr« – »Mit der allerhöchsten Achtung, Herr Anwalt« – »Bitte schön, Ihr Cappuccino, gnädige Frau«, wieselten die Kellner mit Fliege hin und her, in der Hoffnung auf üppiges Trinkgeld von der zahlungskräftigen Kundschaft.
»Ohne Euch würde ich hier nie einen Fuß reinsetzen, Dottore!«
»Wieso, Pinuzzu? Kannst du dir etwa keinen Kaffee leisten?«
»Nicht den. Schuster, bleib bei deinen Leisten, sagten meine Eltern immer. Das hier ist nicht meine Welt.«
»Pfeif einfach drauf, Pinuzzu! Das waren andere Zeiten, der Kaffee geht auf mich. Sag mal, hat es gestern wirklich schon wieder einen Mord gegeben? Bei der Olivella-Kirche?«
»Es is kaum auszuhalten, Dottore! Die Mafia hält sich fürs Gesetz. Die Geschäftsleute wissen nicht mehr, wem sie gehorchen sollen. Wenns früher ein Problem gab, hat man mit der richtigen Person geredet und die Sache war gelöst. Heute bringt man die eingesessenen Familien um, und die Neuen machen Geschäfte mit Fremden und Drogen. Man wird reich, klar, aber die haben den Anstand verloren. Da is zu viel Geld im Spiel!«
Wir tranken unseren Kaffee, der im Vergleich zu Don Calogeros wässrig schmeckte, verließen die Bar, und ich machte mich zu Fuß zur Praxis in der Via Dante auf, vorbei an der sagenumwobenen Villa Whitaker, wie immer bewacht von einem livrierten Wärter.
Mit ihrem weitläufigen Park konnte nicht mal der Botanische Garten von Palermo mithalten. Ich sah englischen Rasen, weiter hinten ragte ein dichter, üppiger Tropenwald mit Palmen und Gewächsen aus Java und Sumatra in die Höhe. Eines Tages, dachte ich, sollte ich über den Zaun klettern oder den Wärter bestechen.
Die Villa gehörte angeblich der letzten Whitaker, einer uralten, einsamen Frau ohne Kinder. Sizilien war bei den Engländern eine Zeit lang sehr beliebt gewesen. Die Whitakers hatten als Wein- und Gewürzhändler ein Vermögen verdient, ihnen hatten wir den Marsala zu verdanken. Ihre Geschichte beeindruckte mich.
Die Vergangenheit besaß für mich ein unergründliches Flair, unwiderstehlich wie die Liebe.
Die Sekretärin der Arztpraxis, in der ich arbeitete, umwehte für mich ebenfalls der faszinierende Zauber vergangener Zeiten. Annamarias schwarze, weit auseinanderstehende Augen, mit denen sie mich spitzbübisch anblickte, ihr dunkelbraunes Haar, so kurz wie das französischer Schauspielerinnen, ihre Stupsnase. Sie kam aus einem Städtchen in der Provinz Caltanissetta, sprach mit energischem Ton und hartem »t«, wie die Kalabresen aus Cosenza. Sie war selbstsicher, ganz anders als mein gewohntes weibliches Umfeld, das sich gegenüber Männern eher unterwürfig verhielt. Peu à peu hatte ich mich in sie verliebt. Während ich einmal mit einer heftigen Erkältung im Bett lag, fiel mir plötzlich auf, dass ich meine Arbeit vermisste, wegen Annamaria. Sie hatte sich in mein Leben geschlichen, was mich erst an meinen Gefühlen zweifeln ließ, denn ich glaubte an Liebe auf den ersten Blick. Entsprang mein Verliebtsein vielleicht nur dem Wunsch, wieder mal Schmetterlinge im Bauch zu haben? Oder war es, schlimmer noch, nur eine Folge des gesellschaftlichen Drucks, erwachsen zu sein, Geld zu verdienen und eine Familie zu gründen?
Annamaria hatte mit knapp vierundzwanzig Jahren schon eine eigene Wohnung im »besseren Palermo«, weit weg von Eltern und ehemaligen Freunden.
Sie war ein paar Jahre vor mir in die Stadt gekommen, zum Studium an der Kunsthochschule. Damit ihr Unterhalt sichergestellt war, hatte ihr Vater, ein alteingesessener Notar in Caltanissetta, ihr die Stelle in der Arztpraxis verschafft.
Nachdem ich sie wochenlang beobachtet hatte, fasste ich Mut.
»Guten Morgen, Dottore«, begrüßte sie mich.
»Annamaria, wenn du mich so nennst, fühle ich mich alt. Nenn mich doch bitte Leonardo.«
»Ja, aber Leonardo, das klingt nach Leonardo da Vinci.«
»Dann eben Nanà, so nennen mich meine Freunde.«
»Nanà?«
»Wieso?«
Annamaria lachte.
»Bei uns auf dem Dorf werden alle Namen verkürzt!«
»Meinst du, bei mir zu Hause nicht? Cicciu. Pinu. Enzu, aber Nanà hab ich noch nie gehört!«
Ein Arzt im Praktikum ist ein Arzt zweiter Klasse. Meine Tage in der Praxis waren eher langweilig, doch ich liebte meine Arbeit. Nicht wegen der Aussicht auf ein gutes Gehalt. Die ärztliche Tätigkeit hatte für mich etwas beinahe Heiliges. Wenn ein kranker Mensch voller Vertrauen zu mir kam, spürte ich Verbundenheit. Ein befriedigendes Verantwortungsgefühl spornte mich an, mein Bestes zu geben.
Ich wusste, dass nicht jeder Patient auf dieselbe Weise gesundete, manche blieben für immer krank, die menschliche Verletzlichkeit kam bei ihnen körperlich zum Ausdruck. Andere, oft die kulturell gebildeten, vertrauten nur auf Medikamente und verstanden die Medizin als unumstößliche Wissenschaft. Am wichtigsten waren aber Disziplin und der Wille zur Zusammenarbeit. Doch auch das reichte leider nicht immer.
Heute also verlangte ich von mir dieselbe Entschlossenheit wie sonst von meinen Patienten. Nach der Arbeit fragte ich darum so locker und beiläufig wie möglich:
»Annamaria, hast du auch Hunger? Sollen wir irgendwo was essen gehen?«
»Möchtest du mit mir ausgehen?« wäre mir zu voreilig und fordernd erschienen.
Sie war einverstanden. Kurz darauf saßen wir in einem kleinen Restaurant im Park der Villa Sperlinga. An den kleinen Tischen mussten wir uns direkt anblicken. Aus der Nähe erschienen mir ihre getuschten Wimpern sehr lang.
»Du bist komisch, Nanà, weißt du das?«, sagte sie und zündete sich eine Zigarette an.
»Wieso?«, fragte ich verwirrt.
»Du hast Monate gebraucht, um mit mir auszugehen. Immer wieder hast du dich im letzten Moment umentschieden: Signorina Onorato, haben Sie die Patientenakte von Ingenieur Mancuso schon auf den neuesten Stand gebracht?«
Ich lachte verlegen.
»Man merkt, dass du nicht aus Palermo kommst«, sagte ich. »Du nimmst kein Blatt vor den Mund.«
»Andere Männer hätten das einfach abgestritten«, sagte Annamaria. »Sie denken, ihre Schwächen verstecken zu müssen.«
»Das tue ich nicht«, versicherte ich.
»Und dass du jeden Tag pendelst, ist auch komisch«, sagte sie. »Oder nicht. Vielleicht wartet in Maciddaru ja deine Freundin auf dich.«
»Auf mich wartet niemand«, antwortete ich. »Außer meiner Mutter. Sie steht am Fenster, bis ich mit dem Auto um die Ecke biege, und stellt mir dann ein warmes Essen auf den Tisch. Mich hält vieles im Dorf. Jeden, den ich auf der Piazza treffe, kenne ich seit Kindertagen. Es gibt keine Geheimnisse. Außerdem mag ich die Ruhe. Spätabends ist keine Menschenseele mehr auf der Straße. Und bei Don Calogero gibt es den besten Kaffee der Welt.«
»Und wer ist Don Calogero?«
»Ihm gehört die Bar an der Piazza. Er kennt mich seit meiner Geburt. Abends macht er erst zu, wenn ich meinen Ristretto getrunken habe. Wenn ich nicht komme, macht er sich Sorgen. Darum ruf ich dann an und sage: Don Calogero, heute nicht. Macht ruhig zu, wenn ihr wollt.«
Annamaria hatte mich noch nie Dialekt sprechen gehört. Sie lachte laut, und ich nutzte die Gelegenheit, um auch eine Frage zu stellen.
»Und du? Du wohnst in einem Neubauviertel, oder?«
»Genau. Als ich für das Studium nach Palermo gezogen bin, war mir klar, dass ich hier nicht so schnell wieder weggehen würde. Was sollte ich im sterbenslangweiligen Santa Caterina Villarmosa? Mein Freund Attilio ist bald mit dem Studium in Florenz fertig und kommt wahrscheinlich nächstes Jahr zurück. Dann werden wir sehen.«
»Du hast einen Freund?«, fragte ich, und die Worte versetzten mir einen Stich in die Brust.
»Seit Langem. Attilio ist anständig, unsere Eltern waren schon immer befreundet. Wir sind noch nicht verheiratet, aber so gut wie.«
Unser Schweigen schien mir endlos. Annamaria wusste genau, was ich dachte.
»Und jetzt fragst du dich bestimmt, warum ich überhaupt mit dir ausgegangen bin?«, fragte sie schließlich in die Stille hinein.
»Ach, kein Problem«, log ich. »Wir sind Kollegen, da kann es nicht schaden, sich auch mal außerhalb der Arbeit kennenzulernen.«
Annamaria sah mich an, mit ihren Augen so schwarz wie Ebenholz. Sie wusste, dass ich ihr etwas vorspielte und mich anstrengte, meine Enttäuschung zu verbergen. Ich blickte in den Park und sah hinter einem Magnolienast ein Gebäude hervorlugen.
»Dort drüben im fünften Stock wohnt übrigens Leonardo Sciascia«, lenkte ich ab.
»Der Autor von Der Tag der Eule?«
»Ja, er hat den Park berühmt gemacht. Früher hingen hier die Drogensüchtigen ab, reiche Bürgersöhne, ihre Eltern waren hauptsächlich damit beschäftigt, ihr Sozialleben in den besseren Kreisen von Palermo zu pflegen. Haschisch, LSD-Trips, Heroin. Einige meiner Mitschüler vom Gymnasium kamen auch hierher. Einmal haben sie mich mitgenommen. Wenn man dazugehören wollte, musste man sein wie sie, dieselbe Kleidung tragen, sich für dasselbe interessieren und die Sprache sprechen, die man nur an den höheren Schulen in Palermo lernt. Ich wollte nichts damit zu tun haben, ich war stolz darauf, vom Dorf zu kommen und abends in Maciddaru wieder mit normalen Leuten über meine Jungenträume zu reden.«
Annamaria blickte mich schweigend und plötzlich verunsichert an. Ich versuchte, ihre Gedanken zu erraten, und hätte sie am liebsten in den Arm genommen.
»Es ist spät geworden, lass uns nach Hause gehen«, sagte ich mit abgewandtem Blick.
»Ja, es ist spät geworden«, wiederholte sie.
Schweiz, April 1988
fragment vier
»Ihre Papiere bitte.«
»Pass und Führerschein?«
»Ja, warten Sie bitte einen Moment.«
Frank lehnte sich in den Autositz seines alten, orangeroten Audi-Kombis zurück. Lola nannte er ihn liebevoll, er hatte umlegbare Rücksitze, zur Not konnte er mit einem Schlafsack auch gut darin übernachten.
»Sie sind ja Deutscher«, sagte der Schweizer Grenzbeamte, als er ihm die Papiere zurückgab. »Sie sehen nicht so aus.«
»Sein Aussehen kann man sich nicht aussuchen, oder?«
»Nein«, stammelte der Grenzbeamte unangenehm berührt. »Aber es gibt gerade so viele Saisonarbeiter aus Südeuropa. Es ist mein Job, die Grenze zu überwachen. Kommen Sie als Tourist?«
»Ich bin Journalist und fahre zu einem Interviewtermin nach Zürich. Keine Sorge, morgen bin ich wieder weg.«
Hinter Schaffhausen erstreckten sich sanfte Hügel mit kurvigen Straßen, der Rhein markierte noch immer die Grenze, die schon Napoleon vor über zweihundert Jahren überschritten hatte.
In Kürze würde er in Zürich einen wichtigen Gesprächspartner treffen, aber nicht deshalb war er heute aufgeregt. In seiner Tasche steckte ein altes Foto aus den späten Sechzigern, es zeigt ihn und seine Mutter bei einem ihrer seltenen Urlaube. Er würde sich einen kleinen Umweg erlauben.
Schon tauchte das Schild »Neuhausen« auf, er bog ab, die Kurven führten ihn abwärts, bis zu einem großen Parkplatz. Mit seinem Fotoapparat und der alten Aufnahme in der Hand stieg er aus und folgte den Schildern.
Zuerst nahm er nur ein fernes Murmeln wahr, wie von einem kleinen Bächlein. Schnell wurde das Murmeln zum stolzen Rauschen, entfaltete sich auf den letzten Metern zu einem ungestümen Getöse, und plötzlich stand er unter dem mächtigen Wasserfall. Genau dort, wo vor zwanzig Jahren das Bild mit Elke entstanden war. Um ihn strudelte das kühle Nass, stürzte hinab, aber er blieb trocken.
Er griff nach dem Fotoapparat, nahm dieselbe Haltung ein wie damals vor zwanzig Jahren, als seine Mutter ihn umarmt hatte, und drückte ab.
Nach einer Weile stieg er die Stufen wieder hinauf. Wie bei den Songs der Siebziger und Achtziger, die mit Gitarren- oder Saxofonsolos ausklangen, verstummte das Tosen des Rheinfalls nach und nach.
»Bitte setzen Sie sich, Herr Fischer«, sagte der Chefredakteur der Tageszeitung Neuste Zürcher Nachrichten, in deren Räumlichkeiten er das Interview führen durfte. »Ueli Zuberbühler wird jeden Moment hier sein.«
Aus dem großzügigen Konferenzraum sah man auf den Seitenflügel des Opernhauses, den Zürichsee und den Bellevueplatz. Der große Platz sowie die Brücke über die Limmat waren mit Fahnen geschmückt.
Der Konferenzraum hingegen war nüchtern gehalten. In der Mitte ein langer, blitzblanker Tisch. Nicht einmal ein Aschenbecher. An den weißen Wänden hingen abstrakte Gemälde. Durch die schalldämmenden Fenster drangen Autoverkehr und Straßenbahnen nur als leises Echo.
Schließlich kehrte der Chefredakteur zurück, mit einem Mann um die fünfzig, im dunkelgrauen Anzug, mit scharlachroter Krawatte. Kurzer Haarschnitt, schmallippig.
»Doktor Zuberbühler«, stellte der Chefredakteur vor. Der Mann betrat den Raum, der wache, Blick hinter der Brille verriet, dass er mit den Mitteln der Rhetorik bestens vertraut war.
»Da bin ich, Herr Fischer. Hatten Sie eine gute Fahrt?«, sagte er mit schriller, unangenehmer Stimme, reichte Frank die Hand und setzte sich. »Wie ich gehört habe, kommen Sie aus unserem nördlichen Großkanton.« Er grinste und fuhr, ohne eine Antwort abzuwarten, fort: »Sie sind ja noch sehr jung. In Anbetracht unserer heutigen Themen nahm ich an, man würde einen erfahrenen Journalisten schicken.«
Frank tat, als überhöre er die unterdrückte Abfälligkeit, die sich hinter der höflichen Fassade des Bankiers verbarg.
»Ich würde vorschlagen, wir fangen an«, sagte er.
Zuberbühlers Miene wurde sofort ernst und konzentriert, wie bei einem Tennisspieler, der auf den gegnerischen Aufschlag wartet.
»Sie leiten die größte schweizerische Bank. Momentan werden Sie von allen Seiten unter Beschuss genommen, denn die Öffentlichkeit verlangt endlich Klarheit. Das Schweizer Bankensystem wird unumwunden angegriffen. Viele sind der Meinung, in schweizerischen Tresoren würden die Gelder von Mafia, Diktatoren, zwielichtigen Geschäftemachern und anderen Kriminellen lagern.«
»Wir halten uns gewissenhaft an das Bankenrecht, an alle Gesetze. Unsere Dienstleistungen genießen weltweit den allerbesten Ruf. Unsere Wirtschaft ist stark, unsere Währung gehört zu den stabilsten der Welt. Unsere Kunden sind anspruchsvoll; dass alle mit uns zusammenarbeiten wollen, ist nicht unsere Entscheidung.«
»Aber laut Ziegler öffnen die Banken Steuerhinterziehung und Geldwäsche Tür und Tor. Nach dem Motto: Geld stinkt nicht.«
»Bei einem begründeten Verdacht stellen wir Nachforschungen darüber an, wer der Kontoinhaber ist, wir gehen Auffälligkeiten nach. Wenn wir auf mangelnde Transparenz stoßen, trennen wir uns ohne Probleme von Kunden.«
Frank spürte, dass ihn die ausweichenden Antworten reizten.
»Herr Zuberbühler, kommen wir zur Sache. Irgendwelche Strohmänner kommen mit Geldern zu Ihnen, deren Herkunft vollkommen rätselhaft ist. Mitarbeiter von Scheinfirmen, in denen einzig und allein Schwarzgelder geparkt werden, können bei Ihnen Konten eröffnen. Die Staatsanwaltschaft hat dafür genügend Beweise.«
»Wir halten uns an Recht und Ordnung. So funktioniert der Kapitalismus, und den meisten gefällt er.«
»Augusto Pinochet und Ferdinand Marcos, um nur zwei zu nennen«, bohrte Frank hartnäckig nach. »Diktatoren, oder etwa nicht? Die kommen höchstpersönlich nach Zürich, um sich um ihre Milliarden zu kümmern.«
»Meines Wissens wurde Marcos mehrfach gewählt. Und Pinochet hat letztes Jahr sogar Besuch vom Papst erhalten. Ich denke, ein Urteil darüber steht Ihnen nicht zu. Halten wir uns doch an die Fakten. Warum sollten Kunden, die mit sämtlichen Staaten Beziehungen unterhalten, bei uns kein Bankkonto eröffnen dürfen?«
»Eine Bank sollte sich also nicht von ethischen Überlegungen leiten lassen?«
»Wir verwalten fremdes Kapital und legen es hochprofessionell und offensichtlich sicherer als andere an. Wir überprüfen unsere Kunden, aber müssen niemandem gefallen, weder Ihnen noch anderen.« Zuberbühler blickte Frank ungerührt an.
»Die USA und Deutschland werfen den hiesigen Banken vor, auch den amerikanischen und deutschen Steuerzahlern den roten Teppich auszurollen.«
»Wenn den Amerikanern und Deutschen wirklich daran gelegen wäre, dass ihre Bürger die Steuern zahlen, würden sie sich selbst darum kümmern«, antwortete Zuberbühler mit zynischem Lächeln.
»Und was sagen Sie dazu, dass laut anonymen Dokumenten noch immer Gelder von Nazis in Schweizer Tresoren liegen?«, fragte Frank, wohl wissend, wie heikel dieses Thema war.
»Wir haben den Nationalsozialismus nicht erfunden. Vielleicht ist es erst einmal an den Deutschen, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen.«
Zuberbühler blickte auf seine teure Armbanduhr. »Unsere Gesprächszeit ist um«, bemerkte er und stand abrupt auf.
Nach dem Gespräch verließ Frank hastig das prächtige Gebäude der Neusten Zürcher Nachrichten. Seine Parkuhr war abgelaufen, und die schweizerischen Politessen kannten kein Pardon. Als er im Laufschritt bei seinem Auto ankam, steckte hinter dem Scheibenwischer schon der grüne Zettel. »Na klar«, murmelte Frank, stieg ein und nahm die Ausfallstraße Richtung Süden.
Sein nächstes Ziel war die Altstadt von Luzern, zuletzt war er vor zwanzig Jahren mit Elke hier gewesen. An eine der Brücken über die Reuss erinnerte er sich besonders: die überdachte, hölzerne Kapellbrücke mit den dreieckigen Gemälden im Giebel, mittelalterliche Ritter, mit Speer und Helm in den Altstadtgassen.
Er parkte in Bahnhofsnähe und spazierte Richtung Brücke.
Luzern kam ihm vor wie Zürich im Miniaturformat. Banken, Werbetafeln, Geschäfte und Restaurantketten mit nichtssagender internationaler Küche waren hier wie dort dieselben. Nur wimmelte es hier von Touristen. Japaner und Amerikaner liefen durch die Straßen, in der Altstadt reihte sich ein Souvenirladen an den nächsten. Zürich war der Finanzplatz, Luzern eine Touristenattraktion.
Als er in der Ferne die Reuss im Licht der untergehenden Sonne sah, wurden seine Schritte länger. Am Flussufer warteten Schwäne und Enten darauf, gefüttert zu werden. Die Erinnerung an den Urlaub mit seiner Mutter wurde mit jedem Schritt Richtung Brücke präsenter. Damals hatte es nicht so viele Läden und am Fluss keine Restaurants gegeben. Selbst an den Kiosken hingen nun Tageszeitungen aus ganz Europa und sogar den USA, das fiel ihm sofort ins Auge, Berufskrankheit. Vieles in der Welt hatte sich verändert, aber manches blieb. Elke hatte vielleicht andere Verzerrungen gesehen als er, aber genau wie sie hatte er einen Blick dafür. Oder versuchte es zumindest.
Ein Straßenmusiker mit seiner Gitarre am Eingang zur Kapellbrücke riss ihn aus seinen Gedanken. Frank kannte das italienische Lied, das er spielte. Spontan setzte er sich zu ihm, schloss die Augen und ließ sich von der Melodie wegtragen. Als die Musik verstummte, sprach er ihn auf Italienisch an: »Eins war von Lucio Dalla, eins von Edoardo Bennato, das dritte kannte ich nicht.«
»Das war von mir«, sagte der Musiker zögernd. »Aber wenn ich über die Runden kommen will, muss ich die Gassenhauer spielen, sonst bleibt keiner stehen. Auch du hast dich wegen Dalla und Bennato hingesetzt.« Ein wenig herausfordernd fügte er hinzu: »Und mir noch nichts gegeben.« Frank kramte in den Taschen.
»Hier, ich habe leider nur D-Mark. Aber es ist ja nicht weit nach Deutschland.«
»Ja, ich bin oft in Stuttgart oder Freiburg, da leben viele Italiener, und die italienischen Cantautori werden immer beliebter. Bob Dylan, Cohen, die Beatles oder Simon & Garfunkel singen viele, da heb ich mich mit meinen Liedern ab.«
»Bist du gerade unterwegs oder wohnst du hier?«, fragte Frank.
»Sowohl als auch. Ich habe hier in der Nähe ein Zimmer. Die Schweiz liegt günstig, und Luzern ist genau in der Mitte zwischen Italien, den deutschsprachigen Ländern und Frankreich, und die Schweizer sind großzügig. Alte Leute bringen mir belegte Brote, Frauen laden mich zum Kaffee ein. Den kriegt man zwar kaum runter, aber was solls.«
»Kommst du aus Süditalien?«
»Ja, aus Palermo. Kennst du die Stadt?«
»Noch nicht. Aber Goethe hat so viel Werbung für Sizilien gemacht, dass man als pflichtbewusster Deutscher gar nicht drumherum kommt.«
»Ohne Goethe kämen wohl nicht mal die Deutschen. Ein Desaster, diese Stadt …«
»Ja, die Mafia, das wird sich vermutlich nie ändern.«
Der Musiker sah ihn forschend an. »Was weißt du denn davon?«
»Ich schreibe politische Reportagen. Ich war ein Jahr als Korrespondent in Rom, bei den Fakten.«
»Oh, gut recherchierter und mutiger Journalismus.«
Jetzt blickte Frank den erstaunlich jungen Musiker neugierig an. »Was machst du überhaupt auf der Straße? Ist die Polizei hinter dir her?«
»Kann man so sagen. Ich musste mich verpissen. Das war nicht schwer, ich schlaf auch unter der Brücke, kein Problem. Daheim ängstigt mich ganz anderes.« Er legte die Gitarre vorsichtig in den Koffer, drückte ihn zu und schulterte ihn.
»Tat gut, mit dir zu reden«, sagte er und gab Frank die Hand. »Wie heißt du? Dann lese ich in den nächsten Fakten zuerst deine Artikel.«
»Frank Fischer.« Und in einer plötzlichen Eingebung setzte er hinzu: »Nächste Woche kannst du ein Interview von mir mit einem bekannten Schweizer Bankier lesen.«
Wenn der Musiker den Mut hatte, mit nichts als der Gitarre auf der Schulter von zu Hause wegzugehen, wollte er genauso mutig schreiben, was er wusste.
»Ich heiß übrigens Pippo«, sagte der Musiker im Umdrehen. »Ich werds lesen.«
Camporeale, Oktober 1988
fragment fünf
»Michele, haste nen Trumpf?«, fragte ich leise.
»Nein, bleib niedrig«, flüsterte mein Spielpartner.
Gaetano grinste: »Ah! Wusst ich’s doch! Die haben nix mehr. Spiel ein Ass, Anto!«
»Jungs, ihr habt einfach zu viel Glück. Mit euch kann man nicht spielen!«, rief ich und hob enttäuscht die Arme.
Don Calogero saß auf einem Holzhocker dabei, spickte uns belustigt in die Karten und wusste schon vorher, wie das Spiel ausgehen würde.
Die Briscola-Runde in der Bar war unumstößlich. Komme, was wolle, am Donnerstagabend wartete der Holztisch auf uns, mit Gaetanos Aschenbecher, weil er eine MS nach der nächsten rauchte. In den Pausen zelebrierten wir Calogeros Kaffee.
»Für mich heute schön stark, Don Calogero, Kaffee des Hauses, wie sichs gehört«, rief ich.
Michele hob seine Tasse.
»Picciotti





























